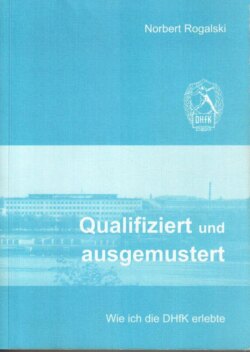Читать книгу Qualifiziert und ausgemustert: Wie ich die DHfK erlebte - Norbert Rogalski - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Student an der Arbeiter – und - Bauern –Fakultät
(1954 – 1957)
ОглавлениеIm Frühjahr 1954 brachte mir der Briefträger erneut einen Umschlag mit dem Absender:
Arbeiter- und- Bauern- Fakultät der Deutschen Hochschule für Körperkultur, Leipzig, Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 59
Ich wurde zur Eignungsprüfung für die Aufnahme an der ABF eingeladen. Die Ablehnung meiner Bewerbung hätte bedeutet, dass Tischler mein Beruf geblieben und ich für unabsehbare Zeit im Kaliwerk tätig gewesen wäre. Zum angegebenen Zeitpunkt fuhr ich nach Leipzig, um die Hürde „Eignungsprüfung“ oder auch „Aufnahmeprüfung“ in Angriff zu nehmen. Leipzig kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt kaum. Nur durch mehrfache Verwandtenbesuche in Altenburg musste ich in Leipzig auf dem Hauptbahnhof umsteigen. Ich nutzte diese Reisen auch einige Male, um mir Punktspiele der Fußballoberliga der DDR in Leipzig anzusehen. In Erinnerung ist mir ein Spiel zwischen „Rotation Leipzig“ mit dem Spieler Horst Scherbaum, der zum ersten Absolventenjahrgang der DHfK 1950/52 gehörte, und „Stahl Thale“ mit dem Spieler Oberländer geblieben. Der Leipziger Hauptbahnhof und die Strecke nach Probstheida in das „Bruno-Plache-Stadion“ waren bisher mein Kenntnisstand von dieser Stadt. Obwohl ich mit der bevorstehenden Prüfung nach der Anreise in Leipzig beschäftigt war, ist mir nicht entgangen, in welch schlechtem Zustand Leipzig nach den Bombenangriffen im 2. Weltkrieg noch gewesen ist. Schon unmittelbar gegenüber dem Hauptbahnhof, auch in anderen Stadtteilen, standen zahlreiche Ruinen. Große Lücken in Häuserfronten sind durch die Bomben gerissen worden. Am Waldplatz angekommen, stand ich nun vor der Deutschen Hochschule für Körperkultur, die gleichzeitig in diesen Jahren auch ihre ABF beherbergte. Es war für mich ein imposanter Bau in relativ gutem Zustand. Der neue Hochschulkomplex – unweit davon entfernt – war schon in der Entstehung, aber noch nicht in vollem Maße nutzbar. Unsicher, ob ich die Bedingungen der Eignungsprüfung erfüllt hatte, kehrte ich in meinen Wohnort zurück. Bereits nach wenigen Wochen bekam ich wiederum Post aus Leipzig mit der Mitteilung, dass ich die Prüfung bestanden habe und im September nach der Herbstmesse 1954 das Studium an der ABF der DHfK beginnen kann. Ich war am Ziel meines Wunsches, einmal Sportlehrer zu werden. Nun wurde es ernst. Ich musste meine gewohnte Umgebung, Wohnort, Freunde, die Betätigung in der Sportgemeinschaft für Jahre mit einer Großstadt und völlig neuen Anforderungen tauschen.
Mitte September zu Beginn des Studienjahres 1954/55 reiste ich nun mit einem Koffer in Leipzig an. Das Gebäude der DHfK und der ABF am Waldplatz kannte ich bereits von der Eignungsprüfung. Es wurde während der gesamten Zeit des Bestehens der Hochschule immer „Altbau“ genannt und gehörte früher der Sozialversicherung, bevor es der DHfK zur Verfügung gestellt worden ist. Während der Einweisung durch Lehrkräfte der ABF erfuhren wir, dass sich in dem Gebäude nicht nur die Unterrichtsräume der ABF befanden, sondern auch die Seminar- und Laborräume sowie ein Hörsaal (Erich-Zeigner-Saal) für den gesamten Lehrbetrieb des Hochschulstudiums. Die Mensa im 3. und 4. Stockwerk und eine Sporthalle im Kellergeschoss wurden sowohl von den ABF-Studenten als auch von den Studenten des Hochschulstudiums genutzt. Der Schwimmunterricht fand ebenfalls für beide Gruppen von Studenten im damaligen Westbad statt, die Ausbildung in der Leichtathletik und in den Sportspielen erfolgte auf der sogenannten Nordanlage des Sportforums oder auf der Festwiese. Während der Ausbildung, im Speisesaal der Mensa und auch in der Freizeit kam es zu ständigen Begegnungen beider Studentengruppen. Wir ABF-Studenten hatten von Beginn des Studiums an nie den Eindruck, nicht als vollwertige Angehörige der DHfK angesehen zu werden. Das Unterrichtsgeschehen beider Gruppen von Studenten in einem Gebäude und auf den gleichen Sportanlagen hatte für beide Seiten Vorteile. Es entstand ein nutzbringender Erfahrungsaustausch, der sich nicht nur auf das Studium beschränkte. Verstärkt wurde das Gefühl der Zusammengehörigkeit, indem alle Studenten mit einheitlichen Trainingsanzügen ausgestattet worden sind. In den 50er und 60er Jahren war das Markenzeichen der DHfK-Studenten und aller Lehrkräfte in der Öffentlichkeit ein dunkelblauer Trainingsanzug mit den vier weißen Buchstaben „DHfK“, im Halbbogen auf der Vorderseite der Jacke aufgenäht. Die Lehrkräfte waren insofern herausgehoben, da ihr Trainingsanzug mit einem hellgrauen Krageneinsatz versehen war. Als wir neuen ABF-Studenten diesen Trainingsanzug empfangen hatten, wurde er zunächst weniger im Sportunterricht als vielmehr in der Freizeit ,z.B. auch zu Kinobesuchen in der Stadt angezogen. Wir bildeten dabei keine Ausnahme, oftmals sah man auch Studenten älterer Semester und des Hochschulstudiums mit dieser Kleidung in der Stadt. Die DHfK hatte in den 50er Jahren noch keinen Weltruf wie in den 70er und 80er Jahren, aber in der DDR und vor allem in Leipzig spielte sie bereits eine wichtige Rolle in der Bevölkerung, wenngleich sie nicht von allen Leipzigern vorbehaltlos akzeptiert wurde. An der DHfK studieren zu können und das mit dem Trainingsanzug sichtbar zu machen, erfüllte die Studenten mit Stolz auf ihre Ausbildungsstätte und stärkte das Selbstbewusstsein. Hinweise der Leitung der ABF führten aber bald dazu, den Trainingsanzug nur zum Sportunterricht oder zu besondern Anlässen zu tragen.
Während einer ersten Einweisung wurden die Seminargruppen zusammengestellt, wir machten uns untereinander bekannt. Meine Gruppe bestand aus etwa 20 männlichen und weiblichen Studierenden. Von den männlichen Seminargruppenmitgliedern war ich mit knapp 20 Jahren einer der jüngsten Studenten. Es war an der ABF keine Seltenheit, dass Studentinnen und Studenten auch zwischen 30 und 40 Jahren noch das Nachholen des Abiturs in Angriff nahmen.. Oftmals hatten sie bereits eine eigene Familie und waren Mütter oder Väter. In den Anfangsjahren der ABF gab es relativ große Altersunterschiede zwischen den Studenten. Gemeinsamkeiten bestanden insofern, dass - bis auf Ausnahmen - alle einen Berufsabschluss besaßen und damit unterschiedliche Lebenserfahrungen in die neue Form des Zusammenlebens einbrachten. Nach der ersten Zusammenkunft in der Gruppe suchten wir unser Internat auf. Die ABF der DHfK besaß damals ein größeres, fünf Stockwerke hohes Eckgebäude in der Straße des 18.Oktober in Leipzig, das für die Männer der Seminargruppe unsere Unterkunft für die nächsten Wochen, Monate und auch Jahre werden sollte. In den 70er und 80er Jahren wurde dieses Internat für die ausländischen Studenten der DHfK bereitgestellt. In die einzelnen Zimmer zogen drei bis vier Studenten ein. Jeder hatte ein Bett und einen Stuhl, zwei Mann einen Schrank für die Kleidung, ein größerer Tisch war für alle Zimmerbewohner ausreichend, die schriftlichen Aufgaben zu erledigen. Bücherregale vervollständigten die Einrichtung. Auf jeder Etage befanden sich eine Küche, ein Klubraum mit Rundfunkgeräten und sanitäre Einrichtungen. Bettwäsche gab es ebenfalls kostenlos, der Tausch wurde von der Internatsleitung organisiert. Die Unterbringung war kein Luxus und den Möglichkeiten der damaligen Verhältnisse entsprechend angepasst. Ich kann mich nicht erinnern, dass es von den ABF-Studenten etwa kritische Bemerkungen zu diesem Internat und deren Einrichtung gegeben hätte. Das Grundstipendium betrug monatlich für alle Studierenden – unabhängig von den sozialen Verhältnissen der Eltern - 180 Mark. Davon wurden lediglich 10 Mark für den Internatsplatz abgezogen. Ohne diese Möglichkeit der Unterbringung wäre es für die Mehrzahl unmöglich gewesen, ein Studium aufzunehmen. Die allgemeine Wohnungsnot zu dieser Zeit verhinderte in der Regel auch die individuelle Suche nach einem Zimmer. Die Erwartung, eine Unterkunft auf privater Basis zu bekommen, war außerordentlich gering. Darüber hinaus wäre die Bezahlung vom Stipendium kaum möglich gewesen. Nur ein geringer Teil der Studenten wohnte zur Untermiete bei Bürgern in der Stadt.
Das Zusammenleben im Internat aller drei Studienjahre gestaltete sich problemlos nach der Art der Selbstverwaltung auf der Grundlage einer Internatsordnung. Hausherr war ein von der ABF eingesetzter staatlicher Internatsleiter, ein Hausmeister erfüllte grundsätzliche Aufgaben in diesem Haus. Jeweils eine Woche lang war eine Seminargruppe für die Einhaltung der Festlegungen der Internatsordnung verantwortlich, vor allem was den Ein- und Ausgang betraf. Rund um die Uhr war ein studentischer Pförtnerdienst tätig, der gleichzeitig die Post und die Tageszeitungen entgegennahm sowie Getränke verkaufte. In den folgenden Jahrzehnten haben sich die Bedingungen in den Internaten der DDR und auch an der DHfK schrittweise bedeutend verbessert, ohne dass die Kosten für die Studenten gestiegen sind. So wurden unter anderem auch Kleinstwohnungen für Studentenehepaare mit Kind oder nur für Studentinnen mit Kind eingerichtet. Die Bereitstellung und Subvention der Internatsplätze durch staatliche Organe der DDR konnten Bürger aller sozialen Schichten der Bevölkerung gleichermaßen nutzen. Die Chance, auf dem Wege über die ABF an Fach- und Hochschulen oder Universitäten sich zu qualifizierten, war bereits schon wenige Jahre nach dem Krieg nicht von finanziellen Möglichkeiten abhängig. Die Kosten für die Verpflegung konnten ebenfalls vom Stipendium mit einer angemessenen Summe beglichen werden. Für die Vollverpflegung in der Mensa (Frühstück, Mittag und Abendbrot), waren 60 Mark monatlich zu bezahlen, die vom Stipendium einbehalten wurden. Die Differenz zu den tatsächlichen Kosten wurde ebenfalls vom Staat getragen. Nur wer besondere Ansprüche an die Mahlzeiten stellte, nahm an der Mensa-Versorgung nicht teil, suchte Gaststätten auf oder verpflegte sich mit erheblich größeren Kosten selbst. Abzüglich der Internatsunterbringung und Vollverpflegung verblieben jedem Studenten noch 110 Markt vom Grundstipendium für weitere persönliche Erfordernisse im Monat. Das war für uns ABF-Studenten, die wir schon im Arbeitsprozess gestanden und somit eine größere Summe Geld im Monat zur Verfügung hatten, anfangs eine schwierige Situation. Man musste sich erst daran gewöhnen, mit weniger finanziellen Mitteln auszukommen. Oft kam es vor, dass wenige Tage vor dem Zahltag des Stipendiums die Geldbörse leer war und untereinander geborgt und ausgeholfen wurde.
Im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsverpflegung an der ABF der DHfK erscheint eine Regelung in den Jahren 1954/55 im Rückblick fast unglaubhaft. Jeder Studierende bekam monatlich ein bis zwei Kilogramm Zucker in Tüten verpackt ausgehändigt. Man konnte diesen Zucker in der Kaltverpflegungsstelle abholen, die im Erdgeschoss im Altbau eingerichtet war. In diesen Jahren musste der Zucker noch rationiert werden, d. h. er wurde an die Bevölkerung auf Lebensmittelkarten ausgegeben. Da Studierende keine Lebensmittelkarten besaßen, aber ihnen die festgelegte Menge nach den Versorgungsrichtlinien zustand, ist uns der Zucker in natureller Form übergeben worden. Die meisten Studenten verbrauchten den Zucker aber nicht selbst, sie übergaben ihn den Eltern oder ihren Familien in den Heimatorten.
In meinem Studienjahr haben 11 Seminargruppen mit etwa 20 bis 25 Studierenden je Gruppe das Studium aufgenommen. Der Unterricht begann in der Regel um 7.00 Uhr und endete gegen 13.00 Uhr, im Rhythmus von jeweils 45 Minuten für eine Unterrichtstunde, unterbrochen von 10 Minuten Pause. Diese Art des Lehrens und Lernens unterschied sich damit nicht von dem bekannten, normalen Schulbetrieb an Grund - und Oberschulen. Der Begriff „Student“ wäre für uns demnach noch nicht berechtigt gewesen, denn der unmittelbare Ausbildungsprozess entsprach nicht einem Studium, wenn man von wenigen hochschulnahen Unterrichtsformen absieht. Schüler waren wir aber auch nicht mehr, und somit konnten und durften wir uns Studenten nennen. Das war für Lernende an der ABF generell so üblich. Es war eine Aufwertung von unserem eigentlichen Status, die auch ein wenig stolz machte. Unsere Lehrkräfte, die überwiegend Männer waren, sind vor allem in den ersten Wochen und Monaten besonders bestrebt gewesen, uns an ein systematisches Lernen wieder heranzuführen. Im Bewusstsein, dass wir vor wenigen Wochen oder Tagen noch als Facharbeiter produktiv tätig waren und der Lernprozess nun völlig neue Anforderungen an uns stellte. Für bestimmte Fachgebiete, das betraf vor allem Chemie, Physik und Russisch, hatte die Mehrzahl der Seminargruppenmitglieder kaum Voraussetzungen. Ich gehörte dazu. Die ersten schriftlichen Arbeiten und Leistungskontrollen waren oftmals entmutigend. Mit pädagogischem Geschick gelang es den Lehrkräften, uns für die erfolgreiche Weiterführung des Studiums wieder zu motivieren und aufzubauen. Begünstigt wurde diese Haltung der Lehrkräfte dadurch, da sie in der Mehrheit über eine Ausbildung und Tätigkeit als sogenannte Neulehrer und weiteren Qualifizierungsmaßnahmen an die ABF gekommen waren und damit mehr Verständnis für die individuellen Probleme bei der Bewältigung der Lernanforderungen hatten. Das ABF-Studium war schon eine Besonderheit in der DDR, kein Schulbetrieb im engeren Sinne, eben schon eine spezifische Erwachsenenqualifizierung.
Die pädagogische Arbeit des Lehrkörpers ist unmittelbar mit einem politischen Auftrag verbunden gewesen, der uns nach kurzer Zeit bewusst wurde, aber keinen Widerspruch hervorrief. Er bestand darin, junge Menschen aus der Schicht der Arbeiter und Bauern zielgerichtet zu erziehen und auszubilden und sie für akademische Berufe vorzubereiten. Dabei ging die Parteiführung der SED und die Regierung der DDR von der Erwartung aus, dass die Absolventen ihre erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten im Sinne der sozialistischen Gesellschaftsstrategie in der DDR im zukünftigen beruflichen Alltag einbringen werden. Die meisten Lehrkräften hatten diesen Auftrag auch verinnerlicht und handelten aus politischer Überzeugung. Erzieherische Möglichkeiten, die dem Unterrichtsstoff immanent waren, sind mehr oder weniger genutzt worden. Insgesamt bestand ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Lehrkräften und Studierenden an der ABF, da Lehrende und Lernende – zwar mit unterschiedlicher Aufgabenstellung – aber doch im Wesentlichen gleiche Ziele verfolgten. Die Jahre an der ABF waren für alle Beteiligten auch ein spannender Prozess, der beide Seiten immer wieder forderte und zu neuen Ansätzen im Denken führte, aber auch Resignation, Konflikte und Probleme im Studienalltag nicht ausschloss. Das war besonders bei einigen Studenten gegen Ende des 1. Studienjahres der Fall, als die Zensuren für einzelne Fächer feststanden und teilweise unbefriedigend ausfielen. Diesen Studenten musste empfohlen werden, das Studium nicht fortzusetzen, andere wiederum warfen selbst das Handtuch. Gründe waren oftmals Selbstüberschätzung der intellektuellen Leistungsfähigkeit oder fehlender Wille, die verbleibende Freizeit optimal zum Lernen zu nutzen. Auch die Tatsache, dass der neue Berufsabschluss erst in mehreren Jahren erreicht sein wird, beeinträchtigte oftmals die Motivation für eine Weiterführung des Studiums. Ein Teil der Studenten war somit aus unterschiedlichen Gründen überfordert, gab auf und kehrte an den bisherigen Arbeitsplatz zurück.
Das ABF-Studium war in dem Sinne ein Ausleseprozess, der vorhersehbar und vielleicht auch in der Art und Weise so angelegt gewesen ist. Jeder, der an der ABF immatrikuliert war, hatte objektiv die gleiche Chance, das Ziel „Abitur“ auch zu erreichen. Die meisten Studenten haben sie genutzt, andere eben nicht oder nicht nutzen wollen, als sie mit den Forderungen konfrontiert wurden. Fast ausschließlich waren es subjektive Gründe, wenn das Studium abgebrochen werden musste. Mit konservativer Begabtentheorie, dass Bürger aus bestimmten sozialen Schichten der Bevölkerung einen solchen Bildungsabschluss objektiv nicht erreichen können, hatte es nichts zu tun.
Mein Studienjahrgang (1954 – 1957) reduzierte sich nach drei Jahren bis zu den Prüfungen zur Hochschulreife von anfangs 11 Seminargruppen auf 7 Gruppen. Zwischenzeitlich wurden immer einige Gruppen aufgelöst und die verbliebenen wieder aufgefüllt. Ich gehörte im 1.Halbjahr an der ABF zum untersten Drittel bei der Leistungsübersicht. Abgesehen von meinen bescheidenen schulischen Voraussetzungen fand ich keinen richtigen Rhythmus, um in der Freizeit Selbststudium zu betreiben und 5 bis 6 Stunden lang dem Unterricht aufmerksam zu folgen. In den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern und in der Fremdsprache konnte ich die Anforderungen anfangs nur schwer erfüllen. Mein fester Wille, den selbst gewählten Weg, der zu einem neuen Beruf führen sollte, erfolgreich abzuschließen, war letztlich die Ursache, dass die Leistungen besser wurden und ich mit durchschnittlich guten Zensuren das 1. Studienjahr an der ABF abschließen konnte. Auf keinen Fall wollte ich entweder in das Kaliwerk oder in die Tischlerei zu den ehemaligen Kollegen zurückkehren und mitteilen müssen: Mein Ziel war zu anspruchsvoll, ich habe das Studium nicht geschafft! So wurde eine eventuelle Blamage vor Kollegen, Bekannten, Sportfreunden und Verwandten zu einem weiteren Antrieb, das Lernen zu intensivieren und zunächst die Hochschulreife zu erreichen. Das gelang mir in den noch bevorstehenden zwei Studienjahren. Mit der Gesamtnote „gut“ erhielt ich im Juli 1957 das Abiturzeugnis mit der Unterschrift des damaligen Direktors der ABF, Horst Hecker, überreicht. Mit den Seminargruppenmitgliedern wurde dieses Ereignis ausgiebig gefeiert, bevor jeder in seinen Heimatort zurückkehrte, mehrere Wochen Urlaub verbrachte und sich gedanklich auf das Hochschulstudium vorbereitete.
Die Jahre an der ABF, wie sie Herrmann Kant in seinem Roman „Die Aula“ treffend beschrieben hat, konfrontierten uns Studenten auch mit politischen Ereignissen, Verhältnissen und Situationen, die gerade in den 50er Jahren das gesellschaftliche Leben in der DDR umfangreich prägten. Die Freie Deutsche Jugend (FDJ) spielte unter der Jugend dabei eine dominierende Rolle, somit auch bei uns an der DHfK. Schon in der ersten Woche des Studiums trat die FDJ-Leitung der ABF an unsere Seminargruppe heran mit der Erwartung, eine FDJ-Gruppe zu bilden. Es war allgemein üblich an den höheren Bildungseinrichtungen, dass eine Seminargruppe gleichzeitig identisch mit einer FDJ-Gruppe gewesen ist, die Basis des strukturellen Aufbaus der FDJ insgesamt. Wir fanden uns zusammen und wählten die FDJ-Gruppenleitung, die aus drei Studienfreunden bestand, ein Mitglied der Leitung übernahm die Funktion des FDJ-Sekretärs der Gruppe. Auf die personelle Auswahl der FDJ-Gruppenleitung hatten wir verständlicherweise geringen Einfluss, wir kannten uns ja kaum. Die übergeordnete Leitung der FDJ und unser Seminarbetreuer, Herr Becher, machten deshalb auf der Grundlage der Bewerbungsunterlagen der einzelnen Studenten die Vorschläge. Inhalt, Aufgaben und Wirksamkeit der FDJ lernte ich das erste Mal unmittelbar an der ABF in meiner Seminargruppe kennen, obwohl ich bereits im Rahmen einer Delegation der BSG „Aktivst“ Bleicherode und Mitglied der FDJ am 1.Deutschlandtreffen der Jugend vom 27. bis 30. 05. 1950 in Berlin teilgenommen hatte. Die Reise zu diesem Treffen war auch der konkrete Anlass, mir das Blauhemd, das zu FDJ-Veranstaltungen und besonderen politischen Anlässen getragen wurde, anzuschaffen. Die FDJ war seit ihrer Gründung bis zur Auflösung 1989/90 in ihrer Hauptzielstellung eine politische Organisation mit antifaschistisch-demokratischer und sozialistischer Grundorientierung. Den politischen Zielen der SED stand sie stets sehr nahe, vereinigte aber in ihren Reihen auch Jugendliche aller sozialen, politischen, ideologischen und religiösen Schichten der Bevölkerung. Es war der einheitliche sozialistische Jugendverband der DDR, der aber ein breites Spektrum von politisch-ideologischen Auffassungen in sich vereinigte. Besonders in den letzten beiden Jahrzehnten hatte die SED-Führung durch ihren Einfluss diesen ursprünglichen Charakter der FDJ verändert und einseitig auf ihre eigenen politischen Ziele festgelegt, indem sie den Jugendverband als „Kampfreserve der Partei“ betrachtete. Manch Jugendlicher fühlte sich dadurch in seiner Meinungsbildung eingeengt, ging auf Distanz zur FDJ oder wandte sich ganz ab. Bestimmte Einschätzungen, die nach der Wende von Politikern, Publizisten und Journalisten über den Jugendverband der DDR und ihre Arbeitsweise veröffentlicht worden sind, reduzierten die FDJ aber nur auf die politischen Aufgaben, die von der SED in den Jugendverband hineingetragen worden sind. Das widerspiegelt nicht annähernd die Wirklichkeit. Die FDJ-Arbeit, insbesondere in den Basisgruppen, war bedeutend umfassender als sie oftmals dargestellt wurde. Von dem, was die Gruppe selbst und ihre Funktionäre planten und realisierten, war das Leben in der FDJ vor allem abhängig. Diskussionsrunden zu aktuellen politischen und kulturellen Problemen, Film- und Theaterbesuche, Tanz- und Faschingsveranstaltungen, Sportwettkämpfe, gemeinsame Reiseerlebnisse waren keine Seltenheit und vielfach Hauptgegenstand der Zusammenkünfte der FDJ-Mitglieder. Mit diesen Inhalten gestalteten wir auch die FDJ-Arbeit in der Seminargruppe an der ABF und in den späteren Jahren im Hochschulstudium. Mehr oder weniger arbeiteten alle mit. Die FDJ-Gruppe und ihre Funktionäre waren legitimiert, bestimmte Probleme mit den Lehrkräften und mit der Direktion zu besprechen und mit zu entscheiden, die das Studium und andere Lebensumstände des Studienalltags betrafen. Sie hatten demokratisches Mitsprache - und Stimmrecht bei der Zuerkennung oder Ablehnung von Leistungsstipendien. Vertreter der Studierenden als FDJ-Mitglieder wurden in den Senat, in den Wissenschaftlichen Rat und in weitere Leitungsgremien der Hochschule gewählt und waren in dieser Eigenschaft stimmberechtigt. Die FDJ-Gruppe wirkte auch als Motor bei der Bewältigung von Studienaufgaben, indem sie sich besonders jenen Studenten zuwandte, die Schwierigkeiten im Studium hatten, ihnen Hilfe anboten und sie dann auch organisierte. Ein festes Kollektiv bildete sich heraus. Während der gesamten Studienjahre gehörte die FDJ-Gruppe einfach dazu, sie hatte ihren festen Platz im studentischen Leben gefunden. Kaum lehnten Studenten den Jugendverband in seiner Wirksamkeit ab oder beteiligten sich nur begrenzt an seiner Arbeit. Diese Auffassung gründet sich auch auf Erlebnisse und Erkenntnisse meines Hochschulstudiums, wo die FDJ die gleiche Funktion erfüllte wie an der ABF.
In den ersten Wochen des Studiums wurden wir neu immatrikulierten Studenten mit der Hochschulsportgemeinschaft (HSG) der DHfK, ihren Sektionen und ihrer Arbeitsweise bekannt gemacht mit dem Ziel, uns für eine Mitgliedschaft in der HSG zu gewinnen. Sie war im Prinzip mit einer Betriebssportgemeinschaft (BSG) gleichzusetzen, die Hochschule war in diesem Fall der Träger. Da alle Seminargruppenmitglieder vor dem Studium eine Sportart aktiv betrieben hatten, war es in der Regel folgerichtig, Training und Wettkampf in der HSG fortzusetzen. Die meisten meiner Studienkollegen entschieden sich für eine Mitarbeit in der HSG, obwohl es keine Pflicht gewesen ist, einige blieben Mitglied ihrer BSG in den Heimatorten. Ich erhielt eine Einladung für ein Probetraining der Sektion Fußball. Wie etwa 30 bis 40 weitere ABF-Studenten fand ich mich auf der Festwiese dazu ein. Die Leiter dieses Auswahlprozesses waren Lehrkräfte des Institutes für Sportspiele der DHfK, Ernst-Günter Degel und Herbert Klemig. Meine Fertigkeiten als Fußballspieler waren ausreichend, um in eine neu aufzubauende HSG-Mannschaft, die vorrangig aus ABF-Studenten bestehen sollte, aufgenommen zu werden. Überrascht wurde ich von der Tatsache, dass die Studenten, die in einer Sektion der HSG trainierten und Wettkämpfe bestritten, eine etwas bessere Vollverpflegung in der Mensa erhielten, ohne eigene zusätzliche Kosten. Mit einer Bescheinigung vom Sektionsleiter und Trainer erhielten wir HSG-Sportler andersfarbige Essenmarken, die zum Empfang dieser gesonderten Verpflegung berechtigten. Wie lange diese Regelung in Kraft war, kann ich rückschauend nicht mehr sagen. Unsere Mannschaft nahm am Wettspielbetrieb im Rahmen der in Leipzig existierenden Leistungsklassen teil. Außer Spielkleidung und Fahrgeld für die Straßenbahn oder den Bus konnte uns die HSG keine weiteren Mittel zur Verfügung stellen. Wir waren im echten Sinne Amateure. Unser Leistungsniveau reichte, um in den Stadtklassen in Leipzig zu bestehen. Nur einmal in der Woche wurde trainiert, mehr war unter den Studienbedingungen nicht möglich. Oftmals kam es zu Missverständnissen mit unseren Gegnern in der Stadt. Sie waren der Meinung, die Fußballmannschaften der DHfK trainieren unter professionellen Bedingungen. Verschiedentlich bestand in Leipzig in dieser Zeit die Auffassung, an der DHfK werden Sportler auf hohe sportliche Leistungen für nationale und internationale Wettkämpfe vorbereitet. Der Sportclub der DHfK wurde mit der akademischen Ausbildungsstätte DHfK anfangs verwechselt. Aus diesem Grunde wurde uns manchmal zugerufen: „Jetzt kommen die Profis!“. Das Gegenteil war der Fall. Unsere Gegner gehörten überwiegend zu großen Betriebssportgemeinschafen der Stadt mit erheblich besseren Bedingungen und Förderungsmaßnahmen als in der HSG der DHfK. Mit dieser Problematik mussten wir und alle weiteren Generationen von Sportstudenten der DHfK fertig werden. Das Argument, an der DHfK würden nur Profis Sport treiben, hat aus Einsicht in die tatsächlichen Gegebenheiten und durch Aufklärung in der Bevölkerung schrittweise abgenommen und war später nur noch selten zu hören. Bei Heimspielen, die wir auf einem Fußballplatz austrugen, wo jetzt die Mehrzwecksporthalle „Arena“ steht, waren nur wenige Zuschauer, meistens Studenten anwesend. Dazu gehörte fast ständig ein Herr Edgar Külow, damals Kabarettist an der Leipziger Pfeffermühle. Er wohnte im Leipziger Waldstraßenviertel und erheiterte mit seinen frechen Sprüchen alle Anwesenden. Es war eine Freude, ihm zuzuhören, er entwickelte eine besondere Beziehung zu uns Studenten.
Unmittelbar erlebten wir auch die Fertigstellung des Zentralstadions. Wenn wir auf der Festwiese oder auf der Nordanlage den Sportunterricht und das Training absolvierten, waren wir unmittelbar Zeuge, wie ein LKW nach dem anderen mit Trümmergestein von den zerbombten Häusern der Stadt im 2. Weltkrieg auf das ovale Stadionrund fuhr, um die entsprechenden Wälle weiter aufzuschütten und die erforderliche Höhe zu erreichen. Das war vor allem Ende des Jahres 1955 und im ersten Halbjahr 1956 der Fall. Zum II. Deutschen Turn- und Sportfest der DDR vom 2. bis 5. August 1956 sollte das Stadion nutzbar sein. Für die Bauarbeiter war es ein Wettlauf mit der Zeit. Wie bei allen Großbauten in der DDR und generell üblich, wurden die Bürger zu freiwilligen Arbeitsstunden am Bau des Stadions aufgerufen. Die Resonanz war groß, die Leipziger wollten ihr Zentralstadion! Es sind einige Hunderttausend Stunden für diese Arbeitseinsatze zusammen gekommen, wie in der Presse später berichtet wurde. Auch wir Studenten beteiligten uns aktiv daran. Mehrere Tage und an Abenden haben wir mit Hacke, Spaten und Schaufel bei Erd - und mit Transportarbeiten geholfen, das Stadion zum Termin fertig zu stellen. Mehrmals stand ich in den folgenden Jahren bei Sportveranstaltungen auf der Terrasse des Hauptgebäudes und musste immer wieder daran denken, dass die Bodenplatten, auf denen ich stand, von unserer Seminargruppe transportiert und an jene Stellen gebracht worden sind, wo sie dann von Fachleuten verlegt worden sind.
Aktiver Teilnehmer im Übungsverband der DHfK beim II. Deutschen Turn-und Sportfest war ich nicht, meine turnerischen Leistungen reichten nicht aus, um aufgenommen zu werden. Ich bekam eine Aufgabe als Führer in der Ausstellung zum „Sport in Vergangenheit und Gegenwart“, die parallel während des Festes in einer Messehalle gezeigt wurde. An diese Aufgabe denke ich nicht nur teilweise gern zurück. Mein Kenntnisstand auf dem Gebiet der Geschichte der Körperkultur und des Sports war zu diesem Zeitpunkt noch unzureichend, nur mit einem kurzen Lehrgang wurden wir als Ausstellungsführer darauf vorbereitet. Oftmals bin ich von Besuchern der Ausstellung auf ihre Anfragen hin in Gespräche verwickelt worden, wo ich merkte, der Materie nicht ganz gewachsen zu sein und unsicher wirkte. Daran musste ich während des Hochschulstudiums oft denken und nahm das Studienfach „Geschichte der Körperkultur“ auch aus diesem Grund sehr ernst.
Mit der Fertigstellung des Zentralstadions im Sommer 1956 war nun die Möglichkeit gegeben, auch Fußball-Länderspiele und andere bedeutende Fußballvergleiche von Vereins- und Clubmannschaften in Leipzig durchführen zu können. Am 6. Oktober 1956 kam es zur Begegnung zwischen dem damaligen Meister der DDR „SC Wismut Karl-Marx-Stadt“ und dem BRD-Meister „1. FC Kaiserslautern“. Oftmals hörte man die Auffassung: „Wer dieses Spiel gewinnt, der ist der wirkliche Deutsche Meister im Fußball“. Abgesehen davon, dass die Leistung der Mannschaft aus Kaiserslautern stärker eingeschätzt werden musste, da sie 5 Spieler der Weltmeistermannschaft von 1954 aufbieten konnte, steckte hinter dieser Aussage ein Stück Realität, das bevorstehende Spiel unter einem solchen Gesichtspunkt zu betrachten. Völlig abgebrochen waren die Kontakte zwischen den Sportleitungen der beiden deutschen Staaten noch nicht, wie an anderer Stelle bereits erwähnt wurde. Neben noch stattfindenden gesamtdeutschen Meisterschaften in einigen Sportarten hatte man sich gerade geeinigt, Sportler der DDR und der BRD für gemeinsame Mannschaften für die Olympischen Sommer-und Winterspiele 1956 zu nominieren, um damit auch einen Beschluss des IOC zu realisieren. So bekam dieses Fußballspiel eine große sportliche und politische Brisanz. Das Zentralstadion in Leipzig, das bis zu 100.000 Zuschauern Platz bot, hätte für dieses Spiel 300.000 und mehr Plätze haben können. Die Nachfrage, Augenzeuge dieses Spiels zu sein, war vom Thüringer Wald bis zur Ostseeküste riesengroß. Fußballanhänger wollten die Weltmeister, die Gebrüder Walter, Eckel, Kohlmeyer und Liebrich, auf dem Spielfeld selbst agieren sehen. Aber man vertraute auch auf die Leistungsstärke des DDR-Meisters, Wismut-Karl-Marx-Stadt, mit Willi Tröger an der Spitze, der renommierten Mannschaft aus der BRD ein gleichwertiger Gegner zu sein. Wir Studenten hatten kaum eine Chance, im freien Verkauf eine Eintrittskarte für dieses Spiel zu erhalten. Während einer Unterrichtsstunde an der ABF holte plötzlich unser Seminarbetreuer eine Eintrittskarte aus der Tasche und stellte die Frage: „Wer von ihnen möchte diese Karte besitzen ?“ Bald klärte sich die Frage auf, indem er uns mitteilte, sie gehöre der gesamten Seminargruppe. Die ABF der DHfK hatte eine bestimmte Anzahl von Eintrittskarten erhalten. Von der Direktion wurde entschieden, jeder Seminargruppe eine Karte zur freien Entscheidung zu übergeben. Wir entschieden uns für eine Verlosung. Ich zog eine Niete. Damit stellte sich für mich und weitere Seminarmitglieder wieder die Frage: Wie kommen wir ohne Eintrittskarte in das Stadion? Folgende Variante führte zum Erfolg: Wir zogen den DHfK-Trainingsanzug an, der uns als Repräsentanten der DHfK auswies, und begaben uns gegen 10.00 Uhr am Spieltag auf die Nordanlage des Sportforums, die sich angrenzend an das Stadion befand. Das Spiel begann erst am Abend unter Flutlicht. Wir beschäftigten uns die vielen Stunden mit leichtathletischen Trainingsübungen, fielen damit den Kontrolleuren nicht auf und befanden uns bereits innerhalb eines größeren Absperrbereiches um das Stadion. Ohne Eintrittskarte war offiziell kein Durchkommen mehr. Ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn sickerten wir unmittelbar in das Stadion ein, überlisteten die Ordner an den Eingängen und suchten uns einen Platz zwischen den Sitzplatzblöcken. Mit ähnlichen Tricks haben sich Hunderte von Fußballanhängern ohne Eintrittskarte die Möglichkeit verschafft, diesem Spiel direkt beizuwohnen, wie später bekannt wurde. Es war ein spannendes Spiel, Karl-Marx-Stadt hatte sich sehr gut gegen Kaiserslautern „verkauft“, obwohl 5:3 verloren wurde. In Erinnerung ist besonders das legendäre Hackentrick-Tor von Fritz Walter geblieben, das er im Hechtflug im Ergebnis eines Eckballs erzielte. Besonders unter den Umständen, wie wir uns zu diesem Spiel Zutritt verschafft hatten, war es ein Erlebnis, konnte aber zur Beantwortung der Frage, wie der Stand der DDR – Oberligamannschaften im Vergleich zum Fußball in der BRD einzuschätzen und wie die Entwicklung im Fußballsport der DDR weitergehen wird, die auch unter uns Studenten heftig diskutiert wurde, nichts beitragen.
Ebenso wie die sportpolitische Problematik zwischen den beiden deutschen Staaten standen politische Ereignisse in den 50er Jahren in engem Zusammenhang mit Diskussionen im Studium. Im Jahre 1954 hatte die Regierung der BRD die FDJ und 1956 die KPD in ihrem Staat verboten. Der Jugendfunktionär Philipp Müller wurde von der westdeutschen Polizei bei einer Demonstration erschossen. Die BRD wurde Mitglied in der NATO, die militärische Aufrüstung in Form der Bundeswehr ist zügig vorangetrieben worden. Die Gefahr des Ausbruchs eines neuen Krieges war nicht nur Theorie, um nur einige Beispiele zu nennen. Etwa zur gleichen Zeit brach in Ungarn ein Aufstand gegen die Regierung aus, der von der sowjetischen Armee beendet wurde. Der XXII. Parteitag der KPdSU informierte über die Probleme des Personenkults mit Stalin, für uns Studenten kaum nachvollziehbar. Zweifel an der Praxis des vorgezeichneten sozialistischen Weges in zahlreichen Ländern Osteuropas traten auf. Die DDR wurde Mitglied des Warschauer Vertrages. Von Seiten der Regierung der DDR kam der Vorschlag, eine Konföderation zwischen den beiden deutschen Staaten zu bilden. In offenen Briefen, die in der Presse veröffentlicht wurden, kamen die SED-Führung und die SPD-Führung der Bundesrepublik zu der Auffassung, öffentliche Kundgebungen im jeweils anderen Staat über die Grundpositionen ihrer Politik und über Möglichkeiten der Zusammenführung beider Staaten durchzuführen. Diese Überlegungen hatten offensichtlich keinen ernsthaften Hintergrund, denn zu solchen Kundgebungen oder weiteren zwingenden Gesprächen zwischen den Spitzenpolitikern der SED und der SPD kam es nicht. Beide deutsche Staaten – eingebunden in die jeweiligen Bündnisse – hatten die Weichen anders gestellt, der „Kalte Krieg“ begann unerbittliche Formen anzunehmen, Feindbilder wurde entwickelt. Bis zum Beginn des Studiums an der ABF haben mich diese und weitere politische Grundfragen nur beiläufig interessiert. Das änderte sich mit dem Studium an der ABF. Besonders durch die Unterrichtsfächer „Geschichte“ und „Gesellschaftswissenschaften“ erfolgte eine systematische Auseinandersetzung mit politischen und ideologischen Auffassungen von Partei und Regierung. Ich wurde – wie alle anderen Studenten ebenfalls – mit der materialistischen Weltanschauung und Philosophie in ihren Grundsätzen vertraut gemacht. Einige Schriften von Marx, Engels und Lenin waren schon Gegenstand des Unterrichtes. Die Entwicklung der Gesellschaftsordnungen von der Urgemeinschaft bis zur Gegenwart, die Entstehung des ersten sozialistischen Staates, der Sowjetunion, lernte ich kennen und vergrößerte damit mein bisher nur oberflächliches Wissen auf diesem Gebiet. Besonders intensiv ist über die Ursachen von Kriegen und über den Widerspruch von Arbeit und Kapital gesprochen worden. Ich bekam in den Jahren an der ABF langsam eine wissenschaftliche Weltsicht. Gefördert wurde dieser Prozess durch einen parteilichen Unterricht der Lehrkräfte, durch die gesamte Atmosphäre, die an der ABF herrschte sowie durch die Weiterführung der inhaltlichen Auseinandersetzungen in der FDJ-Gruppe. Nicht immer waren wir unter den Seminarmitgliedern einer Meinung oder fanden keine Erklärung für manche aktuellen Entscheidungen der Regierung der DDR und der Warschauer Vertragsstaaten. Nach meiner Auffassung war die politische und weltanschauliche Erziehung und Ausbildung, wie ich sie an der ABF und auch im Hochschulstudium kennen lernte, nicht frei von Einseitigkeiten. Das Studium war nicht darauf ausgerichtet, sich auch mit den Ansichten und Schriften von Gesellschaftswissenschaftlern und Philosophen aus dem bürgerlichen Lager im Original befassen zu können und kritisch auseinanderzusetzen. Der Ausschließlichkeitsanspruch, der sinngemäß lautete, der Marxismus-Leninismus ist richtig, weil er wahr ist, schränkte den Streit um die besten ideologischen Ansätze der Gesellschaftsordnungen ein, verhinderte die kritische Begleitung des eingeschlagenen sozialistischen Weges. Das Ziel der Erziehung und Ausbildung, bewusste Staatsbürger im Sinne sozialistischer Ideologie heranzubilden, führte aber auch nicht zur politischen Unmündigkeit der Studenten und nur zum Nachbeten von Leitsätzen. Jeder Einzelne war selbst dafür verantwortlich, welche Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit Ideologien und politischen Lehrinhalten daraus abgeleitet wurden. Die wissenschaftliche Betrachtung gesellschaftlicher Prozesse stand stets im Mittelpunkt, die jedem Studenten ausreichend Möglichkeiten einräumte, seinen eigenen politischen Standpunkt und seinen Platz im Leben zu finden. Ich habe Studenten an der ABF kennen gelernt, die von anderen weltanschaulichen Standpunkten – aus welchen Gründen auch immer – ihr weiteres berufliches und persönliches Leben gestalten wollten und wenig Bezug zur materialistischen Weltanschauung und zum Atheismus fanden. Auch sie haben das Studium an der ABF mit der Hochschulreife beendet, vorausgesetzt, die Leistungen waren dazu ausreichend.
Leben und Studium an der DHfK vollzogen sich nicht wie auf einer Insel, nur in Lehrräumen und Sportstätten. Wir waren in die gesellschaftlichen und politischen Prozesse der Stadt Leipzig und der umliegenden Kreise und Kommunen einbezogen. So wie wir am Bau des Leipziger Zentralstadions mithalfen, kamen weitere freiwillige Arbeitseinsätze in den Tagebauen der Braunkohle um Leipzig, bei Vorhaben im Häuser- und Straßenbau und vor allem in der Ernte der landwirtschaftlichen Einrichtungen in einigen Dörfern hinzu. Da ich heute nur unweit vom Naherholungsgebiet Kulkwitzer See in Leipzig-Lausen wohne, ist mir noch gegenwärtig, dass dieser See in den 50er Jahren ein Braunkohletagebau gewesen ist. Jeweils im Februar / März, in den Wochen komplizierter Witterungsbedingungen, unterstützten wir die Bergarbeiter. Unsere Arbeiten waren besonders im Schlamm versunkene Gleise wieder zu heben. Auf Grund unser insgesamt guten körperlichen Leistungsfähigkeit und der Überzeugung, dass diese Arbeitseinsätze zur Stärkung der Wirtschaft der DDR notwendig waren, sind wir stets von den Leitungen dieser Produktionsstätten gefragte Partner gewesen und wurden immer wieder zur Hilfe angefordert. Auch auf diesem Gebiet hatten sich die Studenten der DHfK insgesamt bei den staatlichen Dienststellen in Leipzig einen guten Namen gemacht.
Wir erlebten während der Studienzeit mehrfach große politische Kundgebungen in der Stadt, die nicht ohne Wirkung auf uns blieben. Auf dem Markplatz und an anderen Orten sahen und hörten wir führende Funktionäre der DDR, anderer sozialistischer Staaten, aber auch aus Ländern, die gegen Ausbeutung und Unterdrückung und um ihre Befreiung kämpften. Die meisten Studenten kannten solche großen Zusammenkünfte noch nicht. Für mich waren sie anfangs ebenfalls mit besonderen Eindrücken verbunden. Ähnlich verhielt es sich zum 1.Mai. Wie allerorts in der DDR, wurde der 1.Mai, als Kampf- und Feiertag der Werktätigen bezeichnet, mit großen Demonstrationen begangen. Die DHfK mit ihren Lehrkräften, Arbeitern, Angestellten und Stundenten nahm stets als eigenständiger Marschblock, an ihren Trainingsanzügen gut zu erkennen, daran teil. In den 50er Jahren gab es an der DHfK einen Fanfarenzug der Studenten. Wir marschierten mit den Klängen des Fanfarenzuges an der Spitze vom Hochschulgebäude durch die Jahn-Allee zum festgelegten Stellplatz und weiter an der Ehrentribüne vorbei. Das dauerte mehrere Stunden und war mit einigen Zwischenaufenthalten verbunden. Man konnte eine optimistische, gute politische Stimmung der Bevölkerung in den 50er Jahren daran ablesen. Der Marschblock der DHfK, auch überwiegend alle anderen Teilnehmer an der Maidemonstration, wurden von der Leipziger Bevölkerung mit Beifall begleitet. Viele Tausend Menschen säumten die Straßen, aus den Fenstern winkten die Bewohner. Man spürte in diesen Jahren eine Zuwendung zur Politik der DDR und eine Aufbruchstimmung, einen neuen Staat nach dem 2.Weltkrieg mit aufbauen zu helfen, eine Gesellschaftsordnung, die im Gegensatz zur kapitalistischen BRD stehen sollte. Der 1.Mai gestaltete sich zu einem richtigen Volksfest, man hatte Freude daran teilzunehmen und gewann mehr und mehr Zuversicht, dass sich die DDR weiterhin politisch, ökonomisch, kulturell und sozial zum Wohle ihrer Bürger entwickeln wird. In den kommenden Jahrzehnten, vor allem in den 70er und 80er Jahren, verlor der 1.Mai aus unterschiedlichen Gründen diesen volkstümlichen Charakter, und es blieb nur noch ein Pflichtprogramm.
Die Auseinandersetzung mit einigen Grundbestandteilen des dialektischen und historischen Materialismus und der Politik von Partei und Regierung der DDR und auch der Politik der BRD sowie das Eingebundensein in das gesellschaftliche und sportliche Leben in Leipzig führten bei mir schrittweise zu einem politisch denkenden Menschen. Sich mit Politik näher zu beschäftigen, machte mir von nun an auch Spaß und weckte Neugier und das Bedürfnis, tiefer in die gesellschaftliche Wirklichkeit einzudringen. Solche Fragen, warum sich die Welt so und nicht anders darstellt, warum sich Politiker, Staaten und Völker so und nicht anders in bestimmten Situationen verhalten, konnte man sich besser beantworten bzw. darüber mit Gesprächspartner streiten. In der Summe meiner persönlichen Erfahrungen als Kind am Ende des verheerenden 2. Weltkrieges und in den Jahren danach, die Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung führten am Ende der ABF-Zeit zu meiner politischen Grundhaltung. Ich war generell überzeugt, auch bei Widersprüchen und Enttäuschungen im Einzelfall in der aktuellen Politik, dass die DDR auf dem richtigen Weg ist. Das führte zu der Überlegung, mich mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) und ihrer politischen Strategie sowie mit ihrem Statut näher zu beschäftigen. In meiner Seminargruppe war bereits ein Jugendfreund Mitglied der SED. Ich bat ihn um das Statut der SED und ließ mir das Wirken der Mitglieder einer Parteiorganisation erklären. Nach Durchsicht des Statuts und auf der Grundlage meiner bisherigen politischen Erkenntnisse war ich zu der Auffassung gekommen, dass ich die Festlegungen im Statut einhalten könne und noch bessere Möglichkeiten als SED-Mitglied hätte, für die DDR zu wirken. Es ging zugespitzt in den 50er Jahren um die Grundfrage: Nie wieder Krieg, kein Krieg darf von deutschem Boden mehr ausgehen, wir wollen ein besseres Deutschland als es vor 1945 gewesen ist ! Diese Zielstellung sah ich mit der SED, mit einem sozialistischen Staat und mit verbündeten Staaten erreichbar. Warum sollte ich mich einer solchen Partei nicht anschließen können ? Es hat mich niemand für die SED geworben, von keiner Person bin ich in dieser Beziehung angesprochen oder bedrängt worden, SED-Mitglied zu werden. Die Entscheidung wurde ausschließlich von mir getroffen. Auch der oft publizierten und geäußerten Feststellung nach der Wende, die meisten SED-Mitglieder seien aus Karrieregründen dieser Partei beigetreten, auch wenn es Einzelfälle sicher gegeben hat, muss ich grundsätzlich widersprechen und kann es an meinem Beispiel beweisen. Die Bestätigung für das Hochschulstudium an der DHfK hatte ich bereits erhalten. Eine Funktion in irgendeiner Form bekleiden zu wollen, war überhaupt nicht in meiner Gedankenwelt. Es gab also nur einen Grund, der SED beizutreten: Meine eigene politische Überzeugung. Ich stellte den Antrag, Kandidat der SED zu werden und wurde von der Grundorganisation der ABF der DHfK im Frühjahr 1957 aufgenommen. Mit dem Abitur als Voraussetzung und als Kandidat der SED nahm ich nach einigen Urlaubswochen im September 1957 das Hochschulstudium an der DHfK auf.