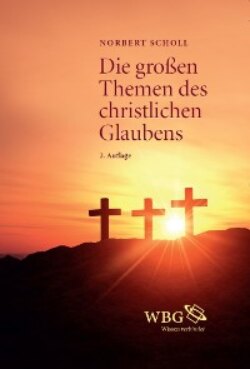Читать книгу Die großen Themen des christlichen Glaubens - Norbert Scholl - Страница 18
b) Grundsätzliche Aspekte für das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie
ОглавлениеNaturwissenschaft und Theologie haben mit menschlichen Erfahrungen zu tun.
Die empirisch arbeitenden Naturwissenschaften sind Erfahrungswissenschaften insofern, als sie die vorgefundene und vorfindbare Wirklichkeit experimentell zu erfahren suchen und aus den erfahrenen Beobachtungen Gesetzmäßigkeiten für die Vorgänge in der Natur ableiten. Die vorgegebene Realität selbst, das „Ding an sich“, kann allerdings nicht direkt erkannt werden, vor allem im subatomaren Bereich. Um dennoch eine Vorstellung des Unvorstellbaren zu vermitteln, behilft man sich mit Modellen. So können beispielsweise die unterschiedlichen Atommodelle nicht die Realität „Atom“ sichtbar machen, sie sind aber als Symbole und Modelle dennoch mehr als nichtssagend. Sie stehen für etwas, was sie selbst nicht sind. Dass hinter den symbolischen Begriffen ein „Etwas“, eine nur indirekt erfahrbare Realität, steckt, ist nicht ein Erkenntniswissen, sondern ist ein „Glaube“ daran, dass es diese Realität wirklich gibt.
Aufgabe der Theologie ist es, religiöse Erfahrungen, die Menschen gemacht haben und die unmittelbar mit dem persönlichen Lebensgang verbunden sind, systematisch zu erfassen, reflektierend zu deuten und in einen Gesamtzusammenhang einzuordnen. Das von Menschen Erfahrene, Gott, kann nicht direkt und unmittelbar erkannt werden. Zu erkennen sind nur „Spuren“ und „Zeichen“ einer „hinter“ den vorgegebenen Realitäten vermuteten (= geglaubten) letzten und eigentlichen Wirklichkeit.
Zwischen Theologie und Naturwissenschaft gibt es letztlich keinen grundlegenden Dissens, solange jeder sich der Reichweite seiner wissenschaftlichen Forschung auf seinem spezifischen Gebiet bewusst bleibt.
1937 hatte Max Planck in einem Vortrag über „Religion und Naturwissenschaft“1 angemerkt, die heutige Quantenphysik lege nahe, dass sich sowohl die Theologen als auch die naturwissenschaftlichen Empiriker getäuscht haben: Die Theologen, sofern sie Gott für eine objektivierbare geistige Realität hielten, die man sozusagen auf den philosophischen und theologischen Seziertisch legen und wie andere Objekte menschlichen Interesses untersuchen könne; die modernen Empiriker, sofern sie in ihrem ebenso naiven Wissenschaftsglauben behaupten konnten, dass nur das wirklich existiere, was man im Experiment messen und mathematisch beschreiben könne.2 „Beide Seiten haben erkannt, dass die Symbole, in denen die Religion Wahrheit ausdrückt, auf einer anderen Ebene liegen als wissenschaftliche Feststellungen über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von natürlichen Objekten. Die Religion der Zukunft wird frei sein von dem sinnlos gewordenen Konflikt zwischen Glauben und Wissen.“3
Wenn nun ein Stephen W. Hawking behauptet, es ließe sich seitens der Physik eine Antwort finden auf die Frage, „warum es uns und das Universum gibt“ und wenn er in dieser Antwort den „endgültigen Triumph der menschlichen Vernunft – denn dann würden wir Gottes Plan kennen –“4 zu sehen glaubt, dann hat er damit nicht nur seine Kompetenz als Physiker überschritten, sondern letztlich auch der Glaubwürdigkeit und Korrektheit naturwissenschaftlichen Denkens einen schlechten Dienst erwiesen.
Theologie und Naturwissenschaft dürfen bei aller notwendigen Spezialisierung den Blick auf das Ganze und auf den Gesamtzusammenhang nicht verlieren.
Angesichts der Fülle des angehäuften Wissens und der daraus resultierenden immer neuen und immer stärker ins Detail gehenden Fragestellungen wird – so widersprüchlich das auf den ersten Blick erscheinen mag – der Wissenshorizont immer mehr eingeschränkt. Der Schweizer Physiker und Wissenschaftsjournalist Eduard Kaeser veröffentlichte vor einigen Jahren einen Essay, in dem er darauf hinweist, dass die „Naturwissenschaft (heute) ohne Natur“ operiere, da sie gar keinen Zugang mehr zur konkret erfahrbaren, „begreifbaren“ Natur habe: „Das Qualitative der Materie – ihre Anfühlbarkeit, Anschaubarkeit, ihr Geruch, Geschmack, ihre Färbung, Textur, ihr Klang – verblasst im scharfen analytischen Blick der Quantenchemie zur entbehrlichen Draperie einer tiefer liegenden quantitativen Struktur.“5 Hier ist ein Prozess der „Enteignung“ der Natur durch die (Natur)Wissenschaft in Gang gekommen.6
Die Beschränkung auf das im Sinne der empirischen Wissenschaften rein objektiv und instrumental Datierbare und die nochmalige Begrenzung auf die pure Abstraktion oder Simulation der Natur in den EDV-Anlagen haben den Menschen mehr und mehr einer umfassenden Begegnung mit der konkret vorgegebenen Natur entfremdet. Problematisch wird es, so der Wissenschaftstheoretiker Hans Julius Schneider, „wenn das eingeschränkte Bild für das ‚eigentliche Wesen‘ gehalten wird, für den ‚harten Kern‘ der Wirklichkeit, den erst die so verstandene Wissenschaft aus einem Gespinst von Vorurteilen und Aberglauben behutsam herauspräpariert habe.“7
Ähnliches ist auch von der Theologie als Wissenschaft zu sagen. Sie hat – um ein Beispiel zu nennen – in Bezug auf die Bibel so viel Detail-Wissen angehäuft, dass nur allzu leicht die Besinnung auf das Eigentliche, auf die Botschaft und das Zeugnis, verloren zu gehen droht.
Die Wissenschaften müssen sich dessen bewusst sein. Sie sollten sich daher (auch) bemühen um die Wiedergewinnung eines weiteren und tieferen Erkenntnishorizontes und um einen dem Menschen als denkendes und fühlendes, wahrnehmendes und reflektierendes Wesen angemessenen Zugang zur Natur und zu dem, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Es geht um die Korrektur einer Praxis reiner Rationalität und eines allein empirisch bestimmten wissenschaftlichen Umgangs. Letztlich entkommt niemand, der ernsthaft über Welt und Wirklichkeit nachdenkt, der Frage, welchen Sinn das alles macht, was er oder sie da erforscht.
Es gibt keine Aussage in Theologie und Naturwissenschaft, die nicht zugleich etwas mitbedeutet für das jeweils denkende und forschende Subjekt.
Albert Einstein, der Erfinder der höchst abstrakten und unanschaulichen Relativitätstheorie, nimmt mit fast kindlichem Staunen die großartige Ordnung der Natur wahr und fühlt sich darin aufgehoben: „Der Anblick des Meeres ist unbeschreiblich großartig, besonders wenn Sonne darauf fällt. Man ist wie aufgelöst in die Natur. Man fühlt die Belanglosigkeit des Einzelgeschöpfes noch mehr als sonst und ist froh dabei.“8 Religiosität, so bekennt er, sei die stärkste Triebfeder wissenschaftlicher Forschung: „Welch ein tiefer Glaube an die Vernunft des Weltenbaues und welche Sehnsucht nach dem Begreifen wenn auch nur eines geringen Abglanzes der in dieser Welt geoffenbarten Vernunft musste in Kepler und Newton lebendig sein, dass sie den Mechanismus der Himmelsmechanik in der einsamen Arbeit vieler Jahre entwirren konnten. […] Nur wer sein Leben ähnlichen Zielen hingegeben hat, besitzt eine lebendige Vorstellung davon, was diese Menschen beseelt und ihnen Kraft gegeben hat, trotz unzähliger Misserfolge dem Ziel treu zu bleiben. Es ist die kosmische Religiosität, die solche Kräfte spendet. Ein Zeitgenosse hat nicht mit Unrecht gesagt, dass die ernsthaften Forscher in unserer im allgemeinen materialistisch eingestellten Zeit die einzigen tief religiösen Menschen seien.“9
Es gibt keine vorurteilsfreie und rein abstrakte Wissenschaft. Jeder Mensch, auch der Mathematiker und Physiker, hat Vorverständnisse, die über die Wege, die Art und Weise und auch die wissenschaftlichen Methoden mitentscheiden, die er oder sie wählt, um die Wirklichkeit zu erforschen und zu begreifen. Eine völlig voraussetzungslose Wissenschaft gibt es nicht, und dies gilt für alle Versuche, die Welt zu erklären, ob wir dazu die Physik oder Metaphysik, die Mathematik oder die Theologie bemühen.
Im Folgenden soll in aller Kürze der heutige Stand biblischer Theologie und naturwissenschaftlicher Theorie über die Entstehung der Welt referiert werden.