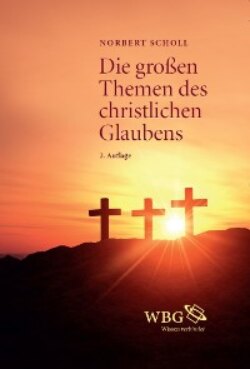Читать книгу Die großen Themen des christlichen Glaubens - Norbert Scholl - Страница 22
c) Theologie der Schöpfung
ОглавлениеAuf der Grundlage der biblischen Texte über die Schöpfung entwickelte die christliche Theologie eine eigene Schöpfungslehre. Das Bekenntnis zu Gott, dem „Schöpfer des Himmels und der Erde“, steht am Anfang jedes Glaubensbekenntnisses. Ähnlich beginnt auch die Bibel: „Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde“ (Gen 1,1).
Das kirchliche Credo spricht von Gott als „Schöpfer Himmels und der Erde“ – losgelöst von allen näheren Bestimmungen über die Art dieser Schöpfung (in sechs Tagen oder in einem „Urknall“) oder über ein mögliches Vorher oder Nachher. Die Bibel sagt, Gott habe „am Anfang“ oder „im Anfang“ – je nach der gewählten Übersetzung – den Himmel und die Erde erschaffen. Genau hier liegen die Probleme.13
Ist mit „Anfang“ der Beginn einer späteren Zeitenfolge gemeint oder nur der Beginn des sich über sechs Tage erstreckenden Schöpfungswerks? Handelt es sich überhaupt um eine Zeitbestimmung oder soll damit nur gesagt werden, dass die Schöpfung „am Anfang“ des in den folgenden Büchern geschilderten Prozesses der Annäherung Gottes an die Menschen steht, dass sie gleichsam die Voraussetzung für das göttliche Heilswerk darstellt?
Der im Credo lapidar vorgelegte Glaube an den Schöpfer lässt diese Fragen offen. Von einer wie immer gearteten Terminierung des Schöpfungsbeginns und des gesamten folgenden Schöpfungswerkes ist ebenso wenig die Rede wie von einer möglichen Evolution. Christlicher Glaube ist an naturwissenschaftlichen Fragen nur zweitrangig interessiert.
Im engen Zusammenhang damit steht auch die Rede von der „Schöpfung aus dem Nichts“. Es handelt sich hier nicht um ein Dogma. Eine Schöpfung „aus Nichts“ ist altorientalischer und israelitischer Vorstellung fremd. Die oft als biblische Begründung herangezogenen Stellen (2 Makk 7,28 [„Ich bitte dich, mein Kind, schau dir den Himmel und die Erde an; sieh alles, was es da gibt, und erkenne: Gott hat das aus dem Nichts erschaffen, und so entstehen auch die Menschen“] und Weish 11,17 [„Für deine allmächtige Hand, die aus ungeformtem Stoff die Welt gestaltet hat …“]) können dafür nicht in Anspruch genommen werden. Schon der große mittelalterliche Theologe Thomas von Aquin konnte sich durchaus eine von Ewigkeit her bestehende Welt vorstellen und hielt sie mit dem Glauben an Gott den Schöpfer vereinbar.14
Christlicher Schöpfungsglaube geht von einem eigenartigen Phänomen aus. Der in einer endlich-begrenzten Welt lebende und selbst endlich-begrenzte Mensch tritt dem Ganzen, dem er selbst zugehört und dessen Teil er ist, fragend-verwundert gegenüber. Wie aber kann „die Natur“ ein Wesen hervorbringen, das über sie hinausfragt? Solches Fragen und Verwundern lässt den „Verdacht“ aufkommen, dass „hinter“ dem vordergründig Wahrnehmbaren noch eine letzte, tiefste und alles gründende Wirklichkeit besteht. Die Annahme macht Sinn, dass der Kosmos, so gewaltig und riesenhaft er auch sein mag, ein „Woher“ besitzt. Der „Verdacht“ erscheint nicht unbegründet, dass diese Welt, so rätselhaft und widersprüchlich sie auch sein mag, einen Ursprung hat, der dem Ganzen Sinn und Ziel eingab. Die Vermutung, dass die Welt von einem dieser Welt nicht selbst zugehörigen Schöpfer geschaffen wurde, erscheint zumindest nicht weniger vernünftig, als die Behauptung, sie sei „durch Zufall und Notwendigkeit“ (J. Monod) geworden. Die schöpferische Macht Gottes liegt allem Endlichen voraus. Sie ist das ursprüngliche Prinzip für alles, was ist, und führt es seiner Bestimmung entgegen. „Der Gedanke der Weltschöpfung durch Gott ist ein Symbol, kein Wissen. Im Weltschöpfungsgedanken wird der Abgrund offen, in den wir mit all unserem Weltwissen und Welttun verschlungen werden und zugleich uns geborgen wissen“ (Karl Jaspers)
Schöpfung ist aber nicht in einer mythologischen Zeit geschehen, als andere Regeln galten. Vorstellungen über die Schöpfung des Kosmos müssen sich heute auf das beziehen, was sich im Universum sichtbar und hörbar abgespielt hat. Das heute von den Naturwissenschaften erarbeitete und vorgelegte Weltbild verlangt, dass sich der theologische Begriff der Schöpfung auf heutige Verhältnisse beziehen lässt. Wenn auch heute noch Neues entsteht, muss Schöpfung auch heute, hier und jetzt und unter den Augen der Naturwissenschaftler stattfinden.