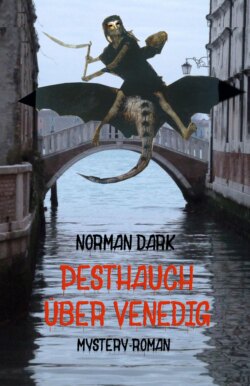Читать книгу Pesthauch über Venedig - Norman Dark - Страница 5
Kapitel 2
ОглавлениеDie beiden Pärchen aus dem Vereinigten Königreich kamen nur langsam voran auf der unheimlichen Insel, denn sie war weitgehend mit wucherndem Gestrüpp bedeckt.
»Wenigstens haben die Tiere die Insel noch nicht verlassen«, sagte Ellen, als zwei aufgeschreckte Vögel in den Himmel hinaufstieben. Auch kreuzten vereinzelt Kaninchen ihren Weg, und Eidechsen huschten schnell davon.
Endlich kamen sie zu einem Gebäude, das Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet sein sollte.
»Das kann unmöglich das Krankenhaus gewesen sein«, sagte Philip, »mit seiner grauweißen Fassade, den kastenförmigen Fenstern und dem Vordach auf dünnen Metallstäben sieht es eher nach einem Bau aus den Sechzigern aus.«
»Es wird sich um ein Verwaltungsgebäude aus jener Zeit handeln«, bemerkte Jayden. »Solche Gebäude fand ich schon immer langweilig, und wie du siehst, sind alle Fenster dunkel. Da hält sich bestimmt niemand auf.«
»Glaubst du eher in dem alten verfallenen Gebäude?«
»Warum nicht? Möglich wäre es doch. Ich schlage vor, du und Charlene seht euch hier etwas um, und Ellen und ich durchforsten das alte Haus.«
»Immer ich, wer weiß, ob dort nicht irgendwelche Geister herumspuken«, sagte Ellen.
»Wenn du ein Hasenfuß sein willst und dir mein Schutz nicht reicht, kannst du auch hier bei den anderen bleiben. Dann gehe ich allein.«
»Nein, ich komme ja schon. Man müsste eine Taschenlampe dabei haben, aber niemand konnte ahnen, dass …«
»Wer sagt, dass ich keine habe? Mit der App, die ich auf meinem Smartphone installiert habe, kann ich den Blitz für Fotos als Taschenlampe nutzen.«
»Ja, die habe ich zum Glück auch«, rief Philip, »also, bis später!«
Nach einer Weile kamen Jayden und Ellen zu einer völlig überwucherten Hausfassade. Durch eine breite Auslassung im Mauerwerk, in der sich wohl einmal eine Terrassentür befunden hatte, konnte man in einen größeren Raum sehen. Gleich vorne an stand ein rostiges Metallbett mit einer zerfledderten, speckigen Auflage. Auf dem Boden ringsherum lag allerlei undefinierbarer Unrat.
»Da gehe ich auf keinen Fall durch«, sagte Ellen, »irgendwo muss es doch einen regulären Eingang geben.«
Den fanden sie kurz darauf, doch von der Größe her konnte es sich allenfalls um einen Nebeneingang handeln. Jaydens Lichtkegel erfasste vollgekritzelte Wände, von denen der Putz abbröckelte. Die ehemals grün gestrichene untere Hälfte war nur noch in Fragmenten erhalten. Rechts und links ging jeweils eine Tür ab, und im Hintergrund führte eine Treppe in die obere Etage. Jayden leuchtete zuerst in den rechten Gang und machte vorsichtig einige Schritte hinein. Von ihm gingen unzählige Türen ab. Ellen folgte Jayden zögerlich und sah an seiner Schulter vorbei in die Räume. Zuerst fanden sie ein Zimmer, das auf dem Boden bröckliges Gestein aufwies. Neben der Tür stand eine Art Rollliege mit Metallrädern und zwei Drahtböden. In der linken Wand gab es so etwas wie ein großes Bullauge, dessen Tür weit offen stand und den Durchblick in den Nebenraum ermöglichte. Bei näherer Untersuchung wirkte die Röhre mehr wie eine sehr große Waschtrommel.
»Was ist das?«, fragte Ellen, »sieht beinahe wie ein überdimensionales Hamsterrad aus.«
»Keine Ahnung. Für einen Kamin fehlt der Abzug. Und wenn es eine, zugegebener Maßen, sehr praktische Waschmaschine war, da sie von zwei Räumen aus befüllt werden konnte, dann fehlen der Wasser Zu- und Abfluss. Äußerst seltsam.«
Beim nächsten Raum musste es sich um eine Küche gehandelt haben, denn es gab ein breites Metallgestell mit gusseisernen Ringen darauf. Auch war er bis zum oberen Türrahmen weiß gekachelt. Oder doch um ein Badezimmer? Denn es lagen auch umgestürzte emaillierte Wannen herum. Sicher war, dass sich bei diesem Zustand der Räume niemand darin aufhalten würde. Dann kamen sie in einen hellblau gekachelten Raum mit breitem Panoramafenster und Glasdach, in dessen Mitte sich eine verrottete Liege mit schwarzem Lederbezug befand. Darüber hing windschief ein runder Beleuchtungskörper mit mehreren Lampen, wie er typisch für einen Operationssaal war. Das war der Moment, wo es Ellen derart grauste, dass sie nur noch weg wollte.
Vom Gang gegenüber gingen auch mehrere Türen ab. Die weit offen stehenden Fenster gaben den Blick auf eine bedrückend hohe, graue Mauer frei. Der Abstand betrug allenfalls zwei Meter. Das „Dach“ bestand aus dicken schwarzen ineinander verwobenen Ästen, und der Boden war voller Laub und loser Steine. Obwohl der Gang vor den Fenstern an einen Freilauf eines Gefängnisses erinnerte, hätte Jayden nicht gewagt, einen Fuß auf den Boden zu setzen. Aus Angst, er hätte unter ihm nachgegeben und ihn in die Tiefe gerissen.
Das Paar ging zurück in die kleine Halle, und Jayden nahm Kurs auf die Treppe.
»Du willst aber jetzt nicht da hinaufgehen?«, fragte Ellen ängstlich, »die Holzstufen sehen sehr morsch aus, und es fehlen auch schon einige.«
»Wenn wir uns eng an die Wand drücken und öfter mal zwei bis drei Stufen auf einmal nehmen, wird es schon gehen.«
»Du wirst da oben kaum etwas anderes finden, als weitere leere Räume mit durchgerosteten Metallbetten.«
»Ich will mich ja darauf nicht schlafen legen. Aber vielleicht gibt es oben doch so etwas wie ein Büro, wo ein einsamer Wächter seinen Kaffee schlürft.«
»Das glaubst du doch selbst nicht! Aber bitte, du gibst sonst ja doch keine Ruhe.«
Jayden nahm Ellen wie ein kleines Kind an die Hand und drückte sich mit ihr die Wand entlang. Das altersschwache Holz der Stufen ächzte zwar gewaltig, und hin und wieder brach auch ein größerer Span davon ab, doch irgendwie schafften sie es schließlich oben anzukommen. Oben bot sich ihnen ein gänzlich anderes Bild. Um einen offensichtlich ovalen Saal führte ein breiter Gang. Rechts gab es mehrere Sprossenfenster, durch die diffuses Nachtlicht fiel. Zwischen den Fenstern waren vereinzelt große, kassettenförmige Flächen mit Resten von grüner, fein gemusterter Tapete. Auch hier lagen auf dem Boden loses Gestein und einzelne Backsteine herum. An der Decke befanden sich noch Lampen, die man nur in Büros oder Krankenhäusern benutzte und die die Illusion eines vornehmen Hotels zerstörten.
Der halbrunde Gang mündete in einen breiten rechteckigen, von dem weitere Türen abgingen. Den oberen Abschluss bildete eine nachtblaue, ovale Kassettendecke, und auch an den Wänden vermittelten helle Stuckleisten einen kassettenartigen Eindruck. Nachdem sich in den Zimmern wiederum nur alte Bettgestelle befunden hatten, wollte Jayden schon aufgeben. Doch plötzlich sah er am Ende des Ganges ein Licht schimmern, wie es nur eine Glühbirne verursachen konnte.
»Es gibt also doch einen Wächter«, atmete Jayden erleichtert auf, »komm, wir werden ihn uns mal ansehen!«
Als Jayden vorsichtig die Tür aufstieß, verschlug es ihm förmlich den Atem, denn er fand keineswegs einen nüchternen Raum vor, in dem sich Wachpersonal aufzuhalten pflegte, sondern ein vollständig eingerichtetes Büro mit dunklen Möbeln, hohen Bücherregalen und einem beeindruckenden Schreibtisch. Und dahinter saß auch kein Wachmann, sondern ein finster blickender, älterer Herr mit weißem Kittel und dunkler Brille, bestehend aus einem Metallgestell und runden Gläsern in Celluloid eingefasst.
»Buona sera!«, sagte er mit sonorer Stimme, »ich bin professore Cavalcanti. Mit wem habe ich das Vergnügen?«
Philip und Charlene Lorring hatten in dem alten Verwaltungsgebäude nichts entdecken können, außer vereinzelten Schränken mit Rollotüren, windschiefen Bürostühlen mit verschlissenen Sitzen und jede Menge längst veraltete Technik. Enttäuscht waren sie um das Haus herumgelaufen, in der Hoffnung, weitere Gebäude zu finden, doch ihnen fiel nur ein leeres Haus auf, mehr eine Hütte, mit offener Tür und einem mit Brettern vernagelten Fenster. Längst aufgegebene Wein- und Gemüsegärten kündeten von besseren Zeiten der Insel. Als sie einen halb überwucherten Grab- oder Gedenkstein mit der Inschrift „Ne fodias vita functi contagio requiescunt“ fanden, machte Charlene ein ratloses Gesicht.
»Was steht da? Kannst du das übersetzen?«, fragte sie ihren Mann.
»Wenn ich mich nicht irre: „Nicht graben, hier ruhen die, die an der Ansteckung starben“«
Charlene schrie entsetzt auf. Philip nahm sie tröstend in den Arm.
»Es ist doch bekannt, dass man Ende des 18. Jahrhundert, als die Pest erneut in Venedig ausbrach, die verseuchten Toten auch hierher brachte, um sie zu verscharren, weil die anderen Quarantäneinseln nicht mehr ausreichten. Bei bis zu vierhundert Toten am Tag entledigte man sich der Leichen, wo man nur konnte. Meist auf den Nachbarinseln. Auch Anfang des 19. Jahrhunderts gab es wieder Pesttote, hinzu kam noch eine Cholera-Epidemie. Die Kranken wurden hier in einem neu erbauten Lazarett behandelt und auch hier begraben.«
»Schrecklich, demnach wandeln wir hier auf verseuchtem Boden.«
»Beruhige dich, Darling, es ist kaum anzunehmen, dass die Erreger der furchtbaren Krankheiten die Jahrhunderte überlebt haben.«
Als sie unter wucherndem Gestrüpp später das Schild „reparto psichiatrica“ entdeckten, nickte Philip wie zur Bestätigung.
»Es hat also damals tatsächlich eine psychiatrische Abteilung gegeben«, sagte er, »demnach ist es nicht nur eine Legende.«
»Die Gebäude sollen doch als Alters- und Siechenheime gedient haben, wenn ich richtig unterrichtet bin, da finde ich es ganz normal, wenn es auch eine psychiatrische Abteilung gab«, meinte Charlene mehr zu ihrer eigenen Beruhigung, »oder glaubst du die Geschichte über diesen Dr. Frankenstein, der mit Patienten experimentiert haben soll?«
»Nein, eher nicht. Ich denke, diese Horrorstorys haben die Amis erfunden.«
Ganz plötzlich bezog sich der Himmel, und innerhalb weniger Minuten kam dichter Nebel auf. Aber damit nicht genug. Es wurde so kalt, dass der ausgestoßene Atem wie eine Rauchfahne wirkte. Charlene drückte sich fröstelnd an Philip.
»Was ist jetzt wieder los? Das ist doch nicht normal, dass auf einmal winterliche Temperaturen herrschen«, sagte sie kläglich, doch weitere Kommentare blieben ihr förmlich im Halse stecken. Denn aus dem Nebel kamen ihnen Gestalten mit zerlumpter Kleidung entgegen. Sie waren schrecklich entstellt durch schwarze Male im Gesicht und an den Händen, die sie wie Krallen nach ihnen ausstreckten. Aus ihren Mündern rann eine schwärzliche Masse, und ihre Augen blickten tot und gebrochen.
Charlene und Philip suchten ihr Heil in der Flucht. Und offensichtlich hatten sie Glück und wurden nicht verfolgt. Da trat ihnen eine alte Frau, krumm auf einen Stock gestützt, entgegen. Auch ihre Kleidung hing in Fetzen an ihr herunter, und sie stank fürchterlich. Aber sie verzog ihren zahnlosen Mund zu einem freundlichen Lächeln.
»Kommt, meine Kinder, ich bringe euch in Sicherheit«, lallte sie. Und vor Aufregung wunderten sich Philip und Charlene nicht einmal, dass sie Englisch sprach. »Ihr müsst dort nach links. Da führen ein paar Stufen zum Wasser hinunter, und ihr werdet ein Boot finden, das euch fortbringt.«
Kurz ein »Danke« murmelnd, gingen die beiden in die angegebene Richtung. Die Alte hatte nicht gelogen. Als Philip und Charlene die Stufen hinuntereilten, sahen sie tatsächlich ein etwas morsches Boot auf dem Wasser schaukeln. Und zwei Ruder gab es auch.
»Sollten wir nicht die anderen holen?«, fragte Charlene unsicher.
»Bis wir die gefunden haben, ist das Boot vielleicht wieder weg. Wenn wir es bis zum Lido-Ufer schaffen, können wir immer noch Hilfe holen.«
»Und wenn nicht?«
»Darüber will ich mir jetzt keine Gedanken machen. Es ist vielleicht unsere einzige Chance. Komm, Darling, aber sei vorsichtig!«
Philip half seiner Frau in das Boot, das zwar etwas schaukelte, aber stabil zu sein schien. Doch das war ein Trugschluss. Von einem Moment zum anderen gab der Boden unter Charlenes Füßen nach, sodass sie langsam im dunklen Wasser versank. Philip sprang ohne zu zögern hinterher, doch er bekam seine Frau nicht zu fassen. Sie entglitt stets wie ein Aal seinen Händen. Da spürte er, wie seine Beine gepackt wurden und man ihn in die Tiefe zog. Philip strampelte in Todesangst, doch obwohl er niemanden unter ihm sah, konnte er den Angreifer nicht abschütteln. Dann begannen seine Lungen zu brennen, und er bekam keine Luft mehr. Das Letzte, was er sah, war Charlene, die mit vor Schreck weit geöffneten Augen leblos in Richtung Grund gezogen wurde.
Rebecca Miller stand am Fenster der alten Wohnung und schaute auf das dunkle Wasser des Kanals. Sie konnte es nicht begreifen, dass ihr Bruder Joshua sich nicht bei ihr meldete. Selbst wenn er es sich kurzfristig anders überlegt hatte und sich lieber in New York ein paar schöne Tage machen wollte, wäre es seine Pflicht gewesen, sie nicht länger im Unklaren zu lassen.
Man sagte ihnen beiden ein schwieriges Wesen nach, und zur Unterstützung dieser Einschätzung führte man gerne die Tatsache an, dass beide noch immer nicht verheiratet waren, obwohl sie mit großen Schritten auf die Vierzig zugingen. Rebecca wurde dann immer böse, wenn man sie darauf ansprach. Schließlich lebten sie in einer Zeit, wo die meisten Leute Singles waren. Ja, sie hatte einige Beziehungen hinter sich, glückliche und unglückliche, aber keine hatte gereicht, den Bund fürs Leben einzugehen, wie es so schön hieß. Rebecca mochte auch keine Menschen, die sich ausschließlich über ihre Partner definierten. Schließlich war sie eine eigenständige Person.
Joshua liebte seine Freiheit. Er ging nur oberflächliche Beziehungen ein, die meist nicht lange hielten. Sein Sport und seine Reiselust nahmen den Großteil seiner Freizeit ein. Und eine Frau zu finden, die ihn auf Dauer faszinierte, konnte er sich einfach nicht vorstellen, wie er schon mehrmals Rebecca gegenüber geäußert hatte. Es gab immer wieder welche, die versuchten, ihn einzufangen. Schließlich sah Joshua mit seiner durchtrainierten Figur und der sonnengebräunten Haut sehr gut aus, aber wenn es ernst wurde, zog er immer die Notbremse. Er sei eben kein Mann zum Heiraten, war einer seiner Lieblingssprüche.
Rebecca war so in Gedanken versunken, dass sie gar nicht bemerkte, beobachtet zu werden. Erst im letzten Moment fiel ihr auf, dass auf der anderen Seite des Kanals ein Mann unbeweglich herüberstarrte. Aber das war doch Joshua! Rebecca hätte jeden Eid geschworen. Er trug kein Gepäck bei sich und sah in der schummrigen Beleuchtung etwas weniger frisch als üblicherweise aus, fast elend. Nur warum kam er nicht zu ihr hinauf, sondern starrte nur unentwegt?
In aller Eile warf sich Rebecca einen dünnen Mantel über, zog ihre bequemen Sneakers an und verließ die Wohnung. Auf der Straße lief sie zum Kanal, aber wie schon befürchtet, gab es keine Spur mehr von Joshua. Etwas weiter entfernt bog zwar ein Mann gerade in die Seitenstraße, aber auf Rebeccas Rufen reagierte er nicht.
Vor Enttäuschung kamen Rebecca die Tränen, doch sie gab noch nicht auf. Voller Ungeduld umrundete sie den langgestreckten Häuserblock in der entgegengesetzten Richtung, erreichte schließlich die Calle del Caffettier und überquerte die schmale Brücke, die mehr einer leicht ansteigenden Treppe glich, um laut rufend, Joshua nachzueilen. In der Nähe des Ristorante Al Theatro stieß sie so heftig mit einem Mann zusammen, dass sie beinahe das Gleichgewicht verlor.
Leider war es nicht Joshua, sondern ein lächelnder Fremder mit männlich markantem Gesicht und leicht angegrauten Schläfen, der sie am Arm festhielt, um sie am Stürzen zu hindern.
»Da hat es aber jemand ganz besonders eilig«, sagte er mit angenehmem Timbre in seiner Stimme. »Laufen Sie vor jemandem davon oder ihm nach?«
»Wie? Letzteres. Ich glaubte meinen Bruder zu sehen, der seit Tagen überfällig ist.«
»Wenn Sie weiter wollen, will ich Sie nicht aufhalten.«
»Danke, aber ich fürchte, Josh dürfte inzwischen über alle Berge sein.«
»Was machen wir denn nun mit Ihnen? Darf ich Sie nach Hause begleiten?«
»Ein Kavalier der alten Schule, was? Entschuldigen Sie! Ich bin es gewohnt, meine Wege ohne Begleitung zu erledigen.«
»Schade. Darf ich mich übrigens vorstellen? Mein Name ist Fabrizio Vespucci.«
»Ein Nachfahre des Seefahrers, Entdeckers und Kaufmanns?«
»Nein, leider nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.«
»Angenehm, ich heiße Rebecca Miller.«
»Ebenfalls angenehm, sehr sogar.«
»Als Nachfahre, oder auch Nichtnachfahre, des großen Eroberers halten Sie es wohl für Ihre Pflicht, mit fremden Frauen zu flirten?«
»Nur wenn sie so attraktiv wie Sie sind.«
»Es gibt jüngere und hübschere …«
»Mag sein, aber selten so schlagfertige. Nun Rebecca hat zwar der Bibel nach einem Knecht Wasser aus ihrem Krug gereicht und auch seinen Kamelen zu trinken gegeben, aber vielleicht können wir es heute umgekehrt machen? Ich würde Sie gerne zu einem Glas Wein einladen. Ein Kamel oder Pferd, das getränkt werden müsste, habe ich allerdings nicht dabei.«
Rebecca musste lachen. »Wie schön, dass Sie sich mit der Bibel auskennen. Ich bin tatsächlich jüdischer Abstammung, lebe aber nicht in Israel, sondern in den USA, in San Francisco.«
»Und was macht die jüdische Amerikanerin dann hier in Venedig? Wollen Sie der jüdischen Kultur in dieser Stadt nachspüren?«
»Bingo! Meine Großeltern haben seinerzeit im Ghetto gelebt. Aber da ich erst seit Kurzem vor Ort bin und die meiste Zeit damit verbracht habe, auf meinen Bruder zu warten, bin ich noch nicht dazu gekommen, nach Spuren zu suchen.«
»Vielleicht darf ich Ihnen dabei behilflich sein. Ein wenig kenne ich mich in der Serenissima aus.«
»Vielleicht sollten wir es anfangs bei dem Glas Wein belassen. Die Einladung nehme ich gerne an.«
»Charmant Körbe zu verteilen, verstehen Sie auch noch! Wie kommt es, dass so eine tolle Frau allein durchs Leben geht?«
»Vielleicht wartet mein eifersüchtiger Gatte nur darauf, Sie zum Duell zu fordern?«
»Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Auch glaube ich nicht, dass Sie verheiratet sind. Ich sehe jedenfalls keinen Ring.«
»Der Herrgott erhalte Ihnen Ihren Glauben!«