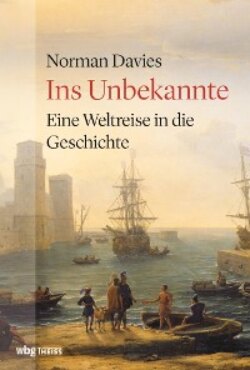Читать книгу Ins Unbekannte - Norman Davies - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
Wo die Zitronen blühn – Von Pilgern und Entdeckern
ОглавлениеDie liebste Lektüre meiner Mutter war John Bunyans Pilgerreise (The Pilgrim’s Progress).1 Über Jahre lag dieses Buch auf ihrem Nachttisch, fast wie ein stiller Tadel an die Adresse meines Vaters, dessen sehr viel seichterer Lieblingsschmöker, Der Graf von Monte Christo, stets neben seinem Kissen auf der gegenüberliegenden Seite des Bettes zu finden war.2 Die Helden dieser beiden Bücher verkörperten die so verschiedenen Gemüter meiner Eltern – und ich habe allen Grund zu der Annahme, dass „der Pilger“ und „der Graf“ auch in jenen Augenblicken diskret zugegen waren, in denen mein eigener Lebensweg seinen Anfang nahm.
Trotz einer obligatorischen Wallfahrt zu der Stelle, wo in Elstow, Bedfordshire, einmal sein Geburtshaus gestanden hatte – ich muss damals sieben oder acht Jahre alt gewesen sein –, bin ich mit Bunyan nie wirklich warm geworden. Er ist Puritaner gewesen – mehr noch: ein puritanischer Prediger, ernst und streng. Und doch habe ich ausgerechnet bei ihm jene wunderbare Allegorie kennengelernt, die den Lebensweg als eine Reise durch wechselvolles Gelände beschreibt, mitsamt allen „Sümpfen der Verzweiflung“, aber auch mit „herrlichen Höhen“; als eine Reise, an deren Ende die Ankunft in einer „himmlischen Stadt“ lockt. Bei der allmorgendlichen Schulversammlung schmetterten wir aus voller Kehle Bunyans mitreißendes To Be a Pilgrim, das einzige Kirchenlied aus seiner Feder:
He who would valiant be
’Gainst all disaster,
Let him in constancy
Follow the Master.
There’s no discouragement
Shall make him once relent
His first avowed intent
To be a pilgrim.
Wer sich im Lebenssturm
fest will bewähren,
folge dem Meister nur
und seinen Lehren.
Keiner Enttäuschung Schlag
zeitigt, dass er verzagt
und schließlich ganz entsagt
dem Weg des Pilgers.3
Die markante Melodie von Ralph Vaughan Williams, nach der Bunyans Text heute meist gesungen wird, trägt zu der immensen Wirkung des Liedes noch einiges bei.
Das Singen von Kirchenliedern war ein wesentlicher Teil meiner Erziehung. Noch immer kann ich mich ans Klavier setzen und Dutzende dieser Lieder aus dem Gedächtnis spielen. Aber keines davon kommt für mich an Cwm Rhondda heran, ein ursprünglich walisisches Lied, das als „Gebet um Stärke auf der Reise durch die Wildnisse dieser Welt“ ins Englische übertragen wurde. Es erklingt in einem kräftigen As-Dur und ist, was kräftigende Kirchenlieder angeht, das Stärkungsmittel überhaupt:
Guide me O Thou, Great Redeemer,
Pilgrim in this barren land.
I am weak, but Thou art mighty;
Hold me with Thy powerful hand.
Bread of Heaven! Bread of Heaven!
Feed me till I want no more.
When I pass the banks of Jordan
Bid my anxious fears subside.
Death of death, and Hell’s destruction
Bring me safe to Canaan’s side.
Songs of Praises! Songs of Praises!
I will ever give to Thee.
Leite mich, du großer Retter,
den Pilger in der Wüstenei.
Ich bin schwach, doch du bist mächtig;
deine Rechte mach’ mich frei.
Brot vom Himmel! Brot vom Himmel!
Gib mir, bis ich hab’ genug.
Wenn ich Jordans Fluten quere,
lindre meiner Ängste Qual. Todes
Tod, der Höll’ Zernichtung
führ’ mich heim in Kanaans Saal.
Halleluja! Halleluja!
will ich singen immerdar.4
Wann immer ein „Sumpf der Verzweiflung“ sich drohend auftut: ein oder zwei schnelle Durchgänge von Cwm Rhondda, und man kann seine Reise sicheren Schrittes fortsetzen.
Ein- oder zweimal im Jahr nimmt mein Sohn Christian (der unter anderem nach dem Helden von Bunyans Buch so getauft wurde) mich mit ins Millennium Stadium von Cardiff – um ein Rugbyspiel zu sehen, natürlich, aber auch, damit ich den Fangesängen lauschen kann. Bei diesen Gelegenheiten wird der walisische Text von Cwm Rhondda gesungen, und das sogar mit noch mehr Inbrunst:
Arglwydd, arwain trwy’r
Fi berein gwael ei wedd
Na does ynof nerth na bywyd
Fel yn gorwedd yn y bedd:
Hollaluog! Hollaluog!
Ydw’r Un a’m cwyd i lan
Ydyw’r Un a’m cwyd i lan.5
Sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben ältere Brüder im Ersten Weltkrieg verloren, der noch heute in Großbritannien schlicht als „der große Krieg“, the Great War, bezeichnet wird. Die meisten populären Stücke aus ihrem Liederschatz entstammten jenen Kriegsjahren und tauchten – damit ich auch noch etwas davon hatte – in den 1960er-Jahren in Joan Littlewoods brillantem (später auch verfilmten) Satire-Musical Oh, What a Lovely War! wieder auf. Meist geht es in diesen Liedern um Verlust und Sehnsucht:
There’s a long, long trail a-winding
Into the land of my dreams
Where the nightingales are singing,
And a white moon beams.
There’s a long, long night of waiting
Until my dreams come true,
Till the day when I’ll be going down
That long, long trail with you.
Eine lange Straße windet
sich für mich in einen Traum,
wo die Nachtigall verkündet
Fried’ in mondbeglänztem Baum.
Eine lange Nacht, die dauert
ohne dich noch mal so lang –
wann erwach’ ich mit dem Schauer,
dass ich mit dir dort wandeln kann?6
Nur wenige moderne Popsongs, finde ich, können da mithalten, was Melodie, Stimmung oder Aussage angeht.
In der achten oder neunten Klasse lasen wir in der Schule William Hazlitts On Going a Journey („Über das Reisen zu Fuß“), einen Klassiker des englischen Essays. Für mich war es eine wahre Offenbarung, dass da einer seine eigenen Gedanken und Gefühle mit derart gründlicher Präzision – und in aller Seelenruhe! – zergliedern und reflektieren konnte. Hazlitt (1778–1830), der tatsächlich ein ziemlich erbärmliches Leben führen musste, feiert in seinem Essay die Freuden der Einsamkeit und den therapeutischen Nutzen des Reisens. Am bekanntesten ist der folgende Satz: It is better to travel than to arrive – „Reisen ist besser als ankommen“ oder anders gesagt: Der Weg ist das Ziel. Aber Hazlitts Text enthält noch weitere Perlen: „Nie bin ich weniger allein, als wenn ich ganz allein bin“ etwa oder das folgende Motto: „Gebt mir den strahlend blauen Himmel über mir, das saftig-grüne Gras unter meinen Füßen und drei Stunden Fußmarsch bis zum Abendessen – und dann wird nachgedacht!“7
Zu meinem ewigen Vorteil teilten gleich mehrere meiner Lehrer Hazlitts Philosophie; immer wieder unternahmen sie mit uns Ausflüge, bei denen wir jede Menge saftig-grünes Gras unter die Füße bekamen. Ich kann nicht sehr viel älter als zehn Jahre gewesen sein, da hatte ich bereits die fells des nordenglischen Lake District erklommen, angefangen mit dem Helvellyn und seinen immerhin 951 Metern; ich hatte den Peak District in Mittelengland erkundet (zuerst bestiegen wir den Mam Tor) und war über die Lichtungen des altehrwürdigen New Forest in Südengland gestreift, wo wir in Queen’s Bower auf der Isle of Wight unser Lager aufgeschlagen hatten. Ich war durch die Einöde von Dartmoor im Südwesten Englands gewandert und hatte mein Zelt vor den Mauern einer Burg in den schottischen Highlands aufgeschlagen, während der Dudelsackspieler des lairds – des Burgherrn – uns eine Serenade blies.
Ein weiterer Lehrer, der in nur kurzer Zeit einen tiefen Einfluss auf mich ausübte, war David Curnow, der später Professor für englische Literatur an der Amerikanischen Universität von Beirut werden sollte. Als jungem Cambridge-Absolventen hatte man ihm die beinah unmögliche Aufgabe übertragen, in die Dickschädel einer Horde von Oberstufenschülern, die noch dazu Englisch als Hauptfach bereits abgewählt hatten, so etwas wie literarische Sensibilität einzutrichtern. Hochgewachsen und elegant, spielte er seine Rolle perfekt: das Haar zu einer modischen Tolle nach Art der Teddy Boys frisiert, mit einer etwas geckenhaften Krawatte angetan und in Hosen aus Cavalry-Twill, an deren akkurat gepressten Bügelfalten man sich hätte schneiden können. Seine Strategie war es, leise und unauffällig den Raum zu betreten, die Hände in den Hosentaschen – wobei er den Tumult, den wir gerade veranstalteten, vollkommen ignorierte –, sich ein Stück Kreide zu schnappen und (ohne auch nur ein Wort zu sagen) einige Verse an die Tafel zu schreiben. Dann drehte er sich blitzschnell um, sah den Dickschädeln unerschrocken ins Auge (wobei er weiter schwieg) – und wartete auf eine Reaktion:
Ah Sun-flower! weary of time,
Who countest the steps of the Sun:
Seeking after that sweet golden clime
Where the traveller’s journey is done.
Where the Youth pined away with desire,
And the pale Virgin shrouded in snow:
Arise from their graves and aspire,
Where my Sun-flower wishes to go.
Ach, Sonnenblume! du bist es müd,
zu bemessen der Sonne Hast,
suchend das glückliche Land im Süd,
wo der Reisende findet Rast:
Wo der Jüngling, der hinschwand in Schmachten,
und die Jungfrau, das Herz vereist,
aus den Gräbern erstehn und trachten,
wohin meine Sonnenblume weist.8
Der Effekt war enorm: Der Tumult ebbte ab, und Schweigen fiel auf den Raum voller pubertierender Burschen, die alle bereits selbst erfahren hatten, was es hieß, „in Schmachten hinzuschwinden“, und die nun plötzlich begriffen, dass William Blake mit ihnen selbst sprach, wenn er über das Leben und den Tod, über Sexualität und spirituelle Grenzerfahrungen dichtete.
Etwa zur selben Zeit entdeckte ich, ganz zufällig, die Welt der Reiseliteratur. Beim Stöbern in der Stadtbücherei von Bolton stieß ich auf eine ungewöhnlich große Abteilung mit Reiseberichten und -erzählungen, die meisten davon aus viktorianischer Zeit. Unter den Büchern, die sich mir besonders eingeprägt haben, waren solche Klassiker wie Arthur Youngs Reisen durch Frankreich (1792), Alexander Kinglakes Eothen (1844), Wildes Wales von George Borrow (das meine Neugier auf Genealogie und Familienforschung lenkte), Robert Louis Stevensons Reise mit dem Esel durch die Cevennen (1879), dem ich eine tiefe Faszination mit dem ländlichen Frankreich verdankte, und Joshua Slocums fesselnder Bericht von seiner Solo-Weltumseglung, Allein um die Welt (1900). Mein unbestrittener Favorit war jedoch William Cobbetts Rural Rides („Ritte über Land“, 1830), in dem sich detaillierte Beschreibungen von weiten Ausritten durch das vorindustrielle England mit prägnanten politischen und sozialen Analysen und Urteilen verwoben. Schon lange bevor ich selbst nach Oxford kam, konnte ich bei Cobbett nachlesen, worauf ich mich einzustellen hatte:
Wie mir die große Menge von Bauwerken in den Blick kam, die sie in Oxford als die Bienenstöcke ihrer sogenannten „Gelehrsamkeit“ errichtet haben, da konnte ich nicht anders, als an all die Drohnen zu denken, die darin hausen, und an all die Wespen, die Jahr für Jahr daraus hervorschlüpfen! Mögen manche unter diesen Geschöpfen auch noch so bösartig sein, ihr auffälligster, ja ihr beherrschender Charakterzug bleibt doch die Torheit: völlige Leere in den Köpfen, Mangel an Talent, und die Hälfte der Kerle, die sie hier gebildet nennen, taugte noch nicht einmal als Gehilfe in einem Kramladen oder Tuchkontor. … Da stieß ich unwillkürlich und wie zu mir selbst hervor: „Herbei, o ihr Großkopferten, ihr prächtig genährten Doktoren! Herbei, ihr vermögenden Kirchenmäuse, denen arme Schlucker per annum einhunderttausend Pfund Sterling in die Geldkatze stecken! … So kommt doch herbei und schaut mir ins Gesicht, der ich mit der Schreibarbeit meiner Mußestunden [mehr] unter euren Schäfchen gewirkt habe als ihr alle zusammen in dem vergangenen halben Jahrhundert!9
Kaum weniger inspirierend für einen heranwachsenden Burschen wie mich waren fiktionale Reiseerzählungen. Unter den Büchern, die ich vor Begeisterung geradezu verschlang, waren Jules Vernes Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer, Arthur Conan Doyles Die vergessene Welt und König Salomons Schatzkammer von H. Rider Haggard. Als ich einmal mit Mumps oder Masern das Bett hüten musste, las ich Die Zeitmaschine von H. G. Wells – das heizte meine Fieberträume wohl eher noch an! In meiner Fantasie erfand ich eine eigene Maschine, mit der man die Lichtstrahlen, die von einem beliebigen Ereignis in der Geschichte reflektiert worden waren, auffangen, bündeln und wiederum projizieren konnte. Auf diese Weise – man musste nur die Regler an der Maschine auf einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit einstellen, wie etwa „Thermopylen, – 480“ oder „Hastings, +1066“ – würde man dann ein wahrheitsgetreues Bild der jeweiligen Szene rekonstruieren können. „Tatsächlich gibt es vier Dimensionen“, heißt es bei Wells, „von denen wir drei die Ebenen des Raumes nennen, und eine vierte, die Zeit.“ Das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Nach mühsamen Reisen durch Raum und Zeit würde ich reich belohnt werden: mit grenzenlosem Wissen, den Eindrücken von unzähligen Wundern und allen Geheimnissen dieser Erde!10
Heute fällt mir immer wieder auf, dass die angeblichen Experten, denen wir Top-10- oder Top-20-Listen der „Besten Reisebücher aller Zeiten“ verdanken, die Ursprünge des reiseliterarischen Genres fast ausnahmslos ignorieren.11 Die meisten Autoren, die sich gegenwärtig über Reiseliteratur äußern, scheinen beispielsweise in seliger Unkenntnis von Goethes Italienischer Reise zu schreiben – eines wahren Grundpfeilers des reiseliterarischen Kanons! Goethe bereiste Italien während zweier Jahre unmittelbar vor der Französischen Revolution, aber er veröffentlichte seine Aufzeichnungen von dieser Rundreise erst mehr als drei Jahrzehnte später, nachdem er sie durch umfangreiche Reflexionen und Kommentare erweitert hatte. Auf den ersten Blick ähnelt sein Bericht den unzähligen Beschreibungen der Grand Tour, die betuchte Bildungsreisende aus ganz Europa schon seit Jahrhunderten zu Papier gebracht hatten. Tatsächlich jedoch war die Italienische Reise höchst innovativ. Nach Goethes über Jahre gereifter Überzeugung bestand der höchste Zweck des Reisens darin, Selbst-Entdeckung zu betreiben; das Reisen war für ihn gleichsam eine „Schule des Sehens“, aber er wollte, wie er schrieb, vor allem sich selbst besser in den Blick bekommen: „Ich mache diese wunderbare Reise nicht, um sich selbst zu betriegen [sic], sondern um mich an den Gegenständen kennen zu lernen …“12 Indem er immer neue, unbekannte Landschaften, Kunstwerke und Menschen aufsuchte und kennenlernte, suchte Goethe also – indem er der Wirkung nachspürte, die diese Erlebnisse auf ihn hatten –, mehr über seine eigenen Vorlieben und vorgefassten Meinungen zu erfahren. Das tat er zu einem großen Teil im Rahmen seiner „Entdeckung der Antike“, wie man diese Etappe seines Lebenswegs charakterisiert hat: Goethe gelangte zu der Einsicht, dass die Griechen und Römer uns keineswegs nur Scherben und Ruinen hinterlassen hatten, sondern quicklebendige Traditionen. So kann man sein Reisen und das Schreiben darüber als Teile eines großen Experiments begreifen, das kulturelle und psychologische Fragestellungen miteinander verband.
Goethe war also alles andere als ein simpler Chronist. Und obwohl die Italienische Reise auf seinen Reisetagebüchern der Jahre 1786–88 basiert, hat ihr die spätere Überarbeitung – sorgfältig, Schicht um Schicht – einen eigentümlichen, schillernd-mehrdeutigen Charakter eingeschrieben. Sie war nun, wie Goethe selbst in einem Brief an seinen Freund Zelter bemerkte, „zugleich völlig wahrhaft und ein anmutiges Märchen“.13 Seine Liebe zu dem Land jenseits der Alpen indes hat ein Leben lang gehalten:
Kennst du das Land? wo die Zitronen blühn
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl? Dahin! Dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn! …14
Und natürlich lautete das berühmte Motto, das Goethe seiner Italienischen Reise voranstellte: „Auch ich in Arkadien!“ – Et in Arcadia ego.
Ich denke mir, dass die damalige Schulleiterin der Bolton School, Margaret Higginson, von ganz ähnlichen Ideen beseelt war, als sie es in den Osterferien 1956 wagte, mit einem Trupp halbwüchsiger Jungen und Mädchen nach Venedig, Florenz und Verona aufzubrechen. Als Lektüreempfehlung für die lange Zugfahrt wies sie uns auf ein schmales Bändchen hin, in dem die Klassiker der lateinischen Literatur in ihrem Zusammenhang mit der italienischen Landschaft vorgestellt werden. Es hieß Poets in a Landscape (Römisches Arkadien. Dichter und ihre Landschaft), und ich war sofort gefesselt – der Beginn einer lebenslangen Begeisterung.15 Was ich damals nicht wusste, war, dass der Verfasser des Büchleins, Gilbert Highet – ein Altphilologe schottischer Herkunft, der sich an amerikanischen Universitäten einen Namen gemacht hatte –, zuvor bereits eine wahre „Bibel“ seiner Zunft publiziert hatte: The Classical Tradition.16 „Die Welt ist klein geworden heutzutage“, hatte Highet in einem anderen Buch namens People, Places and Books geschrieben, „aber die Geschichte bleibt doch weit und tief. Mitunter kommt man weiter herum, wenn man in den eigenen vier Wänden ein Geschichtsbuch liest, als wenn man mit Schiff oder Flugzeug Tausende von Meilen zurücklegt.“17
Ich war gerade achtzehn geworden, da reiste ich zum ersten Mal allein ins Ausland. Die Aufnahmeprüfungen für Oxford hatte ich bereits erfolgreich hinter mich gebracht; nun sollte ich in der Dauphiné, genauer gesagt in Grenoble, mein gesprochenes Französisch vervollkommnen – und wohl auch meine Eigenständigkeit und „Überlebensfähigkeit“ in fremder Umgebung unter Beweis stellen. Den Plan für diese Expedition hatte ich mir selbst überlegt, inspiriert durch meine Lieblingscousine Sheila, die vor dem Zweiten Weltkrieg dort studiert hatte und in deren Fußstapfen ich – so viel stand fest – nun treten wollte. Die genaue Wahl meines Ziels war indes auch durch die Nähe der französischen Alpen beeinflusst. So belegte ich Kurse an der Universität von Grenoble und nahm ein Zimmer bei der Familie De la Marche in der Rue du Lycée, Hausnummer 5 (das Haus steht nun schon lange nicht mehr). Der freundlichen Zuwendung meiner verwitweten Zimmerwirtin – Madame la Baronne – verdanke ich viel. Ich freundete mich mit ihren Söhnen an, Christian und Bernard, und zog – obwohl ich mein Reisegeld ja eigentlich nicht zum Skifahren geschickt bekam – bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die Berge hinauf. Wie ich bald herausfand, war es einer der besten Wege, mein Französisch zu verbessern, mich selbst als „Lehrer“ zu betätigten: Ich half Marie-Louise, der kleinen Schwester meiner beiden Kameraden, bei ihren Hausaufgaben und wiederholte die Übungen in ihrem Lehrbuch dann für mich selbst. Marie-Louise, die von allen in der Familie nur Choupette gerufen wurde – „Süße“ oder „Püppchen“ etwa –, mag damals zwölf oder dreizehn Jahre alt gewesen sein. Eines Tages sollte sie ein Sonett aus dem 16. Jahrhundert auswendig lernen:
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge.
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m’est une province, et beaucoup davantage?
Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux
Que des palais Romains le front audacieux:
Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine.
Plus mon Loir [sic] gaulois que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré que le Mont Palatin
Et plus que l’air marin la douceur angevine.
GLÜCKLICH, wer wie Odysseus eine schöne Reise
Machte oder der Mann, der einst das Vlies errang
Und wiederkam, erprobt und voller Weisheit, lang
Zu leben für den Rest nur im vertrauten Kreise!
Wann seh ich wieder, ach, in meinem Dorf aufsteigen
Den Rauch übern Kamin? In welcher Jahreszeit
Seh ich den Garten dort, mein armes Haus – bereit
Für mich Provinz zu sein, viel mehr noch: ganz mir eigen?
Ich liebe mehr den Ort, wo meine Väter wohnten,
Als die Paläste Roms mit ihren kühnen Fronten,
Statt harten Marmors sagt mir feiner Schiefer zu,
Mein kleiner gallischer Loir statt des Lateiners Tiber,
Mehr als der Palatin ist mir mein Hügel lieber,
Statt Salz und Meereswind – die Sanftheit des Anjou.18
Der Dichter dieser Zeilen, Joachim du Bellay, hatte die lange Reise aus seiner Heimat – dem Anjou im Westen Frankreichs – nach Rom auf sich genommen und litt nun unter schrecklichem Heimweh – ganz wie ich selbst bisweilen in Grenoble. – Was wohl Choupette heute macht …?
Odysseus – oder „Ulysses“, wie du Bellay und die Römer ihn nannten – ist natürlich der Archetyp des europäischen Wanderers. Homer hat ihn zum Helden des zweiten Ur-Klassikers der europäischen Literatur gemacht. Odysseus (was womöglich so viel bedeutet wie „der Sorgenvolle“) war als Veteran des Trojanischen Krieges von der tückischen Nymphe Kalypso auf deren Insel festgesetzt worden und kehrte erst nach zehn langen Jahren voller gefährlicher Abenteuer in seine Heimat auf der Insel Ithaka zurück. Homers epischer Bericht von diesen Abenteuern umfasst genau 12 110 Verse im daktylischen Hexameter. Meine eigene Ausgabe der Odyssee – eine englische Prosaübertragung – habe ich zu einer Zeit gekauft, als man mir mit einigem Druck nahelegte, ich solle mich doch für den auserlesenen Kreis derer bewerben, die an meiner Schule Griechisch lernten. Die HomerÜbersetzung fand ich dann allerdings – leider! – alles andere als spannend. „Schon hatten alle Überlebenden des Krieges den Weg in die Heimat gefunden“, begann sie ganz nüchtern, „und so die Gefahren von Schlachtfeld und Seefahrt hinter sich gelassen …“19 Vielleicht wäre mein Enthusiasmus größer gewesen, hätte mir nur jemand von der viel älteren Übersetzung George Chapmans (1559–1634) erzählt, eines Zeitgenossen Shakespeares, der nur ein Jahr vor dem Tod Joachim du Bellays geboren wurde. Dann hätte mich womöglich auch jener glühende Eifer gepackt, den John Keats in seinem Sonett On First Looking into Chapman’s Homer („Als er zum ersten Mal in Chapmans Homer las“) so trefflich beschrieben hat:
Much have I travelled in the realms of gold,
And many goodly states and kingdoms seen;
Round many western islands have I been
Which bards in fealty to Apollo hold.
Oft of one wide expanse had I been told
That deep-brow’d Homer ruled as his demesne;
Yet did I never breathe its pure serene
Till I heard Chapman speak out loud and bold …
Viel goldene Lande schon hab ich durchreist,
Glänzende Macht und Herrschaft sah ich viel;
Im Westen manches Eiland fand mein Kiel,
Freistatt den Dichtern nach Apolls Geheiß.
Oft kam von einem Großreich mir die Kunde,
Dort, hieß es, herrscht mit hoher Stirn Homer;
Doch spürt’ ich seine reine Luft nicht eher
Als Chapmans Kraft mir sprach mit kühnem Munde …20
Chapmans Homer-Übertragung aus dem 17. Jahrhundert, von der Keats so begeistert war, ist in kunstvollem Paarreim gehalten, wobei jeder Einzelvers zehn Silben zählt. Die berühmte Eröffnung der Odyssee („Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes …“) klingt bei Chapman demnach so:
The Man (O Muse) informe, that many a way
Wound with his wisedome to his wishèd stay;
That wanderd wondrous farre when He the towne
Of sacred Troy had sackt and shiverd downe.
The cities of a world of nations,
With all their manners, mindes and fashions,
He saw and knew; at sea felt many woes,
Much care sustaind, to save from overthrowes
Himselfe and friends in their retreate for home …21
Nachdem ich das Griechische also törichterweise verschmäht hatte, blieb meine klassische Bildung auf das Lateinische beschränkt, dessen erhabene Perioden und imposantes grammatisches Innenleben ich bald bewundern lernte. Nach kurzer Zeit hatten wir uns genug sprachliches Rüstzeug angeeignet, um mit Vergils Aeneis bekannt gemacht zu werden, die ich allerdings eher mit Ehrfurcht denn mit mühelosem Verständnis las – und nicht selten griff ich auf die willkommene Hilfe eines zweisprachigen „Spickers“ zurück:
Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
Italiam fato profugus Laviniaque venit
litora, multum ille et terris iactatus et alto
vi superum saevae memorem Iunonis ob iram,
multa quoque et bello passus, dum conderet urbem
inferretque deos Latio, genus unde Latinum
Albanique patres atque altae moenia Romae.22
Waffentat künde ich und den Mann, der als erster von Troja,
schicksalgesandt, auf der Flucht nach Italien kam und Laviniums
Küsten, viel über Lande geworfen und wogendes Meer durch
Göttergewalt, verfolgt vom Groll der grimmigen Juno,
viel auch duldend durch Krieg, bis er gründe die Stadt und die Götter
bringe nach Latium, dem das Geschlecht entstammt der Latiner,
Albas Väter und einst die Mauern der ragenden Roma.23
All diese Texte und Schreibweisen übten einen nachhaltigen Einfluss auf die abendländische Literatur aus. Der bedeutendste unter den vielen Erben und Nachfolgern Homers und Vergils war fraglos Dante Alighieri (1265–1321), dessen tatsächlich göttliche Göttliche Komödie (Divina Commedia) mir noch bevorstand; während meines Studiums in Oxford sollte sie das Herzstück eines vertiefenden Prüfungsmoduls über „Das Zeitalter Dantes“ bilden. Dantes Vision von einer spirituellen Reise durch das Jenseits verdankte sich einer christlichen Perspektive, die seine heidnischen Vorläufer Homer und Vergil selbstverständlich nicht teilen konnten. Dennoch tritt der Florentiner in das große Triumvirat der Seelenreiseführer. Dante nennt Vergil lo mio maestro e ’l mio autore – seinen „Meister und Urheber“, weshalb er ihn auch als seinen Lotsen auf dem ersten Abschnitt der Reise ins Paradies verpflichtet.
Über all diesen inneren wie äußeren Abenteuern und Erkundungsfahrten wurde mir immer deutlicher bewusst, dass zum Reisen mehr gehört als der bloße Ortswechsel von A nach B. Tatsächlich geht es im ganzen Prozess der Erziehung nur einerseits um den Unterricht im Klassenraum und das Studieren schlauer Bücher; genauso wichtig sind jedoch jene prägenden Einflüsse, denen die Lernenden in einer neuen Umgebung ausgesetzt sind, die ihre Wahrnehmung anregt. Zunächst hätte ich also ohne Weiteres dem Leitsatz zugestimmt, der da besagt – vermeintlich unbestreitbar –, dass „Reisen bildet“. Ich hätte auch Mark Twain zugestimmt, der, selbst ein ausgewiesener Weltenbummler, das Folgende schrieb: „Reisen ist für Vorurteile, Bigotterie und Engherzigkeit lebensgefährlich, und viele unserer Leute benötigen es aus diesem Grunde dringend. Umfassende, gesunde und nachsichtige Vorstellungen von Menschen und Dingen kann man nicht dadurch erwerben, dass man sein ganzes Leben lang in einer kleinen Ecke der Welt vegetiert.“24
Heute bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. In einer Welt, in der das Reisen viel von seinen früheren Beschwernissen – körperliche wie geistige – verloren hat, trifft man Menschen, die Tausende von Kilometern fliegen, nur um in Dubai ein wenig zu shoppen, in Bali am Strand zu liegen oder in Adelaide ein Cricket-Match anzusehen. „Dreimal bin ich schon auf den Galapagos-Inseln gewesen“, hat mir eine augenscheinlich betuchte amerikanische Dame einmal auf einem Langstreckenflug anvertraut, „und ich weiß überhaupt nicht, wo ich als Nächstes noch hin soll!“ Was lernen solche Leute, wenn sie reisen – von leichten Temperaturschwankungen und der nicht zu unterschätzenden Aufgabe, sich auf unterschiedlichen Flughäfen zurechtzufinden, einmal abgesehen? Manche Reisenden legen enorme Entfernungen zurück, ohne dass auch nur ein einziges ihrer sorgsam gehüteten Vorurteile dabei zu Bruch ginge. Reisen bildet – das mag sein, aber leider Gottes bildet es nicht automatisch: „Geht der weise Mann auf Reisen, kommt er weiser wieder her;/Will der Narr das auch beweisen, kommt er wieder närrischer“ – da hat der Volksmund nicht ganz unrecht.
Erst kürzlich las ich, dass einer der frühesten Pioniere der Reiseschriftstellerei, der italienische Renaissancedichter Francesco Petrarca, vor fast siebenhundert Jahren zu demselben Schluss gelangt ist. Im Jahr 1336 bestiegen Petrarca und sein Bruder nämlich – was zur damaligen Zeit absolut unerhört war – den Mont Ventoux in der Provence, woraufhin der Dichter in einem Brief an einen Freund seine Eindrücke von dieser Exkursion festhielt. Bei dem Aufstieg hatte er ein Exemplar von Augustinus’ Bekenntnissen (Confessiones) bei sich und las auf dem Gipfel eine passende Passage daraus: „Und da gehen die Menschen hin“, schreibt Augustinus da, „und bestaunen die Gipfel der Berge, die ungeheuren Fluten des Meeres, die breiten Wasserfälle der Flüsse, die Größe des Ozeans und die Bahnen der Sterne, aber sie vergessen dabei sich selbst …“ – über sich selbst staunen die wenigsten.25 Petrarcas Besteigung des Mont Ventoux am 26. April 1336 ist auch als der „Eröffnungstag der Renaissance“ bezeichnet worden.26 Petrarca selbst jedenfalls war regelrecht entrüstet, weil einige Bekannte, die er zu der Wanderung eingeladen hatte, diese einmalige Chance nicht ergreifen wollten: Seiner Meinung nach ließen sie eine frigida incuriositas erkennen, eine „kühle Teilnahmslosigkeit“ und Mangel an Neugier.27
Der vollständige Name von Bolton in Lancashire, der vormals unabhängigen Stadt, in der ich geboren wurde und aufgewachsen bin, ist „Bolton-le-Moors“, was von der mittelalterlichen Stadtpfarrei gleichen Namens herrührt. (Dass Bolton inzwischen vom Großraum Manchester „geschluckt“ wurde, ist im Übrigen fast so unbegründet wie Putins Annexion der Krim.) Als junger Bursche habe ich viele glückliche Tage damit zugebracht, über die Heidelandschaft rund um Bolton zu streifen (die moors aus dem mittelalterlichen Stadtnamen), dabei die Kraft in meinen Beinen zu spüren, mich in Nebel und Regen zurechtzufinden – und über den „richtigen Weg“ für das Leben im Allgemeinen nachzusinnen.
An lauen Sommerabenden konnte man den Rivington Pike erklimmen, einen hohen Hügelkopf am Rand des Heidelandes, und zusehen, wie die Sonne in der fernen Irischen See versank. Meist war dann auch die Spitze des Blackpool Tower zu sehen, 40 Meilen – gut 65 Kilometer – entfernt, am anderen Ende der flachen Halbinsel Fylde. Und wenn dann der Lichteinfall und die Luftfeuchtigkeit genau richtig waren, konnte man am Horizont gerade so auch noch die dunklen Umrisse der Isle of Man ausmachen. Das war für mich damals „der Westen“. Irgendwo hinter dem Horizont lag Irland, hinter Irland der Atlantik und jenseits des Atlantiks – Amerika! Über viele Jahre hinweg verlockte mich jedoch nichts, über das Meer nach Westen zu gehen. Und auf der Isle of Man bin ich bis heute nicht gewesen.
Wenn ich nun also auf dem Gipfel des – immerhin rund 360 Meter hohen – Rivington Pike hockte, neben dem Aussichtsturm und mit Blick auf einen feuerroten Sonnenball, der langsam im dunklen Wasser versank, dann gab mir das zugleich Gelegenheit, ein wenig über meinen eigenen Ort in der Galaxis nachzudenken. Natürlich war es verlockend, dem jahrtausendealten Denkfehler der Menschheit nachzugeben und zu glauben, dass es die Sonne war, die sich bewegte, während ich selbst, der Aussichtsturm neben mir und der Hügel, auf dem er stand, an Ort und Stelle blieben. Aber irgendwann hatte ich einmal im Schulunterricht von jener großen Entdeckung gehört, die mit dem Namen Nikolaus Kopernikus verbunden ist: dass nämlich die Erde um eine statische Sonne kreist. Tatsächlich raste ja nicht nur die Erde mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne, sondern drehte sich gleichzeitig um ihre eigene Achse, was uns den Wechsel von Tag und Nacht bescherte. Und das mit einem geradezu höllischen Tempo: Auf etwa 53 Grad nördlicher Breite fuhr Rivington Pike (mit mir, dem Turm und der gesamten Erdoberfläche samt Atmosphäre) mit einer Geschwindigkeit von gut 965 Kilometern pro Stunde durch das All. Das konnte man zwar nicht spüren; aber wenn der Wind einem ins Gesicht blies, konnte man sich den Luftwiderstand der Atmosphäre wenigstens vorstellen. Und schloss man die Augen, dann fiel es nicht schwer, sich auszumalen, was „wirklich“ geschah: Ihrer vermeintlichen Bewegung zum Trotz hing die Sonne vollkommen still an ihrem Ort, während der Hügel samt Besatzung in einer weiten elliptischen Flugbahn durch das All auf und davon brauste. Ohne es direkt wahrnehmen zu können, war ich der Reiter einer gewaltigen planetaren Doppel-Schubbewegung – einer größeren um die Sonne, einer kleineren um die Erdachse. Das Einzige, womit man das vielleicht noch vergleichen konnte, waren die komplexen Dreh- und Schraubbewegungen auf den blinkenden Fahrgeschäften, die bei der alljährlichen Neujahrskirmes von Bolton die Hauptattraktion ausmachten. Dort gab es ein großes Karussell, das sich um einen Mittelpfosten drehte, während die einzelnen Gondeln – wir nannten sie „Wirbler“ – zugleich um ihre eigene Achse rotierten.
Wesentlich häufiger jedoch zog es mich nicht nach Westen, sondern in die entgegengesetzte Richtung, und dann stürzte ich mich in die wilden, geheimnisvollen Heidemoore im Landesinneren. Wenn ich an der Ostflanke des Winter Hill stand, konnte ich mühelos den Peel Tower auf dem Holcombe Hill bei Ramsbottom ausmachen sowie, etwas weiter entfernt, das düstere Band der Blackstone Edge, einer langgezogenen Felswand aus dunklem grobem Sandstein, die an der Grenze zwischen Lancashire und Yorkshire liegt. Bevor die Ära der Autobahnen anbrach, war Yorkshire, dessen Einwohner damals noch allgemein als „Tykes“ bekannt waren, eine seltsame und wenig zugängliche Gegend, wo die Leute nur mit Grabesstimme sprachen und aus Prinzip in der Mitte der Straße fuhren. Das war – für mich, wohlgemerkt – die Exotik des „fernen Ostens“. Jenseits von Yorkshire lag die Nordsee und am anderen Ufer der Nordsee, wie ich wusste, das europäische Festland. Wenn Rivington Pike also mein persönlicher Sonnenuntergangs-Tempel war, dann war der Osthang des Winter Hill das Observatorium des Sonnenaufgangs. Man konnte dort herrlich zwischen Heidekraut und Grasbüscheln sitzen, den Lerchen und den Brachvögeln lauschen und dem noch jungen Tag bei seinem allmählichen Anwachsen zusehen, bis er alle Höhenzüge und Täler der Pennines – Englands gebirgigem Rückgrat – im hellen Sonnenlicht gebadet hatte.
Das also war das Wunderland meiner Kindheit und Jugend. Es gab keinen besseren Ort, um sich in Zeit und Raum zu orientieren – und das alles direkt vor meiner Haustür! Ich stieg einfach in den Bus Nummer 19 oder 20 nach Doffcocker (oder noch weiter hinauf bis nach Montserrat) und stiefelte dann entlang der alten Straße nach Chorley an den Zäunen der Schafweiden vorbei. Unten sah ich den gewaltigen Moloch der alten Industriemetropole Manchester liegen, wo Millionen von Menschen zusammengepfercht waren. Vor mir jedoch lockten der klare, offene Himmel, eine leichte Brise, die von den Hügeln strich, und die Leere – selige, vollkommene Leere. Nach etwa einer Meile bog ich auf den Pfad ab, der gegenüber dem Pub Jolly Crofters am Bottom o’th‘ Moor zum Steinbruch hinaufführt, dann immer weiter hinauf zwischen Trockensteinmauern, bis ich, vor Anstrengung und freudiger Erwartung schon leicht außer Puste, auf die hohe, windgepeitschte Heide hinaustrat – als Herr über alles, was ich sah.
Schon früh war mir bewusst, dass meine Freiheit, nach Lust und Laune über Moor und Heide zu streifen, ein Privileg war, das es während der Kindheit meines Vaters beispielsweise noch gar nicht gegeben hatte; und in der Tat waren meine eigenen jugendlichen Ausflüge, wenn man es ganz genau nimmt, illegal. Bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein blieben die braven Bürger von Bolton gezwungenermaßen zu Hause hocken, bis sie im Qualm ihrer eigenen Kohleöfen beinah erstickten, denn die Familie Bridgeman (geadelt mit dem Titel der Earls of Bradford), der das Heideland rund um die Stadt gehörte, wollte dieses als Jagdrevier für Moor- und Rebhühner der Öffentlichkeit vorenthalten. Das Thema lag auch William Cobbett sehr am Herzen. Zu seiner Zeit konnte man für das widerrechtliche Erlegen eines Stücks Federwild nach „Van-Diemens-Land“ deportiert werden – in das heutige Tasmanien –; auf Widerstand gegen den Wildhüter stand gar die Todesstrafe. Cobbetts Entrüstung ist also vollkommen gerechtfertigt:
Es heißt (und ich glaube es aufs Wort), dass in England eine größere Zahl von Männern wegen Verstößen gegen die Jagdgesetze inhaftiert sei, als in Frankreich (mit seiner mehr als doppelt so großen Bevölkerung) wegen aller möglichen Verbrechen zusammengenommen. Als sich ob der an den Priestern und den hohen Herren Frankreichs verübten Grausamkeiten ein lauter Aufschrei erhob …, musste Arthur Young bloß daran erinnern, welche Grausamkeiten unter dem Deckmantel des Jagdrechts am [französischen] Volk verübt worden waren: Wie viele hatte man nicht zu Galeerensklaven gemacht, weil sie Rebhühner, Fasane oder Hasen getötet oder ihnen auch nur nachgestellt hatten!28
Nachdem dann ein neues Jagdgesetz, der Game Act von 1831, erlassen worden war, der sowohl die Registrierung aller Wildhüter als auch feste Schonzeiten für das Wild vorsah, verlegte der Protest sich eher auf Problembereiche wie das Zugangs- und Wegerecht sowie die entsprechenden Strafen für das unbefugte Betreten von Privatgrund.
Ich bin durchaus stolz darauf, dass mein Onkel Don – Donnie Davies, der Cricketspieler und Journalist, der bei dem großen Flugunglück von München im Februar 1958 ums Leben kam – bei den Massenprotesten, die schließlich zur Öffnung der Pennines rund um Bolton für die Allgemeinheit führten, eine entscheidende Rolle gespielt hat. Bereits 1910 – da war er gerade achtzehn Jahre alt – errichteten er und seine Mitverschwörer unter fadenscheinigem Vorwand ein Mahnmal an dem uralten Pfad, der über den Winter Hill führt. Irgendwo in den Akten hatten sie den Fall eines schottischen Kesselflickers namens George Henderson aufgetan, der auf der Heide von Rivington Moor im November 1838 „meuchlings ermordet“ worden war – und bekamen doch tatsächlich die Genehmigung, dem armen Mann ein Denkmal zu setzen: „Zum ewigen Gedenken an …“ Unter den gestrengen Blicken von Polizisten und Wildhütern mühten die geschichtsbeflissenen jungen Männer sich den steilen Pfad hinauf, der von Belmont aus bergan führt; ein Esel zog den Karren mit dem schweren Pfosten aus Gusseisen, an dem die Plakette angebracht werden sollte. Doch kaum war Scotchman’s Stump – „der Schottenstummel“, wie das Denkmal noch heute im Volksmund heißt – fest in seinem Fundament verankert, kaum hatte die eigentliche Zeremonie zu seiner Enthüllung begonnen, da erschienen entlang der Kuppe des Moores Hunderte wild entschlossener „Trauergäste“, deren schiere Anzahl die Ordnungskräfte völlig überforderte. Gegen eine Handvoll Demonstranten wurde ein Ordnungsgeld wegen unbefugten Betretens verhängt, aber von einem Zutrittsverbot für unbescholtene Spaziergänger war nach diesem Vorfall nie wieder die Rede. Andernorts in England dauerten ähnliche Kampagnen noch sehr viel länger. Der größte Fall von massenhaftem – wiewohl friedlichem – Hausfriedensbruch wurde 1932 auf der Hochebene von Kinder Scout in Derbyshire organisiert. Gesetzlich verankert wurde das „Recht auf freies Umherstreifen“ aber erst mit dem Countryside and Rights of Way Act („Gesetz über Landschaftsnutzung und Wegerechte“) aus dem Jahr 2000.
Bei meinen Streifzügen über Moor und Heide gewöhnte ich mir zudem an, den Fakten und Ereignissen der Lokalgeschichte nachzuspüren, was vielleicht half, einen untergründig bereits angelegten, detektivischen Spürinstinkt weiter auszubilden. Wohin ich auch kam, fragte ich mich schon bald (und mit völliger Selbstverständlichkeit) nicht nur: „Was kann ich sehen?“, sondern ich begann, auch über das nachzudenken, was nicht mehr sichtbar war – jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Das faszinierte mich: Dinge zu entdecken, die früher einmal dagewesen, aber inzwischen nur mit Mühe noch erkennbar waren.
Das römische Britannien, für das man im England meiner Kindheit wohl eine gewisse „imperiale Affinität“ empfand, hat in Lancashire nur wenige Spuren hinterlassen. An den Ursprüngen der Stadt Manchester steht das Römerlager Mancunium, von wo ein Fächer von Pflasterstraßen in Richtung der nördlichen Grenze ausstrahlte. Mein Vater fuhr mit uns einmal nach Affetside, wo wir uns die kärglichen Überreste einer dieser Straßen, der in unserer Gegend sogenannten Watling Street, anschauen sollten. Gut 40 Kilometer weiter nördlich lag am Ufer des Flusses Ribble eine bedeutende römische Wehrsiedlung namens Bremetannicum Veteranum, das heutige Ribchester. Ein silberner Reiterhelm, der dort gefunden wurde, befindet sich heute im Britischen Museum in London.29
Zwar verließen die römischen Legionen Britannien im Jahr 410 unserer Zeitrechnung, doch die anschließende Migrationswelle der „angelsächsischen“ Invasoren hat unsere Gegend an der nordwestlichen Küste wohl erst mit einiger Verzögerung erreicht. Früher glaubte ich fälschlicherweise, der Name eines winzigen Dörfchens in der Nähe von Bolton – Anglezarke, das heute von Stauseen für die Wasserversorgung von Liverpool umgeben ist – sei ein Beleg für das frühe Eintreffen der Angeln. Wie sich herausstellte, lag ich mit meiner Herleitung des Namens falsch – aber immerhin damit hatte ich recht, dass sie irgendwann doch eintrafen und ihre Kultur mitbrachten.
Da sowohl die Römer als auch die Angeln in unsere Gegend eingewandert waren, habe ich mir über die Identität der „echten Eingeborenen“ von Lancashire lange Zeit den Kopf zerbrochen. Wenn sie weder Latein noch Angelsächsisch sprachen – wer waren sie dann? Als Träger des urwalisischen Nachnamens „Davies“ hätte ich vielleicht schon etwas früher darauf kommen können … Die entscheidenden Hinweise geben uns zwei Hügel. Der eine heißt „Pendle“ und der andere, gleich hinter der Grenze nach Yorkshire gelegen, heißt „Pen-y-Ghent“. Pen- ist das walisische Wort für „Kopf“ oder „Gipfel“, und so verraten uns die beiden Namen, dass die „Ureinwohner“ von Lancashire – vor Römern und vor Angelsachsen – wohl keltischsprachige Britonen waren. Sie gehörten zu Wales lange bevor sie zu England oder zu Lancashire gehörten. Die Stadt Lancaster bezieht ihren Namen von der brythonischen (also keltischen) Bezeichnung für den heutigen River Lune, der wenige Kilometer hinter der Stadt in die Irische See mündet; und es ist nicht auszuschließen, dass große Teile der späteren Grafschaft Lancashire sich damals in den Grenzen des frühmittelalterlichen Königreichs Strathclyde befanden, dem Kingdom of the Rock, dessen Schwerpunkt entlang dem River Clyde im heutigen Schottland lag.30
Auch die angeblich so furchterregenden Wikinger haben mich immer fasziniert; schließlich bedeutet ja schon mein eigener Vorname, Norman, so viel wie „Nordmann“ oder eben „Wikinger“. Die Drachenschiffe der Männer aus dem Norden erschienen an den Küsten Britanniens erstmals am Ende des 8. Jahrhunderts; danach siedelten sie sich in Irland und im nördlichen Schottland an (das sie – aus ihrer Perspektive, versteht sich – Sutherland nannten, also „Südland“), in der Gegend von York und auch auf dem Gebiet der heutigen Grafschaft Cumbria. Irgendwann erfuhr ich einmal, dass „Anglezarke“ in Wahrheit auf das altnordische Anlafserg zurückgeht, was so viel bedeutet wie „Anlafs Hügelweide“. (In York regierte einst ein Wikingerkönig namens Anlaf Guthrisson.)
Auch die Normannen, die England im Jahr 1066 eroberten, waren ihrer Herkunft nach „Nordmänner“. Erst wenige Generationen zuvor hatten sie sich, aus Skandinavien kommend, im Norden Frankreichs – der Normandie eben – angesiedelt. Diese mittlerweile Französisch parlierenden Ritter teilten nun also die Äcker und Weiden Englands unter sich auf, und einer von ihnen, Harvey de Walter, ein enger Gefolgsmann von Wilhelm „dem Eroberer“, baute sich eine Burg auf einem Hügel nicht weit von Bolton. Seine Nachfahren führten daraufhin den Nachnamen „De Hoghton“ oder „Houghton“, also etwa „vom hohen Platz“. Einmal habe ich meine Mutter zu einem Ausflug nach Hoghton Tower genötigt; wir mussten etliche Male mit dem Bus umsteigen. Beweise für das Gerücht, Shakespeare hätte einmal auf der Burg Zuflucht gesucht, konnten wir jedoch keine finden – und so bleibt der Besuch von König Jakob I. im Jahr 1617, bei dem dieser (der Legende nach) ein besonders schmackhaftes Stück Rindfleisch als „Sir Loin“ zum Ritter geschlagen haben soll, das einzige geschichtliche Ereignis von nationaler Bedeutung, mit dem Hoghton Tower seitdem in Verbindung gebracht wird.
Die Bewohner des mittelalterlichen England waren demnach nicht annähernd so englisch, wie man uns immer glauben machen wollte. Bolton selbst wurde erstmals 1185 als „Boelton“ urkundlich erwähnt, aber ich habe nie herausfinden können, welche Sprache oder Sprachen die damaligen Old Boltonians wohl gesprochen haben. Das älteste Gebäude der Stadt, ein Fachwerk-Wirtshaus namens Ye Olde Man and Scythe („Zum Alten Schnitter“), ist zwar seit 1251 belegt, aber wer weiß schon, wann dort zum ersten Mal ausgeschenkt wurde – geschweige denn, welchen Namen das Wirtshaus damals trug.
Ein einschneidendes Ereignis der englischen Geschichte war natürlich die Reformation, und der traurige Anblick von Klosterruinen, die als letzte Überreste von der Aufhebung der Klöster unter Heinrich VIII. zeugten, hat mich immer tief bewegt. Als Kind habe ich die Broschüren gesammelt, die das damals für ihren Erhalt zuständige Bauministerium über die einzelnen Klöster veröffentlicht hat; ja, ich schrieb dafür sogar das Ministerium in London an, damit man sie mir zusandte. Die selbst noch als Ruinen großartigen Überreste von Bolton Abbey, die wir auch besucht haben, befinden sich jenseits der Grenze zu Yorkshire. Aber Furness Abbey, das war – trotz der etwas weiteren Entfernung – unser Kloster. Dort erfuhr ich, dass Lancashire eines der Zentren der Pilgrimage of Grace („Pilgerfahrt der Gnade“) gewesen war, eines großen Bauernaufstandes, der sich 1536/37 gegen die Abspaltung der englischen Kirche von Rom richtete. Bei uns im Norden blieb der Katholizismus im Geheimen stark. Eine Biografie des 1970 heiliggesprochenen katholischen Märtyrers Edmund Campion untergrub für mich den Mythos, dass England ein von Natur aus tolerantes Land sei.31
Das Elisabethanische Zeitalter – das letzte, bevor die Zusammenführung der englischen und der schottischen Krone sie zu „Briten“ machte – lieben die Engländer ganz besonders. In Bolton ist von dieser Blütezeit nicht viel zu sehen, ausgenommen vielleicht Teile von Smithills Hall, einem herrlich anzusehenden Tudor-Anwesen mit Fachwerkelementen. Gleichwohl wurden im Sommer 1588 auch auf dem Rivington Pike und anderswo in der Umgebung Signalfeuer entzündet, um vor dem Nahen der Spanischen Armada zu warnen.
Als dann 1642 schließlich der Englische Bürgerkrieg ausbrach, befand sich Bolton fest in der Hand von Cromwells puritanischer Parlamentspartei. Im Mai 1644 war die Stadt Schauplatz eines schrecklichen Massakers, bei dem zweitausend Einwohner von königstreuer Reiterei unter dem Prinzen Ruprecht von der Pfalz geradezu abgeschlachtet wurden. Nach Cromwells Sieg bezahlte der Wortführer der Royalisten am Ort, James, Earl of Derby, für dieses Blutbad mit seinem eigenen Leben. Bevor er auf dem Platz vor dem Wirtshaus enthauptet wurde, soll er sich im Old Man and Scythe ein letztes Mal gestärkt haben. Als meiner Grundschulklasse diese Geschichte erzählt wurde, standen wir alle wie versteinert neben der großen Säule mit dem Marktkreuz, nur wenige Schritte entfernt vom Schauplatz des Geschehens.
Die industrielle Revolution machte Großbritannien binnen Kurzem zur Weltmacht, und was ein echter Boltonian ist, der schwört Stein und Bein, dass dies alles in Bolton begann. Genauer gesagt ist Samuel Crompton (1753–1827), der Erfinder des spinning mule, einer frühen Spinnmaschine, der als einfacher Weber in dem alten, schwarz-weiß gezimmerten Fachwerk-Gutshof von Hall i’th‘ Wood begonnen hatte, in der Stadt so etwas wie ein Lokalheld. Als wir – wiederum auf einem Schulausflug – durch jenes altehrwürdige Haus geführt wurden, in dem Crompton einst seine Erfindung gemacht hatte, sagte man uns, dass zwar die Stadt Bolton dank seiner Spinnmaschine reich geworden, der findige Mann selbst jedoch im Armenhaus geendet sei.
Die familiären Wurzeln meiner Mutter reichten offenbar tiefer in die Stadtgeschichte von Bolton zurück als die meines Vaters – immerhin war ihr Mädchenname „Bolton“ gewesen. Mein Großvater mütterlicherseits, Edwin Bolton, war ein Steinmetz und Baumeister, der im Zuge der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren bankrott ging. Seine Frau, meine Großmutter Elizabeth Isherwood, kam aus einer Familie, über deren Vergangenheit nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wurde. In meiner Eigenschaft als Familienhistoriker kam ich der Wahrheit schließlich irgendwann auf die Spur: In den Unterlagen der Volkszählung von 1861 stieß ich auf einen Major James Slater, der mit dem Dienstmädchen Betty Isherwood unter einem Dach lebte – und zwar auf dem Anwesen der Familie Slater in Egerton ein Stück außerhalb der Stadt (wo übrigens auch der Bolton Wanderers F. C. gegründet wurde). Beider Sohn, James Slater Isherwood, genoss eine hervorragende Erziehung und wurde Anwalt, trank sich dann jedoch in ein frühes Grab. Daher rührten also der lebenslange Einsatz meiner Mutter für die Abstinenzlerbewegung, ihr Streben nach einem gottgefälligen Leben und ihre Zuneigung zu John Bunyan.
Die Ursprünge der Familie meines Vaters, der Davies’, sind sogar noch nebulöser. Mein Großvater väterlicherseits, Richard Samson Davies (1863–1939), war angeblich ein walisisch sprechender Waisenknabe, der im Alter von sechzehn Jahren eines Tages nach Manchester gewandert kam, mit einem Halfpenny in der Tasche und dem Kopf voller Mythen aus der alten Heimat. In der freikirchlichen Gemeinde von Pendleton lernte er Ellen Ashton kennen, die er bald darauf in derselben Kirche heiratete. Ihre Mutter war die unverheiratete Tochter eines Bergmanns. Zusammen verbrachten sie vierzig glückliche Jahre und zogen neun Kinder groß. Im Frühjahr 1901 marschierten sie die 10 Meilen (etwa 16 Kilometer) von Pendleton nach Bolton, mit ihrer ganze Habe in einem schweren Bollerwagen und mit ihren fünf ältesten Kindern im Schlepptau. Ihr sechstes Kind, mein Vater Richard, wurde wenig später in einem winzigen, mittlerweile abgerissenen Reihenhaus in der Ash Street geboren.
Und doch, diesen bescheidenen Anfängen zum Trotz: Die Davies’ kamen voran in der Welt. Großpapa stieg bis zum Geschäftsführer von Hodgkinson & Gillibrand auf, einer Strumpfwarenfabrik in der Lower Bridgeman Street – in Anbetracht seiner Herkunft eine geradezu erhabene Führungsposition. Er kaufte ein (frei stehendes!) Einfamilienhaus, das er nach seiner einstigen Waisenanstalt „Wigmore“ taufte; es war um einiges größer als alles, was ich mir später in dieser Hinsicht leisten konnte. Seine älteste Tochter, Lydia – meine „Tante Sis“ –, ging zum Studium nach Cambridge und sein ältester Sohn, Don, besuchte das traditionsreiche Gymnasium der Stadt, die 1514 gegründete Bolton Grammar School.
Wie die meisten britischen Familien hatten beide, die Davies’ wie die Boltons, unter dem Ersten Weltkrieg schwer zu leiden. Der zweitälteste Bruder meines Vaters, der wie ich Norman Davies hieß, kam im September 1918 um sein junges Leben; er war neunzehn Jahre alt und Pilot. Der älteste Bruder meiner Mutter, James Bolton, war Infanterist bei den Lancashire Fusiliers. Er starb an der Westfront am Morgen des 11. November 1918 – am Tag, an dem der Krieg zu Ende ging.
Neben dem prachtvollen Rathaus von Bolton, der 1873 erbauten Town Hall, war es natürlich der Bolton Wanderers Football Club, der die Herzen der Stadt mit Bürgerstolz füllte. Zusammen mit unserem „Nachbarverein“ Blackburn Rovers gehörten die Wanderers zu den Gründungsmitgliedern der englischen Fußballliga. In den Jahrzehnten vor dem Aufkommen des Fernsehens verwandelte sich ihr Heimatstadion, Burnden Park, einmal in der Woche in ein Fußball-Mekka, eine rein männliche Domäne. Mein Onkel Don, der als Amateur in der Nationalmannschaft spielte, trat dort an, bevor er zu Stoke City wechselte. (Eines seiner früheren Teams waren die „Northern Nomads“ gewesen.) Mein Großvater, Richard Samson, behauptete, er sei an der Außenwand des Wembley-Stadions in London hinaufgeklettert, um den Sieg der Wanderers beim legendären Meisterschaftsfinale von 1923 mitzuerleben. Ich selbst war dann in den Jahren nach 1945 auf der Stehtribüne von Burnden Park zu finden, wo ich all die „großen Namen“ jener Jahre spielen sah – Legenden wie Stanley Matthews, Tom Finney und Wilf Mannion. Der unerschrockene Boltoner Mittelstürmer Nat Lofthouse, der vor seiner Profikarriere in einer örtlichen Kohlengrube geschuftet hatte, war der Held meiner Kindheit.
Im frühen 20. Jahrhundert wurde das Leben in Bolton in vielerlei Hinsicht von den Aktivitäten des berühmtesten Sohnes der Stadt geprägt: dem Industriemagnaten William Lever (1851–1925), der später als Lord Leverhulme geadelt wurde und das Fundament für den noch heute bestehenden, international tätigen Konzern Unilever gelegt hat. Der edle Lord hatte sowohl die Freikirche in der St. George’s Road gestiftet, in der meine Eltern sich kennenlernten und zum Gottesdienst gingen, als auch die 1913 mit Abteilungen für Jungen und Mädchen neu gegründete Bolton School, an der ich selbst Schüler gewesen bin. Lever ist in einem kleinen Haus in der Wood Street geboren, dem Geburtshaus meines Vaters gar nicht unähnlich, und hatte den Grundstein für sein sagenhaftes Vermögen mit der Herstellung und dem Verkauf von Seife der Marke „Sunlight Soap“ gelegt. Als Kinder wurden wir allesamt mit dem Bus in die Nähe von Liverpool kutschiert, wo wir uns pflichtschuldigst das Modelldorf Port Sunlight anschauten. Dort war Levers größte Fabrik, und dort legten die Tanker von Levers Flotte an, die das Kokosöl von seinen Plantagen in Afrika herbeischafften. Vergleichsweise weniger bekannt ist Lord Leverhulmes extravagantes Landhaus, der sogenannte „Bungalow“ mit seinem japanischen Garten, beide mit herrlichem Ausblick über dem Stausee von Anglezarke gelegen. Der Bungalow wurde 1913 von militanten Suffragetten niedergebrannt und danach nicht wieder aufgebaut. Vierzig Jahre später, als ich über das Gelände streunte, konnte man sich noch immer in das völlig verwilderte Gestrüpp schlagen und die Hände voller exotischer Blüten wieder hinauskommen – Überreste der einstigen orientalischen Pracht. Wenn sich aus der Vergänglichkeit aller menschlichen Mühen überhaupt eine Lehre ziehen lässt, dann habe ich diese Lektion dort gelernt.
Mit meinem Aufstieg in die höheren Schulklassen zogen unsere Exkursionen immer weitere Kreise. Während die früheren Sommerlager des Boltoner Pfadfindertrupps Nr. 19 stets innerhalb Großbritanniens stattgefunden hatten, schickte man die Senior Scouts – also die vierzehn- bis achtzehnjährigen Pfadfinder – traditionell ins Ausland. Einem Vergleich mit den „Klassenfahrten“ des Jet-Zeitalters, bei denen die lieben Kleinen beinahe routinemäßig bis nach Nepal, Namibia oder Patagonien verfrachtet werden, hätten unsere Touren sicher nicht standgehalten; und doch waren sie nicht weniger aufregend oder herausfordernd. Innerhalb kurzer Zeit fand ich mich beim Zelten in Luxemburg wieder, wo wir rostige Helme ausgruben – Überreste der blutigen Schlacht in den Ardennen im Kriegswinter 1944/45; in einem Kanu, das die Loire hinabtrieb, während wir die Schlösser entlang des Flusses bestaunten; als Wanderer in den Kärntner Alpen nahe der jugoslawischen – heute slowenischen – Grenze; und beim Bergsteigen in Tirol, wo uns im Morgengrauen ein Bergführer auf den Dachsteingletscher brachte, der erst kurz zuvor aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt war. Dieser kräftige Tiroler erzählte uns seine Geschichte, während wir am Rand des Gletschers ein karges Frühstück zu uns nahmen. Das öffnete mir die Augen für die andere, mir zuvor völlig unbekannte Seite des Zweiten Weltkriegs. Als junger Bursche etwa in unserem Alter war er zur Wehrmacht eingezogen worden, bei Stalingrad in Gefangenschaft geraten und hatte in einem sibirischen Arbeitslager dem Tod ins Auge geblickt. Die meisten anderen Gefangenen hatten die Strapazen nicht überlebt. Gerettet hatten ihn seine robuste Konstitution sowie die Überlebenstechniken, die er schon in jungen Jahren gelernt hatte – und zwar in einer raueren Umgebung als dem Winter Hill.
Etwa um dieselbe Zeit begann ich auch, ein Notizheft zu führen, in dem ich meine Lieblingszitate festhielt. Dort finden sich bereits all die Autoren, die einen prägenden Einfluss auf mich hatten: Shakespeare, Hobbes, Michelet, Macaulay, Milton, Vidal de La Blache (der Begründer der Humangeografie), Bacon, Platon, Aristoteles, Gibbon, Augustinus, Blake, Byron, Shelley, Keats, Lamartine, Donne, Gray, Carlyle, Mill, Hazlitt und viele andere mehr. Einer der ersten Einträge, datiert „August 1955“, ist ein Cobbett-Zitat:
Gott hat uns das beste Land der Welt geschenkt; unsere tapferen und weisen und tugendhaften Vorväter … haben uns die beste Regierung auf der ganzen Welt geschenkt – und wir, ihre feigen und törichten und liederlichen Söhne, haben dieses einstige Paradies zu dem gemacht, als das es heute vor uns steht!32
Zum Zeitpunkt der letzten Einträge hatte ich gerade Gibbons monumentales Geschichtswerk vom Verfall und Untergang des Römischen Imperiums ausgelesen:
Wenn die christlichen Apostel, Petrus und Paulus, nach dem Vatikan zurückkehren könnten, dürften sie möglicherweise nach dem Namen der Gottheit fragen, die mit so geheimnisvoller Zeremonie in diesem prachtvollen Tempel verehrt wird …33
Beide Autoren schienen mir sagen zu wollen, dass es mit der Welt beständig bergab gehe.
Unweigerlich enthielt meine recht eklektische Sammlung von Gedichtbänden auch etliche Werke, die mit Reisen und insbesondere mit der Reise auf dem Lebensweg zu tun hatten. Wie so oft, sind auch in diesem Punkt die Beobachtungen Shakespeares von kaum zu überbietender Prägnanz:
Weary with toil, I haste me to my bed,
The dear repose for limbs with travel tired,
But then begins a journey in my head,
To work my mind when body’s work’s expired.
For then my thoughts (from far where I abide)
Intend a zealous pilgrimage to thee,
And keep my drooping eyelids open wide,
Looking on darkness which the blind do see …
Wenn ich, erschöpft von Mühsal, ruhen will,
die müden Augen fallen mir nicht zu;
ach, dann ist’s erst in meinem Kopf nicht still:
der Leib will Ruh, der Geist gibt keine Ruh.
Denn dich sucht bald er in der weiten Ferne,
in die es ihn mit frommem Sehnen zieht.
Vergebens aber leuchten Augensterne
durch jenes Dunkel, das der Blinde sieht …34
Es ist, als ob Shakespeare dreihundert Jahre vor Rainer Maria Rilke eine Einsicht gehabt hätte, die oft Rilke zugeschrieben wird: „Die einzige Reise ist die innere.“ Rilke, auf den ich erst viel später traf, hat überhaupt sehr wortgewaltig über den Effekt geschrieben, den das Reisen auf den Reisenden hat, etwa in seinem späten Gedicht Spaziergang:
Schon ist mein Blick am Hügel, dem besonnten,
dem Wege, den ich kaum begann, voran.
So faßt uns das, was wir nicht fassen konnten,
voller Erscheinung, aus der Ferne an –
und wandelt uns, auch wenn wirs nicht erreichen,
in jenes, das wir, kaum es ahnend, sind;
ein Zeichen weht, erwidernd unserm Zeichen …
wir aber spüren nur den Gegenwind.35
Robert Louis Stevenson (1850–1894), dessen Romane Die Schatzinsel und Entführt echte Lieblingsbücher meiner Jugend waren, kam als Reisender so weit herum, dass er nie wieder heimkehrte: Begraben liegt er auf einem Berggipfel der samoanischen Insel Upolu, weit draußen im Pazifik. Ferne Länder erfüllten ihn mit einer geradezu kindlichen Begeisterung, wie man in seinem Gedicht Travel („Das Reisen“) noch heute spüren kann:
I should like to rise and go
Where the golden apples grow;
Where below another sky
Parrot islands anchored lie,
And, watched by cockatoos and goats,
Lonely Crusoes building boats;
Where in sunshine reaching out
Eastern cities, miles about,
Are with mosque and minaret
Among sandy gardens set,
And the rich goods from near and far
Hang for sale in the bazaar …
Where are forests hot as fire,
Wide as England, tall as a spire,
Full of apes and cocoa-nuts
And the [native] hunters’ huts;
Where the knotty crocodile
Lies and blinks in the Nile,
And the red flamingo flies
Hunting fish before his eyes,
…
Where among the desert sands
Some deserted city stands,
All its children, sweep and prince,
Grown to manhood ages since,
Not a foot in street or house,
Not a stir of child or mouse,
And when kindly falls the night
In all the town no spark of light.
There I’ll come when I’m a man
With a camel caravan …
Wie gern ging ich, jetzt und gleich
nach der goldnen Äpfel Reich,
wo fern unter fremden Himmeln
Papageieninseln wimmeln
und wo – beäugt von Kakadus
und Ziegen – einsame Crusoes
still an ihren Booten schnitzen;
wo östlich-reiche Städte blitzen
in der Sonne, meilenweit,
mit Moscheen in Gärten breit;
wo Minarette prunken
und Flotten kleiner Dschunken
verführerische Waren bringen,
einen Basar von manchen Dingen …
Wo Wälder ragen, himmelhoch
und ewig fern, und schwüler noch;
voll Affenrasen, Kokosnüssen,
wo eingeborne [Jäger] grüßen;
wo das garst’ge Krokodil
liegt und blinzelt in dem Nil
und der Zwergflamingo fliegt,
weil Fischjagd ihm am Herzen liegt
…
Wo irgendwo im Wüstensand
einst eine Stadt (nun wüst) entstand,
deren Kinder – Bettler, Prinzchen –
schon lange nicht mehr Mann noch Kind sind;
in keiner Straße, keinem Haus
rührt sich Kind noch oder Maus.
Und wenn gütig dann die Nacht
heranbricht – nichts! Nicht eine Kerze wacht.
Dahin komm’ ich einst als Mann
per Kamelkarawane an …36
Charles Baudelaire (1821–1867), der, ähnlich wie Stevenson, sein Leben lang an diversen Krankheiten litt, war ebenfalls ein Wortschmied von beinah magischem Geschick. Immer wieder hörte ich als Student von seinen poetischen Heldentaten, meist von Freundinnen – Margaret, Helen oder Jenny –, die für moderne Fremdsprachen eingeschrieben waren. Mit seinem Gedichtband Die Blumen des Bösen (Les Fleurs du mal, 1857) handelte Baudelaire sich einen Gerichtsprozess wegen „Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit“ ein, und schon als junger Bursche war er von seinem Stiefvater auf eine lange Reise nach Indien geschickt worden, die seine angebliche Arbeitsscheu heilen sollte. Diese Erfahrung änderte zwar nichts an Baudelaires eigensinnigem Verhalten, aber er dachte doch gern und merklich begeistert daran zurück:
Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes,
L’univers est égal à son vaste appétit.
Ah! que le monde est grand à la clarté des lampes!
Aux yeux du souvenir que le monde est petit! …
Dites, qu’avez-vous vu?
Dem Kind verliebt in Stiche und Atlanten
Genügt das All zu Hungers Sättigung.
Wie groß sahn wir die Welt, wenn Lampen brannten,
Und, ach! wie klein sieht sie Erinnerung.
Ein Tag bricht an …im Hirne Flammen gaukeln …
Die Brust brennt Groll und Sehnens Bitterkeit …
Wir ziehn und tragen nach der Woge Schaukeln
Unendlich Herz in Meeres Endlichkeit.
…
Allein die echten Wandrer sind, die gehen,
Um fortzugehn; sie weichen nie vom Plan
Des Schicksals ab, und wenn die Winde drehen,
Ruft, unbewußt warum, ihr Herz: „Wohlan!“
…
Ein Segler nach Ikarien ist die Seele.
„Habt acht“, ruft einer von dem Mittelschiff.
Vom Mars ein andrer, Wahnsinn in der Kehle:
„Glück … Liebe … Ruhm!“ Zum Teufel, s’ist ein Riff …
…
Ihr mächtigen Wandrer, welche Abenteuer
Sehn wir auf eurer Augen Meeresgrund!
Tut auf den Schrein Erinnerns! Welch ein Feuer
Geschmeids aus Stern und Düften wird uns kund!
…
Was saht ihr denn! O sagt! …37
Auch ich war eines von jenen Kindern gewesen, von denen Baudelaire schreibt, „verliebt in Stiche und Atlanten“; auch ich war so begierig wie wohl jedes Kind gewesen, von den Abenteuern aus dem Erinnerungsschatz der Reisenden zu hören.
Als ich auf meinem Lebensweg dann, im Alter von zwanzig Jahren, endlich bei der Divina Commedia ankam, musste ich zu meiner Überraschung feststellen, dass Dante für Odysseus, den archetypischen Wanderer und Umherreisenden, einen Platz im achten Kreis der Hölle vorgesehen hat, wo der „Listenreiche“ seine Ewigkeit im Feuer fristet. In Dantes Kosmos konnte ein „Heide“ wie Odysseus eben keinen Zugang zu der reinigenden Sphäre des Purgatoriums erhalten – und zum Paradies natürlich erst recht nicht. Aber irgendwie empfindet man doch, dass Odysseus als einer der größten Helden des klassischen Altertums schon mit etwas mehr Nachsicht hätte rechnen dürfen. Aus diesem Grund hat Dantes strenges Urteil unter den Gelehrten denn auch für hitzige, endlose Debatten gesorgt. Wie sich nämlich herausstellt, war Odysseus, der ewige Unglücksrabe, überhaupt nicht wegen seines langen Umherirrens in Dantes Hölle gelandet, sondern wegen seiner früheren Beteiligung an der griechischen Kriegslist rund um das Trojanische Pferd. Zur Strafe ist er, in der Gesellschaft anderer „falscher Ratgeber“, zu ewigen Qualen verurteilt; die lodernde Flamme, in der er eingeschlossen sitzt, teilt er sich mit seinem Mitverschwörer Diomedes. Da die Römer sich als Abkömmlinge der Trojaner verstanden, waren die lateinischen Quellen zu diesem Sagenkreis – die Dante als einzige zur Verfügung standen – traditionell pro-trojanisch und anti-griechisch. Nach ihrer Ansicht – und nach der Ansicht Dantes – war der Trick mit dem Trojanischen Pferd das Paradebeispiel einer ehrlosen und zutiefst verwerflichen taktischen Hinterlist.
Und doch: Sobald der Grund für Odysseus’ missliche Lage erklärt ist, gesteht Dante ihm eine lange und sprachgewaltige Rede zu, in der er von seinen Reisen berichtet und auch auf die Motive zu sprechen kommt, die ihn einst dazu bewogen hatten, in See zu stechen. Vor allem anderen war er aufgebrochen, sagt Odysseus, um die Welt zu entdecken und ihre Bewohner kennenzulernen:
Ne dolcezza di figlio, ne la pietà
del vecchio padre, ne il debito amore
lo quale dovea Penelope far lieta
vincer poeter dentro da me l’ardore
ch’i‘ ebbi a divenir del mondo esparto
e delli vizi umani e del valore
ma misi per me per l’alto mare aperto
sol con un legno e con quella compagna
picciola da la qual no fui diserto …
Nicht väterlich, nicht kindlich Sehnsuchtwehe
Nach Sohn und Vater, nicht daß Pflicht der Liebe
Mir um Penelope zu Herzen gehe
Nichts dämpfte mir die glühenden Wandertriebe
Um Länder, Meer und Menschen zu erkunden,
Daß fremd mir Laster nicht noch Tugend bliebe.
Mit kleiner Mannschaft, längst als treu befunden
Mit einem Schiff nur gings hinaus die Pfade
Ins offene weite Meer zu fremden Sunden …38
Und „Länder, Meer und Menschen“ gleich auf einmal „zu erkunden“ – das ist doch kein kleines Ziel.
Wenig später – Odysseus hat gerade berichtet, wie er mit seinen Gefährten die Säulen des Herkules im äußersten Westen erreichte – gibt er auch noch die Anfeuerungsrede wieder, die er seiner zweifelnden Besatzung an diesem Halbzeitpunkt der abenteuerlichen Reise gehalten hatte:
O frati, dissi, che per cento milia
perigli sieti giunti all’occidente
a questa tanto picciola vigilia
d’i nostri sensi ch’è del rimanente
non vogliate negar l’esperïenza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e conoscenza.
„O Brüder, bis zum fernen Okzidente
Brachten euch,“ sprach ich, „tausend Abenteuer;
Drum folgt, solang noch irgend in euch brennte
Der Sinnenkräfte letztes Abendfeuer,
Mir ferner nach zu unbewohnten Welten:
Dem Lauf der Sonne folge unser Steuer.
Bedenkt, aus welcher Saat entkeimt wir gelten!
Und strebten wir nach Tugend nicht und Wissen,
So dürfte man mit Recht uns Tiere schelten!“ – 39
Klarer und deutlicher kann man es nicht sagen: Wir reisen, um nach Tugend und nach Wissen zu streben, und weil wir das volle Potenzial unserer Menschlichkeit ausschöpfen wollen.
Nach diesen Vorstößen in die Welt der romanischen Sprachen, die ich im Schulunterricht erstmals erkundete, wandte ich mich Schritt für Schritt in Richtung Osten und brach zu einer neuen Reise auf, auf der ich mich bis heute befinde: meiner Reise durch die slawische Welt. Oft habe ich mich gefragt, ob es nun durch irgendeinen Instinkt oder durch meine freie Wahl so gekommen ist. Fast wäre ich schon mit achtzehn aufgebrochen. Ich hatte mich damals als Wehrpflichtiger melden müssen und unter den verschiedenen Möglichkeiten, meinen Dienst abzuleisten, für eine Bewerbung bei der britischen Marine, der Royal Navy, entschieden, weil ich gehört hatte, dass dort Russisch-Intensivsprachkurse angeboten wurden. Doch Matrose wurde ich nie, denn die Wehrpflicht wurde abgeschafft, bevor ich meinen Einberufungsbescheid erhalten hatte. Stattdessen stellte ich nach meinem Studienbeginn in Oxford fest, dass die Einsteigerkurse der russischen Sprache, die am Oxforder Polytechnikum (der heutigen Oxford Brookes University) angeboten wurden, auch den Studenten der Universität Oxford offenstanden. Finanziert wurde das Ganze von dem schillernden Verleger und Parlamentsabgeordneten Robert Maxwell, der sich daraus einen Vorteil für seinen Verlag, die Pergamon Press, versprach. Maxwell, der als Ján Ludvík Hoch in der Tschechoslowakei geboren worden war und später als the Bouncing Czech* bekannt wurde, war in alle möglichen zwielichtigen Geschäfte verwickelt, darunter viele, die hinter dem Eisernen Vorhang abliefen. Seine Pergamon Press diente ihm dazu, wissenschaftliche und technische Fachbücher und -zeitschriften aus dem Ostblock nachzudrucken, die zu diesem Zweck natürlich übersetzt werden mussten. Ab und an lud er uns, die angehenden Sprachkundigen von gegenüber, zu einem Umtrunk in seine Villa, Headington Hill Hall, ein. Auf diese Weise machte ich also meine ersten Schritte auf dem „slawischen Pfad“, der mich schließlich – nach etlichen Windungen und Wendungen, bald rascher, bald mit Verzögerungen – zu einem zweiten Studienabschluss in Russistik an der Universität Sussex führen sollte.
Zwischenzeitlich hatte ich mich jedoch, während meiner ersten langen Semesterferien in Oxford, dreien meiner früheren Schulkameraden angeschlossen, die einen gebrauchten Jeep der U.S. Army erstanden hatten und nun eine Überlandfahrt bis in die Türkei planten. Ich hatte gerade, wie schon erwähnt, Gibbon gelesen und war begierig, die Theodosianische Mauer von Byzanz mit eigenen Augen zu sehen. Europa war seit Neuestem durch den Eisernen Vorhang geteilt, und die Straße nach Istanbul führte geradewegs durch den Ostblock. Es war ein unvergessliches (und wohl auch riskantes) Erlebnis, auf der vollkommen ausgestorbenen Straße nach Osten aus Wien hinauszufahren, festzustellen, dass jegliche Wegweiser Richtung Budapest abmontiert worden waren, die Dreifach-Barriere aus Panzersperren, Wachttürmen und Stacheldraht zu passieren und schließlich zu hören, wie die riesigen Stahltore laut dröhnend hinter uns zufielen. Wie leicht hätten wir spurlos verschwinden können! So, wie es dann kam, kehrten auch wir „nach tausend Abenteuern“, aber schließlich eben doch, irgendwie, unversehrt von unserer Reise zurück. Und im Gepäck hatten wir bei unserer Heimkehr das Wissen, dass die östliche Hälfte unseres Kontinents randvoll war mit faszinierenden – aber verbotenen – historischen Früchten.
Im Frühjahr 1962 fand ich mich, nachdem eine Studienfahrt nach Moskau, zu der ich mich eigentlich angemeldet hatte, von den sowjetischen Behörden – in letzter Minute und ohne Angabe von Gründen – abgesagt worden war, vollkommen ungeplant plötzlich in Polen wieder, einem Land, von dem ich offen gestanden nichts wusste. Die hoch- und ehrwürdige Geschichtsfakultät der Universität von Oxford hatte es doch tatsächlich versäumt, uns auch nur das Geringste über die dreitausendjährige Geschichte Polens beizubringen! Schon aus Scham begann ich umgehend, mir die notwendigen Grundlagen im Selbststudium anzueignen. Diese wenig verheißungsvollen Anfänge führten schließlich nicht nur dazu, dass ich an der Jagiellonen-Universität in Krakau meinen ersten Doktortitel erwarb, sondern auch zu engen, persönlichen wie familiären Verbindungen nach Polen, die mich mein Leben lang begleitet haben – und nicht zuletzt zu einer Karriere als Forscher und Schriftsteller, die sich zunächst auf polnische Themen konzentrierte.
Mit einem Jahr Verspätung kam ich dann schließlich doch noch nach Moskau. Unsere Reisegruppe erreichte die Stadt am Morgen, nachdem man die Überreste Stalins still und heimlich aus dem Mausoleum auf dem Roten Platz entfernt hatte. Nur der mumifizierte Leichnam Lenins, mit seiner grünlich-kränklichen Haut und dem hellorangen Bart, war an Ort und Stelle geblieben und harrte der andächtigen Verehrung durch die Besucher wie die morbide Ganzkörperreliquie irgendeines italienischen Heiligen. Dabei konnte jeder sehen, dass die Sandsteininschrift über dem Eingang, auf denen die Namen beider verstorbenen „Führer des russischen Volkes“ eingemeißelt gewesen waren, auf recht stümperhafte Weise manipuliert worden war. Es bestand kein Zweifel: Wir waren in der Welthauptstadt der Geschichtsfälschung angelangt.
Zwei Dinge muss man den Russen zugestehen: Sie haben das größte Land der Erde – und eine unglaublich reiche und nuancierte Sprache, um dieses Land zu beschreiben. Ihre literarischen und musikalischen Traditionen sind so herrlich, wie ihre politischen Gepflogenheiten beklagenswert sind. Ihr Nationaldichter Alexander Puschkin (1799–1837) war ein leidenschaftlicher, feuriger – und ein politisch unbequemer Mann. „Geboren bin ich nicht, um Zaren zu amüsieren“, hat er einmal gedichtet. Im Laufe seines kurzen Lebens lieferte er sich nicht weniger als neunundzwanzig Duelle – an den Folgen des letzten ist er dann gestorben. Sein Einfluss auf die neuere russische Literatur kann wohl mit dem Shakespeares auf die englische oder Goethes auf die deutsche Literatur verglichen werden. Eines seiner Gedichte, das in keiner Sammlung russischer Lyrik fehlen darf, ist Zimnii Put’ („Winterliche Fahrt“, 1826), in dem es ganz und gar um eine Stimmung geht und um die Eintönigkeit einer langen Schlittenfahrt bei Nacht.40
Man könnte meinen, dass Puschkins erhaben-schlichte Perioden sich auch einfach übersetzen lassen müssten. Dem ist nicht so. Schon eine flüchtige Internetrecherche fördert einige urkomische Funde zutage, bei denen mitunter eine seltsame Wortwahl, verdrehte Grammatik, ungelenker Satzbau und unsaubere Reime dazu führen, dass schon die Übersetzung der ersten Strophe nie so ganz den Zauber des Originals einfangen kann, wie sehr die Übersetzer sich auch bemüht haben:
Mühsam durch die Nebelschleier
Dringt des Mondes bleicher Strahl
Gießt sein traurig kaltes Feuer
In das traurig stumme Thal …
Oder:
Durch die grauen Nebelwälder
Stiehlt der Mond sich sacht herein,
Und auf schneebedeckte Felder
Gießt er traurig seinen Schein …
Oder aber:
Trüb des Mondes Strahlen brechen
Durch der Nebelwolken Schicht, Auf des
Schneefelds öde Flächen
Gießen sie ihr fahles Licht …
Oder gar:
Durch den welligen Nebel
Sucht sich der Mond hindurchzuarbeiten
Auf die traurigen Lichtungen
Gießt er traurig sein Licht …
Ein besseres Argument dafür, Russisch zu lernen, wird man wohl kaum finden.
Der polnische Nationalheld unter den Dichtern, Adam Mickiewicz (1798–1855) war Puschkins enger Altersgenosse und – während seines Exils in Russland – auch Puschkins persönlicher Freund. Wie Puschkin schrieb er Gedichte, die von romantischer Empfindung und klassischem Formbewusstsein in gleichem Maße geprägt sind, was die Systematiker der Literaturgeschichte regelmäßig ganz durcheinanderbringt. Man wird ihn wohl auf ewig zuerst mit den Eröffnungsversen seines Epos Pan Tadeusz in Verbindung bringen: „Lithauen! Wie die Gesundheit bist du, mein Vaterland!/Wer dich noch nie verloren, der hat dich nicht erkannt …“ Und doch hat Mickiewicz viel und Vielfältiges geschrieben, von Epen und Sonetten bis zu Dramen und akademischen Vorträgen. Mein persönliches Lieblingsgedicht von ihm heißt „In der Akkermanschen Steppe“ und entstand auf einer Reise durch die endlosen Weiten der südlichen Ukraine:
Wpłtynąłem na suchego przestwór oceanu …
Die Steppe! – Wie ein Schiff im Ozean
Schwimmt durch das grüne Meer dahin mein Wagen,
Vorbei an Dornen, die wie Klippen ragen
Im Blütenmeer, bedrohend Schiff und Kahn.
Kein Grabstein zeigt jetzt mehr den Weg mir an.
Dem Seemann gleich muss ich die Sterne fragen.
Doch fern im Osten fängt es an zu tagen:
Der Dnjester blinkt, das Licht von Akkerman.
Halt! – Laß mich in die heil’ge Stille lauschen …
Die Kraniche? Kein Blick erreicht sie mehr,
Ich höre sie! – Im Gras das leise Rauschen?
Ein Schmetterling? Die Schlange kriecht umher.
Könnt’ ich ein Wort aus Polen doch erlauschen.
Fahr zu! Aus Polen dringt kein Laut hierher.41
Osteuropa ist für jeden Reiseschriftsteller ein ideales Jagdrevier, wobei dann allerdings nicht selten eine Variante jenes „Orientalismus“ an den Tag tritt, der in der Vergangenheit so manche Darstellung des Nahen und des Fernen Ostens geprägt (und verzerrt) hat. Für Osteuropa war in dieser Hinsicht Jan Graf Potocki (1761–1815) der große Wegbereiter (da er auf Französisch schrieb, wird er oft auch „Jean Potocki“ genannt). Die Reisen dieses Völkerkundlers, Ägyptologen und Philologen, eines Sprösslings aus wohlhabendem polnischem Adel, erstreckten sich von der Mongolei bis nach Marokko und wurden von ihm in zahlreichen Publikationen beschrieben; am bekanntesten ist jedoch bis heute sein Roman – eigentlich ein Zyklus von Erzählungen mit einer Rahmenhandlung – Die Handschrift von Saragossa (1815).42
Juliusz Słowacki (1809–1849) – gesprochen „Swowatzki“ – ist wohl Mickiewicz’ einziger ernsthafter Konkurrent um den Titel des polnischen Nationaldichters. Wie dieser war er ein reiselustiger Poet, der schließlich ins Exil gezwungen wurde. Sein Versepos Podróz na Wschód („Reise in den Osten“) verfasste er 1836–38 auf einer großen Fahrt, bei der er Griechenland, Ägypten, Syrien und das Heilige Land besuchte.43 Im ersten Teil des Gedichts findet sich das folgende geniale Miniaturporträt von „Europa“:
Jeśli Europa jest nimfą – Neapol
Jest nimfy okiem błękitnem, – Warszawa
Sercem, – cierniami w nodze Sewastopol,
Azow, Odessa, Petersburg, Mitawa; –
Paryż jej głową, a Londyn kołnierzem
Nakrochmalonym, a zaś Rzym … szkaplerzem.
Wenn Europa eine Nymphe ist, dann ist Neapel
Ihr himmelblaues Auge; Warschau –
Ihr Herz; die Dornen in ihrem Fuß sind – Sewastopol,
Asopòs, Odessa, Petersburg, Mittau;
Ihr Kopf ist Paris; London – ihr gestärkter Kragen
Und Rom hingegen – ihr Skapulier.44
Sodann beschreibt Słowacki seine Abreise aus Italien:
I ruszyć w podróż, bo się pieśń przewlecze
Niejedna jeszcze przerwana ideą.
Jutro kurierem wyjeżdżam do Lecce,
Jutro więc zacznę śpiewać Odysseą,
Albo wyprawę o Jazona runach
Na nowej lutni i na złotych strunach.
Aufbrechen [muss ich], mein Lied wird lang
und ich verlier’ den Faden.
Morgen nehm’ ich die Kutsche nach Lecce,
Morgen beginn ich, von Odysseus zu singen
oder von Jasons Jagd nach dem Goldenen Vlies,
auf einer brandneuen Leier mit goldenen Saiten.
Da beschwor doch tatsächlich ein Dichter der Romantik – noch dazu einer vom äußersten östlichen Rand Europas – haargenau dieselben klassischen Bezüge herauf wie dreihundert Jahre zuvor Joachim du Bellay im Westen Frankreichs!
Meine jugendlichen Streifzüge durch die Welt der Reiseliteratur führten mich noch nicht bis zu Słowacki. In den Regalen der Stadtbücherei von Bolton fanden sich jedoch zahlreiche andere Bände, die sich mit Zentralasien und dem Great Game befassten, jenem „Großen Spiel“, in dem Russland und Großbritannien sich über Jahrzehnte die Vorherrschaft in diesem Teil der Erde streitig machten. Zu den Büchern, die ich damals las, zählten etwa Fred Burnabys A Ride to Khiva (1876), Lord Curzons Russia in Central Asia (1889) sowie Heart of a Continent (1896) von Frank Younghusband. Daneben verschlang ich die Werke der großen orientalisierenden Reisemaler und -illustratoren, deren Kenntnisse sich der eigenen Anschauung verdankten, wie etwa bei Edward Lear und David Roberts. Auf dieser Grundlage gelangte ich bald zu neueren Werken wie Peter Flemings Travels in Tartary (1941) und Heinrich Harrers Sieben Jahre in Tibet (1952). Meine Begegnung mit Patrick Leigh Fermor lag noch in der Zukunft; aber Rebecca Wests Black Lamb and Grey Falcon (1941)* sowie Fitzroy Macleans Eastern Approaches (1949) waren als Kostproben mehr als ausreichend, um schon einmal meinen Appetit anzuregen. „Der Osten“ hatte in meinem Kopf also seinen festen Platz, lange bevor ich jemals selbst in eine seiner vielen Gegenden kam.
In derselben Zeit bekam ich auch einen intensiven Eindruck davon, wie rapide sich allerorten die Reiseaktivität verstärkte. Einmal traf ich, völlig überraschend, mit dem breit lächelnden Kosmonauten Juri Gagarin zusammen, dem ersten Menschen im All, der die Londoner Automobilausstellung besuchte und mir dort die Hand schüttelte – was mich absolut fassungslos machte. Bei einer anderen Gelegenheit nahm mein französischer Freund Henri mich mit zum Pariser Flughafen Le Bourget, wo wir uns das weltweit erste Transatlantik-Passagierflugzeug mit Düsenantrieb anschauen wollten, eine Boeing 707 der Pan Am, die auf dem Rollfeld parkte.
Der zweitälteste Bruder meines Vaters hat, im Gegensatz zu mir selbst, den ersten bemannten Raumflug, den ersten Düsenjet nicht mehr erlebt. Mein Onkel Norman, zu dessen Andenken ich später auf denselben Namen getauft werden sollte, ging zu Neujahr 1918 von der Schule ab, um in die gerade neu gegründete Royal Air Force einzutreten. Nach einigen Wochen Grundausbildung erhielt er sein Offizierspatent und flog – noch als Teenager – mit seiner Staffel an die Westfront. Es war sein erster internationaler Flug, und es sollte sein letzter bleiben. Wie man mir später immer erzählte, war er dennoch ein echter Weltenbummler gewesen – aber einer von denen, deren Bummel sich eher in der Welt der Vorstellung abspielte: Onkel Norman war ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler.
Das Briefmarkenalbum unserer Familie wurde um das Jahr 1912 herum von Onkel Norman begonnen; er war damals dreizehn Jahre alt. Noch heute ist es eine wunderbare Fundgrube, nicht nur für Briefmarkenenthusiasten, sondern auch in Sachen politische Geografie und historischer Charme. Es trägt den Titel The World Postage Stamp Album, Revised & Enlarged („Briefmarken der Welt, überarbeitete und erweiterte Ausgabe“) und wurde von einem gewissen T. H. Hinton gestaltet – Mitglied sowohl der weltweiten Sammlervereinigung International Philatelic Union als auch der Société Française de Timbrologie – und irgendwann zu Beginn der Regierungszeit Eduards VII. von dem Verlag E. Nister & Co., 24 St. Bride Street, London, EC, auf den Markt gebracht. Für jedes Land der Welt enthält es mindestens eine, oft auch mehrere Seiten; auf jeder Seite ist oben eine Reihe von Briefmarken abgebildet. Zwar ist das Album nicht datiert, aber die neueste Briefmarke, die darin abgebildet ist, wurde 1902 in Transvaal ausgegeben.
Das Album ist in sechs Abteilungen gegliedert: I. Britisches Weltreich, II. Europa und europäische Kolonien, III. Asien, IV. Afrika, V. Amerika und VI. Ozeanien. Unterhalb der Illustrationen sind auf jeder Seite dreißig Plätze für Briefmarken vorgesehen, fein säuberlich durch gestrichelte Linien eingeteilt. Auf den 224 Seiten des Albums hätten also 6720 Briefmarken Platz gehabt. Ein handschriftlicher Vermerk auf der Innenseite des Einbandes – „3/0“ – lässt darauf schließen, dass das Album einmal drei Shilling gekostet hat.
Nach dem Kauf des Albums hat Onkel Norman den inneren Einbanddeckel noch weiter verziert, indem er mit blauer Tinte und in makelloser Schönschrift ein großes, verschnörkeltes Monogramm seiner Initialen „ND“ hineinsetzte. Zu einem späteren Zeitpunkt kam dann allerdings, ob wohl oder übel, sein jüngerer Bruder Richard (mein Vater) hinzu, der in der Familie nur als „unser Dick“ bekannt war. Wohl, weil sie verhindern wollten, dass noch weitere von der Davies-Brut bei ihrem philatelistischen Treiben mitmischen konnten, schrieb der kleine Richard nun eine klare Ansage hinein, die er direkt neben Normans Monogramm platzierte: „Dieses Buch ist das alleinige Eigentum von N. und D. Davies“, und sicherheitshalber fügte er auch noch die Anschrift der Familie hinzu: „Wigmore, The Haulgh, Bolton, Lancashire“.
Nach und nach tauchten jedoch noch weitere Eintragungen auf, darunter die selbstbewussten Signaturen ihres älteren Bruders – „Donny Davies, Rechtsaußen, Nationalmannschaft“, „Lancashire XI, Old Trafford“ (das Stadion von Manchester United) sowie, voller Stolz nach dem Erringen eines renommierten Stipendiums: „Queen’s Scholar, Cambridge“ –; eine Ausgestaltung des Wortes „Philately“ in schönster Schnörkelhandschrift; eine etwas rätselhafte Beschimpfung (?) in Bleistift („Toshi, der Einarmige“) sowie ein Fragment von irgendjemandes Französisch-Hausaufgaben: „Comment vous portez-vous? Je vais très bien!“ War „Toshi“ vielleicht Onkel Normans Spitzname? Und bekam er in Frankreich vielleicht noch die Chance, sein Französisch ein wenig zum Einsatz zu bringen? Ich bezweifle es. Jedenfalls sollte Onkel Don seiner Schwester niemals nach Cambridge folgen. Nachdem er sein Stipendium erhalten hatte, wurde er zu den Heeresfliegern des Royal Flying Corps eingezogen, stürzte mit seinem Flugzeug hinter den feindlichen Linien ab und verbrachte den Rest des Ersten Weltkriegs in einem deutschen Kriegsgefangenenlager.45
Das Nachsatzblatt sowie die Innenseite des hinteren Buchdeckels wurden verwendet, um die jeweils aktuellen Bestandszahlen der Sammlung als Ganzer festzuhalten, wobei die Einträge zwischen „europäischen“, „australasischen“, „amerikanischen“, „asiatischen“ und „anderen“ Briefmarken unterscheiden. Die frühesten Eintragungen in der Reihe lauten „über 500 am 2. Nov. 1914“ und „1980 am 5ten Mai 1915“, was eine durchschnittliche Wachstumsrate von mehr 200 Briefmarken im Monat beziehungsweise rund sieben Briefmarken am Tag bedeuten würde. Darüber hinaus lassen sich die Berechnungen nur schwer nachvollziehen. Da sie mit dem Bleistift eingetragen wurden, sind viele inzwischen unlesbar geworden – und viele sind wohl auch, wie ich vermute, das Ergebnis einer Art von „kreativer Buchführung“ …
Da der Vater der Jungen – mein Großvater – ja Geschäftsführer einer Strickerei war, ist zu vermuten, dass der stetige Fluss der Geschäftskorrespondenz im Baumwollhandel jede Menge ausländischer Briefmarken zu uns nach Bolton spülte. Aber auch der Baumwollhandel kann nicht die wirklich sehr beachtliche Anzahl von Marken erklären, die aus eher ungewöhnlichen Gegenden in das Album gelangt sind, etwa aus Persien, Uruguay, Haiti, Mosambik und dem Osmanischen Reich. Wie um alles in der Welt konnten ein paar Schuljungen aus Lancashire eine solche Fülle an exotischen Postwertzeichen anhäufen? Natürlich werden sie mit ihren Freunden auf dem Spielplatz getauscht und vielleicht auch manches eingekauft haben. Aber 1915 war Dick in Ungnade gefallen, weil seine schulischen Leistungen deutlich nachließen, und mein Großvater hatte entschieden, dass er wohl besser in der Strickerei arbeiten solle. Es ist kaum vorstellbar, dass Normans Taschengeld und Dicks mickriger Arbeitslohn ihnen bei ihrer Sammelleidenschaft große Sprünge erlaubt hätten. Und doch gibt es ein paar untrügliche Anzeichen für die professionellen Kontakte der beiden. Auf einem Stück vergilbten Packpapiers birgt das Album fünf erstklassige Exemplare aus Neuseeland, auf denen die junge Königin Viktoria zu sehen ist. Es handelt sich um die allererste Briefmarkenausgabe der Kolonie Neuseeland aus dem Jahr 1855. Wie sind diese Marken in ihren Besitz gelangt?
Nach Onkel Normans Tod hat mein Vater die Sammlung dreißig Jahre lang nicht angerührt, hat keine neuen Marken hinzugefügt. Wahrscheinlich wäre die Beschäftigung damit zu schmerzlich gewesen. Ab und an holte er den Band aus dem Schrank, um ihn seiner Frau und seinen Kindern zu zeigen, wobei er stets darauf hinwies, diese Briefmarken seien „unsere Versicherungspolice für schlechte Zeiten“. Seine Zurückhaltung gegenüber der alten Sammelleidenschaft gab er erst wieder auf, als er – wohl aus väterlichem Pflichtgefühl heraus – auch mir die ersten Grundlagen der Philatelie nahebrachte. Zu meinem neunten Geburtstag bekam ich ein Exemplar von Stanley Gibbons’ Simplified Stamp Catalogue („Vereinfachter Briefmarkenkatalog“) in der 14. Auflage, London 1948; und dann bekam ich Onkel Normans geheiligtes Album in die Hände gelegt, mit den Worten: „Das hier hat dein Onkel wirklich geliebt.“
Meine stärkste Erinnerung jedoch ist die an meine Verwirrung. Denn als ich nun die 224 Seiten des Albums durchblätterte, konnte ich manche der Länder nicht finden, von denen ich bereits Marken gesammelt hatte. Der Untermieter meiner Tante Ivy beispielsweise, den ich nur als „Onkel Joseph“ kannte, hatte mir einige ungewöhnliche Marken aus seiner Heimat geschenkt, der TSCHECHOSLOWAKEI. (Im Krieg hatte er aus Prag fliehen müssen.) Und meine Tante Doris hatte eine etwas mysteriöse Beziehung zu einem Missionar, der ihr aus SÜDRHODESIEN schrieb. Aber wo war dieses „Südrhodesien“ denn auf einmal hergekommen? Ich fand es im Katalog, aber nicht im Album.
Auf meine verdutzte Frage hin erklärte mir mein Vater, dass in den Jahrzehnten seit der Veröffentlichung des Albums zahlreiche neue Staaten entstanden waren, während andere aufgehört hatten zu existieren. Die Tschechoslowakei beispielsweise war im Oktober 1918 gegründet worden, kaum einen Monat nach Onkel Normans letztem Flug. Und Südrhodesien hatte 1923 das Licht der Welt erblickt, nachdem ein anderes Staatswesen auseinandergebrochen war, das auf Seite 24 des Briefmarkenalbums als BRITISCH-SÜDAFRIKA (RHODESIEN) erscheint. Und solcherlei Fälle gab es viele: ADEN (wo mein Vetter Peter bei der Royal Air Force Dienst tat), ALGERIEN, EIRE (woher Peters Freundin Vera stammte), FINNLAND (wohin meine Schwester eine Brieffreundschaft unterhielt), JUGOSLAWIEN, LIBANON, LITAUEN, LETTLAND, POLEN, SYRIEN, die VATIKANSTADT und noch so einige mehr.
An diesem Punkt traf mein Vater eine folgenschwere Entscheidung: Onkel Normans Album war nicht mehr zeitgemäß; wir würden es ersetzen müssen. Also kaufte er ein neues Album der Marke Pacific Stamp mit Loseblattsystem, das nach Bedarf erweitert werden konnte, sowie einen großen Packen der notwendigen Blätter. Und dann machten wir uns an die mühevolle Aufgabe, den Namen jedes einzelnen Landes im Katalog auf eine eigene Seite des neuen Albums zu schreiben, zusammen mit dem Namen der jeweiligen Hauptstadt. Dieses Vorhaben nahm Wochen, wenn nicht gar Monate in Anspruch. Danach kam ein sogar noch aufwendigerer Arbeitsschritt, bei dem wir die Briefmarken von dem alten Album in das neue übertrugen. Das war die Mühe, die für mich das Fass zum Überlaufen brachte: Mein Sammlerwille war gebrochen, meine philatelistische Karriere schien am Ende. Ein Jahr verging, dann zwei, dann drei Jahre, und irgendwann – es muss 1950 oder 1951 gewesen sein – gab ich einfach auf. Ich nahm Onkel Normans World Album, das noch immer halb voll war, legte es in eine Kiste und packte das Pacific Album dazu, das noch immer halb leer war. Statt Briefmarken einzukleben, begann ich, mir mit Fußballspielen die Zeit zu vertreiben.
Als ich dann, beinahe sechzig Jahre später, die unvollendete Aufgabe wieder aufnahm, arbeitete ich gerade an einem Buch mit dem Titel Vanished Kingdoms (dt. Verschwundene Reiche: Die Geschichte des vergessenen Europa). Die Prämisse dieses Buchs sollte eine ganz simple historische Beobachtung sein: dass nämliche jegliche politischen Gebilde – ob nun Königreiche, Imperien oder Republiken – eine zeitlich begrenzte, endliche Lebensdauer haben. Kein Staat ist unsterblich. Wie wir Menschen werden sie geboren, leben dann für eine bestimmte Dauer – manche länger, andere kürzer – und schließlich sterben sie. Mittlerweile ist mir klar geworden, dass meine frühe Beschäftigung als „Briefmarkenkundler“ ganz entscheidend dazu beigetragen hat, mir diese Denkfigur in den Kopf zu setzen.
Als mir nun Jahrzehnte später Onkel Normans Briefmarkensammlung wieder in den Sinn kam, holte ich sie aus ihrer Kiste und begann, mir ihre Bestandteile noch einmal genauer anzusehen. Die größte Abteilung des Albums, sie nimmt die Seiten 6 bis 88 ein, ist dem BRITISCHEN WELTREICH gewidmet – einem politischen Gebilde, das inzwischen völlig verschwunden war. Der zweite Abschnitt zu „Europa“ (Seiten 89 bis 162) enthielt vergleichsweise mehr „Überlebende“, von BELGIEN und BULGARIEN bis zu SPANIEN, SCHWEDEN und der SCHWEIZ. Aber ÖSTERREICH-UNGARN, das DEUTSCHE REICH, das RUSSISCHE ZARENREICH und das OSMANISCHE REICH waren allesamt zu Staub zerfallen. Eine ganze lange Liste von KOLONIALBESITZUNGEN EUROPÄISCHER MÄCHTE existierte so nun nicht mehr, und nicht weniger als siebzehn deutsche Staaten, Territorien und sonstige Körperschaften, die eigene Briefmarken ausgegeben hatten, waren ebenfalls von der internationalen Bühne verschwunden, von BADEN, BAYERN und BERGEDORF bis hin zu PREUSSEN, SACHSEN, THURN UND TAXIS (NORD und SÜD) und schließlich WÜRTTEMBERG. Die Insel KRETA, wiewohl ein eigenständiger Staat, wird in dem Album als „unter der gemeinsamen Verwaltung Großbritanniens, Frankreichs, Russlands und Italiens stehend“ beschrieben; nur kurz bevor Onkel Norman seine Sammlung begann, hatte Kreta schließlich seinen Anschluss an Griechenland erklärt. Die Karibik-Inseln von DÄNISCH-WESTINDIEN hingegen wurden 1917, als die Brüder noch zur Schule gingen, an die Vereinigten Staaten verkauft und sind seitdem als die „Amerikanischen Jungferninseln“ bekannt. Das im Album als „Fürstentum“ bezeichnete MONTENEGRO war ab 1910 ein Königreich, wurde jedoch 1918 brutal von Serbien annektiert – der einzige Staat unter den Alliierten des Ersten Weltkriegs, der in diesem Krieg zerstört wurde.
Aus der asiatischen Abteilung des Albums sind die meisten der damals souveränen Staaten, wie etwa CHINA oder JAPAN, auch heute noch auf der Weltkarte zu finden; allerdings hat die Mehrzahl von ihnen in der Zwischenzeit teils drastische Verwandlungen ihres politischen Systems erlebt, und nicht wenige haben ihre Namen geändert: Aus PERSIEN wurde Iran, aus SIAM wurde Thailand, und KOREA – damals „unter japanischer Verwaltung“, wie das Album beschönigend erläutert – ist inzwischen zweigeteilt. Unter den afrikanischen Staaten haben LIBERIA und MAROKKO überlebt, wie auch ABESSINIEN, das inzwischen freilich Äthiopien heißt. In Nordund Südamerika hat es überhaupt keine Veränderungen gegeben, wenn man einmal von der venezolanischen Hafenstadt LA GUAIRA absieht, die zwischen 1864 und 1869 eigene Briefmarken für die Postschiffe nach Curaçao ausgegeben hat. In der Sammlungsabteilung, die Ozeanien gewidmet ist, wird das Territorium HAWAII als „US-Protektorat“ bezeichnet, obwohl die Vereinigten Staaten es damals bereits annektierten hatten. Im Jahr 1959 wurde es dann der fünfzigste Bundesstaat der USA.
Die Arbeit an Verschwundene Reiche nahm fünf Jahre meines Lebens in Anspruch. Als das Buch dann fertig war, wusste ich nicht so recht, wie es mit diesem Leben weitergehen sollte. Die in den Psalmen genannte einschlägige Wegmarke hatte ich zwar passiert – „Unser Leben währet siebzig Jahre …“, heißt es bei Luther –, aber dank dem hervorragenden Hüftchirurgen Professor Derek McMinn aus Birmingham meine verloren geglaubte Mobilität wiedergewonnen. Und nicht zuletzt hatte ich einen Buchpreis gewonnen, dessen Preisgeld ich in Tickets für Langstreckenflüge investieren konnte. Während ich also noch darauf wartete, dass mein Verlag mir grünes Licht – und vielleicht einen Themenvorschlag – für ein weiteres Buchprojekt geben würde, nahm ich die Sache selbst in die Hand und begann, eine Weltreise zu planen.
Die Fallbeispiele, über die ich in Verschwundene Reiche geschrieben hatte, beschränkten sich ausschließlich auf Europa. Nachdem ich nun aber Onkel Normans Album nach langer Zeit wieder in der Hand gehabt hatte und noch dazu meine eigene Weltumrundung ins Auge nahm, wurde mir allmählich klar, dass es „verschwundene Reiche“ an allen Enden der Erde gab. Zudem wollte mir scheinen, dass die Menschheitsgeschichte eine Geschichte nicht nur von stetiger Veränderung, sondern ebenso von ständiger Ortsveränderung gewesen war, eine Geschichte voller Bewegung und Fortbewegung. Seit die ersten Exemplare der Art Homo erectus sich vor rund 1,9 Millionen Jahren auf ihre Hinterbeine erhoben hatten – was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in Ostafrika geschah –, hatten ihre Nachfahren sich beinahe rastlos von Ort zu Ort weiter fortbewegt: von einem Lagerplatz zum nächsten, dann von Kontinent zu Kontinent, schließlich vom Festland bis auf entlegene Inseln hinaus. Als das Zwielicht der Vorgeschichte dann langsam in die Morgenröte der ältesten Aufzeichnungen überging, hatte der moderne Mensch bereits die meisten Gegenden auf dieser Erde erreicht, mit Ausnahme der Antarktis. Die Schöpfungen der Menschheit – und dazu zählen eben auch Gemeinwesen, Staaten und Reiche – entwickeln sich scheinbar aus dem Nichts, blühen auf, vergehen und werden durch andere ersetzt, die an ihre Stelle treten. Diese Abfolge haben sie mit ihren Schöpfern gemein. Und wie jedes einzelne der Individuen, aus denen das große Kollektiv „Menschheit“ besteht, kam auch die Spezies als Ganze mit einem ungeheuren Bewegungsdrang auf die Welt: will seit jeher krabbeln, dann gehen, laufen und springen, bis sie irgendwann gebrechlich und zittrig den Stab an andere weitergeben wird. Über Jahrtausende sind die Menschen von Ort zu Ort gezogen, stets weiter und weiter, immer auf der Suche nach dem Ort, wo das Gras noch saftiger, die Landschaft noch einladender sein würde. Ab und an machen sie Rast, für Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, aber früher oder später packen sie ihre Siebensachen und begeben sich auf die nächste Etappe ihrer Wanderschaft. Sie ziehen weiter und erkunden die Gegend, klettern bergauf und steigen wieder ab; sie führen oder folgen, fliehen vor Unglück oder suchen in der Fremde ihr Glück; sie halten zusammen oder zerstreiten sich, dringen vor oder treten den Rückzug an, kommen an oder brechen auf; sie halten Kurs oder irren umher; sie entfernen sich voneinander, gehen getrennte Wege, sondern sich vom großen Hauptstrom ab oder zerstreuen sich; sie finden zusammen, prallen aufeinander, verschmelzen miteinander oder leben friedlich nebeneinander; sie sind ruhelos, impulsiv oder lassen sich treiben; streunen, streifen und schweifen; stürmen, hetzen oder hasten; marschieren, stampfen oder trampeln; stapfen, trotten oder schleppen sich dahin; drängen, pilgern oder schlendern; sie eilen oder trödeln, gehen, segeln, reiten oder fliegen auf ihren ständigen Migrationen, Emigrationen, Immigrationen, bei ihrem Bevölkern, Besiedeln und Kolonisieren; manchmal wetteifern sie, geraten aneinander, erobern oder kapitulieren; immer aber müssen sie interagieren, sich anpassen und sich stets weiterentwickeln. Sie stoßen als furchtlose Einzelkämpfer ins Ungewisse vor oder ziehen in Familiengruppen und Volksmassen ihres Weges. Bisweilen fegen sie, wie etwa die mongolischen Reiterhorden, über die Steppen und Prärien; dann wieder ziehen sie in Kolonnen behäbiger Planwagen durch die Wildnis, wie die Buren und die Mormonen. Die Ozeane haben sie stilvoll in den Kajüten der Ersten Klasse überquert, in der ärmlichen Enge des Zwischendecks oder qualvoll in den Frachträumen der Sklavenschiffe. Sie sind auf Wikinger-Langschiffen gefahren und polynesischen Auslegerkanus, in Fellbooten und in Fiberglas-Jachten. Manchmal sind sie, wie die römischen Legionen, in Reih und Glied marschiert, manchmal haben sie, wie die Barbarenhorden der Völkerwanderungszeit oder die Migrationsströme des 21. Jahrhunderts, bestehende Grenzen allein durch die Kraft der großen Zahl überwunden. Und bei alldem vergessen sie zugleich nie ihren Überlebensinstinkt, sind fruchtbar und mehren sich, wodurch der ständige Menschenstrom aufrechterhalten wird.
Unsere heutige Welt ist die – vorläufige – Summe all dieser über Jahrtausende aufaddierten Bewegungen. Dank der menschlichen Rastlosigkeit ist die Erde nun mit einer Vielzahl von Ethnien, Religionen, Kulturen, Stämmen, Gesellschaften, Sprachfamilien, Landsmannschaften, Nationen, Staaten, politischen Gruppierungen und Machtblöcken angefüllt; die Vielfalt von guten Nachbarn, bösen Nachbarn, Verbündeten, Rivalen und Feinden ist kaum noch zu überschauen. Und nun wollte ich, ein einsamer Reisender, der fest entschlossen war, sich auf seine eigene Entdeckungsfahrt zu begeben, mich mitten in dieses Getümmel stürzen.
Alles begann mit einer Einladung an mich, in Australien, genauer gesagt in Melbourne, einen Festvortrag zu halten. Meine Frau und ich freuten uns sehr über die Gelegenheit, einmal nach Melbourne zu reisen; aber die Aussicht auf einen 24-stündigen Direktflug erfüllte uns nicht gerade mit Vorfreude. Die naheliegende Lösung war, nicht non-stop nach Australien zu fliegen, sondern stattdessen eine Reihe von kleineren, weniger strapaziösen Etappen zu absolvieren – über Dubai, Delhi und Singapur. Der längste Aufenthalt unserer Reise sollte in Tasmanien sein, wo wir bei Freunden zu Gast sein würden und von wo aus meine Frau dann auch wieder nach Hause zurückkehren wollte. Als Nächstes fiel uns auf, dass wir mit nur ein wenig zusätzlichem Aufwand die Rückreise auch genauso gut ostwärts würden antreten können – über Neuseeland, Tahiti und die Vereinigten Staaten. Aber wir waren ja nicht in Eile, und so gab es überhaupt keinen Grund, bei einer Reise bis ans andere Ende der Welt jedes besuchte Land nach einer blitzartigen Stippvisite – Führung, wenig typische Standardmahlzeit, Übernachtung in einem anonymen Flughafenhotel – sofort wieder zu verlassen. Ganz im Gegenteil: Nicht Eile, sondern Gelassenheit war geboten, und zusätzliche Haltepunkte konnten der Route beinahe nach Belieben hinzugefügt werden. So kamen Baku, Kuala Lumpur, Mauritius und Madeira auf den immer weiter wachsenden Fahrplan. Das waren magische Namen auf der Karte all jener Orte, die ich noch nie zuvor gesehen hatte und danach vermutlich auch nie wieder sehen würde. Als der Tag der Abreise herannahte, stieg die Vorfreude – und mit ihr eine gewisse Aufregung – unbestreitbar an. Und natürlich wollte ich mich nicht von unserem Sohn Christian überflügeln lassen, der eines Tages in einem ähnlichen Anfall von Reisefieber nach Zentralasien aufgebrochen war (wie das unter jungen Leuten heutzutage üblich ist), in jenes Zentralasien, das ich selbst nur in Büchern kennengelernt hatte. Seine Postkarte an uns, die daheimgebliebenen Eltern, enthielt statt der üblichen, banalen Urlaubsgrüße die folgenden vier wortgewaltigen Verse, die wohl als das persönliche Motto aller passionierten Wandervögel dienen könnten:
We travel not for trafficking alone:
By hotter Winds our fiery hearts are fanned:
For lust of knowing what should not be known
We make the golden journey to Samarkand.
Wir reisen nicht allein für Ruhm und Handel:
In unsren Herzen weht ein heißrer Brand:
Die Lust ist’s, Un- in Kenntnis zu verwandeln –
Drum reisen wir ins goldne Samarkand.46
Ich kann daher nicht mit letzter Eindeutigkeit sagen, was mich eigentlich zu meinem Vorhaben bewogen hat, die Welt zu umrunden. Ganz sicher habe ich zur Vorbereitung nicht die zahllosen Theorien darüber studiert, warum Menschen überhaupt einen Reisedrang verspüren; ich habe mich diesem menschlichen Urdrang einfach hingegeben und bin losgezogen. Ganz bestimmt bin ich keiner von jenen „echten“ Reisenden, die – wie es bei Baudelaire heißt – einzig und allein „gehen/Um fortzugehn“. Aber genauso wenig zog es mich auf eine hochgesinnte Pilgerfahrt à la Bunyan. Meine Motivation lag wohl eher in der Nähe von Goethes „Schule des Sehens“ – ich wollte meine Beobachtungsgabe auf die Probe stellen, wiederkehrende Muster entdecken und flüchtigen Details nachjagen, und dann meine Geschichte erzählen. Meine Hoffnung war dabei von Anfang an, dass die Erzählung von meinem impulsiven Abenteuer eine Prise von Cobbetts beißendem Witz, ein Flair ähnlich dem „strahlend blauen Himmel“ und „saftig-grünen Gras“ Hazlitts sowie wenigstens eine Andeutung von Goethes „wahrhaftem Märchen“ enthalten würde. Vielleicht war ich ja auch, wie der alternde Odysseus in Lord Tennysons Gedicht Ulysses, nur ein weiterer „grauer Geist“, der sich nach einem allerletzten Abenteuer sehnte:
Death closes all: but something ere the end,
Some work of noble note, may yet be done,
Not unbecoming men that strove with Gods.
The lights begin to twinkle from the rocks:
The long day wanes: the slow moon clumbs, the deep
Moans round with many voices. Come, my friends,
’Tis not too late to seek a newer world
…
[For] my purpose holds
To sail beyond the sunset, and the baths
Of all the western stars, until I die.
It may be that the gulfs will wash us down;
It may be we shall touch the Happy Isles,
And see the great Achilles, whom we knew.
Tho’ much is taken, much abides; and tho’
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven, that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield.
Der Tod schließt Alles: aber vorher, Freunde,
Kann etwas Edles, Großes noch getan sein,
Was Männern ansteht, die mit Göttern stritten.
Schon glitzern rings die Lichter am Gestad,
Der Tag versinkt, der Mond geht auf, die Tiefe
Wehklagt umher. Auf denn! noch ist es Zeit,
Nach einer neuern Welt uns umzusehn!
…
…[D]enn mein Endzweck ist,
Der Sonne Bad und aller Westgestirne
Zu übersegeln – bis ich sterben muss.
Vielleicht zum Abgrund waschen uns die Wogen:
Vielleicht auch sehn wir die glückseligen Inseln,
Und den Achilles drauf, den wir ja kannten!
Viel ist gewonnen – viel bleibt übrig! Sind
Wir auch die Kraft nicht mehr, die Erd und Himmel
Vordem bewegte: – was wir sind, das sind wir!
Ein einziger Wille heldenhafter Herzen,
Durch Zeit und Schicksal schwach gemacht, doch stark
Im Ringen, Suchen, Finden, Nimmerweichen!47
* Ein Wortspiel mit the bouncing cheque, das auf Maxwells Sinn für Lebensart und zugleich auf seine mitunter fragwürdigen Geschäftspraktiken anspielt: Der „putzmuntere Tscheche“ wird mit einem „platzenden Scheck“ in Verbindung gebracht (Anm. d. Übers. T. G.).
* Eine Auswahl aus diesem Band ist mittlerweile in deutscher Übersetzung erschienen: Schwarzes Lamm und grauer Falke (Berlin 2002), (Anm. d. Übers. T. G.).