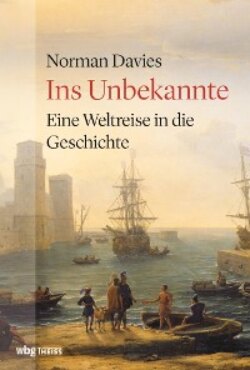Читать книгу Ins Unbekannte - Norman Davies - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Al-Imarat:
Berge von Geld und tankerweise Missverständnisse
ОглавлениеUm von Aserbaidschan in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zu gelangen, braucht es nicht viel: einen Steinwurf von Baku nach Teheran, dann einen Katzensprung über die Berge und Wüsten Irans und schließlich einen kleinen Hopser über den Persischen Golf – und schon ist man da. Mit einem Direktflug von Azerbaijani Air oder Emirates schafft man die Strecke in unter drei Stunden. Es geht in Richtung Südsüdost, das Ziel ist entweder Abu Dhabi oder Dubai. Man fliegt kaum mehr als tausend Meilen, und doch ist es eine kleine Weltreise: von der zentral- und vorderasiatischen Welt der Turksprachen in die Welt Arabiens; aus dem Reich des schiitischen in das Reich des sunnitischen Islam.*
Schon während des Fluges fiel mir auf, welch hohe Bedeutung die emiratische Regierung jeglicher Form von Bildung, vor allem aber der Hochschulbildung beimisst – und insbesondere Studenten aus dem Ausland möchte man für ein Studium am Golf begeistern. Im Bordmagazin meiner Fluggesellschaft werden die Universitäten von Abu Dhabi in den höchsten Tönen gelobt: „Das überaus diverse studentische Leben in Abu Dhabi“, säuselt es da, „spielt in einer ganz eigenen Liga.“1 Fünf Bildungseinrichtungen werden namentlich genannt, die meisten davon Ableger westlicher Universitäten:
University of Abu Dhabi: Luftfahrttechnik, Luftfahrt-Management, Architektur
Paris-Sorbonne Abu Dhabi University: Sprachen, Marketing, Wirtschaftswissenschaften
New York Film Academy, Abu Dhabi: Kurzfilm- und Schauspielkurse Alliance Française, Abu Dhabi: Französischkurse auf allen Niveaus New York University, Abu Dhabi: Geistes- und Sozialwissenschaften
Und dabei ist Abu Dhabi ja nur eines von insgesamt sieben Emiraten, in denen insgesamt noch hundert weitere Universitäten und sonstige Hochschulen wachsen und gedeihen.2 Die Strategie ist nicht schwer zu durchschauen: Man überzeugt Projektpartner mit internationalem Renommee und einem glanzvollen Namen (die Sorbonne! die NYU!) am Persischen Golf eine Zweigstelle zu eröffnen, für die man dann zahlende, studierende Kundschaft aus der ganzen Welt anwirbt, die mit den hier erworbenen Hochschulabschlüssen fit gemacht werden soll für den bekanntlich ja „immer globaleren Arbeitsmarkt“. Zum Gelingen dieses Geschäftsmodells sollen beitragen: Lehrveranstaltungen in englischer Sprache, ein „multinationales Umfeld“, unschlagbare Preise sowie „maßgeschneiderte, innovative Kursinhalte“. Na dann.
Beim Landeanflug auf Dubai ist die Sonne schon untergegangen, und die Gasfackeln der Ölbohrinseln draußen im Golf flackern über das Wasser. Den Fluggästen an den Fensterplätzen hat man aber bereits empfohlen, auch noch nach etwas anderem Ausschau zu halten. Und so taucht, als das Flugzeug gerade zum Landeanflug übergeht, tief unter uns ein riesiger Stachel in der Landschaft auf, der in der Dämmerung grün-golden angestrahlt wird. Selbst bei unserem Überflug über Dubai-Stadt – der Pilot zieht eine Schleife, um den Flughafen vom Landesinneren her anfliegen zu können – liegt der Burdsch Chalifa, das seit 2008 höchste Gebäude der Welt, noch weiter unter uns. Nach der Landung freilich erhebt sich dieser „Chalifa-Turm“, der nach dem Emir von Abu Dhabi, Scheich Chalifa bin Zayid al-Nahyan, benannt wurde und nur wenige Kilometer vom Flughafen entfernt in den Himmel ragt, hoch über unseren Köpfen. Und doch hat ein anderer Anblick der letzten Minuten einen sogar noch stärkeren Eindruck hinterlassen: Als das Flugzeug die Innenstadt zum ersten Mal im Sinkflug passiert, sinken wir durch einen wahren Feuerzauber aus gleißenden Lichtern hinab, nur um gleich darauf wieder in absolute Finsternis einzutauchen. Drei oder vier Minuten lang, während der Pilot seine Schleife zieht, gleiten wir über einem bodenlosen, unfassbar stillen Abgrund dahin. Keine Straße, kein einziges Licht stören diese brutale Verdunklung, dieses völlige Aussetzen der visuellen Wahrnehmung. Wie der Inbegriff der reinen Leere erstreckt sich die Wüste unter uns bis ins Unermessliche; die funkelnde Metropole direkt daneben nimmt sich nun wie ein fragiler Vorposten der Zivilisation aus. Die Wüste ist am Golf nie weit entfernt.
Das Abfertigungsgebäude des Flughafens von Dubai ist riesig, eine schier endlose, verwirrende Höhle mit marmornen Fußböden. Es gibt zwei getrennte Ankunftshallen: Durch Halle A wogt eine Masse von ihrer Reise erschöpfter Männer; in Halle B schieben sich Männer und Frauen, zumeist Europäer, in langen Schlangen Schritt für Schritt auf die gläsernen Kabinen mit den Einwanderungsbeamten zu. Ohne weitere Nachfrage winkt man mich direkt in Richtung der Halle B. Der bärtige Grenzbeamte – makellos gebügeltes Gewand und blütenweiße ghotra – begrüßt mich auf Arabisch. Ich präsentiere mein Einladungsschreiben und erhalte auf der Stelle den nötigen Visumsstempel. Keine Spur von dem Quatsch in Baku.
Da mich ein Fahrer abholen soll, verlasse ich das Gebäude durch die Drehtüren mit dem Hinweisschild „Exit“. Mit dem Schritt nach draußen laufe ich gegen eine Wand aus glühend heißer Wüstenluft, von dem Gedränge unzähliger Menschen ganz zu schweigen, die einander zwischen ganzen Stapeln und Haufen von Koffern, Kisten, Taschen und Truhen umherzuschieben scheinen. Ich ziehe mich schleunig in das klimatisierte Innere des Gebäudes zurück, wo der Fahrer mich schließlich findet. Dieses Land besteht aus einer Vielzahl fein säuberlich voneinander getrennter Abteilungen, die zumeist unsichtbar sind, und man muss sehr genau wissen, wohin man gehört. „Willkommen in den Emiraten!“, sagt der Fahrer und fügt etwas verwundert hinzu: „Warum sind Sie denn nach draußen gegangen?“
Die Nachtfahrt zum Hotel führt uns aus Dubai-Stadt hinaus in die umgebende Wüste. Die Limousine rast an Hinweisschildern vorbei, die solche Aufschriften wie „International City“ oder „Academic City“ tragen. Ersteres ist ein Billigbauprojekt, ganz einfache Wohnungen. „Die leiden ganz schön unter dem Klärwerk“, sagt der Fahrer und hält sich demonstrativ die Nase zu. Academic City, noch nicht ganz fertiggestellt, soll einmal als „Super-Campus“ für eine ganze Reihe universitärer Partnerinstitutionen aus dem Ausland dienen, darunter die American University, die British University und die Mahatma Gandhi University.
„Bald“, sagt der Fahrer, „gibt’s da 40.000 Studenten.“
Der Mond scheint hell und die Sterne funkeln am klaren Nachthimmel. Der Wüstenwind bläst Sand über die völlig verwaiste Straße. Wir passieren Polizeistationen, die wie Grenzposten aussehen. Am Horizont erscheint eine Reihe von Lichtern, die mit hoher Geschwindigkeit davoneilen und sich dabei rhythmisch auf und ab bewegen.
„Was ist denn das?“, frage ich.
„Rennkamele“, sagt der Fahrer. „Die trainieren nachts, wenn es kühl ist.“
Mein äußerst luxuriöses Hotel ist wie eine Oase gestaltet. In der Mitte befindet sich eine große, glasüberdachte Empfangshalle, in der ausgewachsene Palmen mit imposanten Wasserfontänen konkurrieren. Ringsum erhebt sich der kreisrunde Hotelkomplex mit seinen zwanzig Stockwerken, Zimmern, Suiten und Konferenzräumen. Die arabischen Hotelgäste versammeln sich drinnen, wo sie es sich in schweren Ledersesseln gemütlich machen, Kaffee schlürfen und die von den Springbrunnen ausgehende Kühle genießen; die „Westler“ unter den Gästen liegen draußen in der drückenden Hitze neben einem von mehreren Pools, die, aufgereiht wie Perlen an einer Schnur, auf dem Gelände verteilt sind. Die Araber, Männer wie Frauen, halten sich von Kopf bis Fuß bedeckt, die Männer in Weiß, die Frauen – stets zwei Schritte hinter ihnen – in Schwarz. Für die Söhne des Westens scheint es nur zwei Alternativen zu geben: Geschäftsanzug oder Bademode, dazwischen existiert nichts. So wandern sie also in Bermuda-Shorts und mit freiem Oberkörper – die Damen wahlweise im Bikini und mit Flipflops – durch die Lobby, während ihre arabischen Gastgeber so tun, als würden sie nichts bemerken.
Die Kopfbedeckung der arabischen Männer ist nicht einfach nur ein Modestatement, sondern ein Ausdruck der persönlichen Identität. Die kufiya oder ghutra, eine Art von Kopftuch, wird über einer eng anliegenden weißen Kappe getragen, der taqiyah, und mit einer dicken schwarzen Wollkordel, aqal genannt, an Ort und Stelle gehalten. Emiratis und Saudis bevorzugen bei der kufiya ein rot-weißes Karomuster, obwohl manche sich auch für ein reinweißes Tuch entscheiden. Bei den Palästinensern ist die kufiya traditionell schwarz-weiß kariert – das berühmte „Palästinensertuch“ –, und Jordanier erkennt man an ihrer Vorliebe für Fransen. Bei den Frauen ist der hidschab („Schirm“ oder „Schleier“) verpflichtend, der Kopf und Oberkörper bedeckt, aber das Gesicht vollkommen frei lässt; ergänzt wird er durch die abaya, ein bodenlanges schwarzes Gewand. Unter den Araberinnen der Emirate ist es nur eine kleine Minderheit, die den niqab (Gesichtsschleier) nach saudischer Art trägt.
Das Essen im Hotelrestaurant spiegelt die vielfältige Herkunft der Gäste und Hotelbediensteten wider. Das Büffet, das in eine nahöstliche, eine euroamerikanische, eine indische, eine fernöstliche und schließlich eine afrikanische Abteilung gegliedert ist, biegt sich unter den Köstlichkeiten dieser Erde. Bei den Bedienungen und ihren Vorgesetzten kann man eine ähnliche Vielfalt beobachten. Die lächelnde Schönheit im Sari, die mich an meinen Platz geleitet, ist Filipina, die Auszubildende im Hotelfach eine junge Frau aus Glasgow. Über die nächsten Tage hinweg bedienen mich nacheinander ein Afghane, eine Nepalesin, eine Singhalesin, ein Sudaner, eine Kolumbianerin, ein Iraner, eine Ukrainerin, ein Mongole, ein Madagasse und ein Mauritier – und keine dieser Nationalitäten kommt doppelt vor! Vielleicht will man so einem Aufstand des Servicepersonals vorbeugen?
Das TV-Angebot des Hotels dominieren internationale Sender. Auf CNN sehe ich ein weiteres aufwendig produziertes Stück Werbefernsehen für den örtlichen Bildungssektor, diesmal für die technische Hochschule der Emirate, die Higher Colleges of Technology. Stapel von Büchern schleppende, aber dennoch zügig ausschreitende Studierende halten zielstrebig auf ultramoderne Gebäude der Sorte „Weiß mit Glas“ zu. Bei der Selbstdarstellung der HCT auf deren Internetseite werden ebenfalls alle Register gezogen:
Seit ihrer Gründung per Föderaldekret im Jahr 1988 genießen die Higher Colleges … einen ausgezeichneten Ruf, was innovatives Potenzial in der Lehre angeht. Mehr als 18.000 Studierende besuchen heute 17 moderne Campus für Männer beziehungsweise Frauen in Abu Dhabi, Al-Ain, Dubai, Fudschaira, Madinat Zayed, Ras al-Chaima, Ruwais und Schardscha. … Die Studierenden studieren in einem hoch entwickelten E-Learning-Environment, in dem das selbstständige und lebenslange Lernen im Mittelpunkt steht.3
Man mag mich radikal nennen, aber getrennte Campus für Männer und Frauen klingen in meinen Ohren nicht sonderlich „innovativ“.
Manchen Quellen zufolge leitet sich der Name „Dubai“ von einem arabischen Wort ab, das mit „Heuschrecken“ zu tun hat. Die allgegenwärtigen Plakate versprechen jedoch SONNE, SAND UND SHOPPING, und für meinen Geschmack gibt es hier von allen diesen Dingen eindeutig zu viel. Mittags brennt die SONNE auf uns herunter, was im Sommer regelmäßig zu Temperaturen von unerträglichen 40 bis 50 °C führt; der 2002 aufgestellte Rekord liegt bei 52,2 °C. Bei dem vielbeworbenen SAND handelt es sich nicht um die Sorte, auf der man sich bequem ausstrecken könnte, sondern vielmehr um ein hartes und grobkörniges Granulat, das sich unnachgiebig in den Haaren, zwischen den Zähnen, in Ohren, Kleidung und Schuhen festsetzt. Und was schließlich das SHOPPING betrifft, so hat man naturgemäß kaum eine andere Wahl, da die riesigen klimatisierten Einkaufszentren den konkurrenzlos besten Zufluchtsort vor der sengenden Hitze bieten. Es ist grotesk und hat in seiner Widernatürlichkeit etwas beinahe Unanständiges, wie dort in einer vollkommen artifiziellen Umgebung haufen-, ja bergeweise Waren feilgeboten werden. Importiert werden sowohl die Schnäppchen als auch die Schnäppchenjäger, die zwischen ihnen umherwuseln. Internationale, sogenannte Luxusmarken leeren die Taschen der Gehirngewaschenen und spülen den Überschuss in die Schatulle der herrschenden Scheichs.
Aus nächster Nähe ist der Burdsch Chalifa so groß, dass man ihn erst fotografieren kann, wenn man ein Stück aufs Meer hinausfährt oder zu diesem Zweck einen Helikopter chartert. Manche Besucher lieben die Fahrstühle, die mit der magenumdrehenden Geschwindigkeit von zehn Metern pro Sekunde in Richtung Spitze rasen; anderen reichen auch die Einkaufsmöglichkeiten in den niederen Stockwerken. Dort kann man über endlose Marmorfußböden spazieren, ziellos auf hochglanzpolierten Rolltreppen umherfahren, tief die aufbereitete Klimaanlagen-Luft einatmen oder Stechrochen und Haien hinterherglotzen, die in einem Aquarium hinter der weltgrößten Plexiglasscheibe ihre Bahnen ziehen. Oder man versucht – womit dann der Gipfel der Absurdität erreicht wäre – sein Glück auf der hauseigenen Kunstschneepiste.4 Aber ganz egal, was man tut: Man leistet auf jeden Fall einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur globalen Erwärmung.
Die schicksten und teuersten Übernachtungsmöglichkeiten in Dubai sind das Burj Al-Arab Hotel5 und das Palm Island Resort. Ersteres besitzt seinen eigenen Hubschrauberlandeplatz und nennt sich selbst wenig bescheiden „das luxuriöseste Hotel der Welt“; das Letztere hat man in den Jahren 2001 bis 2006 dem Meer abgerungen, indem in einer künstlichen Lagune hinter einem Wellenbrecher kleine Inseln in Form von Palmwedeln aufgeschüttet wurden.6
Wem ein bisschen Hitze nichts ausmacht, der kann auch lohnendere Sehenswürdigkeiten finden. Die immerhin vierzig Jahre alte Moschee im Stadtteil Dschumeirah beispielsweise soll die meistfotografierte Sehenswürdigkeit von ganz Dubai sein – und ganz gewiss ist sie eine der wenigen Moscheen im Land, die auch „Ungläubige“ betreten dürfen. Mit ihrem blassgelb-grauen Stein, ihren beachtlichen Kuppeln und schlank aufragenden Minaretten, die sich gleichermaßen plastisch vor dem sattblauen Himmel abheben, fordert sie den Fotografen geradezu heraus, ein paar gelungene Schnappschüsse zu machen.7 Ganz in der Nähe erinnert eine Gedenkstätte mit einem enormen Fahnenmast an jenen Rundbau, in dem die versammelten Scheichs am 2. Dezember 1971 beschlossen, ihre Herrschaftsgebiete zusammenzuschließen – die Geburtsstunde der Vereinigten Arabischen Emirate. Auch indische und iranische Viertel gibt es, die überaus lebendig sind. Die alte Festung Al-Fahidi, einst Residenz der Herrscherfamilie und heute Sitz des städtischen Museums, veranschaulicht wie kein zweiter Ort den scharfen Kontrast zwischen Gestern und Heute. Die zinnenbewehrten Mauern und runden Türme der Festung, die im späten 18. Jahrhundert aus Lehmziegeln und Korallenblöcken erbaut wurde, kontrastieren mit einem uralten zweimastigen Segelschiff, einer arabischen Dhau, die mit ihrem typischen hohen Bug nun auf einem noch höheren Sockel thront. Allem Anschein zum Trotz ist die „gute alte Zeit“ hier aber noch gar nicht lange vergangen. Bevor in den frühen 1960er-Jahren das Öl zu sprudeln begann, lebten die wenigen Bewohner der Gegend verstreut und unter einfachsten Bedingungen entlang der sandigen Grenze zwischen Wüste und Meer. Kaum fünfzig Jahre ist es her, da gab es hier keine befestigten Straßen, keine Elektrizität, keine Trinkwasserversorgung, keine weltlichen Schulen, ja noch nicht einmal eine Erfassung der Geburten und Sterbefälle in einer Bevölkerung, die kaum 5 Prozent der heutigen Einwohnerzahl erreichte. Die alte Festung wachte mit ihren eher noch älteren Kanonen über einen winzigen Hafen; elegante Dhaus zogen auf den blauen Fluten des Golfs ihre Bahn; vielleicht hockten Fischer und Perlentaucher vor ihren Schilfhütten in der Sonne; vielleicht versteckten sie sich aber auch vor den Piraten, die in der Gegend zahlreich waren. Beduinenstämme aus dem Landesinneren kamen auf ihren Dromedaren an die Küste geritten; ab und an ging ein britisches Kriegsschiff vor Anker, und auch die Royal Air Force unterhielt eine Reihe von Flugplätzen, die, zur Kette gereiht, ein Teilstück der britisch-imperialen Luftfahrtroute von Irak nach Indien bildeten.
Nordöstlich von Dubai drängen sich fünf kleinere Emirate auf der annähernd dreieckigen Landspitze, mit der die Arabische Halbinsel dort in die Straße von Hormus hineinragt, mit Iran am gegenüberliegenden Ufer. Dies ist der „Flaschenhals“ für den Schiffsverkehr im Persischen Golf; 20 Prozent der weltweiten Ölfördermenge werden durch die Straße von Hormus transportiert. (Der äußerste Vorsprung dieser Spitze, das gebirgige Kap Musandam, ist eine Exklave des östlichen Nachbarn der VAE, des Sultanats Oman.) Das Emirat Schardscha ist für seinen religiösen Konservatismus bekannt; Adschman, das von Schardscha ganz umschlossen wird, ist das kleinste der Emirate. Das weiter nördlich gelegene Emirat Umm al-Qaiwain ist am dünnsten besiedelt, beherbergt mit dem Dreamland Aquapark jedoch eine große Touristenattraktion. Ras al-Chaimah (was „Spitze des Zeltes“ bedeutet) besitzt ergiebige Eisenerzvorkommen.8 Das gebirgige Fudschaira schließlich, Heimat des Araberstammes der Asch-Scharqi, liegt an der Ostküste der Arabischen Halbinsel, am Golf von Oman.
Das Emirat Schardscha (oder Asch-Schariqa) bietet einen reizvollen Kontrast zu Dubai: Es ist weniger überfüllt, weniger kommerziell, weniger protzig und hat ganz eigene Sitten. Und da Schardscha-Stadt nur eine kurze Taxifahrt vom internationalen Flughafen Dubai entfernt liegt, ist es tatsächlich ein idealer Zufluchtsort. Am ersten Verkehrskreisel auf der Einfahrt nach Schardscha weisen Verkehrsschilder auf islamische Institutionen wie den OBERSTEN FAMILIENRAT oder die ISLAMISCHE BANK VON SCHARDSCHA hin.
Das Hotel Al-Hamra, in dem ich als Nächstes unterkomme, liegt vielleicht ein oder zwei Güteklassen unter meiner vorherigen Luxusherberge, ist aber angenehm schlicht und wirkt gastfreundlich. (Sein Name bedeutet „das Rote [Haus]“ und entspricht genau demjenigen der berühmten Alhambra von Granada.) Ein Großteil der Empfangshalle wird von einem kastanienbraunen Beduinenzelt in Anspruch genommen, das mit Teppichen, Vorhängen und Kissen üppig ausgestattet ist. Über dem Rezeptionstresen hängt ein großes Porträt des Herrn „Scheich Dr. Sultan“, also von Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, dem Herrscher von Schardscha. Ein Hinweisschild im Aufzug bittet darum, „anständige Kleidung“ zu tragen; nackte Knie und nackte Schultern sind hier nicht erlaubt. Der Pool ist von den beiden Geschlechtern nur getrennt zu benutzen; jeden Tag gibt es zwei Nutzungszeiten für Männer und eine für Frauen. Durch ein winziges Fenster erspähe ich einen kleinen öffentlichen Park mit Rasenflächen und Blumenbeeten, dazu die ebenfalls eher kleine Moschee des Viertels, eine Palme sowie ein Geschäft mit dem vielversprechenden Namen Al-Britannya Grocery Store. In meinem Zimmer nimmt ein großer grüner Pfeil mit der Beschriftung QIBLA etwa die Hälfte des Schminktisches ein. (Qibla bedeutet „Richtung“, und gemeint ist die Gebetsrichtung nach Mekka, die gläubige Muslime fünfmal am Tag einnehmen müssen, wie es der Pflicht zum salāt, zum muslimischen Ritualgebet, entspricht.
In den Lokalzeitungen sind täglich die genauen Gebetszeiten abgedruckt. Von Emirat zu Emirat variieren sie leicht, was mit kleinen Abweichungen in der Sonnenauf- und -untergangszeit zusammenhängt:
Im Hotelzimmer liegt auch ein Faltblatt mit einer Gebetsanleitung bereit. Nach der vorgeschriebenen rituellen Waschung stellt sich der treue „Diener Gottes“ mit dem Gesicht in Richtung Mekka auf und verharrt einen Moment in stiller Reflexion. Dann folgt eine Sequenz genau vorgeschriebener Gesten und Bewegungen, die jeweils von der Rezitation eines rakat oder „heiligen Textes“ begleitet werden (manchmal wird auch die Kombination von Gesten und Texten zusammen als rakat bezeichnet). An erster Stelle steht die feierliche Verkündigung von Gottes Größe, „Allahu Akbar“, wozu die offenen Hände zu beiden Seiten des Kopfes erhoben werden; dann, zweitens, ein Eröffnungsgebet, das mit verschränkten Armen gesprochen wird; drittens ruft der Beter Allah an, wozu er sich tief verneigt und die Hände auf die Knie legt; als Viertes folgt ein längeres Gebet, das in aufrechter Haltung gesprochen wird, fünftens, sechstens und siebtens das dreimalige Niederwerfen vor der Allmacht Gottes in der Haltung, die als sudschūd oder sadschda bezeichnet wird und in der die Stirn des Gläubigen den Boden berührt; achtens setzt man sich aufrecht auf die Unterschenkel und Fersen; neuntens und zehntens dreht man den Kopf nach rechts, um die Engel zu grüßen, beziehungsweise nach links, um den Teufeln zu widersagen. Jeder Gebetszyklus dauert etwa fünf bis zehn Minuten, wodurch man mit den Pflichtgebeten mindestens eine halbe Stunde pro Tag zubringt.
Das Frühstück im Hotel Al-Hamra ist anders als erwartet. Auf einem Fernseher läuft ein russisches Programm, wohl zugunsten einer lärmenden Reisegruppe aus Moskau: Ein orthodoxer Patriarch feiert einen Gedenkgottesdienst und verurteilt mit leidenschaftlichen Worten propaganda protiv Boga, „Propaganda gegen Gott“. Die Uhrzeit auf dem Bildschirm erinnert daran, dass Moskau in derselben Zeitzone liegt wie Dubai, weshalb denn auch die Russen den „Nahen Osten“ der westlichen Welt viel eher als ihren „Nahen Süden“ wahrnehmen. An einem anderen Tisch sitzt eine Gruppe von Spielern und Funktionären des Fußballclubs Al-Yarmouk aus Kuwait. (Der Name ihres Vereins erinnert an eine Schlacht zwischen arabischen Muslimen und byzantinischen Christen im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung.) Die Fußballprofis wie auch die fidelen Moskowiter setzen sich beherzt über die örtlichen Gepflogenheiten hinweg, indem sie schamlos ihre nackten Knie zur Schau stellen. Eine saudische Familie, die ebenfalls beim Frühstück sitzt – die Mutter trägt eine Vollverschleierung aus abaya und niqab –, schaut diskret zur Seite. Auf einer großen Landkarte an der Wand wird der Persische Golf als „Arabischer Golf“ bezeichnet.
Schardscha liegt an einem Fluss, der in den Golf mündet. Sein ganzer Stolz ist die Corniche, eine lange Promenade, die sich über einige Kilometer – vom Jachthafen bis zur Al-Seef-Moschee – am Flussufer entlangzieht. Gesäumt von Bäumen, blühenden Sträuchern und schattigen Ruhebänken, ist hier der ideale Ort für einen Morgen- oder Abendspaziergang, zum Sehen und – Schleier hin oder her – Gesehen-Werden. Hier treffen Saris und Turbane auf abayas, dischdaschas und thabs (die letzteren zwei sind die üblichen Varianten des langärmeligen, knöchellangen Gewandes, das von so gut wie allen erwachsenen arabischen Männern getragen wird). Aber immerhin gibt es keine Religionspolizei, die kontrolliert, dass alle korrekt gekleidet sind – schließlich sind wir nicht in Saudi-Arabien.
Auf einer schattigen Bank an der Corniche kann man ausgezeichnet die Morgenzeitungen durchsehen. In englischer Sprache stehen zwei Blätter zur Auswahl: Gulf News und The Gulf Today. Erstere Zeitung kommt aus Dubai, die zweite erscheint in Schardscha selbst. Beide leisten eine umfassende Berichterstattung über das Geschehen in der Welt, schlagen dabei aber einen spürbar vorsichtigen Ton an. In beiden Zeitungen ist das Datum doppelt angegeben: Sonntag, 15. Januar 2014/Rabi Al-Awwal 17, 1435. Die Blattlinie ist eindeutig. Iran stößt, als schiitisches Land, auf Misstrauen. Die ägyptische Militärregierung, die gerade die Muslimbruderschaft unterdrückt hat, erntet damit Lob; Israel hingegen wird scharf verurteilt. In einem Beitrag auf der Titelseite von The Gulf Today sind die Glückwünsche der VAE an „das ägyptische Volk“ festgehalten.10 Bei Gulf News lautet die Schlagzeile: Keine Beziehungen zu Israel ohne Friedensabkommen.11 Ausführlich werden die Widersprüche in der amerikanischen Außenpolitik analysiert. Und noch ausführlicher ist nur die Berichterstattung zur englischen Premier League mit den aktuellen Spielen des FC Arsenal (der von Dubais Staatsfluglinie Emirates gesponsert wird) und von Manchester City (gesponsert von der Konkurrenz-Airline Etihad mit Sitz in Abu Dhabi). Wo immer von der Regierungspolitik der VAE die Rede ist, wird eine geradezu unterwürfige Ehrerbietung spürbar.
Über den Bürgerkrieg in Syrien, der seit 2011, also inzwischen seit neun Jahren im Gange ist, erfährt man so gut wie nichts. Auch zu den Aktivitäten ihres exzentrischen Nachbarn Katar schweigen die emiratischen Zeitungen. In der internationalen Presse ist – im Unterschied zu den einheimischen Zeitungen – mehrfach davon die Rede, dass mehrere Golfstaaten, darunter die VAE, in Syrien regierungsfeindliche Kräfte unterstützen. Dieses Vorgehen speist sich zum einen aus einer Abneigung gegen das Assad-Regime, zum anderen aus der Solidarität mit den syrischen Sunniten, und teils wohl auch aus der Hoffnung, die Stabilität in Syrien wiederherstellen zu können. Bei den Konflikten in Libyen und Jemen scheinen die Emirate inzwischen eine ganz ähnliche Strategie zu verfolgen. Man darf wohl vermuten, dass in allen drei Fällen genau der entgegengesetzte Effekt eintritt.12
Spätestens um 11 Uhr vormittags treibt die Hitze alle nach drinnen. Das prachtvolle „Museum der islamischen Zivilisation“ direkt an der Corniche bietet kühle, wohltuende Zuflucht. Das 2008 eröffnete Museum ist in einem langgestreckten, eleganten Gebäude aus Honigstein untergebracht, über dem eine goldene Kuppel thront. Hier sollen nicht nur die weltweiten Errungenschaften der islamischen Kultur präsentiert werden, sondern – was vielleicht noch ambitionierter ist – auch die Grundlagen des Islam in einer ausgewogenen und keineswegs triumphalistischen Form. Überall tragen zweisprachige Beschriftungen – auf Arabisch und in einem hervorragend übersetzten Englisch – zum weiteren Ansteigen meiner ohnehin schon steilen Lernkurve bei. So bedeutet das Wort „Islam“ beispielsweise „Unterwerfung unter Gott“. In einer Abteilung, die sich den „fünf Säulen des Islam“ widmet, ist von der „am schnellsten wachsenden Religion weltweit“ die Rede; im Einzelnen wird der Besucher mit den Grundlagen des islamischen Glaubens vertraut gemacht: der schahāda (dem „Glauben an den einen Gott und Seinen Propheten“); dem salāt (dem fünfmal-täglichen Gebet) und zakat (der Pflicht zum Almosengeben); dem saum (Fasten während des Ramadan) und schließlich der hadsch, der Pilgerfahrt nach Mekka. Dazu gibt es eine Ausstellung mit wirklich wunderschön handgeschriebenen Exemplaren des Koran sowie große Modelle der prachtvollsten Moscheen dieser Welt, von Marokko bis Jakarta. Eine andere Abteilung präsentiert einen Überblick über die Wissenschaft und Technik des islamischen Mittelalters, deren stupende Fortschritte in Astronomie, Mathematik, Chemie, Kartografie, Medizin und Ackerbau in der Forschung inzwischen außer Frage stehen. Die Museumsbesucher können selbst Hand anlegen und voll funktionsfähige Modelle von Astrolabien, Schneckenpumpen, Gerätschaften zur Papierherstellung oder zur Destillation von Rosenwasser ausprobieren (Letzteres eine eindrucksvolle Apparatur aus Kupfer und Glas). Es gibt so viel zu sehen und zu erleben, dass die Stunden wie im Flug vergehen, dabei warten im Obergeschoss noch vier riesige Ausstellungssäle mit Keramik, Teppichen und anderen Textilien, Metallarbeiten, Waffen und Musikinstrumenten. „Wer sich auf den Weg macht, um nach Wissen zu suchen“, sagt der Prophet Mohammed einmal, „dem ebnet Gott einen Weg zum Paradies.“*
Wenn man das „Museum der islamischen Zivilisation“ verlässt, schwirrt einem der Kopf vor so vielen schönen Eindrücken und offengebliebenen Fragen – aber es fällt auch auf, dass es sich bei fast allen nicht religiösen Ausstellungsstücken, die mit dem „Goldenen Zeitalter der islamischen Zivilisation“ zusammenhängen (also den fünf Jahrhunderten nach dem Tod des Propheten), um Repliken gehandelt hat. Mehr als tausend Jahre lang haben die Anhänger des Islam ihr kulturelles Erbe also, wie es scheint, entweder vernachlässigt oder sogar vorsätzlich zerstört.
Heute sprudeln glücklicherweise die Erdöleinnahmen, und so können viele Kulturstätten, die lange dem Verfall preisgegeben waren, endlich gerettet oder rekonstruiert werden. So wurde beispielsweise die alte Stadtmauer von Schardscha mitsamt ihren Toren und Türmen nachgebaut und umschließt nun ein eigenes „Kulturviertel“ innerhalb der Stadt. Und die Restaurierungsarbeiten an der ehemaligen Festung der Emire von Schardscha schreiten ebenfalls voran – in einer Straße, die zu beiden Seiten von Wolkenkratzern gesäumt wird.
Das Kalligrafiemuseum von Schardscha ist eine weitere Perle, die von dem gegenwärtig wiederauflebenden Interesse an der islamischen Kultur profitiert. Bei meinem Besuch hatte ich es ganz für mich – wenn man von dem Aufsicht führenden Kustos einmal absieht, der mich zu einem Eintrag in das bereitliegende Gästebuch drängte. Kalligrafie – dieses griechische Wort bedeutet wörtlich „schöne Schrift“ oder „Schön-Schreibung“ – heißt auf Arabisch khatt, „Gestaltung“. Ihre große Bedeutung in der islamischen Kultur verdankt sich dem strengen Bilderverbot im Islam. Vor allem im Mittelalter hat die islamische Welt einige heftige Phasen dessen erlebt, was in der christlichen Tradition als „Ikonoklasmus“ – wörtlich: „Bilder-Bruch“ – oder „Bildersturm“ aufgetreten ist (etwa im Gefolge der Reformation). Also flossen die kreativen und dekorativen Impulse im Islam in das aufwendige Kalligrafieren religiöser Texte, vor allem des Koran. Dabei gibt es zwei grundlegende Schrifttypen: eine eher „eckige“ Schrift, die ursprünglich für Inschriften verwendet wurde, und eine „fließende“ oder Kursivschrift. Die erstere Variante ist die ältere von beiden; sie entstand bereits im 7. Jahrhundert und wird nach der heute irakischen Stadt Kufa die „kufische Schrift“ genannt. Die zweite Variante, die ab dem 10. Jahrhundert Verbreitung fand, tritt in vier Untervarianten auf, die thuluth, naschī, reqā und muhaqqaq heißen. In Persien, am osmanischen Hof und im westlichen China entwickelten sich ausgeprägte regionale Spielarten dieser Schriften. Allen gemein ist, dass sie mit einem „Schreibrohr“ oder qalam aus Schilf auf Papier oder Pergament geschrieben werden, aber auch auf Kacheln, Textilien und Münzen zum Einsatz kommen. „Die Kalligrafie“, heißt es, „ist die Blüte der menschlichen Seele.“
Glücklicherweise braucht es keine großen Fach- oder gar Arabischkenntnisse, um die Schönheit der islamischen Kalligrafie zu würdigen, ganz egal, ob es sich um die elegante Strenge der kufischen Schrift handelt oder um den verspielten Einfallsreichtum der kursiven Varianten. Schon bald hat man gelernt, die basmala zu erkennen, die Anrufungsformel „Im Namen Allahs, des Barmherzigen und Gnädigen“, die im arabischen Original vier Worte umfasst und in Tausenden von kalligrafischen Varianten gestaltet werden kann, von denen eine einfallsreicher und plastischer ist als die nächste. Außerdem ist die islamische Kalligrafie eine höchst lebendige Kunstform; zahlreiche Ausstellungsstücke des Museums sind das Werk von Gegenwartskünstlern aus allen Teilen der Erde.
In allen großen Basaren und Einkaufszentren findet man professionelle Kalligrafen, die für ein Honorar kunstvolle „Maßanfertigungen“ zu Papier bringen – durchaus auch als ein herrliches Souvenir für Touristen. Einer von diesen Profis ist Amir Hossein Golshani im Suk (Basar) Chan Murdschan in Dubai, ein anderer der irakische Künstler Uday al-Aradschi, der seine Werke und die dahinterstehende Philosophie auf seiner Internetseite wie folgt beschreibt: „Uday Aradschi versteht die arabische Kalligrafie als eine Kunst, die mit Formen, Farben, Raumgestaltung, dem Goldenen Schnitt und vielem mehr zu tun hat. [Er] nutzt alle Elemente dieser Kunstform, um visuelle Schönheit erfahrbar zu machen, [und] beherrscht sämtliche Formen der arabischen Kalligrafie. … Alle [seine] Werke entstehen in Handarbeit … auf speziellem Papier.“13
Das islamische Banken- und Finanzwesen ist ein weiteres Thema, das die nähere Beschäftigung lohnt. Im Ausland stößt es oft auf Ablehnung, weil dort die Scharia – das islamische Rechtssystem – ganz unfairerweise oft als ein barbarischer Verhaltenskodex gilt, der außer Enthauptungen für Abtrünnige und Steinigung bei Ehebruch nicht viel zu sagen hat. Dabei ist es nach dem skandalösen Verhalten vieler westlicher Bankmanager in den letzten Jahrzehnten doch einmal sehr erfrischend, wenn ein Finanzsystem ganz augenscheinlich auf ethischen Prinzipien beruht. Im islamischen Wirtschaftsverständnis ist ein freier Markt nicht vorgesehen; Spekulation ist ebenso verpönt wie allzu hohe Zinsen. Stattdessen gilt ein Ethos der finanziellen Fairness, das die Starken davon abhalten soll, die Schwachen auszubeuten, und wodurch das Risiko von Kreditgebern und Kreditnehmern gemeinsam getragen wird. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die „Islamische Bank von Schardscha“, die 1975 als Nationalbank von Schardscha gegründet wurde, diesen Sektor entscheidend geprägt.
Wer in Schardscha shoppen gehen möchte, sollte dies am besten in der Kühle des Abends tun. Die Betreiber der Marktstände in den Suks helfen einer Touristin genauso gern, eine rundum züchtige schwarze abaya zu finden, wie ihrem Begleiter, der eine blütenweiße, bodenlange dischdascha sucht. Anders als die vom Erfolg verdorbenen Ladenbesitzer in den klimatisierten Einkaufszentren von Dubai haben sie Zeit, mit ihren Kunden zu plaudern und ihnen mit ihrer Aufmerksamkeit zu schmeicheln. Einer erwischte mich, als ich gerade im Schatten vor dem Suk Al-Arsa eine Zigarettenpause einlegte. Gestenreich lud er mich ein, seine Waren zu begutachten, und führte mich am Arm in das Innere des Ladens, wo er umständlich und unter allerlei Scherzen seine Kollektion von dischdaschas ausbreitete, deren Größe und vor allem Länge er dabei genauestens prüfte. Zur Sicherheit kaufte ich gleich auch noch eine rot-weiße kufiyah samt dem passenden agal zur Befestigung und einer taqiyah-Kappe als Fundament – vermutlich alles Made in China.
Den schönen Abendspaziergang über die Corniche sollte man sich jedenfalls nicht entgehen lassen. Auf dem Fluss wetteifern Dhaus mit Motorbooten, Paare schlendern über die Promenade, und selbst die Kinder müssen noch nicht ins Bett. Die untergehende Sonne taucht die Minarette der Al-Seef-Moschee in ein rosiges Licht, bis die Beleuchtung angeht und den Bau in lebhafte Violett- und Grüntöne hüllt. Mein Tag endet mit einem Bad im Pool auf dem Hoteldach, den ich ganz für mich habe. Auf dem Wasser spiegelt sich das Mondlicht.
Abu Dhabi, rund 120 Küstenkilometer westlich von Dubai und etwa 160 Kilometer von Schardscha entfernt gelegen, ist sowohl die Hauptstadt der VAE als auch der Sitz des gleichnamigen Emirats, das mit fast 90 Prozent den Löwenanteil an der Gesamtfläche der Föderation ausmacht. Die geläufigste Übersetzung seines Namens lautet „reich an Gazellen“, was vielleicht mit einem altehrwürdigen Wasserloch oder einer Tränke zu tun hat. Über mehrere Jahrzehnte hinweg hat Abu Dhabi sich eher im Hintergrund gehalten, während man in Dubai Pionierarbeit leistete, was den Einsatz von Erdöleinnahmen zur Anbahnung internationaler Kontakte und Partnerschaften anging. So wurden dort Innovation, Expansion und Investitionen aus dem Ausland gleichermaßen gefördert, und das mit geradezu halsbrecherischer Geschwindigkeit: „zwei oder drei Manhattans in einem Viertel der Zeit“, so hat jemand einmal das explosionsartige Wachstum von Dubai beschrieben. In den ersten zehn Jahren des 21. Jahrhunderts hat der vom Gulf Co-operation Council (GCC) vertretene Handelsblock ausländische Investitionen in Höhe von mehr als 30 Milliarden US-Dollar eingeworben.14 Doch während der großen Rezession von 2008 sprang die Wundermaschine von Dubai beinahe aus dem Gleis: Gleich mehrere Staatsunternehmen hatten Schuldenberge angehäuft, die sie nicht mehr zurückzahlen konnten – doch Rettung nahte, und sie kam aus Abu Dhabi. Das Bauvorhaben für den Burdsch Chalifa beispielsweise, der ursprünglich Burdsch Dubai heißen sollte, wurde von Abu Dhabi vor dem drohenden Zahlungsausfall gerettet; als Gegenleistung kam es zu der Namensänderung, sodass der fertige Wolkenkratzer nach dem Emir von Abu Dhabi benannt wurde. In der internationalen Presse war viel von dem „spektakulären Absturz Dubais“ die Rede, in letzter Zeit dann auch davon, dass das Emirat sich wieder „auf dem Weg der Besserung“ befinde.15 Dubais Strategie zur Wirtschaftsförderung wurde überarbeitet.16
Inzwischen hatte Abu Dhabi seinen eigenen schwindelerregenden Aufstieg begonnen. Die Ölreserven des Emirats werden auf 97,8 Milliarden Barrel geschätzt, das sind umgerechnet mehr als 15,5 Billionen Liter, beziehungsweise die Fördermenge eines ganzen Jahrhunderts. Die Fluglinie Etihad aus Abu Dhabi wurde zwar erst 2003 gegründet, ist inzwischen aber eine ernsthafte Konkurrentin der traditionsreichen Emirates aus Dubai. Auch in anderen Bereichen holt das traditionell einflussreichere Emirat Abu Dhabi inzwischen auf – etwa in der High-Tech-Rüstungsproduktion und bei der Atomenergieerzeugung. Über kurz oder lang wird wohl Abu Dhabi, das aktuell etwa 40 Prozent des Gesamt-Bruttoinlandsprodukts der VAE erwirtschaftet, mehr als die Hälfte erzielen. Die Kernpunkte der auf dieses Ziel gerichteten Ambitionen lassen sich einem Planungspapier namens Abu Dhabi Vision 2030 entnehmen, das neben der Vorhersage eines atemberaubenden Wirtschaftswachstums vier konkrete Großprojekte entwirft.17 Eines davon, der Khalifa Port („Chalifa-Hafen“), der auf einer dem Meer abgerungenen Insel vor der Küste entstehen soll, tritt nun schon langsam in die Bauphase ein.18 Das zweite Projekt, ein gigantisches Industriegebiet namens Khalifa Industrial Zone (KIZAD), soll auf einer Fläche von 417 Quadratkilometern Küstenland entstehen und damit eines der größten Industriegebiete der Welt werden.19 Das dritte Projekt ist auf der Insel Saadiyat vor dem Hafen von Abu Dhabi angesiedelt20 und umfasst Kooperationen mit Kultureinrichtungen wie dem Guggenheim-Museum in New York, dem Louvre in Paris und dem Britischen Museum in London; das vierte, Masdar City, entsteht in der Wüste jenseits des Flughafens von Abu Dhabi und soll in den Jahren 2020–2025 fertiggestellt werden. Ein Selbstbewusstsein von solchem Format muss man sich erst einmal leisten können. Der spektakuläre Jachthafen auf der Insel Yas ist seit 2009 Austragungsort von Rennen der Formel 1 („Großer Preis von Abu Dhabi“).
Masdar City wird als ein „arkologisches Projekt“ beschrieben. Wie sich herausstellt, ist „Arkologie“ ein Kunstwort, das die Verschmelzung von Architektur und Ökologie ausdrücken soll und von dem visionären italienischen Architekten und Stadtplaner Paolo Soleri (1919–2013) geprägt wurde. In den 1970er-Jahren wurde auf Soleris Planung und Betreiben die Experimentalstadt Arcosanti in der Wüste von Arizona (USA) erbaut.21 Masdar City orientiert sich eng an dem Vorbild von Arcosanti, nur dass die Planung dieses Mal von einer anderen Architektenlegende, Sir Norman Foster, verantwortet wurde. Mit Masdar City soll eine autarke urbane Umgebung geschaffen werden, die ihrer lebensfeindlichen Umwelt nicht nur trotzt, sondern sogar Nutzen daraus zieht. Eine äußere Ringmauer wird den Wüstenwind abhalten, während ein gigantisches Luftkühlungssystem die Temperaturen auf den Straßen von Masdar City um 15 bis 20 °C absenken soll; die dafür – und für alles andere – benötigte Energie liefern 88.000 Solarmodule. Schon bald sollen hier Forschungsinstitute, Unternehmen und bis zu 50.000 sorglose Einwohner angesiedelt werden, die sich „sauberen Technologien“ und alternativen Energiequellen verbunden fühlen. Es wird keine Autos geben, keine Wolkenkratzer, keine Zersiedelung des Umlandes, keinen Kohlendioxid-Ausstoß und keinerlei Luftverschmutzung.22
Die Bundesregierung der VAE hat übrigens einige noch ambitioniertere Projekte angekündigt. Dazu gehören ein „Regenmacherberg“, der aufgeschüttet werden soll, um für mehr Niederschläge zu sorgen, vier Atomkraftwerke und eine unbemannte Marsmission, die von 2021 an die Atmosphäre des Wüstenplaneten untersuchen soll.23
Abu Dhabis stolzestes Monument ist jedoch bereits gebaut: die gewaltige Scheich-Zayid-Moschee, ohne deren Besuch man wohl weder das geistige Umfeld der wirtschaftlichen Expansion am Golf noch die Rolle des sogenannten „gemäßigten Islam“ wirklich verstehen kann. Das prachtvolle Bauwerk, das im Ramadan 2008 eröffnet wurde, soll als religiöses Glanzstück all die profanen Wolkenkratzer, Einkaufszentren und Paläste überstrahlen. Seine Abmessungen sind enorm; den Boden im großen Gebetssaal bedeckt der größte am Stück gefertigte Teppich der Welt. Dennoch wirken die geschwungenen Linien seiner Kuppeln, Minarette und Innenhöfe warm und elegant, und die allgegenwärtigen Blumenmuster im Inneren der Moschee haben etwas Frisch-Einladendes, beinahe Kindliches. Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die hoch aufragende Moschee sich im zartgrünen Licht der Scheinwerfer vom dunklen Nachthimmel abhebt – Grün ist schließlich die Farbe des Propheten –, strahlt sie eine rätselhafte Spiritualität aus. Dennoch wirkt sie weder triumphal noch bedrohlich. Auch Nichtgläubige sind hier jederzeit willkommen. Die Besucher kommen und gehen, und selbst an diesem heiligen Ort tragen Frauen zwar die abaya und bedecken ihre Köpfe, verhüllen jedoch nicht ihr Gesicht. Mit ihren Freunden und Familien fahren sie vor, lachen und schwatzen, schelten auch einmal ihre Ehemänner und fahren zuletzt selbst wieder vom Parkplatz.
Der Mann, nach dem die Scheich-Zayid-Moschee benannt ist, Scheich Zayid bin Sultan al-Nahyan (1918–2004), war der Gründervater der Vereinigten Arabischen Emirate. (Scheich bedeutet eigentlich „Ältester“ und ist der übliche Ehrentitel für beduinische Stammesführer, oft verwendet man es auch anstelle des formelleren Emir, das heißt „Fürst“; bin Sultan heißt „Sohn des Sultan“ und ist ein sogenanntes Patronym (Vatersname); und al-Nahyan ist der Name des Stammes, der Abu Dhabi in seiner ganzen jüngeren Geschichte regiert hat.) Zayid, der nach arabischen Begriffen noch in der Vormoderne geboren wurde, wuchs größtenteils in der Wüste auf, zwischen den Zelten seines Clans. Seine Erziehung beschränkte sich weitgehend auf die traditionellen Fertigkeiten der Beduinen, auf das Überleben in der Wüste. Sowohl sein Vater, Scheich Sultan, als auch dessen Nachfolger als Herrscher über Abu Dhabi, Scheich Saqr, fielen Attentaten zum Opfer. Über Jahrzehnte lebte Zayid im Schatten eines älteren Bruders, bevor er 1966, gerade rechtzeitig zu Beginn des großen Ölbooms, selbst auf den Thron kam.
In die vierzigjährige Herrschaft Scheich Zayids fielen drei große Errungenschaften, für die der Herrscher heute berühmt ist: erstens die Schaffung der VAE nach fünf Jahren zäher Verhandlungen mit den Briten, zweitens seine Strategie einer „Begrünung der Wüste“ durch ölfinanzierte Wohlfahrts- und Entwicklungsprojekte sowie drittens eine beispiellose Ära inneren wie äußeren Friedens. Zayid war beileibe kein Liberaler, sondern ein frommer Muslim mit vier Frauen, und ein Despot, der keinen Widerspruch duldete. Als die New York Times ihn einmal nach der Aussicht der VAE auf ein demokratisches Parlament fragte, antwortete er: „Warum soll man ein System einführen, das nur zu Meinungsverschiedenheit und Konfrontationen führt?“ Aber er war auch ein geschickter Vermittler, ein großzügiger Wohltäter und ein aktiver Verteidiger der Stabilität in der Region. Nachdem ihn die anderen Scheichs 1971 zum ersten Präsidenten der VAE gewählt hatten, blieb er in diesem Amt bis zu seinem Tod im Jahr 2004.24
Im Gegensatz zur Scheich-Zayid-Moschee gibt sich das mit sieben Sternen ausgezeichnete Emirates Palace Hotel in Abu Dhabi ganz ungeniert als Tempel des Mammon. Als Normalsterblicher kann man seine umwerfende Opulenz kaum begreifen. Eine Penthouse-Suite mit Blick auf den Golf kostet schlappe 11.000 Dollar pro Nacht; im Restaurant steht eine Flasche Saint-Émilion Grand Cru für 17 500 Dollar auf der Weinkarte; und auf dem Hotelflur findet sich ein „Gold-to-go“-Automat, der für 5000 Dollar das Stück Miniatur-Goldbarren ausgibt. Hoch über den Köpfen der staunenden Besucher bringen Arbeiter an der Decke zwischen ausladenden Swarowski-Kronleuchtern Applikationen aus Blattgold an, während sich Touristen heimlich auf die Toiletten schleichen, um deren Pracht mit eigenen Augen zu sehen. David Beckham, der englische Fußballstar, hat hier übernachtet, als er zum Kauf einer Villa auf der „Palmeninsel“ Palm Jumeirah in Dubai war; die restlichen Häuser waren Berichten zufolge binnen einer Woche ausverkauft.
Aber das Emirates Palace ruht sich keineswegs auf seinen Lorbeeren aus. Eine ständige Ausstellung im Untergeschoss des Hotels umfasst spektakuläre Dioramen der geplanten Kulturquartiers auf der Insel Saadiyat, einschließlich futuristischer, maßstabsgetreuer Modelle des künftigen Zayid-Nationalmuseums, des Guggenheim AD und des Louvre AD, die allesamt von Meerwasser umgeben sein werden. Das Nationalmuseum aber wird die absolute Hauptattraktion sein. Aus fünf Edelstahl-Türmen soll es bestehen, die die Form von Bienenflügeln haben werden. Ein wenig wie die Flame Towers von Baku sehen sie aus, und diese Form soll – im Sinne einer sogenannten „solaren Klimatisierung“ – als eine Art natürlicher Klimaanlage wirken. Der Entwurf für die Guggenheim-Dependance sieht eine ganz ähnliche Ansammlung asymmetrischer Formen vor, die nun allerdings in Beton ausgeführt werden. Als Verbindungselemente zwischen den Gebäuden dienen gewaltige Röhren aus Milchglas. Der Louvre-Komplex (Eröffnung war im November 2017) besteht aus vielen kleinen Gebäuden und Palmengärten, über denen ein freistehendes „UFO-Dach“ zu schweben scheint. Und diese Zukunft, die in dem Plan für eine Vision 2030 entworfen wird, soll in knapp einem Jahrzehnt schon Wirklichkeit geworden sein. „Wenn der Mensch Pläne schmiedet“, sagt jedoch ein arabisches Sprichwort, „kann Gott nur schmunzeln.“
Die wagemutige Architektur der Abu Dhabi Vision 2030 ist von Fachleuten durchweg gelobt worden. Die Motive jedoch, die dahinterstehen, haben nicht selten für Stirnrunzeln gesorgt. Manche halten das Vorhaben für den Ausdruck einer massiven, vom Öl-Reichtum befeuerten Eitelkeit; andere können darin nichts anderes als tätige, leidenschaftliche Vaterlandsliebe erkennen, einen Beitrag zur andauernden „Staatswerdung“ der VAE: Seit Menschengedenken waren die Emiratis und ihre Vorfahren Nomaden, die in der Wüste umherzogen. Jetzt muss man sie erst einmal davon überzeugen, dass ihr raketengleicher Flug in die Zivilisation der Gegenwart mehr gewesen ist als nur eine Fata Morgana. Ähnliche Vorhaben gibt es auch im benachbarten Katar, dem reichsten Land der Erde, und nach Ansicht der New York Times besteht der Sinn der Übung in beiden Fällen darin, „die nationale Identität neu zu definieren“, „das angeschlagene arabische Image aufzupolieren“ und „eine Balance zwischen Modernisierung und islamischer Tradition zu finden. „Scheich Chalifa [der Präsident der VAE] und seine Regierung wollen erreichen, dass eine junge Generation von Emiratis stolz ist auf ihre Nation; zugleich wollen sie ihnen aber auch das nötige intellektuelle wie psychologische Handwerkszeug vermitteln, um in der Weltgesellschaft von heute bestehen zu können.“25
In seiner heutigen Gemütslage zeigt Abu Dhabi also mehr Interesse an der Zukunft als an der Vergangenheit. Die historische Festungsanlage der Stadt ist weit weniger bedeutend als die von Dubai; und das bescheidene Museumsdorf, mit dem weit draußen am Jachthafen die vielfältigen Unterschiede zwischen gestern und heute greifbar gemacht werden sollen, übersieht man leicht. Vor dem Eingang lungern Jugendliche in traditioneller arabischer Kleidung auf der Ufermauer herum – wobei sie unweigerlich ihre makellos weißen Gewänder beschmutzen – und feuern ihre Kameraden an, die mit Rennboten durch das Hafenbecken pflügen. Man setzt sich einfach auf eine nahe gelegene Bank, lässt den Blick über das Wasser schweifen, wo protzige Wolkenkratzer über der Abu-Dhabi-Variante einer Corniche emporragen, und sinnt darüber nach, dass hier noch vor einigen Jahrzehnten nichts war als nur ein menschenleerer Strand.
Wer die Oase Al-Ain besuchen will – der Name bedeutet entweder „das Auge“ oder „die Quelle“ –, muss sich auf eine zweistündige Autofahrt über die leere, sandüberwehte Schnellstraße gefasst machen, die von Abu Dhabi aus in Richtung Süden führt. Auf dem Weg fährt man ein Stück am Begrenzungszaun des Luftwaffenstützpunkts Al-Dhafra entlang, wo neben den F16-Kampfjets der emiratischen Streitkräfte auch amerikanische Truppen stationiert sind. Früher war Al-Ain „nur“ eine von Saudi-Arabien beanspruchte Oase; heute ist es zu einer beachtlichen Stadt herangewachsen, die mehrere Universitäten, Forschungsinstitute und produzierende Unternehmen beherbergt. Auch diese Siedlung hat jedoch überraschend weit zurückreichende Wurzeln.
In der Hitze des Tages bin ich der einzige Besucher am archäologischen Freilichtmuseum von Hili. Der überaus motivierte Fremdenführer holt sofort zu einem im wahrsten Sinne des Wortes erschöpfenden Rundumschlag aus: Wir besichtigen alle und sämtliche prähistorischen Grabhügel, Hügelgräber und Grabkammern in der näheren Umgebung. Mein australischer Buschhut kann einen Sonnenstich gerade so abhalten. „Mad dogs and Englishmen …“, murmele ich vor mich hin.* Es ist kaum zu glauben: Schon während der Bronzezeit, vor 7000 Jahren, lebten hier Menschen. Das Basrelief eines Löwen, das sich seit 5000 v. Chr. auf einer Steinplatte der großen Grabkammer findet, regt die Vorstellungskraft an, genauso wie die Erzählungen von prähistorischen Kupferminen, von Kamelkarawanen, die die Arabische Halbinsel durchqueren, und vom Seehandel mit dem alten Mesopotamien. Mein Besuch im Archäologiepark war auf jeden Fall die bessere Wahl im Vergleich mit der benachbarten Hili Fun City.
Im Herzen der Oase gibt es ein ausgedehntes Netz von antiken Bewässerungskanälen und dazu willkommenen Schatten. Mehr als 100.000 Dattelpalmen gedeihen hier prächtig – dem faladsch-Bewässerungssystem sei Dank. Diese uralten Wasserkanäle fließen in der Oase über eine Reihe gestufter Ebenen hinab und versorgen so eine Fläche von mehr als zwölf Quadratkilometern mit dem kostbaren Nass. Für die Beduinen – und nicht nur für sie – sind der Geschmack saftiger Datteln und das leise Plätschern fließenden Wassers ein wahrer Balsam für die Seele.
Das Prunkstück von Al-Ain ist jedoch zweifellos das Fort Al-Dschahili – eine wuchtige Festung wie aus einem alten Abenteuerfilm, halb Indiana Jones, halb Lawrence von Arabien. Rund um die hellen Lehmmauern erstreckt sich ein Meer von Dünen bis ins Unermessliche. Wenn man das Tor durchschreitet, kommt man in einen Innenhof, auf dessen Steinpflaster eine Handvoll mit Kalk weiß getünchter, niedriger Gebäude verteilt sind. Heute beherbergen sie das Stadtmuseum, aber früher einmal war dieses Fort die Residenz des Provinzgouverneurs sowie das Hauptquartier der Trucial Oman Scouts (siehe unten). Ein betagter Kellner – ein Relikt des britischen Empire ganz wie ich selbst – gießt mir aus der schnabelartigen Tülle einer reich punzierten Bronzekanne süßen arabischen Kaffee ein.
„Die TOS-Piloten“, beginnt er, „haben das Fort als Flugplatz genutzt. Mit ihren Doppeldeckern sind sie direkt vor den Mauern auf dem Sand gelandet und geradewegs hier hereinspaziert, um sich einen Drink zu genehmigen.“
Meine größte Überraschung stand mir allerdings noch bevor. Als ich meinen Kopf in einen Ausstellungsraum des Stadtmuseums stecke, stellt sich heraus, dass dieser dem britischen Schriftsteller und Forschungsreisenden Sir Wilfred Thesiger (1910–2003) gewidmet ist. Ein bisschen etwas wusste ich über ihn. Er hatte am Magdalen College in Oxford studiert, wie ich selbst; auch sein Buch Arabian Sands (dt. Die Brunnen der Wüste), ein Klassiker der Reiseliteratur, war mir bekannt. Ich hatte ihn immer für einen typischen Spätviktorianer gehalten, einen eigenwilligen Exzentriker vom Schlag eines Richard Burton oder eines Charles M. Doughty. In diesem Ausstellungsraum nun füllte ein herrliches Foto von ihm eine ganze Wand aus: Hoch auf einem Felsen stehend und in die traditionelle Tracht der Beduinen gekleidet, trägt Thesiger darauf einen Karabiner nebst einem Gewirr von Patronengurten und dem dazu passenden, ein wenig hochmütigen Lächeln. Der Mann auf dem Foto ist schmutzig, sonnenverbrannt und bärtig wie ein Bär – so gar nicht der viktorianische Schöngeist, den ich im Sinn gehabt hatte. Neben ihm stehen die beiden jungen Beduinen, die ihn über fünf Jahre hinweg auf seinen Reisen durch die Rub al-Chali, das „Leere Viertel“ von Arabien, begleitet haben. Am meisten überraschte mich jedoch die Jahreszahl, mit der das Foto datiert war. Nachdem er die Arabische Halbinsel zu Fuß durchquert hatte, tauchte Thesiger eines Tages aus den Weiten der Wüste auf und gelangte nach Al-Ain – im Jahr 1959! Dabei sahen das ganze Foto und insbesondere Thesigers Erscheinungsbild eher nach 1859 aus.
Auf der Rückfahrt an die Küste führt die untere Straße von Al-Ain direkt durch die Oase Al-Wathba, das Mekka des Kamelrennsports, das Newmarket oder Ascot aller Kamelliebhaber. Jedes Jahr findet hier der Scheich-Zayid-Grand Prix statt, bei dem während fünf Tagen im Januar etwa 10.000 Kamele (oder vielmehr deren Eigentümer) um üppige Preisgelder konkurrieren. In der Nebensaison finden hier auch Rad- und Pferderennen statt.
Für Uneingeweihte ist Camelus dromedarius ein eher hässliches, plumpes und übelriechendes Tier. Sein Gesicht zieren drei Paar Augenlider und übertrieben lange Wimpern; sein Rücken wird durch einen seltsamen Höcker verunstaltet; beim Wiederkäuen macht es laute, abstoßende Geräusche wie eine Kuh und bekommt dann ebenso heftige wie unschöne Blähungen; wenn man es ärgert, dann spuckt es voller Bosheit;* sein Urin hat eine sirupartige Konsistenz und es paart sich – ein Unikum im Tierreich – in sitzender Haltung. Für den Beduinen jedoch ist so ein Dromedar ein Lebensretter: ein zähes Lasttier; das beste Transportmittel für die Reise in der Wüste; dazu noch eine Quelle von Fleisch, Milch, Leder, Fell und Brennstoff in Form von Dung; für die Emiratis von heute schließlich ist das Dromedar die Verkörperung ihres kulturellen Erbes. Sie lieben ihre Dromedare, wie viele Europäer Pferde lieben. Wenn sie zum Kamelrennen gehen, dann nehmen sie Tuchfühlung mit ihrer Vergangenheit auf. Außerdem kann so ein Dromedar – trotz seiner Spreizfüße und ungelenk wirkenden Beine – ein durchschnittliches Rennpferd problemlos überholen und selbst über lange Distanzen eine Reisegeschwindigkeit von 40 km/h beibehalten. Um ein Dromedar zu reiten, benötigt man einen speziellen Sattel, der oben auf dem Höcker festgeschnallt wird; die Jockeys müssen natürlich möglichst klein und leicht sein, meist sind sie noch halbe oder sogar ganze Kinder. Mit ihren Knien klammern sie sich mehr schlecht als recht fest – und nicht selten kommt es zu Unfällen: Da sie doppelt so hoch sitzen wie ein Pferdejockey, können sie auch doppelt so tief fallen und verletzen sich dabei schwer.
Das Glücksspiel ist im Islam verboten; es ist die „vierzehnte schwere Sünde“ und „das Werk Satans“. Die Scharia sieht harte Strafen vor, darunter Peitschenhiebe. In den VAE gibt es keine Lotterie und keine Wettbüros. Zum Glück hat der Prophet jedoch entschieden, dass Wetten bei Bogenschieß-Wettbewerben, Pferde- und Kamelrennen zulässig sind. „Selbst die Engel gehen zum Kamelrennen“, heißt es hier. Entsprechend fehlt es rund um den Rennbetrieb nicht an Geld. Die besten Dromedare kosten bis zu 500.000 Dollar. Reiche Emiratis setzen unerhörte Summen und waschen ihr Gewissen dann mithilfe eines anderen islamischen Gebots wieder rein: Sie spenden großzügig für wohltätige Zwecke.
Aber in den Rennställen, wo die Jockey-Jungen leben und schuften müssen, kommen die Engel anscheinend nicht sehr oft vorbei. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sind Gewalt und Ausbeutung dort an der Tagesordnung. Die meisten der Jungen sind eigentlich moderne Sklaven, die in Indien oder Pakistan angekauft und dann heimlich an den Golf geschmuggelt werden, ohne dass irgendjemand Fragen stellt. Wenn sie aus Verletzungsgründen – oder weil sie schlicht zu groß geworden sind – nicht mehr reiten können, lässt man sie rücksichtslos fallen. Zwar gilt in den VAE seit 2002 ein Gesetz, das den Import solcher „Jockeysklaven“ verbietet, und man hat sogar Robo-Jockeys als Ersatz eingeführt, aber hinter den Kulissen gehen die Menschenrechtsverstöße weiter. Auch die Organisation Anti-Slavery International hat sich der minderjährigen Jockeys vom Golf angenommen.26
Auch die drakonischen Gesetze gegen Homosexualität, die unter bestimmten Umständen sogar die Todesstrafe vorsehen, sind von Menschenrechtsorganisationen scharf verurteilt worden.27 Die weibliche Genitalverstümmelung grassiert vor allem in den traditionellen Stammesgemeinschaften, wo die staatlichen Verbote in dieser Sache schlicht ignoriert werden.28
Das Gefängnis von Al-Wathba liegt zwar abseits der üblichen Touristenpfade, aber im Jahr 2011 hat es doch für weltweite Schlagzeilen gesorgt – als nämlich eine Australierin öffentlich machte, wie sie dort misshandelt worden war. Ohne Gerichtsverfahren hatte man Yvonne Randall eingesperrt, unter dem Vorwand, sie hätte ihre Hotelrechnung nicht bezahlt. Ihrer Darstellung zufolge war die Rechnung nicht gezahlt worden, weil ihr Arbeitgeber ihr die Kreditkarte gestohlen hatte, als sie versuchte, ihr Arbeitsverhältnis zu beenden.29
Alle diese Dinge scheinen so überhaupt nicht zu einer weiteren Attraktion der Oase zu passen: dem Feuchtschutzgebiet Al-Wathba. Süßwasserseen sind in den Golfstaaten eine große Seltenheit, und ein Flamingo-Reservat ist wohl noch viel seltener. Im Allgemeinen fühlen die Emiratis sich den Tieren der Wüste jedoch sehr verbunden. Insbesondere die Weiße oder Arabische Oryx-Antilope (Oryx leucoryx) hat es ihnen angetan. Diese herrlichen, schneeweißen Tiere mit den langen, leicht gebogenen Hörnern befanden sich lange am Rand der Ausrottung, aber mittlerweile haben sich die Bestände erholt – nicht zuletzt dank intensiver Schutzmaßnahmen – und die Oryx sind zum emiratischen Nationalsymbol avanciert. Die Antilopen können monatelang ohne Wasser auskommen, und die Beduinen glauben, dass die Tiere, die sie al-Maha nennen, nur dem Geräusch unterirdischer Wasserläufe folgen müssten, um stets eine Quelle zu finden. Bei den alten Ägyptern waren sie ein ganz besonderes Opfertier, und für Aristoteles waren sie es, die hinter den Berichten über angebliche Einhörner steckten. Vor der Gründung der VAE waren die Oryx-Antilopen durch intensive Bejagung beinahe ausgerottet, doch dann hat ihr Bestand sich dank dem leidenschaftlichen Einsatz von Tierschützern wieder erholt. Im Jahr 1968 hat man die letzten vier frei lebenden Exemplare eingefangen und als Zuchtherde auf eine Insel gebracht, die sich im Privatbesitz des Emirs, Scheich Zayid, befand. Heute gibt es wieder 500 Tiere, Tendenz steigend. Am besten kann man sie im Al-Maha-Reservat von Dubai oder im Wildpark von Sir Bani Yas beobachten. Die Weiße Oryx ist tatsächlich eine Tierart, die „von den Toten auferstanden“ ist.
Als „Geschichte“ im Sinne einer Erzählung gibt die Geschichte der Südküste des Persischen Golfs leider nicht viel her. Schuld daran sind das extreme Klima und die nur sehr spärliche Besiedlung der Region. Erzählen kann man nur vom Aufstieg und Niedergang größerer oder kleinerer Scheichtümer, von Handelsrivalitäten und den Beziehungen zwischen lokalen und regionalen Machthabern. Im 19. und im frühen 20. Jahrhundert waren die Scheichtümer unbedeutend und harmlos. Zwischen dem Osmanischen Reich im Norden und dem Sultanat Oman im Süden positioniert, fürchteten die sunnitischen Scheichs zwar am meisten das schiitische Persien auf der anderen Seite des Golfs, legten jedoch durchaus Wert auf ihre Unabhängigkeit von den osmanischen Sultanen, deren Herrschaftsgebiet von Mesopotamien bis zu der Felsenküste von Al-Katr (Katar) reichte. Insofern gründete die „Zusammenarbeit“ der Scheichs vom Golf mit dem britischen Weltreich, die im frühen 19. Jahrhundert ihren Anfang nahm, auf einem beiderseitigen Interesse. Der entsprechende Vertrag von 1820, durch den ein lose gebundenes politisches Gebilde namens Trucial Coast („Vertragsküste“) ins Leben gerufen wurde, richtete sich nominell gegen die in den Gewässern vor dieser Küste grassierende Seeräuberei – weshalb viel häufiger von der „Piratenküste“ die Rede ist –, zielte tatsächlich jedoch auf eine Zementierung des Status quo. Die Briten wollten ihren Seeweg nach Indien schützen, und die Scheichs wollten Schutz vor äußerer Einmischung. Ein 1853 mit den „Vertragsscheichtümern“ geschlossener „Ewiger Seefrieden“ (Perpetual Maritime Truce) räumte der Royal Navy die Seehoheit im Persischen Golf ein; dazu wurde in Buschehr an der persischen Golfküste eine britische Residentur eingerichtet.30 Mit einem weiteren Vertrag wurde 1892 aus der eher locker gefassten „Vertragsküste“ der deutlich klarer verfasste „Vertragsoman“ (auf Englisch Trucial States). Dabei behielten die Scheichs in inneren Belangen freie Hand, traten ihre außenpolitische Vertretung jedoch an Großbritannien ab. Falls nötig, trat der britische Resident auch einmal als Vermittler zwischen den Scheichs auf; zur Durchsetzung etwaiger Sanktionen standen ihm jedoch nur sehr begrenzte (Streit-)Kräfte zur Verfügung.31
Die Herrscherfamilien der heutigen VAE stammen alle „aus altem Geschlecht“, und alle stehen in einem Abstammungs- oder sonstigen Verwandtschaftsverhältnis zu noch größeren Clans oder Stämmen. Gemeinhin ist von den „zehn Familien“ die Rede, womit die Clans gemeint sind, die in den unabhängigen arabischen Staaten am Persischen Golf seit deren Gründung an der Macht gewesen sind:
| die Al-Sabah aus Kuwait die Al-Chalifa aus Bahrain die Al-Thani aus Katar die Al-Maktum in Dubai die Al-Qasimi in Schardscha | die Al-Nuaimi in Adschman die Al-Scharki in Fudschaira die Al-Nahyan in Abu Dhabi die Al-Said in Oman und in Sansibar die Al-Mu’alla in Ras al-Chaima und Umm al-Qaiwain |
Sowohl die Familie Al-Nahyan als auch die Familie Al-Maktum stammt von demselben Beduinenstamm ab: den Bani Yas, eigentlich eine Föderation verschiedener Beduinenstämme aus dem Landesinneren. Die Al-Nahyan herrschen in Abu Dhabi schon seit 1761; die Al-Maktum sind in Dubai 1833 an die Macht gekommen, achthundert Stammeskrieger der Bani Yas eroberten damals die Küste. Die Familie Al-Nuaimi aus Adschman bezeichnet sich selbst als Quraischi, das heißt als direkte Nachfahren des Propheten. Die Al-Qasimi aus Schardscha begnügen sich mit einer Abstammung von Mohammeds Schwiegersohn, dem Imam Ali. Einer ihrer Söhne, Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, war es, dessen Porträt über dem Rezeptionstresen meines Hotels gehangen hatte; ein anderer, Saud bin Saqr Al-Qasimi, ist der gegenwärtige Emir von Ras al-Chaima. Ihre Vorfahren waren die Anführer jener Piraten, die im 18. Jahrhundert den Persischen Golf unsicher machten und so in Konflikt mit den Omanis und später auch mit den Briten gerieten. Den Seekrieg zwischen diesen Seeräuberclans und den Briten beendete schließlich der Vertrag von 1820.
Die Frage, ob die Trucial States jemals ein echter Bestandteil des britischen Weltreiches waren, bleibt strittig. Die Briten betrachteten ihr Protektorat am Persischen Golf durchaus als Teil ihres imperialen Netzwerks, wenn auch als einen eher lose assoziierten Teil. Die Scheichs sahen sich selbst vermutlich als Verbündete Großbritanniens und nicht als britische Kolonialuntertanen. Aber weder in der Encyclopædia Britannica von 1910/11 noch in Onkel Normans Briefmarkenalbum aus derselben Zeit findet sich ein Eintrag für die Trucial States. Das Lexikon behandelt die Region als Teil seines umfangreichen Artikels über „Arabien“; die dort abgedruckte Karte weist das Gebiet zweifelsfrei als Teil von Oman aus. Nur drei Orte sind überhaupt bezeichnet: Abu Dhabi, Schardscha und „Birema“ (Al-Ain). Entlang der Piratenküste ist der Name „Jewasimi“ geschrieben, was sich fraglos auf das Territorium der Al-Qasimi bezieht.32 Der Artikel der Encyclopædia Britannica über Oman wiederholt die Behauptung, „das Al-Katr-Gebirge in der osmanischen Provinz El-Hasa“ bilde die nördliche Grenze des Sultanats.33 Anscheinend waren die Informationen der Redaktion ein wenig veraltet.
Das wirtschaftliche Potenzial der Region wurde bereits in der Zwischenkriegszeit erkannt, aber noch nicht ausgeschöpft. 1932 wurde bei Schardscha eigens ein Fort errichtet, um eine dort befindliche Landebahn der British Imperial Airways zu schützen, und eine Tochtergesellschaft der Iraq Petroleum Company, die Petroleum Concessions Ltd. (PCL) wurde gegründet, um sich alle Optionen für eine zukünftige Erschließung der Region zu sichern. Alle betreffenden Konzessionen wurden von den örtlichen Machthabern vergeben und bestätigt, was deren Einfluss und Bedeutung stark ansteigen ließ.34 Mit der Erfindung der Zuchtperlen in Japan in den 1920er-Jahren brach die traditionelle Perlenfischerei im Persischen Golf zusammen – eine wirtschaftliche Katastrophe für die Region.
Von den Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs blieben die Trucial States verschont. Allerdings kam es zu Störungen im Handel und auch zu akuten Knappheiten. Wer damals Kind war, erinnert sich noch heute an diese schlimme Zeit:
Meine Großeltern lebten in Al-Hamriyah, nahe dem Meer. Während [des Krieges] blieben die Schiffe aus, die sonst aus Indien und anderen Ländern kamen, und so mussten die Leute hungern. Mein Großvater fing Fische, und meine Großmutter zerteilte den Fisch in Stücke und verkaufte ihn in der Gegend. Später zogen sie nach Dhaid, im Landesinneren, wo sie Landwirtschaft betrieben. Es gab weder Geschäfte noch Märkte dort, und so mussten sie mit dem Kamel bis nach Schardscha, um Zucker und ähnliche Vorräte zu kaufen. Eine Tagesreise nach Schardscha – und eine Tagesreise zurück.
Als ich klein war, ging ich mit meinem Großvater oft auf seinen Hof, wo er die Kamele molk. Die Milch war schaumig – „echte Kamel-Eiskrem“, scherzte mein Großvater. Wir nahmen die Milch, gaben frischgebackenes ragag hinein [ein dünnes, crêpeartiges Fladenbrot] und gossen Honig darüber. Das fanden wir köstlich.35
Die Erziehung dieser Kriegskinder beschränkte sich noch immer auf drei oder vier Jahre in einer mutawwa, einer „Lehrerschule“. Die Schüler saßen unter einem Sonnensegel im Sand und lauschten der Rezitation des Lehrmeisters mit dem Turban, der ihnen die heiligen Texte des Koran und die Hadithe (Aussprüche des Propheten Mohammed) vortrug. Die wichtigsten Passagen mussten sie auswendig lernen, dazu auch die Anleitung zu den islamischen Ritualen, und wenn sie Glück hatten, bekamen sie auch ein wenig Schreib- und Kalligrafieunterricht. Mathematik oder Naturwissenschaften standen nicht auf dem Lehrplan, von Englischunterricht ganz zu schweigen.36
Mit dem Verlust des indischen Kolonialreiches 1947 verlor Großbritannien zugleich die strategische Existenzberechtigung für sein Protektorat am Persischen Golf. „Rückzug aus den Gebieten östlich des Sueskanals“, lautete nun die Devise. 1946 wurde die britische Residentur von der iranischen Hafenstadt Buschehr nach Bahrain verlegt. Und doch blieb an der „Vertragsküste“ ein geschlagenes Vierteljahrhundert lang alles beim Alten, bevor dann endlich doch ein politischer Wandel einsetzte, während die nahöstliche Ölindustrie bereits ihren unaufhaltsamen Expansionskurs eingeschlagen hatte.
In den Tagen vor dem großen Ölboom verirrten sich nur wenige auswärtige Besucher in die Emirate am Persischen Golf; entsprechend rar sind auch die Reiseberichte und Schilderungen der damaligen Lage. Einer der wenigen, der seine Erinnerungen an diese Zeit mitgeteilt hat – die Zeit vor dem Öl und vor der Unabhängigkeit –, ist Munir Al-Kaloti, ein arabischer Geschäftsmann, der im Laufe seines Lebens zu einem der reichsten Männer in den Emiraten aufgestiegen ist:
[Mein] Visum … hatte ich vom britischen Konsulat in Amman in Jordanien. Von den VAE war damals ja noch überhaupt keine Rede. Zwischen Abu Dhabi und Dubai konnte man nicht frei reisen. … Es gab keine asphaltierten Straßen, kein Haus mit mehr als einem Stockwerk … Alles stand noch ganz am Anfang.
Das Erste, was ich [nach meiner Ankunft in den Emiraten] fand, waren überaus freundliche Menschen, sehr gastfreundlich, sehr arm … Sie hatten nichts. Es gab keinerlei Stromversorgung. Ich wohnte bei Freunden, die hatten einen Generator für die Glühbirnen … Ab und an fuhr ich nach Zabeel [ein Stadtteil von Dubai] zu einer Audienz bei Scheich Raschid [dem damaligen Emir von Dubai]. Er setzte sich immer vor seinen Palast, und jeder, der eine Frage oder eine Bitte oder ein Problem hatte, konnte zu ihm kommen, einer nach dem anderen. Und der Emir saß dort auf seinem Holzschemel, rauchte seine berühmte Pfeife … und empfing wirklich jeden.
Wenn der Ramadan kam, kaufte Scheich Raschid jedes Jahr riesige Mengen Fleisch für seine Leute, für das Fastenbrechen am Abend und für das Eid-Fest am Ende der Fastenzeit. Und dann stellten die Leute sich vor dem Palast in die Schlange und baten um eine bestimmte Menge Vieh, und dann schloss der Scheich mit [mir] einen Handel, damit ich die benötigten Tiere importierte. … Ziegen liebt man hier besonders, … weil das Fleisch so mager ist; in der Hitze kann man nicht so fett essen … Neben dem Scheich saß ein Beamter [namens] Kamal Hamza. Der sagte dann zu mir: „Gut, du wirst also das Vieh [kaufen].“ Und dann fingen wir an zu feilschen.37
Offizielle Aufgabe der 1951 gegründeten Trucial Oman Scouts war es, entlang der Grenzen zu patrouillieren und dabei ein besonders wachsames Auge auf die Beduinen zu werfen, die immer wieder ohne Vorwarnung aus dem nahe gelegenen Leeren Viertel herüberkamen.* Inoffiziell sollten sie jedoch den in der Region noch immer grassierenden Sklavenhandel unterbinden und saudische Infiltrationsversuche abwehren. Im Jahr 1957 zählten die Scouts 150 britische Offiziere, die rund 1000 arabische Soldaten befehligten; Letztere rekrutierten sich teils aus der vormaligen „Arabischen Legion“ des Königreiches Jordanien, teils aus den desertionsanfälligen Aufgeboten lokaler Machthaber.
Ein Veteran eines Lufttransportgeschwaders der Royal Air Force erinnert sich an Gegebenheiten seines Militärdienstes am Golf wie folgt:
Im Jahr 1961 wurde ich als scharwisch (Feldwebel) zu den Trucial Oman Scouts abgestellt. … Eine Zeitlang haben wir Patrouillen in das ‚Leere Viertel‘ geschickt [und] ich wurde zu deren Versorgung abkommandiert. … Man gab mir ein Flugzeug – eine Twin Pioneer –, als Piloten einen Unteroffizier, der gern auch mal einen über den Durst trank, und dazu noch einen Navigator.
Der Pilot bezeichnete seine übliche Vorgehensweise als „Dünenhüpfen“ – das heißt, er flog in etwa sechzig Metern Höhe über die Wüste, in der einen Hand eine Thermoskanne Kaffee (mit Schuss), die andere am Steuerknüppel. … Wir transportierten alle möglichen Versorgungsgüter: Benzin, Öl, Schmierstoffe und so weiter, oft auch Ziegen. Dann wurde ich doch wirklich gefragt, ob ich diesen ganzen Kram nicht [während des Fluges] abwerfen könne, [die Landung] sei so schwierig! Also erklärte ich – mit der gebotenen Höflichkeit, versteht sich –, dass der Abwurf lebendiger Ziegen aus sechzig Metern Höhe in der Folge zu gewissen Problemen führen könnte …
[Nachdem wir wieder einmal Benzin, Öl, Schmierstoffe und so weiter geladen hatten], legte ich den verbliebenen Laderaum mit einer großen Plane aus. Dann wurden die Ziegen angeliefert und der Pilot, der Navigator und ich begannen, sie ordnungsgemäß festzubinden. Schließlich flogen wir los, [aber] nach ungefähr einer Stunde Flugzeit gelang es acht der Ziegen, sich loszumachen. Der Pilot und der Navigator schlossen sich im Cockpit ein und überließen mich meinem Schicksal. Ich verbrachte die nächsten anderthalb Stunden mit dem Versuch, die widerspenstigen Tiere wieder einzufangen, die selbstverständlich überall hinpinkelten und das gesamte Flugzeug vollkackten. … Und das „Dünenhüpfen“ war in dieser Situation auch nicht gerade hilfreich.
Wir landeten und die Frachtluke wurde von außen geöffnet. Vierzehn Ziegen, die schier außer sich waren vor Angst, rannten in die Wüste davon, gefolgt von einem schwer traumatisierten Feldwebel, der haargenau so aussah – und auch so roch – wie sie. Es dauerte zwei Wochen und erforderte einiges an Seife und Schrubberei, bis die Kameraden sich wieder auf weniger als zwanzig Meter an mich heranwagten … Wie heißt es doch so schön: NIL SINE LABORE – nichts ohne Mühen.38
Wilfred Thesiger kam gerade noch rechtzeitig, um die traditionelle Lebensweise der Menschen in dieser Region festzuhalten, bevor sie für immer verschwand. Seine Darstellung ist zu Recht berühmt für die tiefe Empathie, mit der Thesiger den vormodernen Gesellschaften begegnet, die er besucht, allen voran die Marsch-Araber im Süden des Irak und die Beduinen des Leeren Viertels. Auf seiner ersten Reise an die Ränder dieser Wüste hatte er gelernt, „[sich] den Sitten der Bedu und ihrem Lebensrhythmus anzupassen“. Die allmorgendlichen Rituale in einem Beduinenlager mitten in der Wüste waren seit Jahrhunderten die gleichen geblieben:
Meine Gefährten waren stets wach und auf den Beinen, sobald es hell wurde. Ich glaube, dass die Kälte sie nur in kurzen Zeitspannen schlummern ließ, hatten sie doch außer den Kleidern, die sie auf dem Leib trugen, kaum etwas, um sich zu bedecken. … Im Halbschlaf hörte ich sie frühmorgens die Kamele aufwecken. Die Kamele brüllten und röhrten, als man sie fortführte, und die Männer schrien einander mit ihren harten, weittragenden Stimmen an. Die Kamele stolperten an meinem Lagerplatz vorbei. Ihre Vorderbeine waren zusammengebunden, damit sie nicht fortlaufen konnten, ihr Atem stand weiß in der kalten Luft. Ein Knabe trieb sie zu den nächsten Büschen. Dann rief irgendeiner zum Gebet:
Gott ist groß.
Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt.
Ich bezeuge, dass Mohammed der Prophet Gottes ist.
Kommt zum Gebet!
Kommt zur Erlösung!
Beten ist besser denn schlafen.
Gott ist groß.
Es gibt keinen Gott außer dem einen Gott.
Jede Zeile mit Ausnahme der letzten wurde zweimal wiederholt. Der langgezogene Wohllaut der Worte … schwebte über dem schweigenden Lager. Ich sah zu, wie der alte Tamtaim, der in meiner Nähe schlief, sich vor dem Gebet wusch. … Er wusch sein Gesicht, die Hände, die Füße, zog Wasser durch die Nase auf, säuberte die Ohren mit nassen Fingern und fuhr sich mit den nassen Händen über den Kopf. … [Er] kehrte den Boden vor sich, legte sein Gewehr darauf und betete dann, nach Mekka gewandt. Er stellte sich gerade hin, beugte sich, die Hände auf die Knie gelegt, nach vorn, kniete nieder und neigte den Kopf, bis seine Stirn den Boden berührte. Die rituellen Bewegungen wiederholte er mehrmals langsam und eindrucksvoll, während er das vorgegebene Gebet sprach. Manchmal stimmte er lange Abschnitte aus dem Koran an, wenn er sein Gebet beendet hatte, und schon allein der Klang der Worte vermittelte die Schönheit einer großen Dichtung. [Und doch kannten] viele jener Bedu … nur die [erste] Sure des Korans:
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des
Allbarmherzigen, Preis sei Gott, dem Herrn der Welten,
Dem Allerbarmer, dem Allbarmherzigen,
Dem Herrscher am Tage des Weltgerichts. …
Kurz nach dem Morgengebet konnte ich dann metallisches Klingen vernehmen: Der Kaffee wurde in Messingmörsern zerstampft, und der Mann, der ihn zerstampfte, tat dies stets so, dass eine Art Melodie dabei entstand. Nun erhob ich mich. In der Wüste schliefen wir in unsern [sic] Kleidern, so dass ich nichts weiter zu tun hatte, als mein Kopftuch zu richten, mir ein wenig Wasser über die Hände zu gießen, mein Gesicht zu benetzen, ans Lagerfeuer zu treten und die Araber, die darum herum saßen, zu begrüßen: ‚Salam Alaikum!‘ (Friede sei mit euch.) Die Araber standen dann auf und antworteten: ‚Alaikum as-Salam!‘ (Mit dir sei der Friede.) Die Bedu erhoben sich immer, wenn sie einen Gruß erwiderten. Hatten wir keine Eile, dann buken wir das Frühstücksbrot, sonst aber aßen wir die Reste vom letzten Abendessen. Wir tranken süßen schwarzen Tee und dann Kaffee, der bitter, schwarz und sehr stark war. Das Kaffeetrinken verlief zeremoniell und durfte nicht hastig absolviert werden. Der Kaffeeausschenker goss im Stehen winzige Mengen in eine kleine Porzellantasse, die kaum größer war als ein Eierbecher, und reichte einem jeden von uns unter Verneigungen die Tasse. Jedem wurde die volle Tasse so oft gereicht, bis er sie beim Zurückgeben ein wenig schüttelte, was bedeutete, daß er nun genug habe. Es war nicht üblich, mehr als drei Tassen zu trinken.
…
Die Kamele, die von diesen Bedu geritten wurden, waren Stuten. Im Sudan hatte ich stets Kamelbullen geritten, da man dort, wie in den anderen Teilen der Sahara, die ich bereist hatte, die weiblichen Tiere niemals zum Reiten verwandte, sondern [ausschließlich] wegen ihrer Milch hielt. In ganz Arabien jedoch reitet man mit Vorliebe Kamelstuten. Die Stämme, die sie für Lastentransporte vermieten, benutzen Bullen als Lasttiere, aber die Bait Kathir schlachten fast alle männlichen Kälber … Daher sind Kamelbullen zum Decken Mangelware. Als ich später in Hadramaut reiste, begleitete mich ein Mann, der einen Kamelbullen ritt. Wir wurden unentwegt von Leuten mit weiblichen Tieren verfolgt, die gedeckt werden sollten. Wir hatten eine lange Reise vor uns, und die fortwährenden Anstrengungen erschöpften das Reittier meines Gefährten merklich. Aber er konnte nicht ablehnen. Es war ein alter Brauch, dass dieses Kamel so viele weibliche Tiere decken musste, wie ihm zugeführt wurden. Man holte dazu nicht einmal die Erlaubnis des Besitzers ein. Die Stute wurde einfach gebracht, man ließ sie decken und nahm sie wieder mit.39
Thesigers Bekanntheit rührt auch von der Offenherzigkeit her, mit der er über die Zuneigung zu seinen männlichen Reisegefährten schrieb. In den 1950er-Jahren war das Thema noch tabu; heute füllt es ganze Forschungsbibliotheken:
In Arabien suchte sich Thesiger zwei besonders enge Gefährten. Der eine war ein fünfzehnjähriger Ziegenhirte namens Salin bin Kabina. „Wir tränkten gerade die Kamele in einem Wadi, und ich erinnere mich, dass er in einem roten Lendenschurz und … diesen langen Haaren auf uns zukam. Er fragte, ob er mit mir kommen könne. Ich fragte die Scheichs, und die sagten: ‚Ja, wenn er ein Gewehr und ein Kamel bekommt.’“
Thesiger betrachtete Kabina als seinen Assistenten. … „Dass Bin Kabina als bezahlter Diener mit mir reiste, kam gar nicht infrage! Unter solchen Bedingungen hätte er bestimmt nicht sein Leben für mich riskiert. Das Letzte, was ich wollte, war eine Herr-und-Diener-Beziehung mit den Bedu.“ … Thesigers Fotos zeigen einen schlanken, aber kräftigen jungen Mann mit feinen Zügen und schulterlangem Haar …
Thesigers anderer enger Gefährte in Arabien war Salim bin Ghabaischa, ein Cousin Bin Kabinas. „Er war höchstens fünfzehn oder sechzehn, mit einer auffällig heiseren Stimme und jener schlanken, geradlinigen, beinahe femininen Statur, die Thesiger so bewunderte. Seine Anmut und seine ruhige Würde kontrastierten mit dem stets übermütigen, energischen Bin Kabina, aber sie gaben ihm auch einen festeren, ernsteren und rücksichtsloseren Charakter. In Arabian Sands [Die Brunnen der Wüste] lässt Thesiger sich ausführlich über seine äußere Erscheinung aus und vergleicht ihn mit dem jungen Antinoos in jenem Augenblick, als Kaiser Hadrian ihn zum ersten Mal in den Wäldern Phrygiens erblickte.“40
Man könnte meinen, die Briten hätten einen groben Fehler begangen, als sie ausgerechnet um jene Zeit aus der Golfregion abzogen, als die Öl- und Gasförderung dort so richtig Fahrt aufnahm. Aus Londoner Sicht stellte sich die Sache damals jedoch anders dar. Zum einen hatte die erste, 1950 in Ras Sadr nahe Abu Dhabi erfolgte Probebohrung keinen einzigen Tropfen Öl zutage gefördert; die Größenordnung des späterhin folgenden Ölbooms konnte man daraus keineswegs ablesen. Zum anderen behielten die Londoner Ministerien sehr wohl ihre Finger im Spiel und bauten darauf, dass britische Firmen bei allen zukünftigen Unternehmungen zur Exploration und Ölförderung beteiligt sein würden, ganz egal, wie diese im Einzelnen verlaufen würden. Großbritannien hoffte also, seine laufenden Kosten zu reduzieren, ohne sich etwaige ökonomische Gewinne entgehen zu lassen.
Mitte der 1960er-Jahre, als die Prozesse zur politischen Umgestaltung der Region bereits in Gang waren, stieg das Volumen der Erdölförderung binnen Kurzem dramatisch an: Der relativ gesehen stärkste Anstieg erfolgte in den Jahren 1962–1964, als das Ölexportterminal im Frachthafen von Dschebel Dhanna den Betrieb aufnahm. Dennoch hielt das Wachstum in den Emiraten einem Vergleich mit Saudi-Arabien oder Iran (die beide einen gewissen Vorsprung in diesen Dingen hatten) vorerst nicht stand; allerdings war der Umfang der emiratischen Ölreserven auch noch nicht vollständig bekannt.41
Im Jahr 1968 jedoch gab die britische Regierung ihre Absicht bekannt, sich binnen drei Jahren vollkommen aus der Golfregion zurückzuziehen. Diese Nachricht löste, wie es in der Literatur heißt, „fieberhafte Verhandlungen“ aus – nicht nur zwischen den herrschenden Scheichs und der britischen Regierung, sondern auch Verhandlungen der Scheichs untereinander.42 Von britischer Seite favorisierte man die Schaffung eines Einheitsstaates. Die im Trucial Council, dem „Vertragsrat“ der „Vertragsküste“, vertretenen Scheichs zeigten sich äußerst vorsichtig. Von 1968 bis zum Sommer 1971 nahmen an den Verhandlungen auch Bahrain und Katar teil; allein Bedenken in letzter Sekunde verhinderten, dass auch sie der in Gründung befindlichen Föderation von Emiraten beitraten. Die Gründungsakte der VAE wurde am 2. Dezember 1971 im Dubai Guest House unterzeichnet, das seitdem Union House heißt.43 Der neue Staat der Daulat al-Imarat al-Arabiya al Muttahida oder kurz Al-Imarat („die Emirate“) war geboren. Quasi über Nacht wurde aus der „politischen Vertretung“ Großbritanniens am Golf die britische Botschaft in den VAE.
Die politischen Veränderungen haben sich seitdem in engen Grenzen gehalten – ganz im Gegensatz zum wirtschaftlichen, finanziellen und demografischen Wandel, der immens gewesen ist. Die Rohölförderung ist beständig angestiegen, von 1146 Millionen Barrel am Tag im Jahr 1984 auf 2804 Millionen im Jahr 2012 (ein Barrel entspricht rund 160 Litern).44 Das Wachstum der emiratischen Staatsfonds hat alle Grenzen gesprengt. Die 1976 gegründete staatliche Investmentgesellschaft Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) hält inzwischen ein Portfolio im Wert von 773 Milliarden Dollar – das zweitüppigste der Welt nach dem Staatlichen Pensionsfonds von Norwegen –, was einem Kapitalanteil von 839 305 Dollar pro Kopf der Bevölkerung entspricht. Damit stellt ADIA sowohl den Staatsfonds von Dubai als auch die gemeinsame Federal Investment Authority der VAE in den Schatten.45 Die Zahl privatwirtschaftlicher wie staatlicher Unternehmensgründungen hat sich jahrelang geradezu exponentiell vergrößert, und die Bevölkerungszahl ist auf vergleichbare Weise in die Höhe geschossen. Bei Staatsgründung 1971 betrug die (nicht genau erfasste) Bevölkerung der VAE wohl um die 100.000, die aktuelle Schätzung beläuft sich auf 9479 Millionen Menschen. Sowohl Abu Dhabi als auch Dubai waren früher verschlafene Hafenstädte mit jeweils 20.000 bis 30.000 Einwohnern; heute leben dort 603.000 beziehungsweise 1 137.000 Menschen. Selbst Schardscha-Stadt hat inzwischen mehr als eine halbe Million Einwohner.46
Bei solchen schwindelerregenden Entwicklungen sind Probleme unausweichlich. Was ihr Territorium betrifft, sind die VAE lange Zeit durch Grenzverletzungen Saudi-Arabiens belästigt worden; immer wieder drangen saudische Truppen in grenznahe Oasen ein. Auch die Besetzung dreier Inseln im Persischen Golf durch Iran sorgt für diplomatische Verstimmungen. Diese Inseln – Abu Musa und die beiden Tunb-Inseln – liegen mitten in der Straße von Hormus und damit unmittelbar an der internationalen Schifffahrtsroute. Ohne sich um die Meinung seiner Nachbarn zu kümmern, hat Iran inzwischen auf der Großen Tunb-Insel einen Flugplatz errichtet.47
In politischer Hinsicht sind – wie Scheich Zayid nur zu gut wusste – absolute Regimes anfällig für Konflikte innerhalb des Herrscherhauses, und insbesondere Schardscha hat wiederholt mit derartigen Turbulenzen zu kämpfen gehabt: 1972 wurde Scheich Khalid von einem Vetter getötet und Khalids jüngerer Bruder, Sultan, bestieg den Thron inmitten eines blutigen Stammeskrieges. Aber die feindselige Stimmung dauerte an, und im Juni 1987 wurde Sultan seinerseits abgesetzt, als er sich gerade außer Landes befand. Der Verantwortliche? Ein älterer Bruder, der fünfzehn Jahre zuvor übergangen worden war. Dieser Usurpator war Scheich Abdul Aziz, seines Zeichens Kommandeur der Nationalgarde. Seine Söldner aus Balutschistan riegelten den Flughafen ab, nahmen Journalisten fest und verbarrikadierten sich im Gebäude des Königlichen Justizpalastes. Scheich Abdul klagte über finanzielle Misswirtschaft. Drei oder vier Tage lang sah es so aus, als wäre sein Coup geglückt; einzig und allein der Emir von Dubai hatte einen öffentlichen Protest eingelegt. Aber dann votierte der Rat der VAE dafür, Scheich Sultan wieder in Amt und Würden zu setzen. Abdul Aziz gab nach und akzeptierte den Rang eines Kronprinzen und Vizeherrschers.48
Im Jahr 1991 wurden die VAE von der Zwangsliquidation der in Großbritannien ansässigen Bank of Credit and Commerce International (BCCI, „Internationale Kredit- und Handelsbank“) erschüttert. Die Regierung von Abu Dhabi hatte einen Anteil von 77 Prozent an dieser Bank gehalten, deren Gründung auf die Initiative eines pakistanischen Finanziers namens Agha Hasan Abed zurückgegangen war. Er hatte sie zur siebtgrößten Bank der Welt gemacht, mit einer Bilanzsumme von 20 Milliarden Dollar. Oberflächlich betrachtet schien alles respektabel: Der Hauptsitz der Bank in London war von den Wirtschaftsprüfern von PricewaterhouseCoopers kontrolliert worden; die Bank von England war als Regulierungsbehörde ebenfalls im Spiel. Aber dann brachten Nachforschungen in den Vereinigten Staaten über das Geschäftsgebaren einer BCCI-Tochter, der First American Bank, ein riesiges Betrugsnetz ans Licht. Zu den Kunden der BCCI gehörten der irakische Diktator Saddam Hussein, der panamaische Machthaber Manuel Noriega, der palästinensische Terrorist Abu Nidal sowie der zwielichtige CIA-Mann Oliver North. Der sogenannte Sandstorm-Report kam zu dem Schluss, dass die Geschäftsbeziehungen der BCCI von Geheimhaltung, absichtlicher Vertuschung, Bestechung, Waffenschmuggel und Drogenhandel geprägt gewesen waren. Gleichzeitig kamen auch die internationalen Regulierungsinstanzen in Bewegung; die BCCI wurde zum Konkurs gebracht und ihre Manager wurden in London vor Gericht gestellt, wo sie sich schuldig bekannten. Abu Dhabi blieb nichts anderes übrig, als die Bank von England zu verklagen; das Vorhaben war aussichtslos, zog sich aber dennoch bis 2005 hin. Die Insolvenzverwalter, die nach eigenen Angaben 45 Prozent der von den Gläubigern der BCCI verlorenen Gelder gerettet haben, konnten ihre Bücher sogar erst 2012 schließen.49
Auf dem vormals blütenweißen thawb, dem guten Ruf der VAE hat der BCCI-Skandal unschöne Flecken hinterlassen. Einem Anti-Geldwäsche-Gesetz aus dem Jahr 2002 zum Trotz reißen die Gerüchte nicht ab, dass gewisse emiratische Banken – und vor allem gewisse Banken in Dubai – weiterhin genau dieselben zwielichtigen Geschäftspraktiken verfolgen, welche die BCCI damals zu Fall brachten. Dabei sollten Schlagzeilen wie „Dreckiges Geld versteckt sich in Dubai“ oder „Internationale Finanzaufsicht nimmt Dubais dunkle Schattenseite ins Visier“ eigentlich nicht gern gesehen sein.50 Es heißt, Dubai diene dem Iran dazu, die gegen ihn verhängten Sanktionen zu unterlaufen, das Beutegeld somalischer Piraten reinzuwaschen und russische Mafiabosse zu decken. Noch immer kann man hier ein Konto eröffnen, ohne dass allzu viele Fragen gestellt werden, Aufenthaltsgenehmigungen sind käuflich und der Transaktion auch größerer Summen werden keinerlei Schranken gesetzt. Es geht also, wie eine britische Journalistin es formuliert hat, um „Russen, die mit Koffern voller Bargeld Appartements kaufen, in denen sie dann nie einziehen“.51
Die französisch-norwegische Juristin Eva Joly, deren Spezialgebiet als Richterin und Europaabgebordnete die Bekämpfung der internationalen Wirtschaftskriminalität gewesen ist, hat eindringlich darauf hingewiesen, dass Dubai das „Weltzentrum“ der Geldwäsche sei. Sie hat das Emirat nicht nur mit französischen Wirtschaftsskandalen wie der Affaire Elf-Aquitaine in Verbindung gebracht, sondern auch mit dem Fall Sergej Magnitski in Moskau und dem Skandal um die afghanische Kabul Bank, wo über die Jahre fast eine Milliarde Dollar an amerikanischen Hilfsgeldern verschwunden waren.52
Mehr über diesen etwas unappetitlichen Aspekt der VAE kann man auch aus der undurchsichtigen Karriere des indischen Geschäftsmannes Naresh Kumar Jain, alias „Patel“, ablesen, der als „internationaler Hawala-König“ bekannt wurde und zwanzig Jahre lang von Dubai aus sein Unwesen trieb. (Eine hawala ist eine Agentur für internationale Geldanweisungen.) Jains Firma diente angeblich nur als Fassade für illegale Geldtransfers im Umfang von bis zu zwei Milliarden Dollar am Tag. Mithilfe der sogenannten „Mehrschicht-Technik“, bei der illegale Transaktionen durch legale Transaktionen „gedeckt“ werden, soll Jain mit internationalen Drogenschmugglern, Menschenhändlern und – dem Vernehmen nach – auch mit Terrororganisationen wie Al-Qaida Geschäfte gemacht haben. Jain, der alle Vorwürfe bestreitet, floh 2007 in die Vereinigten Staaten, setzte sich 2009 aus Dubai ab, wo er gegen Kaution freigekommen war, und konnte schließlich in Delhi festgenommen werden. Verurteilt wurde er jedoch nie.53
Das soll nun aber nicht heißen, dass alles, was in den VAE glänzt, gleich kriminell wäre. Die glasklare Karriere eines anderen Geschäftsmannes aus Dubai, des bereits erwähnten Munir Al-Kaloti, zeigt das genaue Gegenteil. Al-Kaloti, ein Palästinenser aus Jerusalem, kam 1968 auf der Flucht vor dem arabisch-israelischen Konflikt nach Abu Dhabi. Nach verschiedenen Unternehmungen im Lebensmittelhandel – er war der Mann, der für Scheich Raschid insgesamt rund 20.000 Ziegen einkaufte – kam er auf die Idee, das von den Erdölsuchern zurückgelassene Altmetall einzusammeln und zum Verkauf einzuschmelzen. Anschließend handelte er mit Schmuck aus zweiter Hand.
„Dubai war viel offener als die Nachbarländer“, erinnert er sich, „keine Steuern, keine Kontrolle und Flugverbindungen in alle Welt. Es dauerte nicht lange, da stiegen Leute mit Bruchgold aus Afrika oder Asien aus dem Flieger und fragten: ‚Wer kann das abwickeln?‘“
Den Anfang machte Al-Kaloti mit einem Kilobarren Gold, den er für 40.000 Deutsche Mark kaufte. Dann eröffnete er ein Prüflabor für Materialproben, eine auf Gold spezialisierte Gießerei und Schmiede sowie eine Reihe exklusiver Schmuckläden. Seine erste Barrengießerei in Schardscha gibt es heute noch; jedes Jahr produziert sie Goldbarren im Wert von 30 Milliarden Dollar. Die Firma Kaloti International unterhält Niederlassungen in Hong Kong, Singapur und Surinam. Als 2015 vor den Toren von Dubai eine neue Raffinerie eröffnet wurde, wurde eine Verdreifachung von Kalotis Umsatz erwartet.54 Herr Al-Kaloti selbst hat sich seinen Spitznamen – „der Alchemist“ – redlich verdient: „Wo sonst als in den VAE kann man als Schrotthändler anfangen und es am Ende zum Besitzer einer Goldfabrik bringen?“
Ein noch größeres Unternehmen aus den VAE, die Al Ghurair Group, geht auf ähnlich bescheidene Anfänge zurück. Ahmad Al-Ghurair und sein Sohn Saif stammten aus einer Dubaier Familie von Perlentauchern, die um 1960 schließlich so viel Vermögen angespart hatten, dass sie es irgendwie anlegen wollten. Also bauten sie die erste Zuckerfabrik in den Emiraten, das erste Zementwerk, das erste Stahlwerk und das erste Einkaufszentrum. Dazu kamen später noch die größte Bank des Landes, Mashreq (vormals Bank of Oman) sowie eine Vielzahl von anderen Unternehmen. Als mehrfache Milliardäre stehen die Al-Ghurairs heute auf der Forbes-Liste der Superreichen.
Die Bundesverfassung der VAE war ursprünglich als ein Provisorium gedacht, dem nach Beitrittsverhandlungen mit weiteren Mitgliedern eine endgültige Version folgen sollte; irgendwann wurde sie dann aber doch „entfristet“. Ihre 151 Artikel versprechen die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, allgemeine Schulbildung, eine Zoll- und Währungsunion, eine Bundesarmee sowie ein „in umfassender Weise demokratisch gestaltetes Regiment“ für eine „arabische und islamische Gesellschaft“. Die emiratische Bundesflagge zeigt drei horizontale Streifen in Grün, Weiß und Schwarz, an die linker Hand ein roter Streifen anschließt. Das Staatswappen zeigt einen stilisierten Falken. Die Währung der VAE ist der dirham; ein VAE-Dirham (AED) ist gegenwärtig etwa 0,25 € wert, das heißt für einen Euro erhält man rund vier Dirham. Staatsreligion ist der Islam, Arabisch die einzige Amtssprache und der 2. Dezember Nationalfeiertag. Die Nationalversammlung, die lediglich beratende Funktion hat, setzt sich aus Vertretern der einzelnen Teilstaaten zusammen; entscheidend ist deren proportionaler Anteil an der Gesamtbevölkerung. Im Obersten Herrscherrat der VAE sitzen die sieben Scheichs der sieben Emirate. Die Herrscher von Abu Dhabi und von Dubai besitzen ein Vetorecht; die fünf anderen – die Emire von Schardscha, Adscham, Ras al-Chaima, Umm al-Qaiwain und Fudschaira – haben kein solches Recht. Die Mitglieder des Herrscherrates wählen aus ihrer Mitte einen Präsidenten sowie einen Vizepräsidenten und ernennen zudem einen Premierminister, der die Geschäfte der Bundesregierung führt. Seine eigenen Entscheidungskompetenzen hält der Herrscherrat auf ein Minimum beschränkt, damit die traditionell unbeschränkte Herrschaft der einzelnen Emire in ihren Territorien erhalten bleibt.55
Wie auch in den vier Golfstaaten, die den VAE nicht angehören – Kuwait, Bahrain, Katar und Oman –, bleibt die politische Macht in den Emiraten in den Händen einiger weniger Herrscherfamilien; dieses System wird aufrechterhalten durch aufwendige Vorschriften, eine mitunter drakonische Strafverfolgung sowie eine tief verwurzelte Kultur der Unterwürfigkeit. Zwar haben wir es hier mit Monarchen und Konstitutionen zu tun, aber von einer konstitutionellen Monarchie sind die VAE noch meilenweit entfernt – von dem „in umfassender Weise demokratisch gestalteten Regiment“, das die Bundesverfassung verspricht, ganz zu schweigen.56 Innerhalb ihrer Scheichtümer können die Scheichs schalten und walten, wie sie wollen; dies ermöglicht eine Willkürherrschaft bis zur Despotie. Als Föderation sind die Emirate, die ja auf einen Konsens der Scheichs untereinander angewiesen sind, äußerst schwach. Sämtliche Entscheidungen werden per Dekret gefällt. Die Gerichte und die Polizei, die überwiegend mit Söldnern aus dem Ausland besetzt ist, sind der Staatsspitze unmittelbar unterstellt. Versammlungsfreiheit gibt es nicht, Zensur findet sowohl formell als auch informell statt, und die traditionelle Vorstellung, dass offene Kritik mit Aufruhr gleichzusetzen sei, wird lediglich durch den ebenso traditionellen Brauch etwas abgemildert, mit dem die Scheichs auch einmal Gnade gewähren.
Und doch: Eine geradezu kriecherische Unterwürfigkeit den Herrschenden gegenüber ist allgegenwärtig. Ganz wie der feine Wüstensand findet sie den Weg noch in die kleinsten Ritzen und Verästelungen sämtlicher gesellschaftlicher Gruppen und Institutionen. Jeglicher staatliche Erfolg muss auf das persönliche Genie des jeweils passenden Emirs zurückgeführt werden; bei keiner Gelegenheit dürfen Dankes- und Lobesworte an seine Adresse fehlen. So zum Beispiel, als die VAE im Dezember 2011 unter dem Motto DER GEIST DER EINHEIT ihr vierzigjähriges Bestehen feierten. Bei einem festlichen Galakonzert spielte das Royal Oman Symphony Orchestra unter der Leitung des britischen Dirigenten Neil Thomson. Den Abend eröffnete die Ouvertüre zur Verdi-Oper La forza del destino – Die Macht des Schicksals, vielleicht eine naheliegende Wahl. Im Geleitwort zu der Jubiläumsfestschrift, die an jenem Abend verteilt wurde, waren als Gründe für das Gelingen des Konzerts jedoch die „allergnädigste Unterweisung“ und der „erlesene Musikgeschmack“ Seiner Hoheit des omanischen Sultans Qabus ibn Said genannt.
Jeder einzelne der sieben Männer, die über die VAE herrschen, hat zugleich die direkte Kontrolle sämtlicher finanzieller und wirtschaftlicher Organe inne, die seinen Reichtum verwalten. In den Worten ihrer eigenen, unfreien Presse: Sie sind „die Titanen von Staat und Geschäft“. Der bei Weitem Einflussreichste unter ihnen, der inzwischen 71-jährige Scheich Chalifa bin Zayid al-Nahyan, herrscht zugleich als Emir über Abu Dhabi, amtiert als Vorsitzender der ADIA und als Präsident der VAE. Der zweite Mann in der Hackordnung, Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktum, ist zugleich Emir von Dubai, Vorsitzender der Dubai Holding sowie Vizepräsident und Premierminister der VAE.
Die einzigen politischen Schranken, mit denen solche Männer rechnen müssen, setzen ihnen die zahlreichen Mitglieder ihrer Familienclans. Denn vor allem anderen sind sie schließlich – Stammeschefs. Sie sind Väter vieler Söhne, die alle (in der Regel mehrere) Frauen und mit diesen Frauen ihrerseits zahlreiche Kinder haben. Ihr Geburtsrecht auf den Thron verdanken die Emire den ungeschriebenen Gesetzen der Thronfolge, für deren Geltung frühere Monarchen, Lieblingsfrauen und ehrgeizige Mütter gesorgt haben. Diese Familienpolitik wird im Geheimen gemacht, hinter den geschlossenen Türklappen der Stammeszelte, und wird in der Öffentlichkeit niemals erklärt oder gerechtfertigt.
Infolgedessen ist in der emiratischen Politik jedes beliebige „Entscheidungsfindungsverfahren“ – wie Politologen vielleicht sagen würden – maximal undurchsichtig. Jeder Plan oder Vorschlag, jede auch nur provisorische Regelung muss der Herrscherfamilie zur Bestätigung vorgelegt werden – stets mit unsicherem Ausgang. Diplomaten und Geschäftsleute mit Erfahrung in der Region sprechen von einem „schwarzen Loch“ oder einer „black box“, in die kein Einblick möglich ist. Gemeint sind damit die Privat- und Geheimsphäre, innerhalb deren sämtliche Regierungsentscheidungen getroffen werden. Wenig hat sich geändert seit den Zeiten, in denen Bittsteller ihr Anliegen durch einen Spalt des herrscherlichen Zeltes flüsterten und untertänigst auf Antwort hofften.
Bei einem solchen System überrascht es kaum, dass die Vetternwirtschaft auf allen Ebenen grassiert, ja, selbst zu einem tragenden Element des Systems und seiner Institutionen wird. Der Vorgänger des jetzigen Emirs von Abu Dhabi, Scheich Zayid, hatte dreizehn Söhne, die alle erwarten durften, eines Tages einen Posten zu erhalten, der ihrer edlen Abstammung entsprach. Der aktuelle Kronprinz beispielsweise, General Scheich Mohammed bin Zayid bin Sultan al-Nahyan, ist ein Halbbruder des gegenwärtigen Emirs; er ist zudem der stellvertretende Oberbefehlshaber der Streitkräfte der VAE und Vorstandsvorsitzender von Mubadala, der wichtigsten Investmentgesellschaft der VAE. Außenminister ist Scheich Zayids vierter, Innenminister sein sechster Sohn. Der Geschäftsführer von Mubadala hingegen, der 45-jährige Chaldun Chalifa al-Mubarak, gehört zur jüngeren Generation der Familie. Nebenbei ist er übrigens auch noch Vorsitzender von Manchester City. Die Schwestern dieser Männer können sich nur selten durchsetzen. In dieser Hinsicht ist Fatima al-Dschaber, die operative Geschäftsführerin der Al-Jaber Group und erstes weibliches Mitglied, das in die Handelskammer von Abu Dhabi gewählt wurde, eine absolute Ausnahme. (Ihr Titel – „nur“ operative Geschäftsführerin, nicht CEO, sondern COO – lässt dabei vermuten, dass sie ihre Arbeit dennoch unter männlicher Aufsicht verrichtet.)
In gesellschaftlicher Hinsicht ist die Ungleichheit beinahe so ausgeprägt wie in der Politik. Kaum 20 Prozent der Bevölkerung sind emiratische Staatsangehörige (und haben also eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung); die übergroße Mehrheit sind ausländische Wander- und Zeitarbeiter. In die letzte Kategorie fallen durchaus auch gut bezahlte Berater und Wirtschaftsmanager; aber sehr viel größer ist die Zahl der Hausbediensteten, Sachbearbeiter, Taxifahrer und ungelernten Arbeiter. Keiner von ihnen hat irgendwelche Rechte, die über ihren Arbeitsvertrag oder ihr Visum hinausgingen, und keiner von ihnen hat eine Chance, die emiratische Staatsangehörigkeit zu erwerben – außer durch Heirat. Jedwede Organisation oder Einrichtung in den VAE muss einen emiratischen Staatsangehörigen zum Direktor haben, und jedes Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, mindestens 51 Prozent der Firmenanteile in emiratischer Hand zu belassen. In der Folge hat sich keinerlei Sinn für bürgerliche Gleichheit entwickeln können. Auf den Straßen drängen sich zwar die Luxuskarossen sowie Menschen aus allen Erdteilen, und dieser Multikulti-Mix kann durchaus den Eindruck eines wohlhabenden und friedlichen Landes erwecken. Aber jeder einzelne dieser Menschen muss doch seinen Platz kennen, und noch immer gibt es tiefsitzende Vorurteile en masse. Der Sklavenhandel wurde erst in den 1960er-Jahren abgeschafft, und das uralte Konzept eines „Kopfgeldes“, nachdem unterschiedlichen Menschen und Menschengruppen ein je unterschiedlicher (monetärer) Wert zukommt, feiert hier fröhliche Urständ. Europäer können hier mit breiter Brust auf einen Zebrastreifen zumarschieren, immer in dem Wissen, dass ihr Leben für 200.000 Dirham oder mehr versichert ist; Asiaten oder Afrikaner dagegen sind gerade einmal 40.000 Dirham pro Kopf wert. Diese Mentalität verändert sich nur sehr, sehr langsam.
In allen inneren Belangen genießen emiratische Staatsangehörige gegenüber Ausländern eine Vorzugsbehandlung. Sie allein haben vollumfängliche Eigentumsrechte. Von der Wiege bis zur Bahre steht ihnen die staatliche Gesundheitsversorgung zur Verfügung, dazu subventionierter Wohnraum, Vorrechte auf dem Arbeitsmarkt, überaus günstige Darlehen für junge Familien sowie – nicht zuletzt – ein kostenloses Bildungssystem. (Die ersten modernen Lehrpläne, auf denen nun auch Mathematik und Englisch standen, gab es in den 1970er-Jahren; nach der Unabhängigkeit folgte dann in den 1980er-Jahren das volle Programm von Schulbüchern und staatlichen Prüfungen.) Wenn man sich diese umfassenden staatlichen Fürsorgeleistungen vor Augen führt, erscheint die offizielle Statistik, der zufolge das durchschnittliche emiratische Jahreseinkommen bei gerade einmal 48.000 Dollar pro Kopf liegt, als vollkommener Unsinn.
Am anderen Ende der Skala steht das harte Los der Wanderarbeiter – dabei stellen sie die größte Bevölkerungsgruppe dar. Meist sind es junge Männer vom indischen Subkontinent, die ihre Familien zurücklassen mussten – sie dürfen sie nicht mit an den Golf bringen – und nun in armseligen Baracken hausen, wo nicht selten sechs oder acht von ihnen sich ein Zimmer teilen. Da sie kein Arabisch sprechen, sind sie skrupellosen Arbeitgebern, Bauunternehmen und Mittelsmännern vollkommen ausgeliefert. Sie arbeiten auf dem Bau, nicht selten in extremer Hitze und erhalten – für emiratische Verhältnisse – einen Hungerlohn. Ihren Arbeitgeber dürfen sie nicht wechseln, über ihre Bezahlung oder die Arbeitsbedingungen keine Verhandlungen führen. Ihr einziger Wunsch ist es, ihren Frauen oder Eltern ein wenig Geld in die Heimat schicken zu können. Um sie nicht zu enttäuschen, unterdrücken die Arbeiter jeden Gedanken an eine Beschwerde, von Protest gar nicht erst zu reden.
Nach Beobachtungen von internationalen Menschenrechtsorganisationen kommt es zu vielerlei Missständen. Wie auch in Bahrain und Katar verschulden sich viele der armen Arbeitsmigranten in den VAE bei erbarmungslosen Kredithaien – und bei den Vermittlern, die sie überhaupt erst angeworben haben. Bei ihrer Ankunft legt man ihnen nicht selten Knebelverträge vor, die sie nicht lesen können und allein deshalb schon unterschreiben, weil sie Angst haben, sonst wieder nach Hause geschickt zu werden. Am Ende haben sie sich so unrettbar verschuldet, dass sie von früh bis spät schuften müssen wie Sklaven oder zumindest Schuldknechte. Im Jahr 2006 leitete die indische Regierung eine Untersuchung ein, weil so auffällig viele indische Staatsangehörige in den VAE Selbstmord begangen hatten. Auf der Baustelle des Burdsch Chalifa in Dubai kam es zu einer Revolte der Arbeiter, woraufhin andere auf dem Flughafen Dubai in einen Solidaritätsstreik traten. 2007 wurden rund 4000 Streikende festgenommen.57 2010 machten Arbeiter von der Baustelle des NYU-Abu Dhabi-Campus die amerikanischen Behörden auf Missstände aufmerksam.58 Inzwischen nimmt der internationale Druck auf die VAE zu, diverse internationale Menschen- und Arbeitsrechtskonventionen zu unterzeichnen, darunter die UN-Antifolterkonvention.
Natürlich zieht eine gesellschaftliche Misere meist andere nach sich. Der ausgeprägte Überschuss an ledigen Männern in der Gesamtbevölkerung hat zu einem Anstieg von Prostitution, Menschenhandel und Sextourismus geführt, vor allem in Dubai. Frauen aus Russland und Äthiopien, heißt es, seien dort besonders gefragt, und Menschenhändlerbanden aus dem Ausland können dank geschickt platzierter Bestechungsgelder ungestört ihren Geschäften nachgehen.
Der immense wirtschaftliche Aufstieg der VAE ist also mit erheblichen gesellschaftlichen Missständen erkauft worden, unter denen vor allem Migranten zu leiden haben. Im Grunde lebt jede der drei großen Bevölkerungsgruppen in den VAE in ihrem eigenen Kokon: Die einheimischen Emiratis haben weder mit den Scharen von Wanderarbeitern, deren Zahl die der Einheimischen weit übersteigt, noch mit den „Expats“ aus dem Westen, auf deren Arbeit viele Unternehmen und staatliche Institutionen angewiesen sind, viel gemein. Gelegenheitsbesucher aus dem Westen, wie ich selbst einer bin, werden automatisch in die Gesellschaft anderer Westler geschleust. Schwer zu sagen, wie diese statistisch gesehen reiche Gesellschaft, die jedoch auf einer Form von Rassentrennung beruht, sich künftig weiterentwickeln soll, wenn dabei nicht ein erheblich größeres Maß an Gleichheit und Grundrechten ins Spiel kommt. Dass 80 Prozent der Bevölkerung sich quälen und leiden, damit 20 Prozent bequem leben können, ist auf lange Sicht kein tragfähiges Gesellschaftsmodell. Man denkt unwillkürlich an das vorrevolutionäre Frankreich.
In Dubai wurde ich von einem Paar herumgeführt, das dort seit zwanzig Jahren als Englischlehrer arbeitete, in Abu Dhabi von einem talentierten jungen Programmierer aus Polen. Auch zu Diplomatenempfängen wurde ich eingeladen. Aber weder mit den Wanderarbeitern, die man überall sieht, noch mit ganz normalen Emiratis bin ich in Kontakt gekommen. Um auch ihre Perspektive kennenzulernen, habe ich auf die Erfahrungen von anderen zurückgegriffen, die abenteuerlustiger gewesen sind als ich selbst. So hat etwa ein Reisender aus Neuseeland von seinem Gespräch mit den Matrosen berichtet, die auf dem Khor Dubai eine Fähre bedienen:
Ich blieb stehen, um ein paar Worte mit der pakistanischen Mannschaft zu wechseln. … Ihr Leben war so anders als meines: absolut anders, aber wenn man sich gegenseitig Fotos von seinen Kindern zeigt, hat man sofort eine Verbindung, die überall gültig ist. [Sie waren] so freundlich, und ganz offensichtlich machte es ihnen großen Spaß mit einem „Kiwi“ zu plaudern, weil Neuseeland ja so viele berühmte [Cricketspieler] hervorgebracht hatte … Immer wieder habe ich mit Männern gesprochen, die ihre Söhne und Töchter schon ein Jahr nicht mehr gesehen hatten – oder schon drei Jahre nicht mehr. Unter verschiedenen Arten von Lohnfesseln hatten sie die freie Wahl gehabt. Ihre sporadischen Besuche in der Heimat machten ihr Heimweh [nur] noch schlimmer …59
Eine in den Emiraten ansässige britische Journalistin hat andererseits recherchiert, warum Expats und Emiratis nicht in Kontakt treten: „Die Realität in Dubai ist ganz einfach, dass die meisten von uns in einer ‚Expat-Blase‘ leben. Ja, unsere Freunde hier kommen aus 200 verschiedenen Ländern – aber haben wir auch einheimische Freunde? Unwahrscheinlich.“60
Eine andere Journalistin hat die emiratische Seite des Problems untersucht. Ihr erster Interviewpartner war der Autor Abdel Khalek Abdullah. „Die Emiratis verlieren zunehmend ihre Identität“, sagte der, „die Anwesenheit von so vielen Expats führt immer öfter zu inakzeptablem Verhalten, das unseren Traditionen zuwiderläuft.“61
Ganz oben in der langen Chronik des „inakzeptablen Verhaltens“ muss wohl der Fall jenes britischen Pärchens genannt werden, das 2008 ausgewiesen wurde, nachdem es am helllichten Tag und an einem öffentlichen Strand Sex gehabt hatte. Aber auch allzu freizügige Kleidung bei den ausländischen Damen und übermäßiger Alkoholgenuss führen dazu, dass die Einheimischen sich immer stärker von der westlichen Präsenz in ihrem Land gestört fühlen – und das wiederum befeuert die Tendenz, sich in exklusive Wohnanlagen am Stadtrand zurückzuziehen. Eine Politologin von der staatlichen Universität der VAE, Professor Ibtisam al-Ketbi, hat sich in dieser Frage besonders freimütig geäußert: „Wir sind zu einer Minderheit [in unserem eigenen Land] geworden“, klagte sie, „und Arabisch ist schon nicht mehr die wichtigste Sprache. Wir sind von Ausländern umgeben und leben in ständiger Angst um unsere Kinder wegen einer Schwemme von Drogen und der steigenden Kriminalität. … Wir leben praktisch schon jetzt in Reservaten. … In zwanzig Jahren wird es uns gehen wie den Indianern in Amerika.“62
Religiöse Spannungen heizen die ohnehin gereizte Stimmung weiter an. Seit Langem gelten die VAE als der moderateste Staat in der ganzen Region, und ganz gewiss fallen sie nicht in dieselbe Kategorie von repressivem Regime wie das benachbarte Saudi-Arabien mit seinem fundamentalistischharten Wahhabismus. Scheich Zayid hat seinerzeit sogar Kritik vonseiten konservativer Emiratis einstecken müssen, weil er darauf bestand, dass alle „Völker des Buches“ oder „Schriftbesitzer“ – wie Juden und Christen in der islamischen Tradition genannt werden – in seinem Staat sollten Gottesdienst halten dürfen. So kommt es, dass in den Emiraten eine Vielzahl christlicher Kirchen vertreten sind und toleriert werden – Katholiken, Protestanten, Orthodoxe und Kopten –, während einige kleinere Gruppierungen wie etwa Mormonen oder Pfingstler ebenfalls ohne Einschränkung tätig sein können.
Und doch kann man solche westlichen Konzepte wie „Toleranz“ und „Religionsfreiheit ohne Einschränkungen“ im emiratischen Kontext kaum eng genug interpretieren. Weder Buddhisten noch Hindus noch Sikhs dürfen in den VAE Tempel errichten, und Missionare aus dem Ausland sind nicht willkommen. Zuzugeben, dass der Islam selbst eine Vielzahl unterschiedlicher Spielarten umfasst, fällt den emiratischen Behörden schon schwer genug. Staatliche Zensoren überwachen den Inhalt der in den Moscheen gehaltenen Predigten, und in dem größten Teil des emiratischen Rechtssystems kommt die Scharia zur Anwendung, besonders im Familien- und Strafrecht. Zwar kann man überall (außer in Schardscha) Alkohol und Schweinefleisch kaufen, aber die in der Scharia vorgesehenen Strafen gelten für Muslime und Nichtmuslime gleichermaßen. Auspeitschungen sind an der Tagesordnung, und die vorherrschenden Ansichten in Sachen Ehebruch und häusliche Gewalt müssen auswärtigen Beobachtern geradezu vorsintflutlich erscheinen. Muslimische Männer dürfen Frauen „des Buches“ heiraten (also Christinnen oder Jüdinnen), aber muslimische Frauen dürfen ausschließlich Muslime heiraten. Der Emir von Adschman hat Geldpreise für jeden Strafgefangenen ausgelobt, der in der Zeit seiner Haft den Koran auswendig lernt.
Die Schiiten sitzen ganz besonders in der Falle. Zwar sind sie als Muslime anerkannt, machen 15 Prozent der emiratischen Staatsangehörigen aus (und sogar 40 Prozent der Bevölkerung), aber in den Institutionen, die das muslimische Leben in den VAE bestimmen, haben sie keinerlei Mitspracherecht. Ihre Moscheen müssen sie als private Vereine organisieren. Zudem werden sie politisch unter Generalverdacht gestellt; oft unterstellt man ihnen, sie seien die fünfte Kolonne Irans oder unterstützten die Hisbollah. In den Jahren 2013 und 2014 wurden rund 4000 Schiiten kurzerhand aus den VAE ausgewiesen, nachdem man ihnen ohne Vorwarnung die Arbeitserlaubnis entzogen hatte. Die Regierung Pakistans war die einzige, die gegen dieses Vorgehen protestierte.63
Unter den Schiiten geht es der Gemeinschaft der Ismailiten noch vergleichsweise gut. Ihr religiöses Oberhaupt, der Aga Khan, ist ein Freund des Scheichs von Dubai, und 2008 wurde dort ein elegantes Ismailitisches Zentrum eröffnet, um gute Beziehungen zwischen Ismailiten und anderen Muslimen zu fördern. Schreiende Ungleichheit besteht hingegen mit Blick auf jenes andere „Volk des Buches“, das die abrahamitische Tradition überhaupt erst begründet hat: Eigentlich sollten Juden in den VAE dieselben Rechte zukommen wie Christen. Und doch gibt es keine einzige öffentliche Synagoge. Das Problem wird auch im Internet diskutiert: „Gibt es nun eine Synagoge oder nicht?“ – „Ja, gibt es: Den jüdischen Gebetsraum auf der Queen Elizabeth II [die als Hotel- und Museumsschiff im Hafen von Dubai festgemacht ist].“ Noch schwieriger wird die Situation durch die oft ablehnende Haltung der Einheimischen gegenüber Israel. Ihre Vorbehalte dem Judentum gegenüber rechtfertigen Emiratis nicht selten unter Verweis auf die schlechte Behandlung der Palästinenser durch den israelischen Staat.
Scheich Zayid hat versucht, die Lage zu bessern, aber die Ergebnisse seiner Bemühungen müssen ihn entmutigt haben. So hat er in Abu Dhabi das Zayed Center for Coordination and Follow-Up gegründet (etwa: „Zayid-Zentrum für Koordination und dauernde Gesprächsbereitschaft“), das als Ideenschmiede und als Forum für den interreligiösen Dialog dienen sollte.64 Auch hat er dem renommierten theologischen Seminar der Harvard University eine große Summe gespendet, damit dort ein Lehrstuhl für islamische Theologie errichtet werde.65 Beide Initiativen sind gescheitert. Das Zayed Center hatte zwar illustre Gäste wie die früheren US-Präsidenten Clinton und Carter, wurde dann aber zur Zielscheibe heftiger Kritik; unter anderem wurde den Verantwortlichen vorgeworfen, sie hätten der Leugnung des Holocaust Vorschub geleistet. Und in Harvard nannten Demonstranten Scheich Zayid einen Sklavenhalter und Geldgeber antisemitischer Umtriebe. Das Zayed Center wurde 2003 geschlossen, die Spende an Harvard zurückgezogen.
Die Fülle an Universitäten in den Emiraten passt also nicht so ganz zu ihrer politischen Landschaft, die strenge, ja diktatorische Züge trägt, noch zu ihrer gesellschaftlichen und intellektuellen Landschaft, die trostlos, um nicht zu sagen öde ist. Allein in Dubai mit seinen Wolkenkratzern und Metro-Stationen gibt es 79 Universitäten und andere Hochschulen – verglichen mit 109 Universitäten in ganz Großbritannien. Drei dieser Einrichtungen tragen das Wort American in ihrem Namen, andere sind „britisch“, „kanadisch“, „französisch“ oder „russisch“. Die Studiengebühren für einen ersten Studienabschluss liegen zwischen 22.000 und 90.000 Dirham im Jahr, das entspricht etwa 5000 bis 22.000 Euro. Wer eine Business School besuchen möchte, muss mit Kursgebühren von mehr als 100.000 Dirham rechnen (etwa 25.000 Euro); Medizin oder Zahnmedizin schlagen mit bis zu 250.000 Dirham zu Buche (rund 63.000 Euro). An Eltern, die solche Summen bereitwillig zahlen, mangelt es nicht. Aber wie nur sollen sie die guten Schulen von den eher zwielichtigen unterscheiden? Vielleicht gehen sie einfach einmal die Liste im Internet durch und verlassen sich auf ihren Instinkt: Aga Khan University, Atlanta University, Bharathiar University, Calicut, Duke, Exter, Fuqua, Griggs, Herriot-Watt, Indira Gandhi National, Jazeera, Kidville, London Business, Murdoch, Nottingham, Online, Philippine, Quaid I. Azam, Richford, Strathclyde, University of Dubai, Vellore, Wollongong, Zayed International … Alle diese Hochschulen machen Werbung im Internet, und alle haben ein glaubwürdiges Auftreten:
Die University of Jazeera reagiert auf Veränderungen in den nationalen, regionalen und internationalen Anforderungen, indem sie Diversität begrüßt und Innovationen in den Bereichen Lernen, Lehre, Forschung und Ehrenamt fördert. Die UOJ hat es sich zum Ziel gesetzt, aus einer Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden heraus ethisches Verhalten und sicheres Wissen in die Gesellschaft der VAE und der ganzen Welt zu tragen.66
Aber auch hier gilt natürlich das alte Sprichwort: caveat emptor – „Augen auf beim Eierkauf!“ Die Kidville University beispielsweise gehört zu einer internationalen Kindergarten-Kette. Und fraglos gibt es auch Phantom-Universitäten, die nur zu gern Anzahlungen entgegennehmen, über ihre Website hinaus aber nichts zu bieten haben.
Dennoch ist eines klar: Die Scheichs vom Golf setzen große Stücke auf den Hochschulsektor. Die großzügige Spende Scheich Zayids an die London School of Economics mag man als Ausdruck seines guten Willens auffassen.67 Viel ist von einer „wissensbasierten Ökonomie“ die Rede, und dieses Schlagwort fällt besonders häufig, wenn emiratische Politiker oder Beamte ihre Pläne für die „Zeit nach dem Öl“ darlegen; schon jetzt wird die starke Abhängigkeit der VAE vom Ölexport als problematisch empfunden. Aber das Streben nach Wissen lässt sich schwerlich rein wirtschaftlich begründen. Der Sinn und Zweck des Wissenserwerbs an sich muss in jedem Bildungsverständnis, das auf eine tatsächliche Bildung des Individuums abzielt, zentral sein. Die Verantwortlichen in den Emiraten haben weder Kosten noch Mühen gescheut und sich hierüber ihre Gedanken gemacht. Zumindest auf dem Papier scheinen ihre Prioritäten dabei klar zu sein:
Die VAE bieten heute Schülern und Studenten beiderlei Geschlechts eine umfassende Erziehung vom Kindergarten bis zur Universität; [diese ist] für emiratische Staatsangehörige auf allen ihren Ebenen kostenfrei. … Viel ist bereits erreicht worden, aber es herrscht Einstimmigkeit darüber, dass noch vieles zu tun bleibt. … Die emiratische Regierung wird Bildungsfragen auch weiterhin oberste Priorität einräumen, [dazu werden] 21 Prozent des Bundeshaushalts für 2014 aufgewandt, das sind 9,8 Milliarden Dirham [etwa 2,45 Milliarden Euro]; [davon] werden allein 3,8 Milliarden Dirham [etwa 950 Millionen Euro] in akademische Exzellenzinitiativen für die lokalen Universitäten investiert.
Um diese politische Linie erfolgreich umzusetzen, hat das Erziehungsministerium der VAE … eine Reihe von ambitionierten Fünfjahresplänen entworfen, die eine signifikante qualitative Verbesserung erzielen sollen …, insbesondere mit Blick auf das methodische Vorgehen der Lehrenden und Lernenden.68
Die entscheidenden Formulierungen sind „akademische Exzellenzinitiativen“ und „signifikante qualitative Verbesserung“. Zur Erreichung beider Zwecke wurde das Emirates College for Advanced Education gegründet. „Wir sind wie jene, die einen Berg bestiegen haben und nun auf dem Gipfel angelangt sind,“ hat Scheich Zayid einmal gesagt, „wenn wir nach unten schauen, wollen wir immer noch höher hinaus.“
Mein Vortrag in Al-Ain hat mir eine Kostprobe von diesem hochgelobten Bildungssystem verschafft. Der Kanzler der Hochschule, ein freundlicher, weißhaariger Kanadier, sprach ein paar einführende Worte und stellte mich vor; man hatte ihn aus dem Ruhestand zurückgeholt, um die Verwaltung dieser Universität zu übernehmen. Auch die Rektorin der Hochschule, eine würdige, etwas ernste ältere Dame in schwarzem Gewand, saß im Publikum, was ich als eine besondere Ehre auffasste. Der Hörsaal verfügte über die neueste Technik: elektrische Verdunklungsrollos, dimmbare Beleuchtung, Kameras und Mikrofone zur Aufzeichnung von Vorlesungen, Beamer und Leinwand für Präsentationen. Die roten Plüschsessel hätten in einem Opernhaus nicht fehl am Platz gewirkt. Geräuschlos wehte eine fein justierte kühle Brise aus den Belüftungsschlitzen an der Decke des Saales. Dreißig oder vierzig Angehörige des Lehrkörpers, die allermeisten von ihnen Europäer, saßen gemeinsam in der Mitte des Auditoriums. Drei Studentinnen in schwarzen abayas saßen am äußersten rechten Rand des Zuschauerblocks; nicht einmal die dringliche Bitte des Kanzlers konnte sie dazu bewegen, in die Mitte der Sitzreihe durchzurücken.
Nach meinem Vortrag wurden Tee und feines Gebäck gereicht. Als ich gerade mit einer Gruppe von Englischdozenten plauderte, kam der Kanzler und scheuchte die drei mutigen Studentinnen in meine Richtung. Ihre Köpfe waren bedeckt, aber sie waren nicht verschleiert. Nur eine von den dreien war unverkrampft genug, mit mir ein paar Worte zu wechseln, bat aber darum, dass wir Französisch sprächen. Sie kam aus Algerien, und der zweiminütige Austausch von Höflichkeiten, der sich nun anschloss, war auch schon mein ganzer Kontakt mit der örtlichen Studentenschaft. Ganz so, wie Geschäftsleute sich mit einem „schwarzen Loch“ konfrontiert sehen, stehen Kurzzeit-Besucher nicht selten vor einer „gläsernen Wand“, die einen ungezwungenen Austausch mit den Einheimischen zumindest erschwert.
Anschließend bot man mir eine Tour über den äußerst sonnigen Campus. Mein weißgewandeter Betreuer fuhr mich in einem elektrischen Golfwagen von einem prachtvollen Gebäude zum nächsten. Vom Giebel eines halbmondförmigen Verwaltungsgebäudes strahlte uns als Wandgemälde ein riesiges Porträt von Scheich Zayid entgegen. Gegenüber dem Sportzentrum mit seinem wettkampftauglichen 50-Meter-Becken standen schmucke Studentenwohnheime und Laborgebäude aufgereiht, die aus makellosem roten Backstein gerade erst neu erbaut worden waren. In den Regalen der riesenhaften neuen Universitätsbibliothek standen noch kaum Bücher, aber die technisch voll ausgestatteten Einzelleseräume waren geräumig und licht; auch die zentrale Buchausgabe genügte, was die Computertechnik anging, höchsten Ansprüchen. Uniformierte Bibliotheksmitarbeiter warteten nur darauf, jemandem behilflich sein zu können.
Erst nach einer Weile wurde mir klar, was hier fehlte. Im Schwimmbecken waren keine Schwimmer, in den Labors keine Forscher, keine Leserinnen und Leser in der Bibliothek. Alle diese prachtvollen Einrichtungen waren vollkommen menschenleer. Es war Donnerstagnachmittag; alle Studenten, sagte man mir, seien mit Bussen in die Stadt zurückgefahren worden, um dort mit ihren Familien das muslimische Wochenende – Freitag und Samstag – zu verbringen.
„Was ich ihnen gerade gezeigt habe“, sagte mein kundiger Führer, „ist der Frauencampus. Wir haben hier einen Frauenanteil an der Studentenschaft von gut 80 Prozent, aber da jetzt ja niemand hier ist, kann ich problemlos mit Ihnen herumfahren. Der Männercampus ist auf der anderen Seite des ‚Halbmondes‘.“ Er erklärte mir auch, wie die Bibliothek funktioniert: Männer und Frauen haben getrennte Eingänge auf gegenüberliegenden Seiten des Gebäudes; sie holen ihre Bücher von getrennten Theken ab und lesen sie in getrennten Lesesälen. Die strikte Trennung der Geschlechter – und die Vormundschaft der Männer über die Frauen – erscheinen als unveränderliche Prinzipien der emiratischen Gesellschaft.
An meinem letzten Abend laden mich drei freundliche US-Akademiker zum Essen ein. Hier in den VAE arbeiten sie alle im Edubiz, wie sie es nennen, also im Bildungswesen. Zwei von ihnen sind in der Qualitätssicherung tätig, oder genauer: in quality assessment and analysis („Qualitätsprüfung und -analyse“). Alle sind sie Spitzenverdiener und geben offen zu, dass sie hier deutlich höhere Monatsgehälter erzielen, als man ihnen zu Hause in den Vereinigten Staaten gezahlt hatte.
Unser Gespräch beginnt mit Politik.
„Gibt es hier eigentlich irgendwelche Regimekritiker?“, frage ich gleich als Erstes.
„Aber klar!“, antwortet einer. „Viele Tausend sogar. Das Problem ist nur: Wer hier offen seine Meinung sagt, bekommt so heftig eins über den Schädel, dass alle anderen gleich eine Todesangst bekommen.“
Erst vor Kurzem hatten fünf Emiratis in einem Brief vorzuschlagen gewagt, die Mitglieder der Nationalversammlung sollten zumindest teilweise gewählt werden. Die Unterzeichner des Briefes wurden sofort festgenommen, man drohte ihnen ein Strafverfahren wegen Aufwiegelung der Öffentlichkeit an.
„Aufwiegelung, meine Güte“, fuhr mein Gesprächspartner fort, „das ist ja praktisch Landesverrat.“
„Mich erinnert es an die Kommunisten in Osteuropa“, sage ich. „Die konnten auch nicht zwischen konstruktiver Kritik und bewaffnetem Aufstand unterscheiden. Und dann haben sie eben abgewartet, bis alles um sie herum zusammengebrochen ist.“
„Ja, das trifft’s genau“, kommt die Antwort. „Diese Kerle hier sind zwar zügellos liberal, wenn man sie mit den Nachbarn in Saudi-Arabien vergleicht; aber sie glauben ja trotzdem, dass sie ihre Autorität direkt von Allah bekommen haben.“
„Emire von Gottes Gnaden?“, werfe ich ein.
„Haargenau – und mit Allah führt man keine politische Debatte!“
„Und was ist mit den Islamisten?“, frage ich weiter. „Ein islamisches Land ohne Islamisten ist ja kaum vorstellbar.“
„Natürlich nicht. Die gibt’s hier haufenweise, und zwar in zig Varianten. Aber das Problem ist genau dasselbe wie bei den säkularen Dissidenten: Die Behörden können nicht zwischen harmlosen Spinnern und gefährlichen Extremisten unterscheiden. Es gibt zum Beispiel eine Gruppierung namens Al-Islah, das heißt ‚Reform‘. Einer ihrer Köpfe, eine Jemenitin, hat sogar den Friedensnobelpreis bekommen.* Aber die Regierung behandelt sie alle ohne Unterschied als Subversive und wirft ihnen vor, einen gewaltsamen Umsturz zu planen.“
Im Sommer 2013 fand in Abu Dhabi der Prozess gegen 94 Mitglieder von Al-Islah statt. Die Angeklagten wurden als Mitglieder der Muslimbruderschaft beschimpft – zu einer Zeit, als Mohammed Mursi, ebenfalls ein Muslimbruder, gerade noch als der erste demokratisch gewählte Präsident Ägyptens amtierte. Zudem waren die Verbindungen zwischen Al-Islah und der Muslimbruderschaft kein Geheimnis und gehen auf Ägypter zurück, die in den 1970er-Jahren auf der Flucht vor dem Nasser-Regime ins Ausland gingen. In den VAE erhielten nun 56 der Angeklagten Gefängnisstrafen; acht wurden in Abwesenheit verurteilt; und sechs wurden freigesprochen.69
„Werden die Scheichs also weiter den Deckel draufhalten?“, frage ich.
„Puh, keine Ahnung. Versuchen tun sie es, und wie. Gerade geht es sehr darum, das Internet zu kontrollieren.“
Der emiratische Hauptserver ETISAT blockiert unliebsame Websites automatisch, überwacht sämtliche Tweets und Facebook-Einträge. Und auch als unsere Unterhaltung sich in Richtung Bildungssystem bewegte, hat mich die Offenheit meiner Gesprächspartner verblüfft. Keiner dieser Profis hatte auch nur den geringsten Zweifel daran, dass in dem System, in dem sie alle arbeiteten, gehörig etwas faul war. Dabei machten sie der Regierung keine Vorwürfe – auch wenn sie sich über die „black box“ beschwerten –, und auch ihren Expat-Kollegen gaben sie keine Schuld (auch wenn sie hier und da auf ein schwarzes Schaf zu sprechen kamen): Was ihnen wirklich gegen den Strich ging, war die tief verwurzelte emiratische Art, mit Lehren und Lernen umzugehen.
„Das größte Hindernis“, sagte einer, „ist der sture, vollkommen statische Wissensbegriff, den die hier haben. Wissen hat für die mit Denken scheinbar gar nichts zu tun.“
„Alles, was die Dozenten wollen“, sagte ein anderer, „ist eine Powerpoint-Präsentation, mit der sie eine Zusammenfassung von einem beliebigen Thema abliefern, und die Studenten plappern es dann nach.“
„Selbst denken? Fehlanzeige!“
„Von Spitzenforschung haben die noch nie gehört.“
Dann nehmen sie das „absolut bizarre Geschlechterverhältnis“ aufs Korn.
„Frauen studieren hier hauptsächlich, damit sie mal die Überwachung durch ihre Männer und Brüder loswerden.“
Viele bekommen schon vor Studienbeginn die ersten Kinder, wie es scheint, und die Mehrzahl der Studentinnen wird sich gleich nach Studienabschluss auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter konzentrieren. Nur relativ wenigen gelingt es, eine akademische oder berufliche Karriere einzuschlagen. Ein größeres Hindernis als die äußeren Umstände scheinen dabei die inneren Einstellungen zu sein.
„Emiratis zu einer Promotion bewegen zu wollen, ist ein absoluter Albtraum“, sagt der dritte Universitätsmensch. „Die verstehen gar nicht, was das soll, haben keinerlei Begriff davon, ‚wissenschaftliches Neuland zu betreten‘ oder ‚bahnbrechende Entdeckungen‘ zu machen. Man hört ja manchmal, die seien einfach faul. Das glaube ich aber nicht. Es liegt an etwas anderem: Wenn wir Forschungsprogramme damit bewerben, dass dort ein ‚eigener Beitrag zum Wissen der Menschheit‘ geleistet werden soll, dann sehen die Menschen hier einen inneren Widerspruch – und schreiben sich nicht ein.“
Das hat schwerwiegende Folgen. Seit zwanzig Jahren versucht man, das emiratische Hochschulsystem mit einheimischen Kräften zu „emiratisieren“ – bislang ohne Erfolg. Dabei ist das Ziel, Wissenschaftler aus dem Inland heranzuziehen, um die „importierten“ Professoren nach und nach zu ersetzen.
„Aber wir können doch niemandem einen Lehrstuhl geben, der noch keine Doktorarbeit geschrieben hat!“
Amerikaner und Europäer kritisieren zwar gern, sollten aber nicht vergessen, dass auch die westlichen Bildungssysteme keineswegs perfekt sind – und außerdem Jahrhunderte gebraucht haben, um ihren heutigen, modernen Entwicklungsstand zu erreichen. Noch dazu ist ein eher statischer Wissensbegriff, historisch gesehen, ja kein alleiniger Makel der islamischen Welt. Noch Jahre nachdem Francis Bacon seinen 1605 erschienenen Klassiker The Advancement of Learning (Über den Fortschritt der Wissenschaften) geschrieben hatte, war sein Zeitgenosse Galileo Galilei ins Gefängnis geworfen worden, weil er das Weltbild der römischen Kirche infrage gestellt hatte. Das ist jetzt vierhundert Jahre her. Die VAE wollen dieselbe Entwicklung von Galileo bis heute innerhalb weniger Jahrzehnte aufholen.
Wie jedes Kind weiß, ist das Aufstellen von Hochschul-Ranglisten keine exakte Wissenschaft. Englischsprachige Universitäten, auf die dieser Brauch ja letztlich zurückgeht, haben dabei einen gewissen Startvorteil. Zum Zeitpunkt meines Besuches in den VAE waren die sechs in diesem Sinne „besten“ Universitäten der Welt die folgenden:
1. California Institute of Technology (Caltech)
2. Harvard
3. Stanford
4. Oxford
5. Princeton
6. Cambridge
Aber selbst, wenn man diese Dominanz angelsächsischer Institutionen mit einer gewissen Vorsicht bewertet, waren die schlechten Platzierungen arabischer Universitäten regelrecht beschämend. Trotz üppigster finanzieller Mittel haben es nur vier (!) von ihnen unter die eintausend besten Universitäten der Welt geschafft. Viele der Probleme, die in den VAE zu beobachten sind, betreffen den gesamten arabischen Raum. Die beste emiratische Hochschule, die Universität der VAE in Al-Ain, belegt zwar im innerarabischen Hochschulvergleich den achten Platz, steht weltweit jedoch nur auf Rang 1157. Die Universität Schardscha findet sich auf Rang 1694 wieder, die Amerikanische Universität von Schardscha sogar nur auf Rang 1922, und die hochgelobte technische Hochschule der Emirate, die Higher Colleges of Technology, bei denen ja „das selbstständige und lebenslange Lernen im Mittelpunkt steht“, liegen weit abgeschlagen auf Rang 2074.70 Manche sind der Ansicht, die arabische Hochschulwelt leide an einer Art „religiösem Kater“ – den schlimmen Nachwirkungen der lange Zeit dominanten religiösen Erziehung; dort stehen nämlich das Auswendiglernen und die stark ritualisierte Berufung auf theologische Autoritäten im Vordergrund. Andere verweisen eher auf den schädlichen Einfluss despotischer politischer Regimes, die jegliches kritische Denken unterdrücken.
Von diesen Punkten einmal ganz abgesehen, sollten die Emiratis sich fragen, ob Spitzenforschung und Hochschulbildung wirklich nur Waren oder Handelsgüter sind wie andere auch. Glauben sie wirklich, Wissen und Bildung könne man einfach so für Geld importieren? Ihre amerikanischen Freunde würden diese Frage vielleicht mit „ja“ beantworten, auch wenn vielen bewusst ist, dass die Sache eigentlich komplizierter ist. Hohe Bildungsstandards sind zum Teil das Werk von guten Lehrern, Dozenten und Professoren, die man ja durchaus ausbilden oder „einkaufen“ kann; aber zu einem größeren Teil sind sie das Ergebnis eines produktiven Austauschs zwischen Lehrenden und Lernenden. Wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Lehrveranstaltung schlecht vorbereitet oder unmotiviert sind, wäre selbst ein Albert Einstein als Lehrer auf verlorenem Posten. Die Bodenqualität ist mindestens genauso entscheidend wie die Qualität des Saatguts. Vielleicht braucht das Ganze einfach Zeit. Bildung ist wie eine mächtige Eiche, die über Generationen langsam heranwächst. Niemand kann sie zu einem Wachstum zwingen, das ihre grundlegenden natürlichen Rhythmen übersteigt – vor allem nicht damit, dass man sie mit einer goldenen Gießkanne gießt. Bildung ist ein grundlegender Übertragungsmechanismus von Kultur – und Kultur ist, auf lange Sicht, stärker als Geld.
Fairerweise muss man sagen, dass viele bemühte Lehrer und Dozenten in der islamischen Welt sich der beschriebenen Problematik durchaus bewusst sind. Sie alle berufen sich auf ein Wort des Propheten Mohammed, der gesagt hat: „Das Streben nach Wissen ist Pflicht für jede Muslimin und jeden Muslim“, und wiederholen die Frage des Koran: „Sind etwa diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht wissen, gleich?“* Sie verweisen auf die Tradition, der zufolge Mohammeds Frau Aischa eine gebildete Person gewesen sei, und trösten sich mit der Tatsache, dass in vielen – wenn auch nicht allen – islamischen Ländern immer mehr Mädchen zur Schule gehen. In dieser Hinsicht gehören die VAE – wie auch etwa Iran – zu den absoluten Vorreitern, während Länder wie Jemen, Jordanien oder Sudan unter die Schlusslichter fallen. Wenn diese muslimischen Pädagogen nun ein neues Interesse an den kulturellen und wissenschaftlichen Errungenschaften des islamischen Mittelalters schöpfen, dann muss ihnen die relative Rückständigkeit ihrer Länder in der modernen Welt nur umso stärker ins Auge stechen – wie könnten sie den Riss nicht beklagen, der die religiöse und die weltliche Bildung inzwischen voneinander getrennt hat? Kurz gesagt, würden sie fraglos das Konzept einer „großen Divergenz“ akzeptieren, mit dem Kenneth Pomeranz die heutigen großen Unterschiede zwischen den „westlichen“ Ländern und dem Rest der Welt zu erfassen versucht hat. Und natürlich wollen sie, dass diese Lücke, diese „große Divergenz“, so schnell wie möglich geschlossen wird.71
Nicht alle Emiratis sind begeistert von dem drastischen, noch immer nicht vollkommenen Wandel in ihrem Land. Von der Besorgnis über Wanderarbeiter und Expats einmal ganz abgesehen, empfinden gerade ältere Menschen, die den radikalen Wandel vom Beduinenzelt zum klimatisierten Wolkenkratzer am eigenen Leib erfahren haben, keine geringe Nostalgie, wenn sie an die „gute alte Zeit“ von (Stammes-)Gemeinschaft und Solidarität denken:
Wir haben alles zusammen gemacht. Wir haben zusammen gewaschen, wir haben zusammen gefischt, wir haben zusammen gearbeitet [sic]. Wir haben unser Essen geteilt. … Unsere Kinder waren nicht nur die Kinder ihrer Eltern, sie waren die Kinder der ganzen Gruppe, der ganzen Nachbarschaft. Nach der Arbeit haben wir gemeinsam gesungen. Wir haben kaum etwas je alleine gemacht. Das Leben war härter damals, aber es war … ein schönes Leben. Es war einfach, und alle haben zusammengehalten. Heute sind alle verstreut … und kümmern sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten.72
Dass die Emirate mit nennenswerten kolonialen Altlasten zu kämpfen hätten, lässt sich wohl kaum behaupten. Zwar kann man den Briten durchaus vorwerfen, weite Teile der arabischen Welt für ihre eigenen politischen Zwecke ausgenutzt zu haben, nur um sich dann aus dem Staub zu machen, bevor in den betreffenden Ländern eine stabile Demokratie etabliert werden konnte. Aber im Gegensatz etwa zu Palästina oder Irak hat es in den Trucial States keinerlei Bestrebungen gegeben, eine tatsächlich imperiale Herrschaft zu errichten. Die schlimmsten Auswirkungen der britischen Protektoratsherrschaft am Persischen Golf waren wohl, dass sie ein antiquiert-patriarchales Gesellschaftssystem konserviert, das Gottesgnadentum der Scheichs legitimiert und letztlich ihren Beitrag geleistet hat, den „frischen Wind des Wandels“ von den Emiraten fernzuhalten.
Während ich mich für die Abreise fertig machte, ging mir daher der Wert „80 Prozent“ im Kopf herum: Rund 80 Prozent der emiratischen Bevölkerung werden grundlegende Bürgerrechte vorenthalten und sie erhalten dabei Löhne, die mindestens 80 Prozent unter dem Durchschnittsverdienst liegen; 80 Prozent der Hochschulabsolventen – nämlich die -absolventinnen – haben keine Aussicht darauf, ihr späteres Leben selbstbestimmt und gleichberechtigt führen zu können. Selbst unter den wohlhabenden Einheimischen regt sich Unmut. Das alles scheint mir eine gesellschaftspolitische Zeitbombe – und vielleicht liegt die Wahrscheinlichkeit ja schon jetzt bei 80 Prozent, dass sie demnächst hochgeht.
Anders als Cornwall oder Aserbaidschan oder viele andere Länder, die ich auf meiner Reise besucht habe, haben die Vereinigten Arabischen Emirate nur wenig wirklich tiefes historisches Wurzelwerk. Sie sind ein Geschöpf der letzten paar Jahrzehnte, ein Laboratorium und Musterbeispiel für den schwindelerregenden Wandel unserer gegenwärtigen Welt. Dabei verdankt sich das Gewimmel auf den Straßen von Dubai oder Abu Dhabi einzig und allein Immigranten und Neuankömmlingen: Auch jene angeblich „Eingeborenen“, die ortsansässigen Araber nämlich, die Kinder und Enkel jener Bedu-Nomaden, die Wilfred Thesiger beschreibt, sind vor gerade einmal zwei oder drei Generationen aus der angrenzenden Wüste hierhergekommen. Die Menschen in dem multinationalen Heer von billigen Arbeitskräften, die zahlenmäßig das Land inzwischen dominieren, sind Nutznießer und zugleich Opfer einer sich zunehmend aggressiv globalisierenden Weltwirtschaft. Und die kleinere Söldnertruppe der Expats ist ein Produkt des Jet-Zeitalters. Ihre Lage ist ebenso beneidenswert wie bemitleidenswert. Man fragt sich unweigerlich, ob dieser Boom nicht eines Tages – gleich einer Fata Morgana – genauso plötzlich wieder aufhören wird, wie er einst begonnen hat.
* Schon seit dem ersten Jahrhundert der islamischen Ära ist die islamische Welt in Sunniten und Schiiten gespalten. Beide Zweige berufen sich auf ihre Herkunft vom Propheten Mohammed: Der zugrundeliegende Streitpunkt ist nicht so sehr dogmatischer, sondern vielmehr legitimativer Natur. Global gesehen, sind die Sunniten in der Mehrheit; die Schiiten, deren kopfstärkster Vertreter Iran ist, befinden sich in der Minderheit.
* Die übliche Abkürzung für Ras al-Chaima, nach der englischen Transkription Ras al-Khaimah (Anm. d. Übers. T. G.).
* Zit. nach der Ausgabe des Hadith von Adel Th. Koury (Lizenzausgabe WBG 2008), Bd. 1, S. 39.
* In dem sprichwörtlich gewordenen Refrain des 1931 von Noèl Coward veröffentlichten Chansons Mad Dogs and Englishmen heißt es: Mad dogs and Englishmen go out in the mid-day sun – „[nur] tolle Hunde und Engländer gehen in der Mittagssonne spazieren“ (Anm. d. Übers. T. G.).
* Bei der vermeintlichen „Kamelspucke“ handelt es sich jedoch nicht tatsächlich um Speichel, sondern um halbverdauten Nahrungsbrei aus dem obersten Vormagen des Tieres.
* Bei ihrer Gründung hieß die paramilitärische Truppe noch Trucial Oman Levies, also etwa „Aufgebot des Vertragsoman“, ab 1956 dann Trucial Oman Scouts („Spähtruppe des Vertragsoman“).
* Tawwakul Karman, die Gründerin der Vereinigung Women Journalists without Chains (WJWC, „Journalistinnen ohne Ketten“), ist 2011 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden.
* Zit. nach der Ausgabe des Hadith von Adel Th. Koury (Lizenzausgabe WBG 2008), Bd. 1, S. 38.