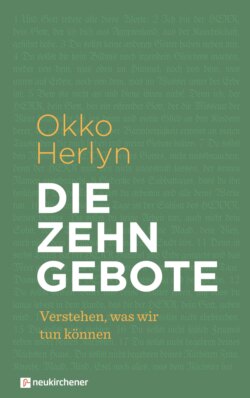Читать книгу Die Zehn Gebote - Okko Herlyn - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII. „ICH BIN DER HERR, DEIN GOTT“
Eine Präambel, die es in sich hat
1. Mehr als ein Vorwort
Es ist uns bereits aufgefallen: Der erste Satz der Zehn Gebote ist gar kein richtiges Gebot. Ein solches steht nach den Regeln der Grammatik bekanntlich in der Befehlsform (Imperativ). Dies aber ist ein Satz in der Aussageform (Indikativ): „Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe.“ Trotz dieses Unterschieds steht dieser Satz aber nun einmal in einem sehr engen Zusammenhang mit den folgenden Geboten. Es scheint sich um eine Art Prolog (wörtlich „Vorwort“) oder eine Präambel zu handeln. Solche Vorworte kennen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen. Nicht wenige Bücher zum Beispiel beginnen mit so einem vorangestellten Wort, in dem uns etwas Wichtiges zum Verständnis des Buches etwa durch den Herausgeber mitgeteilt wird.
Und wenn wir den Kreis noch etwas weiterziehen, dann stellen wir fest, dass Prologe manchmal sogar Teil des ganzen literarischen Werkes sind. Bereits die alten griechischen Tragödien machten reichlich Gebrauch davon. Oder wir denken an den berühmten „Prolog im Himmel“ in Goethes „Faust“, an den einen oder anderen Roman von Erich Kästner, ja selbst an das biblische Buch „Hiob“. Auch im übertragenen Sinne begegnet uns der Begriff hier und da. So heißt etwa die erste Etappe der „Tour de France“ seit jeher „Prolog“, weil es auch hier um eine wichtige Vorentscheidung geht, nämlich darum, wer das begehrte Gelbe Trikot des Spitzenreiters bis auf Weiteres tragen darf.
Vielleicht kommen wir jenem ersten Satz der Gebote noch etwas näher, wenn wir in ihm nicht nur ein Vorwort, sondern geradezu eine Präambel sehen. Eine solche hat eigentlich ein noch größeres Gewicht als ein bloßes Vorwort. Sie steht nämlich in der Regel vor besonders herausgehobenen Texten: Urkunden, Verträgen oder auch ganzen staatlichen Verfassungen, und gibt dabei die grundsätzliche Richtung vor, unter der der folgende Vertrags- oder Verfassungstext zu verstehen ist. Umgekehrt muss sich dieser immer wieder eben an den in der Präambel vorangestellten Grundsätzen messen lassen. So sind uns seit den Tagen des Englischunterrichts etwa die Worte aus der Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung im Ohr: „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal …“ Noch näher ist uns natürlich die Formulierung aus der Präambel unseres eigenen Grundgesetzes: „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen … hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.“ Andere, die ebenfalls in der Schule ein wenig aufgepasst haben, vergleichen eine Präambel gerne mit dem Vorzeichen vor einer Klammer. Ein solches – so viel sollte vom Mathematikunterricht hängen geblieben sein – bestimmt entscheidend den gesamten Inhalt dessen, was sich in der Klammer befindet. Plus oder minus. Wie auch immer – die in einer Präambel formulierten Grundsätze bestimmen also entscheidend den „Charakter“ des ihr folgenden Textes.
Um nun dem Charakter der Zehn Gebote auf die Spur zu kommen, ist es demzufolge sinnvoll, sich die Grundsätze klarzumachen, die in dieser Präambel formuliert werden. Ohne das Beachten dieser Grundsätze könnten wir sonst Gefahr laufen, die Gebote völlig misszuverstehen. Das kann niemand wollen. Und dass es beim Verständnis der Zehn Gebote von Missverständnissen nur so wimmelt, gehört leider zu den eher betrüblichen Seiten der Christentumsgeschichte. Über manche davon werden wir noch reden müssen. Gucken wir uns also zunächst in aller Ruhe an, was überhaupt in dieser Präambel drinsteht.
2. Was für Gott typisch ist
„Ich bin die Katrin.“ Wir sitzen gerade in einer Vorstellungsrunde. Bevor es an die eigentliche Arbeit geht, soll jeder kurz etwas Typisches über sich sagen. „Ja, also, ich bin die Katrin“, ist nun gerade Katrin an der Reihe. „Ich bin 32 Jahre alt, habe zu Hause einen süßen kleinen Kater, lache gerne und bin manchmal etwas ungeduldig.“ Nun wissen wir also schon etwas mehr über Katrin. Zumindest einiges von dem, was sie selbst uns als für sie typisch mitteilen möchte.
Auch die Präambel der Zehn Gebote fängt mit so einer „Ich-bin“-Formulierung an: „Ich bin der Herr, dein Gott …“ Wenn das Katrin-Beispiel zutrifft, dann können wir also auch hier etwas von dem erfahren, was Gott selbst uns als für ihn typisch mitteilen möchte. Solche sogenannten „Selbstvorstellungsformeln“ Gottes kommen in der Bibel gar nicht so selten vor. „Ich bin dein Schild und sehr großer Lohn“, sagt er zum Beispiel zu Abraham (1. Mose 15, 1). „Ich bin mit dir“, sagt er zu Jakob (1. Mose 28, 15). „Ich bin der Herr, und sonst keiner mehr“, sagt er zu Jesaja (Jesaja 45, 5). Aus all diesen Worten spricht zunächst eine unbedingte göttliche Autorität. Wer Gott ist, kann nur Gott selbst sagen. (Nebenbei: Es ist ähnlich wie in jener Vorstellungsrunde. Wer Katrin ist, kann auch nur Katrin selbst sagen.) Aber was ist das – wenn man so will – „Typische“ für Gott?
Er selbst sagt von sich: „Ich bin der Herr.“ Was Martin Luther und andere an dieser Stelle mit „Herr“ übersetzen, ist im hebräischen Urtext der Zehn Gebote nur eine merkwürdige Folge von Buchstaben: JHWH. Dieses Kürzel geht zurück auf die Geschichte von der Berufung des Mose am Berg Horeb in der Wüste (2. Mose 3). Auch dort stellt sich Gott vor: „Ich bin, der ich bin.“ Der hebräische Text lässt auch zu, es mit „Ich werde sein, der ich sein werde“ oder mit „Ich bin da, weil ich da bin“ wiederzugeben. Dieses kurze Sätzchen lässt sich im Hebräischen in der Buchstabenfolge JHWH, dem sogenannten Tetragramm, zusammenfassen. Fortan steht in der jüdischen Tradition bis heute das Tetragramm für den Namen Gottes. Während die christliche Tradition in der Regel dort, wo es auftaucht, unbefangen das Wort „Herr“, manchmal auch „Jahwe“ verwendet, spricht ein jüdischer Mund diesen Namen Gottes grundsätzlich nicht aus. Aus Ehrfurcht. Stattdessen werden Umschreibungen gewählt: „der Ewige“, „der „Heilige“, „der Erhabene“ oder einfach auch nur „der Name“.
Wie auch immer man die Selbstvorstellungsformel Gottes in der Berufungsgeschichte des Mose auch übersetzt, in jedem Fall scheint eine Grundbotschaft unmissverständlich hindurch: Gott stellt sich als derjenige vor, der unbedingt für sein Volk da ist und bleiben wird. Die Erzählung setzt sich nämlich so fort: „So sollst du zu den Israeliten sagen: Der ,Ich bin da‘ hat mich zu euch gesandt“ (2. Mose 3, 14). Und so ist auch aus der Selbstvorstellungsformel unserer Präambel zunächst nichts anderes als die unbedingte Zuwendung Gottes zu den Seinen herauszuhören. Wenn Gott sagt: „Ich bin“, so ist das etwas grundsätzlich anderes als die bloß theoretische Behauptung der Existenz einer Gottheit. Über diese Frage kann man gerne anderenorts philosophisch streiten. Hier geht es darum, dass von Gott her eine Beziehung gestiftet wird: „Ich bin der Herr, dein Gott.“
Ja, es ist schon auffallend, dass in der Bibel überall dort, wo von Glauben die Rede ist, wenig bis gar nicht über die sogenannte „Gottesfrage“ abstrakt theoretisiert wird. Im Glauben geht es dort immer zuerst um eine Beziehung, und zwar um eine überaus vertrauensvolle. „Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit“, heißt es zum Beispiel von einem der Erzväter (1. Mose 15, 6). Und wenn Jesus im Neuen Testament die starke „Ich-bin“-Formel übernimmt, so beansprucht er damit nicht nur göttliche Autorität, sondern veranschaulicht in vielen verschiedenen Bildworten immer wieder andere und neue Seiten eben einer unverwechselbaren Beziehung: „Ich bin der gute Hirte“ (Johannes 10, 11). „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ (Johannes 15, 5). „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Johannes 14, 6). Es ist nicht verwunderlich, wenn etwa Konfirmanden, die sich ihren Konfirmationsspruch selbst aussuchen dürfen, häufig eins dieser Ich-bin-Bildworte wählen. Was auch immer sie im Unterricht gelernt oder auch nicht gelernt haben mögen, sie haben wenigstens verstanden: Da ist jemand für mich da. Ich gehöre zu ihm, komme, was da wolle. Auf meiner Konfirmationsurkunde sind die Worte aus dem Heidelberger Katechismus zu lesen: „… dass ich mit Leib und Seele, beides, im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin.“
Diese von Gott selbst gestiftete Zugehörigkeit zu ihm wird nun in der Präambel der Zehn Gebote noch einmal präzisiert, wenn es dort heißt: „Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe.“ Das erinnert unschwer an die Geschichte des Volkes Israel, wie sie ja in aller Breite in der Bibel erzählt wird. Durch dramatische Umstände, vor allem aufgrund wirtschaftlicher Nöte, gerät die Großfamilie des Erzvaters Jakob in die Fremde nach Ägypten. Nach etlichen Generationen werden sie dort zu einem großen Volk, vor dem sich die Ägypter irgendwann allerdings zu fürchten beginnen. Wir lesen: „Siehe, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unsern Feinden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Land hinaufziehen“ (2. Mose 1, 9f). Fortan wird das Volk der Israeliten nicht nur „mit List niedergehalten“, sondern unterdrückt, geknechtet und ausgebeutet: „Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Dienst und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie ihnen mit Gewalt auferlegten“ (13f).
Doch dann kommt es zu einer dramatischen Wende. Gott selbst greift in diese schreckliche Geschichte ein: „Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt“ (2. Mose 3, 7f). Wie auch immer sich diese Geschichte im Einzelnen historisch gesehen abgespielt haben mag, das Volk Israel lebt bis heute von dieser – psychologisch gesprochen – „Urerfahrung“: Gott ist nicht nur einfach „da“, so wie man etwa davon reden kann, dass ein Baum oder ein Haus „da“ ist, also bloß existiert. Gott ist vielmehr für seine Menschen da („dein Gott“), ja, mehr noch: Er ist so für seine Menschen da, dass er sie aus der Unterdrückung befreit („der ich dich aus der Knechtschaft geführt habe“).
Halten wir fest: Wenn es in der Präambel der Zehn Gebote um die Selbstvorstellung Gottes geht, und wenn – noch einmal dem Katrin-Modell folgend – Gott selbst über sich etwas für ihn Typisches sagt, dann ist die Botschaft ganz einfach: Aus Gottes eigener Sicht ist Befreien etwas für ihn Typisches. Der Gott, der uns in den Zehn Geboten begegnet, ist ein grundsätzlich befreiender Gott. Wie quer liegt allein diese Erkenntnis zu den vielen Vorurteilen, die einem bei der Erwähnung der Zehn Gebote auch begegnen. Auf die Frage, was das Christentum sei, antwortete mir ein Konfirmand: „Alles das, was man nicht darf.“ Hat er recht? Die Präambel spricht jedenfalls eine andere Sprache.
3. Eine theologische Grammatik der besonderen Art
Wir müssen noch einmal auf die Grammatik zu sprechen kommen. Die Zehn Gebote sind ja – so ist das eben bei Geboten – grammatikalisch in der sogenannten „Befehlsform“ (Imperativ) verfasst: „Du sollst …“ beziehungsweise „Du sollst nicht …“. Solche imperativischen Formulierungen begegnen uns ja auch sonst häufig im Leben. „Übersetzen Sie bitte den folgenden Abschnitt!“ Wie oft bin ich seinerzeit unter solchen „Befehlen“ zusammengezuckt. Wenn man mal darauf achtet: Überall sind wir eigentlich von Befehlen, Vorschriften, Geboten, Verboten, Regeln, Aufforderungen oder Anweisungen umzingelt. „Keine Reklame einwerfen!“, ist zum Beispiel in harschem Ton an meinem Briefkasten zu lesen. Und relativ humorlos kommt sogar eine harmlose Straßenverkehrsordnung daher, wenn es in einem ihrer ersten Paragrafen heißt: „Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass …“ Das Zusammenleben von Menschen funktioniert offenbar nur so, dass vieles nicht dem persönlichen Ermessen überlassen werden kann oder der Frage, ob ich gerade dazu Lust habe, sondern dass es schlicht eingefordert werden muss. Befehlsform, Imperativ. Um mit einem ehemaligen Bundeskanzler zu sprechen: „Basta!“ So weit, so gut.
Doch nun ist uns bereits aufgefallen, dass die den Geboten vorausgehende Präambel selbst nicht in der Befehls-, sondern in der sogenannten Aussageform (Indikativ) steht. Diese Vorordnung des Indikativs vor dem Imperativ ist eine Besonderheit, die für die gesamte theologische Grammatik der Bibel kennzeichnend ist. Bevor es dort nämlich um irgendein menschliches Sollen (Imperativ) geht, geht es grundsätzlich zunächst einmal um das Feststellen dessen, was von Gott her bereits ist (Indikativ). Erst mit Blick auf das, was Gott tut und bereits getan hat, nimmt die Bibel das in den Blick, was nun vom Menschen her zu tun und zu lassen ist. Der Apostel Paulus zum Beispiel hat nach diesem theologischen Grundmuster ganze Briefe konzipiert. Es kann gut sein, dass der Dekalog mit seiner vorangestellten Präambel dabei Pate gestanden hat. Und der Theologe Karl Barth hat dieser Grammatik mit seiner berühmten Formel „Evangelium und Gesetz“ (statt „Gesetz und Evangelium“) Rechnung getragen.
Die Wichtigkeit dieser Vorordnung des Indikativs vor dem Imperativ kann man sich leicht an zwei einfachen Gedankenspielen klarmachen. Nehmen wir zum Ersten einmal an, jene indikativische Präambel gäbe es gar nicht. Die übrig bleibenden Zehn Gebote könnten dann leicht als ein bloßer Moralkodex missverstanden werden, als angeblich ehernes Sittengesetz oder nur als „Quintessenz des Menschenanstandes“, um mit Thomas Mann zu reden. Das hätte am Ende womöglich das Gegenteil dessen zur Folge, was eigentlich beabsichtigt ist. „Keiner tut gern tun, was er tun darf – was verboten ist, das macht uns grade scharf“, singt Wolf Biermann. Wo er recht hat, hat er recht.
Oder nehmen wir zum Zweiten einmal an, es verhielte sich mit der biblischen Grammatik genau umgekehrt, also so, dass der Indikativ (Gottes Tun) dem Imperativ (Tun des Menschen) nachfolgte. Das hieße dann ja, dass Gottes Tun eine Art „Quittung“ – sei’s Lohn, sei’s Strafe – für unser Tun wäre. Nach dem Motto des bekannten Karnevalschlagers: „Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind.“ Und leider ist das Befolgen der Gebote auch in der Christenheit häufig genau so missverstanden worden: als eine moralische Leistung, um Gottes Gunst zu erwerben. „Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm.“ Frömmigkeit als religiöses Geschäft. So kann man bereits in kleine Kinderherzen gefährliche Irrlehren einpflanzen.
An der Präambel wird indes sehr anschaulich, dass die Botschaft der Bibel eine andere ist. Zuerst wird daran erinnert, was Gott getan hat. Dann erst geht es – eben in den folgenden Geboten – um das, was vom Menschen um Gottes willen zu tun ist. Damit bekommen die Gebote selbst noch einmal einen anderen Charakter als den einer bloßen Forderung. Wissenschaftler, die der alttestamentlichen Ursprache mächtig sind, weisen gerne darauf hin, dass der hebräische Imperativ nicht nur mit „du sollst“, sondern auch mit „du wirst“, „du kannst“, ja womöglich sogar mit „du darfst“ wiedergegeben werden kann. Das würde bedeuten, dass in allen Imperativen der Zehn Gebote gerade keine neue, sozusagen „moralische Knechtschaft“ errichtet wird, sondern dass in ihnen vor allem eine große Verheißung beschlossen liegt: Da, wo du den Weisungen dieses befreienden Gottes folgst, „wirst“, „kannst“, ja „darfst“ du seiner Befreiung in deinem Leben und in deiner Welt Raum geben. Kein Wunder, wenn es in der Bibel immer wieder heißt, dass Menschen „Freude“ (Psalm 119, 47), ja sogar „Lust am Gesetz des Herrn“ (Psalm 1, 2) haben. Der Heidelberger Katechismus spricht in diesem Zusammenhang von „Lust und Liebe, nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben“ (Frage 90). Das ist zunächst einmal ein völlig anderer Grundton als der, mit dem man ganzen Generationen die Zehn Gebote mit verbiesterter, moralinsaurer, gar drohender Freudlosigkeit eingetrichtert hat.
Dieser Verheißungscharakter der Gebote darf nun allerdings nicht mit einer willkürlichen Beliebigkeit verwechselt werden. Etwa nach der Weise: Du kannst zum Beispiel dem Gebot, nicht zu töten, Folge leisten, du kannst es aber ebenso gut bleiben lassen. Das „du kannst“ hebt das „du sollst“ nicht auf. Schön wäre es sicher, wenn immer alles, was um Gottes willen zu tun und zu lassen ist, gewissermaßen von selbst geschieht. Tut es aber bekanntlich nicht. Manchmal müssen wir zu dem, was für uns und andere gut ist, eigens aufgefordert werden. Das bleibende „du sollst“ verdunstet nicht einfach in dem „du kannst“ oder „du wirst“. Vielmehr erinnert es uns daran, dass es in den Geboten Gottes auch um eine Verbindlichkeit geht, der wir uns nach Gottes Willen nicht einfach entziehen können. Ja, es kann durchaus sein, dass das gewissenhafte Befolgen der Gebote uns manchmal hart ankommen mag. Das ändert aber nichts an jener verheißenen Freiheit, die es mit den Geboten zu bewähren und zu bewahren gilt.
Beim Vorwort der Zehn Gebote haben wir es mit einer Präambel zu tun, die es wahrhaftig in sich hat. Sie macht unmissverständlich deutlich, dass es bei den Geboten nicht um repressive Gesetzlichkeit, sondern – mit Worten des tschechischen Theologen Jan Milič Lochman – um eine „Wegweisung der Freiheit“ geht. Deshalb werden wir gut daran tun, wenn wir im Folgenden genau diese Leitfrage mitschwingen lassen: Wovon befreien die Gebote überhaupt? Wovon befreit etwa ein „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir“ oder ein „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren“ oder ein „Du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten“? Und es könnte sein, dass wir unter dieser Leitfrage auch mit manch einem Missverständnis oder Vorurteil, ja vielleicht sogar mit manch einer Irrlehre aufräumen müssen. Aber auch ein bloßes Aufräumen, das weiß ich von meinem Schreibtisch, kann manchmal schon etwas Befreiendes an sich haben.