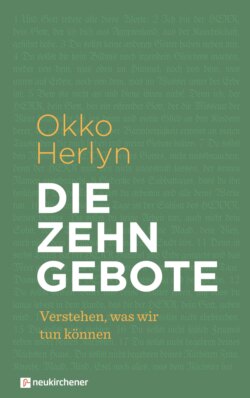Читать книгу Die Zehn Gebote - Okko Herlyn - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII. „KEINE ANDEREN GÖTTER HABEN“
Kompromissloser Ruf in die Freiheit
1. Fragen, die nicht am Schreibtisch entstehen
Steil und keinen Widerspruch duldend, tritt uns gleich nach der Präambel das erste Gebot entgegen: „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ Man hat den Eindruck, dass es kein Zufall ist, dass ausgerechnet dieses Gebot vornean steht. Schon sein ganzer Tonfall verrät, dass es nicht nur das zahlenmäßig erste, sondern seiner Bedeutung nach auch das wichtigste Gebot ist. Dass von ihm – ähnlich wie von der vorausgegangenen Präambel – eine gewisse Strahlkraft auf alle anderen Gebote ausgeht. Das muss wohl auch Martin Luther so gesehen haben, wenn er in seinem Kleinen Katechismus die kurze Erläuterung des ersten Gebots, nämlich dass wir „Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen“ sollen, bei jeder einzelnen Erläuterung der folgenden Gebote noch einmal wiederholt. Doch im Ernst: „keine anderen Götter haben“ – gibt es da nichts Wichtigeres? Und was ist mit den vielen Fragen, die – etwa in Zeiten des religiösen Pluralismus – sogleich über einen herfallen? Was ist mit so etwas wie Toleranz? Was mit der „eigenen Façon“, nach der „jeder selig werden soll“? Was mit der gerade wieder aufkeimenden harschen Kritik am sogenannten „Monotheismus“? Fragen, die allerdings nicht nur am Schreibtisch entstehen.
In der Schule „mit überdurchschnittlich hohem Ausländeranteil“ soll der jährlichen Entlassfeier ein ökumenischer Schulgottesdienst vorausgehen. Eine junge engagierte Lehrerin empfindet das als „Diskriminierung der muslimischen Schüler“. Ihr Vorschlag: Ob man nicht einmal einen interreligiösen Schulgottesdienst halten könne. Beim bald zustande kommenden Round Table mit evangelischen, katholischen und muslimischen Lehrern und Schülern zeigt sich, dass allein die Wortwahl Probleme macht. Worum soll es gehen? Um einen „Gottesdienst“, also eine Versammlung im Namen Jesu? Da sträuben sich die protestantischen Haare, weil Etikettenschwindel droht. Oder um eine „Messe“? Da ist die katholische Seite mit ihrer eucharistischen Definitionshoheit vor. Oder einfach nur um ein „Gebet“, wie es die muslimische Seite in Anlehnung an ihr Freitagsgebet vorschlägt? Auch hier sperrt sich etwas. Beten wir denn alle zu demselben Gott? In Ermangelung einer besseren Idee einigt man sich schließlich auf „interreligiöse Entlassfeier“. Etwas holperig zwar, aber besser als gar nichts. In der Feier selbst sollen die Ängste und Hoffnungen der Schülerinnen und Schüler zur Sprache kommen. Die Frage nach einem gemeinsamen Gebet wird so gelöst, dass zunächst ein muslimischer Schüler das Allahu akbar spricht, danach die christlichen Schüler gemeinsam das Vaterunser. Wenn schon nicht miteinander, so doch wenigstens nebeneinander beten. „Keine anderen Götter haben neben mir“?
In dem Gespräch mit dem jungen heiratswilligen Paar ist das meiste geklärt. Nach den üblichen Erkundungen im Hinblick auf Wohnung, berufliche Perspektiven, Urlaubspläne und verschiedene Interessen ist nun der Traugottesdienst selbst an der Reihe. Termin, Trauzeugen, Texte, Lieder, Fürbitten, Musik, Altarschmuck, Einmarsch, Empfang mit Prosecco vor dem Kirchenportal. Anschließend Hochzeitsessen in den Rheinterrassen, „wozu Sie natürlich auch ganz herzlich eingeladen sind“. Beim Eintrag in die vorgesehenen Formulare stellt sich heraus, dass beide verschiedenen Konfessionen zugehören. Ob das ein Problem für sie darstelle? Nein, das sei völlig egal. „Wir glauben doch alle an einen Gott“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Toleranz oder Gleichgültigkeit? Man weiß es nicht so richtig. Da fällt der Braut noch etwas ein. Ob ihre vierjährige Tochter wohl beim Ausgang die Blumen streuen dürfe. Selbstverständlich. Sie solle sich nur mit der Küsterin verständigen. Wegen des Teppichs. Aber wo sie das gerade anspreche, eine ganz andere Frage. Aus den Unterlagen sei zu ersehen, dass ihre Tochter noch gar nicht getauft sei. Ob man nicht die Gelegenheit nutzen solle, um das nachzuholen? „Nein, das soll unsere Tochter später einmal selbst entscheiden. Wissen Sie, es gibt da ja heutzutage so viele spirituelle Möglichkeiten. Was sollen wir ihr da Vorschriften machen?“ Herzliche Verabschiedung an der Tür des Pfarrhauses. „Keine anderen Götter haben neben mir“?
Ralf gehört zu denen, die sich gerne für das, wovon sie überzeugt sind, mit Eifer ins Zeug legen. Manchmal sogar mit einer gewissen missionarischen Leidenschaft. Wir sitzen in der Kneipe gegenüber und kommen, wie das so ist, auf dieses und jenes zu sprechen. Nun ist Ralf gerade dabei, mir wortreich von einem Buch zu berichten, das er gerade gelesen hat. Der Autor habe darin eine für ihn völlig neue, aber sehr schlüssige These vertreten. Danach sei für die Gewalt in der Welt, man denke nur an terroristische Anschläge, an Folter und Kriege oder in der Vergangenheit an Kreuzzüge, Hexenverbrennungen und Judenpogrome, ursächlich der Monotheismus verantwortlich. Wie bitte? Ja, der wahnwitzige Glaube, es könne nur einen wahren Gott geben, der ja zur Folge habe, dass alle anderen Götter unwahr seien, spalte die Welt automatisch in Freund und Feind, in „wir“ und „ihr“. Demgegenüber seien polytheistische Religionen wie etwa der Hinduismus, die von vornherein von der Existenz vieler Götter ausgingen, schon im Ansatz friedfertiger. Wer verschiedene Götter und damit eben auch verschiedene Wahrheiten anerkenne, sei von Hause aus toleranter und weniger gewaltbereit. Die Nachfrage, wie man sich denn die gewaltsamen Übergriffe hinduistischer Nationalisten auf muslimische und christliche Minderheiten etwa in Indien zu erklären habe, ficht Ralf in seiner neuen Erkenntnis offenbar nicht an. „Schwarze Schafe gibt es eben überall.“ Wir bestellen zwei frische Pils.
„Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ Einsames Relikt aus längst vergangenen Religionen? Gefährlicher Kern monotheistischer Intoleranz? Oder gerade umgekehrt Ausdruck einer universalen, ja geradezu menschenverbindenden Überzeugung, wonach „wir doch alle an einen Gott glauben“? Sehen wir uns das erste und wichtigste Gebot einmal in Ruhe an.
2. Null Toleranz?
„Keine anderen Götter.“ Schon hier ist man geneigt zu stutzen. Augenblick mal, hat man uns nicht bereits als Kindern beigebracht, dass es nur einen Gott geben könne? Ist nicht in der Bibel selbst immer wieder davon die Rede, dass „ein Gott und Vater“ sei, „der da ist über allen und durch alle und in allen“ (Epheser 4, 6)? Zählt nicht gerade das Christentum neben Judentum und Islam zu den großen monotheistischen Religionen, wie es immer wieder heißt? Und zeigt am Ende nicht schon der gesunde Menschenverstand, dass ein halbwegs vernünftiger Gottesgedanke eigentlich nur in der Einzahl sinnvoll sein könne? Um den biblischen Text zu verstehen, müssen wir – was noch des Öfteren der Fall sein wird – für einen Moment in die Vergangenheit eintauchen.
Von Beginn an war das Volk Israel stets von den verschiedensten Völkern, Kulturen und Religionen umgeben: Ägyptern, Assyrern, Babyloniern und natürlich den Kanaanäern im eigenen Land. Die „anderen Götter“ dieser Kulturen bestanden in der Regel darin, dass Dinge der geschöpflichen Welt, die man aus irgendeinem Grund als mächtig empfand, vergöttlicht wurden: Sonne, Mond, Sterne, Tiere, Flüsse, Bäume. Oder auch Herrschaft, Macht, Gewalt, Krieg, Reichtum, Sexualität. In Kanaan zum Beispiel war der religiöse Fruchtbarkeitskult sehr verbreitet. An jeder Ecke standen die Standbilder des Gottes Baal oder der Göttinnen Aschera und Astarte. In rauschenden religiösen Festen wurden Saat und Ernte, Sonne und Regen, die Fruchtbarkeit des Bodens und das Gelingen des Lebens beschworen. Sogar von kultischer Prostitution wird uns berichtet. Insgesamt also faszinierende Events, deren Zauber man sich kaum entziehen konnte.
Es ist eine Welt der magischen und dämonischen Mächte, die in ihrer Allgegenwart den einzelnen Menschen eher klein halten und entmündigen. Wenn alles religiös aufgeladen ist, dann ist mein Leben am Ende nichts anderes als ein Spielball solcher undurchschaubaren „Mächte und Gewalten“, wie es im Neuen Testament einmal heißt (Kolosser 1, 16). Dem Einzelnen bleibt dann nur noch die schicksalhafte Ergebung in die nun einmal vorhandenen Verhältnisse. Diesen „anderen Göttern“ gilt die harsche Abgrenzungsrhetorik des ersten Gebots, die sich immer wieder in der Bibel vorfindet. Warum? Weil sie schlicht ein Eigenprodukt von Menschen sind. „Ihre Götzen“, so spottet etwa der Psalmist, „sind von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Nasen und riechen nicht, sie haben Hände und greifen nicht, Füße haben sie und gehen nicht, und kein Laut kommt aus ihrer Kehle“ (Psalm 115, 4-7). Was Luther hier mit „Götzen“ übersetzt, lautet im hebräischen Ursprung eigentlich „Nichtse“. Der Mensch macht sich zum Sklaven selbst gemachter Nichtigkeiten.
In diese Situation hinein trifft nun das erste Gebot. Das heißt, es geht zunächst wie selbstverständlich davon aus, dass es überhaupt „andere Götter“ gibt. Ihr Vorhandensein wird mit dem „du sollst keine anderen Götter haben …“ erst einmal gar nicht infrage gestellt. Das ist überaus bemerkenswert. Die alte und in letzter Zeit wieder neu aufkommende Streitfrage „Monotheismus oder Polytheismus“ stellt sich diesem biblischen Text überhaupt nicht. Er geht vielmehr, wie es seiner historischen Situation entspricht, von der faktischen Existenz vieler, eben „anderer Götter“ aus. Diese waren für Israel täglich sichtbare und erlebbare Realität. Das Gebot, „keine anderen Götter zu haben“, bestreitet also keinesfalls, dass es andere Götter überhaupt gibt. Wohl aber bestreitet es das Recht, sie zu haben. Das ist etwas anderes. Aber was ist genau mit diesem Haben gemeint?
Aufschlussreich sind ein paar ähnlich klingende Bibelstellen im Umfeld der Zehn Gebote. So wird allein im 2. Buch Mose häufig eindringlich davor gewarnt, anderen Göttern nicht zu „opfern“ (22, 19), ihre Namen nicht „anzurufen“ (23, 13), vor ihnen nicht „niederzufallen“ (34, 14) oder ihnen gar „nachzulaufen (34, 15). Im zweiten Gebot, das inhaltlich eng mit dem ersten zusammenhängt, tauchen die Worte „anbeten“ und „dienen“ auf. Unschwer sind all diese verschiedenen Begriffe als eine Veranschaulichung dessen zu verstehen, was im ersten Gebot mit „haben“ gemeint ist: alles andere als ein bloßes „Fürwahrhalten“, sondern ein bestimmtes Verhalten. „Worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott“, hat es Martin Luther in genialer Einfachheit auf den Punkt gebracht. Dem ersten Gebot ist es also offensichtlich egal, ob jemand der Meinung ist, dass es nur einen oder mehrere Götter gibt. Es geht ihm nicht um einen theoretischen Monotheismus. Es geht ihm vielmehr um die sehr grundlegende, „existenzielle“ Machtfrage: Wem willst du eigentlich dienen, wer soll Herr in deinem Leben sein? Gott oder irgendwelche anderen Götter?
Nun erklärt sich auch das noch ausstehende „neben mir“ im ersten Gebot. Gemäß dem hebräischen Urtext müsste es genau genommen „mir ins Angesicht“ heißen, wie der jüdische Gelehrte Martin Buber die beiden Wörter übersetzt hat. Das würde so viel bedeuten wie „mir gegenüber“ oder – wie andere vorschlagen – „an meiner statt“ oder gar „mir zum Nachteil“. Deutlich wird in allen Übersetzungsvarianten, dass es hier um eine in der Tat harte Alternative geht, die keinen Kompromiss duldet. Manchmal gibt es eben kein Sowohl-als-auch, sondern nur ein Entweder-oder. „Niemand kann zwei Herren dienen“, wird Jesus später einmal sagen. „Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten“ (Matthäus 6, 24). Bei dem Gegensatz „Gott oder die anderen Götter“ geht es also nicht um eine formale Alternative, so als stünden sich hier zwei eifersüchtige Nebenbuhler gegenüber, wie man das aus den Götterkämpfen der antiken Mythologien kennt. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Wildwestfilmen und mehr noch den vielen üblichen Alltagsrivalitäten, die jeder schon erlebt hat: der oder ich. Wenn es so wäre, würde ja vollends außer Acht gelassen, dass die Gebote nur unter der Botschaft der vorangegangenen Präambel recht zu verstehen sind: Gott ist ein befreiender Gott. Es geht also beim „neben mir“ um eine inhaltliche Alternative. „Neben dieser Freiheitsmacht kann und soll es keine anderen Götter geben“, sagt Frank Crüsemann. Ja, wenn es um die Befreiung des Menschen geht, dann spricht die Bibel in der Tat eine kompromisslose Sprache. Null Toleranz gegenüber Knechtschaft, Unterdrückung und Ausbeutung.
3. Im eigenen Haus aufräumen
Man kann lange darüber debattieren, ob es einen Gott gibt. Oder viele. Oder am Ende gar keinen. Wer von uns – ob Christ oder Atheist – hätte sich nicht schon darüber den Kopf zerbrochen? Denn es wird niemand bestreiten, dass solche Fragen überaus sinnvoll sind. Nicht zuletzt deshalb, weil sie manchmal auch eine gewisse intellektuelle Herausforderung darstellen. Ich weiß nicht, wie viele Abende und Nächte ich in jungen Jahren mit solchen „Grundsatzdiskussionen“ verbracht habe. Der seinerzeit auch für Studenten erschwingliche Lambrusco tat dazu nicht selten ein Übriges.
Zu welcher Antwort man bei solchen Debatten auch immer findet, sie haben alle eines gemeinsam, nämlich dass sie eigentlich gar nichts mit meinem Leben zu tun haben. Für die Frage etwa, wie ich mich im Straßenverkehr zu verhalten habe, ist es völlig gleichgültig, ob ich die Existenz eines oder vieler Götter für wahrscheinlich halte. Und einer Mastgans wird es herzlich egal sein, ob sie dereinst einmal von einem Gottgläubigen oder Atheisten verzehrt wird. Die Diskussion „Monotheismus, Polytheismus oder Atheismus“ ist anscheinend eine reine Angelegenheit des Kopfes – ohne wirkliche Relevanz für das Leben.
Wie anders das erste Gebot! „Gott oder die Götter“ ist hier alles andere als eine intellektuelle Denkübung. Es geht ja darum, was von beiden ich habe, wem von beidem ich diene, wem von beidem ich nachlaufe, an welchem von beidem – mit Luther zu sprechen – „mein Herz hängt“. Kurz: wem ich einräume, Macht über mich zu gewinnen und also mein Leben entscheidend zu bestimmen. Ja, das erste Gebot verlangt eine kompromisslose Entscheidung – aber nicht für irgendeine weltanschauliche Theorie, sondern für den Gott, der unumstößlich Freiheit gewährt und verheißt. Und gegen alle Mächte, die am Ende nur dazu geeignet sind, den Menschen in neue „Knechtschaften“ zu versklaven. Im ersten Gebot steht nicht Meinung gegen Meinung, sondern von Gott geschenkte Freiheit gegen selbst gewählte Unfreiheit.
In seinem Großen Katechismus hat Martin Luther in überaus kühner Deutung des ersten Gebots solche selbst gewählten Knechtschaften beim Namen genannt: „Es ist mancher, der meint, er habe Gott und alles genug, wenn er Geld und Gut hat, verlässt und brüstet sich darauf so steif und sicher, dass er auf niemand etwas gibt. Siehe, dieser hat auch einen Gott, der heißt Mammon … Also auch, wer darauf traut und trotzt, dass er große Kunst, Klugheit, Gewalt, Gunst, Freundschaft und Ehre hat, der hat auch einen Gott, aber nicht diesen rechten, einigen Gott.“ Interessant ist, dass jeder dieser genannten „Götter“ für sich genommen erst einmal gar nichts Negatives an sich hat. Wer wollte etwa grundsätzlich etwas gegen Kunst oder Klugheit, Freundschaft oder Ehre sagen? Auch Geld und Gut an sich sind ja nichts Schlechtes. Jeder von uns geht täglich damit gebrauchend um. Entscheidend ist für Luther, ob wir diesen Dingen so viel Bedeutung beimessen, dass sie gewissermaßen zu „Göttern“ in unserem Leben werden, die alles beherrschen. Denn „einen Gott haben“ heißt für ihn „das, dazu man sich versehen soll alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten“. Seine Konsequenz: „dass wir alle Güter, so Gott gibt, brauchen, nicht weiter denn wie ein Schuster seine Nadel, Ahle und Draht braucht zur Arbeit und darnach hinweg legt.“
Luthers kühne Ausdeutung dessen, was alles – von Geld bis Ehre – ein „anderer Gott“ sein kann, sofern man diesen über sich herrschen lässt, inspiriert geradezu dazu, noch einmal ganz neu und auch kritisch über sein eigenes Leben nachzudenken. Wo in meinem Leben und dann auch in der Welt überhaupt spielen Dinge eine so dominante Rolle, dass sie geradezu zu Tyrannen unseres Lebens werden? Da ist der Markt mit seinen angeblich unumstößlichen Eigengesetzlichkeiten, unter denen nicht wenige leiden – hier bei uns und um vieles mehr noch in Ländern der sogenannten „Dritten Welt“. Da sind die Begründungen für Militäreinsätze, die einem – keinen Widerspruch duldend – als „alternativlos“ verkauft werden. Da ist die Gier nach mitunter exorbitanten Gehältern, die in keinem nachvollziehbaren Verhältnis mehr zu einem ehrlich erbrachten Arbeitsaufwand stehen. Da ist die nachgerade herrische Ideologie, alles und jedes im Leben müsse vor allem Spaß machen, egal auf wessen Kosten. Da ist der penetrante Zwang, jedwedes Ding auf Teufel komm raus „auch mal positiv“ sehen zu müssen, auch wenn einem zum Heulen zumute ist. Da ist der weitverbreitete Kult um Körper, Gesundheit und Wellness, der nicht selten mit fast religiöser Inbrunst betrieben wird. Da ist die Vergötzung von Leistung und Erfolg, von Einfluss und Macht, von Sexualität, Genuss oder Verzicht. Da ist die merkwürdig voraufklärerische Selbstverständlichkeit, mit der man irgendwelchen kosmischen Konstellationen wegweisenden Einfluss auf die persönliche Lebensgestaltung einzuräumen bereit ist. Da ist das ständige Kreisen um des heilige Ich, um die eigenen Befindlichkeiten, Interessen und Vorteile. Da ist die Angst vor der Meinung anderer, das bange Schielen nach Beliebtheit und Gunst. Die Sucht nach Ruhm oder auch nur nach Aufmerksamkeit, Anerkennung oder wenigstens möglichst vielen „Likes“. Wer einmal Fünfjährigen im Kindergarten dabei zugehört hat, wie sie sich gegenseitig mit ihren neuesten Markenjeans oder Smartphones zu übertrumpfen versuchen, weiß, um welche „anderen Götter“ es heute geht. Ja, der Knechtschaften sind viele. Auch heute noch. Sage keiner, es gebe keine „anderen Götter“ mehr.
Mit unnachgiebiger, aber gerade darin heilsamer Kompromisslosigkeit verkündet das erste Gebot das Ende solcher Tyranneien, indem es ihnen in radikaler Wortwahl das Recht bestreitet, unser Leben zu beherrschen. Interessanterweise ist das Verbot, „anderen Göttern zu dienen“, ursprünglich an das Volk Israel selbst gerichtet. Bevor wir über andere Religionen befinden, hätten wir also in unserem eigenen Haus mit den vielen selbst gewählten Knechtschaften aufzuräumen. Die Frage, ob „wir alle an einen Gott glauben“, entscheidet sich nicht am richtigen Gesangbuch. Sie entscheidet sich auch nicht daran, ob wir Anhänger irgendeines Monotheismus sind. Sie entscheidet sich daran, ob wir bereit sind, dem Ruf in die Freiheit zu folgen. Und die Verheißung gilt, dass da, wo wir es tun, das „du sollst“ in der Tat mehr und mehr den Charakter des „du kannst“ und „du wirst“ bekommt. Es könnte die Erfahrung sein, dass es schlicht gut, ja schön ist, jenem Ruf zu folgen. Auch dann, wenn ein solcher Weg nicht immer ohne Steine ist.