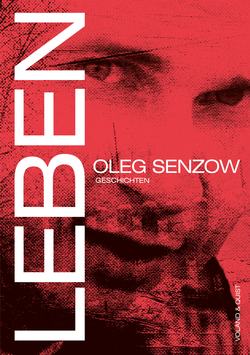Читать книгу Leben - Oleg Senzow - Страница 7
Der Hund
ОглавлениеAls Kind wollte ich einen Hund haben. Einen Schäferhund, und unbedingt einen Deutschen. Schäferhunde hatte ich in Filmen öfter gesehen, auch bei uns im Dorf gab es ein paar. So einen wollte ich auch. Ich wollte ihn ausführen, ihn erziehen. Mit ihm die Straße entlanglaufen, und alle würden mir hinterhergucken. Er würde auf mich hören, und wir hätten einander lieb.
Einen Hund hatte ich vorher schon mal gehabt. Genauer gesagt, nicht ich, sondern meine Familie. Er hieß ganz unheldenhaft Tusik. Ein mittelgroßer schwarzer Straßenköter, der uns zugelaufen war. Das bisherige Leben von Tus – so nannte ich ihn, weil das in meinen Ohren gewichtiger klang – war kein Zuckerschlecken gewesen, anscheinend wurde er ordentlich geschlagen und viel drangsaliert. Die erste Woche bei uns saß er in seiner Hundehütte und ging nicht mal zum Fressen nach draußen. Er war so froh, dass er in Ruhe gelassen wurde, das war ihm wichtiger als jede Nahrung.
Dann gewöhnte sich Tusik an uns und wir schlossen ihn ins Herz. Ich war damals vielleicht neun oder zehn. Ich ging mit ihm raus, in den Wald oder über die Felder. Ich hielt ihn an der Leine. Zu Hause wurde er angekettet und über Nacht von der Kette gelassen, er lief frei im Hof oder sogar auf der Straße herum und tat niemandem etwas. Tus war sehr klug, gutherzig und gehorsam. Aber das Erlebte hatte sich für immer in seine Züge eingebrannt. Es heißt, das Gesicht eines Menschen spiegelt seine Erfahrungen wider. Das stimmt. Auch in Hundeaugen spiegelt sich ein Hundeleben wider. Die Augen dieses schwarzen Straßenköters sollten für immer traurig bleiben.
Einige Jahre später weckte mich eines unauffälligen Morgens meine Mutter, setzte sich auf die Bettkante und sagte, Tusik sei tot. Irgendwer war unterwegs gewesen, um streunende Hunde zu erschießen, und dabei hatte es auch unseren Hund erwischt, frühmorgens auf der Straße, direkt vor unserem Tor. Meine Mutter meinte, ich solle mich ausweinen, aber ich konnte nicht. Ich konnte es nicht glauben. Ich verstand zwar, dass man ihn erschossen hatte, aber ich glaubte es nicht, ich begriff es nicht. Das ist immer so. Zwischen der Nachricht über den Tod eines nahen Angehörigen und dem Wahrnehmen des Verlustes vergeht immer etwas Zeit. Ich habe das mehr als einmal erlebt. Als ich zwanzig war und jemand zu mir kam und sagte, mein Vater sei gestorben, war mein erster Gedanke: »Das kann nicht sein.« Auch als ich ihn eine Stunde später wie schlafend daliegen sah, hatte sich das Gefühl des Verlustes nicht eingestellt.
Am nächsten Tag wurde er im Sarg aus dem Haus getragen – da spürte ich einen Stich, aber es zerriss mich nicht. Nach der Aufforderung an die Angehörigen, sich von dem Verstorbenen zu verabschieden, gab der Mann auf dem Friedhof das Kommando, den Sarg zu schließen, und da spürte ich den zweiten Stich – die bereits im Deckel steckenden Nägel wurden mit einem wahnsinnig dumpfen Geräusch eingeschlagen. In der tiefen Grube lag noch eine Flasche, die die Totengräber leer getrunken und vergessen hatten.
Ich fühlte mich wie in einem wattigen Traum. Als passierte das alles nicht mir. Der Leichenschmaus in der Kantine, der Wodka, der einen nüchtern lässt, all diese Leute, zufällige oder mitfühlende Beobachter, irgendwelche Verwandten.
Spätabends, als etwas Ruhe einkehrte und nur noch die nächsten Angehörigen bei uns waren – das Haus war inzwischen wieder aufgeräumt, und nach dem schweren Tag machten sich alle langsam bettfertig –, setzte ich mich auf eine kleine Holzbank, die etwas abseits vor dem Haus im Dunkeln stand, außerhalb des Lichtkreises der Straßenlaterne. Ich war erschöpft und starrte schweigend in die Finsternis. Und auf einmal wurde mir bewusst, dass ich genau an der Stelle saß, wo mein Vater gerne gesessen hatte, dass ich auf seiner Lieblingsbank saß, die er selbst gezimmert hatte. Mit einem Schlag war mir klar, er ist weg. Ich spürte es im ganzen Körper: Die Stelle ist da, die Bank ist da, ich bin da, aber er ist für immer weg. Dieses Gefühl der Leere und Schwärze war furchtbar. Und da fing ich langsam an zu weinen, leise, wortlos. Mein achtjähriger Neffe stand neben mir und sah, dass ich weinte. Ich tat ihm leid, und er zeigte mir sein Mitleid auf seine Kinderart, indem er mir über den Kopf strich. Auch er sagte nichts. So saß ich auf der Bank, mit gesenktem Kopf, und weinte leise, während er neben mir stand und mir wortlos über den Kopf strich.
Seit Tusiks Tod war fast ein Jahr vergangen. Endlich rang ich meinen Eltern einen neuen Hund ab. Einen Schäferhund! An meinem zwölften Geburtstag fuhr mein Vater mit mir in die Stadt und kaufte auf dem Markt einen Welpen, eine Mischung aus Deutschem und Kaukasischem Schäferhund. Der Welpe war winzig, knapp über eine Woche alt, konnte sich kaum fortbewegen und noch weniger fressen, er passte in meine Kinderhand. Einen Stammbaum hatte er nicht, aber dafür kostete er auch nur fünfzehn Rubel. In der Nacht fiepte er und robbte in meinem Zimmer auf dem Boden herum, bis meine Mutter genug hatte und ihn zu mir ins Bett legte, wo er es sich gemütlich machte und einschlief. Ich fütterte ihn mit Milch, die er mir vom Finger leckte; richtig trinken konnte er noch nicht. Wir tauften den Kleinen Dick.
Dick wurde schnell größer, er war ein kräftiger, zotteliger, unbeholfener Rüde und wie alle Welpen sehr verspielt. Als er heranwuchs, erlebte ich eine kleine Enttäuschung: Halbblut bleibt Halbblut, und obwohl Deutsche und Kaukasische Schäferhunde gezielt verpaart werden, um das Beste aus beiden Rassen herauszuholen, ähnelte mein Hund keinem der Bilder aus dem dünnen Kynologie-Buch, das ich mir irgendwann »nur kurz« von einem Bekannten geliehen hatte. Eine Zeit lang wurmte mich das sehr, aber dann triumphierte die Liebe zu meinem Hund über den Eindruck, er sei minderwertig.
Dick wurde riesig, er hatte das rötlich-schwarze Fell eines Deutschen Schäferhundes, aber er war breiter gebaut und ähnelte damit, wie auch mit seinen Schlappohren und der Ringelrute, eher dem Kaukasier. Er hing sehr an mir und ich an ihm. Wir waren viel draußen, ich dressierte ihn, und er lernte so manches, was ein Wachhund können muss. Allerdings war er ziemlich eigensinnig. Auf seinen Jagdinstinkt beim Anblick von Hühnern, Enten und sonstigem Geflügel war immer Verlass, was für zahllose Konflikte mit den Besitzern der zu Schaden gekommenen Hoftiere sorgte, unter anderem auch mit meinen eigenen Eltern.
Meist führte ich Dick im Wald aus, der ganz in der Nähe von unserem Dorf lag, auf einer Anhöhe jenseits der Felder. Ich ging entweder allein mit ihm oder mit meinen Freunden, die ebenfalls ihre Hunde mitnahmen, aber keiner war so schön und stark wie mein Dick. Mit der ganzen Bande war es lustiger, aber ich zog es trotzdem vor, alleine mit meinem Hund im Wald zu sein. Das waren unvergessliche Momente. Wenn er nach dir Ausschau hält und du mit Absicht etwas zurückbleibst und dich am Wegrand im Gebüsch versteckst. Und dann sucht er und spürt dich auf. Und ihr beide seid glücklich über das schnelle Wiedersehen. Der Hund ist froh, dass er sein Herrchen gefunden hat, das Herrchen ist froh, dass es so einen klugen Hund hat, und beide sind froh, dass sie einander lieb haben und wieder vereint sind. Oder wenn ihr auf einen Hasen stoßt, der bis zum letzten Moment reglos bleibt und dann fast unter deinem Fuß hervorschießt, und du zusiehst, wie dein wuchtiger Rüde sich zu einem Pfeil streckt, die Ohren anlegt, leicht winselnd dem Hasen hinterherhetzt und allmählich zurückfällt. Was für ein Genuss, an einem feuchten Herbsttag spazieren zu gehen, in der langen hellen Dämmerung, wenn weit und breit kein Mensch zu sehen ist und Moderduft und Nebel aufsteigt.
Oder im Winter, im Schnee, der in unserer Gegend so selten ist – du siehst Fußspuren, eigene und fremde, deine Stimme schallt hell und weit, du schreist aus voller Lunge: »Dick, hier!«, und gleich darauf hörst du zuerst das Tappen seiner Pfoten, dann das Hecheln und erst danach siehst du, wie dein Hund auf dich zurennt und dabei den Schnee von den unteren Ästen fegt.
Wie schön, an einem Sommerabend auf dem Heimweg zu sein, die Luft sirrt und es riecht schon nach Wolkenbruch, und als du aus dem Wald trittst, hörst du auf einmal, wie die Blätter viel zu laut rauschen, und du weißt, das ist der Regen, er ist schon überm Wald und dir auf den Fersen. Du rennst so schnell du kannst übers Feld bergab, dein Hund an deiner Seite blickt dir ins Gesicht, und auf halbem Weg holt der Regen euch ein. Danach geht ihr durchs Dorf nach Hause, du führst ihn an der Leine, und alle Hunde entlang der Straße kläffen, was das Zeug hält, und dein Hund antwortet mit lautstarkem Gebell, du musst ihn mit aller Kraft zurückhalten, ihr seid beide erschöpft und glücklich. Du gibst ihm zu trinken, gießt Wasser aus einer Kanne in seine Schale nach, bringst ihm sein Abendessen raus. Selig schlaft ihr beide ein, und als du am Morgen in die Schule gehst, begleitet dich mit klirrender Kette dein Hund vors Tor, und ihr wisst beide, dass ihr abends wieder losziehen werdet, wieder zusammen, wieder glücklich.
Die Kindheit ist eine Zeit des Glücks. Meine Kindheit jedenfalls war glücklich, Gott sei Dank, und meine wärmsten und liebsten Erinnerungen sind mit meinem Hund und mit diesen Spaziergängen verbunden.
Aber dann ging die Kindheit allmählich zu Ende, die Spaziergänge mit dem Hund wurden zur lästigen Pflicht, oder zum Vorwand, um mit anderen Jungs im Wald zu rauchen und Karten zu spielen. Im Sommer verbrachte ich mehr Abende mit meinen Freunden und mit Fußball als mit meinem Hund. Jedes Mal, wenn Dick sah, wie ich Richtung Tor lief, machte er einen Satz aus seiner Hundehütte, in den Augen die Hoffnung, dass wir gleich gemeinsam losgehen würden, aber fast immer wurde er enttäuscht. Anfangs blieb ich noch stehen, streichelte ihn und bat ihn um Entschuldigung, weil ich ihn an dem Tag nicht ausführen würde, er leckte mein Gesicht und wir verabschiedeten uns. Irgendwann tätschelte ich ihn nur noch beim Weggehen, und schließlich ging ich einfach an ihm vorbei. Je höher die Schulstufe, desto weniger beschäftigte ich mich mit meinem Hund und desto seltener wurden unsere Spaziergänge, bis sie eines Tages ganz aufhörten. Ich hatte nun neue Interessen, neue Freunde, der Hund stand nicht mehr an erster Stelle – wie eine Frau, die man nicht mehr wahrnimmt, obwohl man noch mit ihr zusammenlebt.
Nach dem Schulabschluss zog ich zum Studium in die Stadt und sah Dick nur noch ein Mal die Woche. Ich streichelte ihn zur Begrüßung, manchmal zum Abschied. Hatte ich ihn noch lieb? Natürlich, aber diese Liebe war wie eine Gewohnheit, wie die Liebe zu den Großeltern. Dick war damals schon zehn und wurde langsam alt. Hatte er mich noch lieb? Ich denke, ja. In den letzten Jahren war es zwar meine Mutter gewesen, die sich um ihn kümmerte, die ihn fütterte und über Nacht im Hof oder auf der Straße laufen ließ, aber ein Hund entscheidet sich nur einmal für einen Herrn und bleibt ihm bis zum Lebensende ergeben. Dick wurde kränklich. Seine Hinterbeine fingen an wegzuknicken, er stand nur noch selten auf und bekam Rheuma. Diese Krankheit hatte ich selbst durchgemacht, meine Familie wusste deshalb, was zu tun war, und gab ihm die notwendigen Spritzen. Dick rappelte sich wieder auf und machte es danach noch eineinhalb Jahre. Er starb langsam und qualvoll. Aber ehe wir uns entschließen konnten, ihn einschläfern zu lassen, war auf einmal alles vorbei. Ich kam aus der Stadt nach Hause und brachte ihn auf einer Karre weg, in einer großen Kiste. Dick war im Alter fast um die Hälfte geschrumpft, aber immer noch recht schwer.
Ich begrub ihn allein, neben dem Weg in den Wald, den wir so gerne entlanggelaufen waren, auf einer Brache, die allmählich zur Müllhalde verkam. Ich hob eine Grube aus, legte ihn hinein und machte mich ans Zuschaufeln. Ich hatte nichts dabei, um Dick zuzudecken, und nach der ersten Schaufel Erde, die auf der Hundeschnauze landete, hielt ich inne. Es war schwer. Ich konnte mich kaum überwinden. Nach der zweiten Schaufel traten mir Tränen in die Augen. Als die Erde den Hund ganz bedeckte, wurde es einfacher. Nie hätte ich gedacht, dass es schwerer sein würde, einen Hund zu beerdigen als den eigenen Vater.
Es gibt keine bösen Menschen, sagt man, nur böse Taten. Das stimmt. Jeder Mensch hat etwas Gutes in sich. Dieses Gute ist sein gutes Herz. Je gutherziger, desto besser ist der Mensch. Die Grundlagen dafür werden in der Kindheit geschaffen: durch die Zärtlichkeit der Mutter, die Arme des Vaters, die Freunde, die Märchen, die Bücher, die Kinderfilme. In dem Bild eines kleinen Mammuts, das auf einer Eisscholle zu seiner Mutter schwimmt, steckt mehr Herz als in allen sozialen Hilfswerken zusammen. Auch Liebe schafft Güte. Nicht nur Liebe zu den Eltern, Geschwistern und sonstigen Verwandten, sondern auch zu Tieren. Vor allem zu den eigenen Haustieren.
Es gibt nichts Besseres, als einen Hund zu lieben und sich so zu verhalten, dass er die Liebe erwidert. Katzen können nicht lieben, Sittiche erst recht nicht. Leben ja, aber lieben nicht. Die Liebe zu einem Hund ähnelt am ehesten der zu einer Frau. Deine Mutter mag dich zwar lieben, aber sie muss auch deinen Vater lieben, deine Geschwister, ihre eigenen Eltern, und vielleicht auch noch Onkel Petja, den Nachbarn, auch wenn uns das nichts angeht … Ein Hund wird nie jemand anderen lieben, er bleibt dir immer treu. Und er verlangt keine Gegenleistung. Außer deiner Liebe.