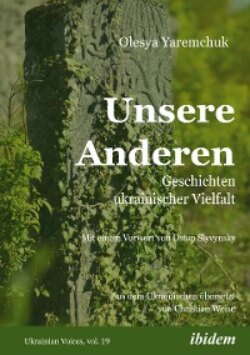Читать книгу Unsere Anderen - Olesya Yaremchuk - Страница 15
ІІ. Bugün – heute
ОглавлениеAus Meschetien deportierten die sowjetischen Behörden die türkischen Mescheten nach Zentralasien, hauptsächlich nach Usbekistan.
„Wir haben in Samarkand gelebt. Das war die erste Hauptstadt Usbekistans.“ Jasim bricht mit den Händen das Brot, etmek. „Ich hatte dort eine gute Arbeit, ich habe in einer Fabrik gearbeitet. Wir lebten sehr friedlich. Ich weiß nicht, was passiert ist.“
Was im Mai 1989 geschah, nennt man Fargʻona-Pogrome. Der übliche Streit auf dem Basar eskalierte zu einem interethnischen Konflikt. Wenn man nach den Ursachen der Tragödie fragt, können nur wenige etwas erklären.
„Wir teilen eine Religion, einen Glauben“, denkt Jasim laut nach. „Im Islam gibt es Sunniten und Schiiten. Wir sind Sunniten. Und in Usbekistan sind 95–96% auch Sunniten. Es gab keinen Streit über die Sprache. Moskau hatte das Signal gegeben, das Tschernozem, den fruchtbaren schwarzen Boden zu kultivieren. Das Fargʻona-Tal war die am dichtesten besiedelte Region. Vielleicht hätten wir die Überflüssigen vertreiben sollen. Aber wir sind ein ruhiges, fleißiges Volk, wir haben still und leise vor uns hin gearbeitet. Deshalb weiß ich es nicht.“
Es wird gesagt, dass ein Türke auf dem Basar eine usbekische Verkäuferin grob verprügelt, ihre Erdbeeren umgeworfen habe, andere Männer dann für sie eingetreten sind und ein Kampf ausgebrochen sei.
„In den siebziger und achtziger Jahren konnten sie wirklich jemanden töten und es passierte nichts, aber hier haben sie gekämpft und es hat sich zu einem interethnischen Konflikt hochgeschaukelt“, erinnert sich der Gemeindeälteste.
Gulnara Bekirowa schreibt in ihrem Artikel über Krim. Realien, dass den Ereignissen vom Mai 1989 Kundgebungen in Taschkent im Dezember 1988 vorausgingen, die unter dem Motto „Russen, geht nach Russland und Krimtataren auf die Krim“ stattfanden. Offenbar breitete sich der Hass auf die Siedler auch auf die türkischen Mescheten aus: „ ... die Anspannung ließ nicht nach, unter der usbekischen Jugend zirkulierte die Rede davon, dass man den Türken ‚eine Lektion geben sollte‘.“
Am 23. Mai kam es in den Straßen von Quvasoy zu Zusammenstößen, an denen sich von beiden Seiten mehrere hundert Menschen beteiligten. Die Menge versuchte, in die Viertel der türkischen Mescheten und anderer nationaler Minderheiten einzudringen, um ein Pogrom zu begehen. Mit Hilfe von mehr als dreihundert Polizisten gelang es, die Unruhen zu stoppen. Achthundertfünfzig Menschen wurden verletzt, einunddreißig Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.
In der Region verbreiteten sich Gerüchte, dass türkische Mescheten Usbeken verspotteten, Frauen vergewaltigten und Kinder folterten. Am Morgen des 3. Juni stürmte eine Gruppe Usbeken das türkische Viertel in Toshloq. Häuser wurden angezündet, Anwohner geschlagen. Am nächsten Tag brannten nicht nur Häuser in Fargʻona und Toshloq, sondern auch in Margilan und anderen Siedlungen, in denen türkische Mescheten lebten.
„Sie kamen zu uns nach Samarkand und sagten: ‚Entweder du gehst, oder wir arrangieren so etwas wie in Fargʻona‘“, erinnert sich Jasim ruhig. „Ich erinnere mich an den Moment, als wir begriffen, dass es hier kein Leben geben würde.“ Und wir machten uns auf die Suche nach einem Zuhause.
Obwohl der Vater der Familie darüber distanziert spricht, können die Mädchen es nicht ertragen, sie verlassen den Raum.
Zu dieser Zeit kamen Männer aus verschiedenen Familien zusammen und reisten von Region zu Region auf der Suche nach einem Ort und in der Hoffnung, irgendwo akzeptiert zu werden.
„Acht von uns sind losgezogen“, erinnert sich Jasim an die Ereignisse vor 28 Jahren. „Zunächst musste ein Ort gefunden werden, an dem die Familien nicht leiden würden. Es war Juni. Uns wurde gesagt, dass es Häuser in der Region Stawropol in Russland gibt. Aber als wir dort ankamen, durften wir nicht hin. Als nächstes ging es in die Stadt Prochladnyj. Es war genau, als der Zug Adler durch ganz Kasachstan fuhr. Sie fuhren durch Kalmückien, durch Dagestan, nach Grosny, nach Beloretschensk. Wir schauten uns das an, gut, aber wir sind solche Bedingungen nicht gewohnt. Im Juni fällt Regen, überall Dreck, Matsch unter den Füßen, wie soll man hier leben? Lasst uns zurückgehen. Auf der Fähre Baku-Krasnowodsk trafen wir eine Familie, die für eine medizinische Behandlung nach Turkmenistan fuhr. Der Mann sagte uns: ‚Wir haben viele Kolchosen, Sie können kommen und schauen. In fünfzehn Tagen bin ich zu Hause.‘ Er gab uns seine Telefonnummer. Er sagte, ‚einverstanden, ich treffe euch. Ruft morgen an.‘“