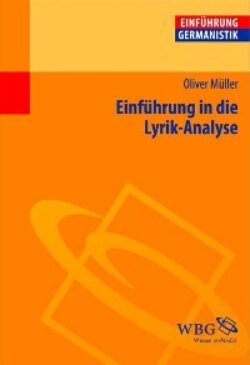Читать книгу Einführung in die Lyrik-Analyse - Oliver Müller - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Einleitung
ОглавлениеDAS SONETT
Sich in erneutem Kunstgebrauch zu üben,
Ist heil‘ge Pflicht, die wir dir auferlegen:
Du kannst dich auch, wie wir, bestimmt bewegen
Nach Tritt und Schritt, wie es dir vorgeschrieben.
Denn eben die Beschränkung läßt sich lieben,
Wenn sich die Geister gar gewaltig regen;
Und wie sie sich denn auch gebärden mögen,
Das Werk zuletzt ist doch vollendet blieben.
So möchte’ ich selbst in künstlichen Sonetten,
In sprachgewandter Maße kühnem Stolze,
Das Beste, was Gefühl mir gäbe, reimen;
Nur weiß ich hier mich nicht bequem zu betten,
Ich schneide sonst so gern aus ganzem Holze,
Und müßte nun doch auch mitunter leimen. (Goethe [1], 245)
Goethes ‚Sonett‘
Form
Inhalt
Der Witz von Goethes abwägender Sonettkritik besteht darin, dass sie selbst die Form eines Sonetts hat, d.h. eines gereimten Gedichts aus 14 Versen mit festem Reimschema. Die Form ist vorgegeben, weshalb sich in sie jeglicher Inhalt gießen lässt, doch, wie das Gedicht zu sagen scheint, keiner in angemessener Weise (,aus ganzem Holz schneiden‘ vs. ‚leimen‘, V.13/14). Sieht man genauer hin, dann lässt sich dieser Befund noch präzisieren. Goethe – oder sagen wir besser: der Sprecher des Gedichts, der sich als sein ‚Macher‘ ausgibt – unterwirft sich der fixen Form, um die Dürftigkeit anzuprangern, die sie seinem Gefühlsausdruck auferlegt; und er schreibt ein perfektes Sonett, das freilich kein Gefühl ausdrückt, sondern einen formkritischen Gedanken formuliert: die formale Perfektion und der karge Gedanke der Sonettkritik sind eben nicht „das Beste“, „was Gefühl“ ihm gibt (V.11). Sich „bequem zu betten“ (V.12), kann nicht gelingen, weil sozusagen das Laken immer zu kurz ist: entweder treten Gefühl und Gedanke auseinander, oder Inhalt und Form. Darüber hinaus ist Goethes Spiel mit Form und Inhalt für uns instruktiv. Es macht uns darauf aufmerksam, dass Gedichte Texte sind, deren Gattungszugehörigkeit allein durch ihre äußere Form bestimmt sein kann. Um beispielsweise Komödien von Trauerspielen unterscheiden zu können, muss man den Inhalt verstehen – man muss wissen, ob die Handlung lustig oder traurig, der Ausgang glücklich oder schrecklich ist. Beim Sonett dagegen zählt man die Verse, überprüft das Reimschema und weiß Bescheid. So schematisch ist dieses Verfahren, dass es sogar dann funktioniert, wenn das Gedicht in einer unbekannten Sprache geschrieben ist. Nun sind zwar nicht alle lyrischen Untergattungen formal definiert; so spielen Inhaltsfragen eine Rolle, wenn man wissen will, ob ein Gedicht eine Ballade oder ein Lied ist. Doch das bloße Vorhandensein reiner Form-Gattungen macht die Entwicklung eines Begriffsapparats erforderlich, der zu ihrer Beschreibung benutzt werden kann. Die Lyrik-Analyse hält dazu die Begriffe des Reims, des Metrums, des Verses und der Strophe bereit. Daher wird eine Teilaufgabe der vorliegenden Einführung darin bestehen, mit diesen Begriffen und ihren anhängenden Unterbegriffen bekannt zu machen. Da Gedichte zugleich, wie alle anderen literarischen Texte, interpretiert werden können, besteht eine zweite Teilaufgabe der Einführung darin, die Methoden der Inhaltsanalyse darzustellen: die Analyse von Aufbaustrukturen, sprachlichen Bildern, Erzählsituationen bzw. Sprecherpositionen etc.
Form und Inhalt
Strukturanalyse
Damit aber ist es nicht getan. Denn solange die formale und die inhaltliche Analyse nicht verbunden werden, drohen Textuntersuchungen in zwei Teile auseinander zu brechen – eine bloße Formbeschreibung einerseits, eine Inhaltsinterpretation andererseits. Die dritte Teilaufgabe wird also darin bestehen, Konzepte vorzustellen, die Form und Inhalt sinnvoll aufeinander zu beziehen erlauben. Als Mittel dazu eignet sich der Begriff der Struktur. Er soll in einem möglichst alltäglichen Sinne verstanden werden. Strukturen kommen überall in der Welt dadurch zustande, dass Dinge Eigenschaften aufweisen, die auch andere Dinge aufweisen, weshalb zwischen den Dingen eine bestimmbare Relation besteht. Die Gesamtheit von Eigenschaften und Relationen lässt sich dann als Struktur bezeichnen. Dasselbe gilt für Wörter und ihre Bedeutungen. In den ersten acht Versen des ‚Sonetts‘ treten zwei ‚Ideen‘ (d.h. zwei Bedeutungskomplexe) in eine Oppositionsbeziehung: die Gefahr der sich regenden Geister und die Möglichkeit ihrer Bannung durch Formstrenge. Sich jener auszusetzen und diese zu nutzen, wird mit dem Etikett der Heiligkeit versehen, d.h. mit einem Wertprädikat höchster Güte ausgezeichnet. In den letzten sechs Versen ist davon keine Rede mehr. Hier geht es um den Stolz versus die Bequemlichkeit des Vers-Handwerkers. Sobald man diese inhaltlichen Komplexe isoliert hat, erkennt man, dass die Kritik am Schluss auf die Vorschläge des Anfangs gar nicht antwortet. Die Ergebnisse der strukturellen Inhaltsanalyse korrelieren zugleich mit dem formalen Aufbau des Gedichts, der durch das Reimschema vorgegebenen Zweiteilung des Textes nach dem achten Vers. Strukturell gesehen, steht die herausgearbeitete inkomplette Argumentation des Gedichts in einer Oppositionsbeziehung zur Form, die Vollständigkeit suggeriert. Die Form verweist darauf, dass die Vollständigkeit des Arguments nicht in seinen manifesten Sätzen, sondern in einem latenten Sinn liegt, der erst vom Leser zu rekonstruieren ist. Daraus folgt, dass die Interpretationsaufgabe nicht darin besteht, den Sinn der Worte des Gedichts solange zu biegen, bis am Ende ein formal gültiges Argument herauskommt, sondern nach dem Nicht-Ausgesprochenen zu suchen, das einleitend als Paradoxon von Gefühl und Gedanke, Inhalt und Form charakterisiert wurde. – Da jedoch die Lage bei vielen anderen Gedichten nicht so einfach wie hier ist, wird die vorliegende Einführung sich eingehend mit komplexeren Strukturbeschreibungen und Interpretationen befassen. Kapitel III, in dem die Begriffe eingeführt werden, die man bei der Analyse und Interpretation lyrischer Texte in Schule und Universität benötigt, versteht sich daher primär als Propädeutikum für die praktische Lyrikinterpretation.
Lyriktheorie
Geschichte der Lyrik
Exemplarische Analysen
Doch zur Arbeit mit Lyrik gehört noch mehr. Jede Methode knüpft über ihre Begriffe an Theorien an, die sich mit der Beschaffenheit der untersuchten Gegenstände auseinandersetzen. Ein Kernbereich der lyriktheoretischen Diskussionen ist die Frage, wie Metrum, Rhythmus und Vers zu definieren sind; sie wird die ersten Kapitel der Einführung begleiten. In Beziehung dazu stehen die vielfältigen Versuche, Lyrik als Gattung zu definieren; ihre historische Entwicklung wird im vierten Kapitel skizziert. Kleinere Streifzüge durch die allgemeine Literaturtheorie erfolgen in mehreren Kapiteln nach Bedarf; man muss schon etwas Theoriegeschichte kennen, um zu verstehen, weshalb Goethe die Übung in „erneutem Kunstgebrauch“ als „heil‘ge Pflicht“ gilt (V.1/2) – als Menschenpflicht des Genies. Die Erarbeitung des theoretischen Hintergrundwissens ist ein erster Ansatz, auf den Unterschied zwischen einer modernen Literaturauffassung und der des Barock und der Aufklärung hinzuweisen. Diese Auffassungen spiegeln sich nicht einfach in den Gedichten der verschiedenen Epochen; sie müssen vielmehr aktiv in die Interpretation einbezogen werden, um historisch fragwürdige Textdeutungen zu verhindern, die eine isolierte Textanalyse in manchen Fällen vielleicht zulässt. Die Fähigkeit, Gedichte in ihre historischen Kontexte einordnen zu können, ist bei der Entwicklung fundierter wissenschaftlicher Fragestellungen unerlässlich. Der notgedrungen knappe Abriss einer Geschichte der Lyrik in Kapitel V soll eine grobe Orientierung im Dickicht der Stile und Strömungen, der Ideen und ihrer sozialen Umwelt vermitteln. Wie man dann – auch unter Berücksichtigung geschichtlicher Zusammenhänge – einzelne Gedichte interpretiert, werden die abschließenden sieben exemplarischen Untersuchungen in Kapitel VI zu zeigen versuchen.
Einführung und Wissenschaft
Abschließend sei noch auf ein grundsätzliches Problem hingewiesen, das im Verhältnis von Einführungen zu ihren jeweiligen Wissenschaften liegt. Die Aufgabe, zentrale wissenschaftliche Begriffe vorzustellen, bereitet solange kein Kopfzerbrechen, wie es um relativ langweilige, kaum umstrittene und zählebige Kategorien wie den Versfuß oder das Reimschema geht. Doch schon die Frage, welches Prinzip bei der Bestimmung der Versfüße angewendet werden soll, berührt eine kontroverse wissenschaftliche Diskussion, und als echte theoretische Hot Spots erweisen sich die Definitionen der literarischen Bildformen des Symbols oder der Metapher. Hier prallen, einstweilen ohne Aussicht auf einen Konsens, die verschiedensten Auffassungen aufeinander. Um überhaupt zum Verständnis solcher Begriffe anleiten zu können, müssen Einführungen daher die Bewegungen der Diskussionen zur Ruhe bringen und sich damit die Schuld aufladen, einen falschen Eindruck von Wissenschaftlichkeit zu vermitteln. Denn gerade dort, wo die Lage der Dinge am wenigsten geklärt ist, sind Wissenschaften am lebendigsten. Um das Vergehen, ein verzerrtes Wissenschaftsverständnis zu vermitteln, etwas zu mildern, können Einführungen nur zweierlei tun. Sie können erstens auf weiterführende Forschungsliteratur verweisen, also beispielsweise für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Bildformen die von Gerhard Kurz vorgelegte Untersuchung Metapher, Allegorie und Symbol und den von Anselm Haverkamp herausgegebenen Sammelband Theorie der Metapher empfehlen. Zweitens können sie auf den problematischen Sachverhalt selbst hinweisen, was hiermit geschehen ist.