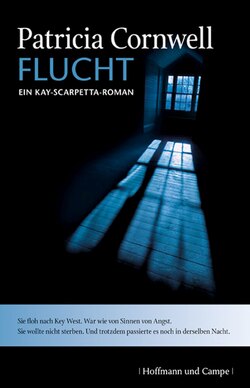Читать книгу Flucht - Patricia Cornwell - Страница 11
3
ОглавлениеZehn Blocks weiter hielt ich wieder an einer Parkuhr und warf meine letzten beiden Vierteldollarmünzen hinein. Ich stellte immer ein rotes Medical-Examiner-Schild gut sichtbar auf das Armaturenbrett meines Dienstwagens, aber die Verkehrspolizisten kümmerten sich nicht darum. Vor ein paar Monaten hatte doch tatsächlich einer von ihnen die Frechheit besessen, mich aufzuschreiben, während ich in der Innenstadt an einem Mordtatort arbeitete, zu dem mich die Polizei mitten am Tag gerufen hatte.
Ich eilte ein paar Betonstufen hinauf und betrat durch eine Glastür die Hauptstelle der Stadtbücherei. Auf hölzernen Tischen stapelten sich Bücher, und Leute gingen geräuschlos herum. Die Ruhe in diesen Räumen rief in mir dasselbe Gefühl der Ehrfurcht hervor wie in meinen Kindertagen. Ich fand eine Reihe von Mikrofiche-Lesegeräten und schrieb mir dort die Titel der Bücher, die Beryl Madison unter ihren verschiedenen Pseudonymen veröffentlicht hatte, aus dem Katalog heraus. Ihr neuestes Werk, einen historischen Roman, der zur Zeit des Bürgerkriegs spielte, hatte sie unter dem Namen Edith Montague verfasst. Er war vor eineinhalb Jahren erschienen. Vermutlich ein belangloses Buch, dachte ich, und außerdem hatte Mark recht. Innerhalb der letzten zehn Jahre hatte Beryl sechs Romane veröffentlicht. Mir war kein einziger davon bekannt.
Als Nächstes suchte ich unter den Zeitschriften. Nichts. Beryl hatte wohl ausschließlich Bücher geschrieben. Anscheinend hatte sie in Magazinen weder etwas veröffentlicht, noch war jemals ein Interview darin erschienen. Vielleicht erwiesen sich Zeitungsausschnitte als ergiebiger. In der Richmond Times waren im Lauf der letzten Jahre ein paar Buchbesprechungen erschienen. Aber sie waren nutzlos, denn die Autorin war darin unter ihren Pseudonymen aufgeführt, Beryls Mörder hingegen hatte sie unter ihrem richtigen Namen gekannt.
Eine Seite nach der anderen flimmerte in unscharfen Buchstaben über den Bildschirm. »Maberly«, »Macon« und schließlich »Madison«. In der Times vom November vergangenen Jahres fand ich eine kurze Meldung über Beryl:
AUTORENVORTRAG
Die Romanautorin Beryl Stratton Madison wird am Mittwoch im Jefferson Hotel, Main und Adams Street, vor den Daughters of the American Revolution einen Vortrag halten. Miss Madison, eine Schülerin des Pulitzerpreisgewinners Cary Harper, wurde durch ihre historischen Romane über die Amerikanische Revolution und den Bürgerkrieg bekannt. Sie spricht zum Thema »Die Legende als Vehikel historischer Wahrheit«.
Ich notierte ein paar Stichpunkte und suchte mir dann aus den Regalen einige von Beryls Büchern heraus, um sie mir anzusehen. Als ich wieder im Büro war, erledigte ich eine Menge Schreibarbeit, doch meine Aufmerksamkeit wanderte ständig hinüber zum Telefon. Das geht dich doch nichts an. Ich wusste sehr wohl, wo mein Aufgabenbereich aufhörte und der der Polizei begann.
Draußen im Gang öffneten sich die Türen des Aufzugs, und Leute vom Reinigungspersonal unterhielten sich lautstark auf ihrem Weg zur Besenkammer ein paar Türen weiter. Sie kamen immer gegen sechs Uhr dreißig. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich Mrs. J.R. McTigue, über die man laut Zeitung damals die Karten hatte vorbestellen können, sowieso nicht erreichen würde. Die Nummer, die ich mir notiert hatte, war vermutlich die Geschäftsnummer der Daughters of the American Revolution, die nach fünf bestimmt nicht mehr besetzt sein würde.
Schon nach dem zweiten Läuten hob jemand ab.
Nach einer kurzen Pause fragte ich: »Spreche ich mit Mrs. J.R. McTigue?«
»Ja, ich bin Mrs. McTigue, warum?«
Es war zu spät. Es gab keine andere Möglichkeit, jetzt musste ich direkt sein. »Mrs. McTigue, mein Name ist Dr. Scarpetta …«
»Doktor wer?«
»Scarpetta«, wiederholte ich. »Ich bin Chief Medical Examiner und untersuche den Tod von Beryl Madison …«
»Ach, du meine Güte. Ja, ich habe darüber gelesen. Wie schrecklich! Sie war eine so liebenswerte junge Frau. Ich konnte es einfach nicht glauben, als ich hörte …«
»Soviel ich weiß, hat sie auf dem Treffen der Daughters of the American Revolution im November gesprochen«, sagte ich.
»Wir waren so begeistert, dass sie zu uns kommen wollte, denn normalerweise machte sie so etwas nicht.«
Mrs. McTigue klang wie eine ältere Dame, und ich hatte bereits das Gefühl, umsonst angerufen zu haben. Aber dann überraschte sie mich.
»Wissen Sie, Beryl hat uns damit einen Gefallen getan. Nur aus diesem Grund konnte die ganze Sache überhaupt stattfinden. Mein verstorbener Mann war ein Freund von Cary Harper, dem Schriftsteller. Sicher haben Sie schon von ihm gehört. Eigentlich hat ja Joe das Ganze organisiert. Er wusste, wie viel es mir bedeutete. Ich habe Beryls Bücher schon seit jeher geliebt.«
»Wo wohnen Sie, Mrs. McTigue?«
»In den Gardens.«
Chamberlayne Gardens war ein Altersheim, nicht weit von der Innenstadt entfernt. Von meinem Beruf her war es mir in finsterer Erinnerung, denn im Lauf der letzten paar Jahre hatte ich einige Todesfälle in den Gardens zu untersuchen gehabt, ebenso wie in buchstäblich allen anderen Alters- und Pflegeheimen der Stadt.
»Könnte ich vielleicht auf meinem Nachhauseweg für ein paar Minuten bei Ihnen vorbeischauen?«, fragte ich. »Wäre das möglich?«
»Ich glaube schon. Warum nicht? Das ließe sich machen. Wie heißen Sie gleich noch mal, Dr. …?«
Ich wiederholte langsam meinen Namen.
»Ich wohne im Apartment Nummer 378. Gehen Sie in die Eingangshalle, und nehmen Sie den Aufzug in den dritten Stock.«
Seit ich wusste, wo sie wohnte, wusste ich auch schon eine Menge über Mrs. McTigue. Chamberlayne Gardens betreute die alten Menschen, die ohne Sozialhilfe leben konnten. Die Kautionen für die Apartments waren beträchtlich, und die monatlichen Mieten höher als anderer Leute Hypothekenzinsen. Die Gardens waren, wie andere, ähnliche Institutionen, ein goldener Käfig. So schön sie auch sein mochten, eigentlich wohnte niemand wirklich gern in ihnen.
Das hohe, moderne Gebäude lag am westlichen Rand der Innenstadt und sah aus wie eine bedrückende Mischung aus Hotel und Krankenhaus. Ich stellte mein Auto auf dem Besucherparkplatz ab und ging zu dem hellerleuchteten Hauptportal. In der Eingangshalle glänzten dem amerikanischen Kolonialstil nachempfundene Möbel, auf denen großartige Seidenblumenarrangements in schweren Vasen aus geschnittenem Bleikristall standen. Auf dem roten Teppichboden lagen maschinengeknüpfte Orientläufer, und an der Decke hing ein Messingleuchter. Ein alter Mann mit einem Spazierstock in der Hand saß steif auf einem Sofa in der Ecke, seine Augen starrten unter dem Rand einer englischen Tweedkappe ins Leere. Eine altersschwache Frau schleppte sich am Arm eines Pflegers durch die Halle.
Der junge Mann, der gelangweilt hinter der Topfpflanze auf dem Empfangstisch hervorsah, schenkte mir keinerlei Beachtung, als ich zum Aufzug ging. Die Türen öffneten sich und brauchten eine Ewigkeit, bis sie sich wieder schlossen, wie es überall dort üblich ist, wo Leute wohnen, die sich nur langsam fortbewegen können. Allein fuhr ich drei Stockwerke hinauf und starrte geistesabwesend auf die Anschläge, die mit Klebeband an den hölzernen Innenwänden befestigt waren. Sie luden zu Ausflügen zu den Museen und Herrenhäusern der Umgebung ein, machten auf Bridge-Clubs, Kunst- und Handwerkskurse aufmerksam und riefen zu einer Wollsachensammlung für das Jüdische Gemeindezentrum auf. Viele der Anschläge waren veraltet. Seniorenheime mit Namen wie Sunnyland, Sheltering Pines oder eben Chamberlayne Gardens, die allesamt an Friedhöfe erinnerten, weckten immer ein ungutes Gefühl in mir. Ich wusste nicht, was ich tun würde, wenn meine Mutter nicht mehr für sich sorgen könnte. Bei meinem letzten Anruf hatte sie etwas von einem künstlichen Hüftgelenk gesagt.
Mrs. McTigues Apartment lag etwa in der Mitte des linken Gangs. Ich klopfte, und eine runzelige Frau mit spärlichem, in kleine Locken gedrehtem Haar, das vergilbt aussah wie altes Papier, öffnete mir prompt. Ihr Gesicht war mit Rouge betupft, und sie hatte sich in einen viel zu großen weißen Strickpullover gehüllt. Der Duft von Rosenwasser und der Geruch von etwas mit Käse Überbackenem zogen in meine Nase.
»Ich bin Kay Scarpetta«, stellte ich mich vor.
»Wie nett, dass Sie gekommen sind«, erwiderte sie und gab mir einen leichten Klaps auf meine hingehaltene Hand. »Wollen Sie Tee oder etwas Stärkeres? Ich habe alles, was Sie wollen. Ich trinke Portwein.«
Währenddessen hatte sie mich in ihr kleines Wohnzimmer geführt und mir einen Lehnsessel angeboten. Sie schaltete den Fernseher aus und knipste eine weitere Lampe an. Das Wohnzimmer war in etwa so überwältigend wie das Bühnenbild von Aida. Jedes Fleckchen auf dem verblichenen Perserteppich war mit schweren Mahagonimöbeln vollgestellt. Stühle, Beistelltische und ein Tisch mit Kuriositäten standen vor überquellenden Bücher- und Eckschränken, die mit feinem Porzellan und langstieligen Gläsern vollgestopft waren. An den Wänden hingen dunkle Gemälde, Klingelschnüre und mit Bleistift abgepauste Bilder von Messinggrabplatten eng nebeneinander.
Sie kam mit einem kleinen Silbertablett zurück, auf dem, neben einem kleinen Teller mit selbstgebackenen Käsebiskuits, eine Karaffe voll Portwein und zwei der langstieligen Gläser standen. Sie schenkte ein und reichte mir den Teller und eine alte, aber frisch gebügelte Leinenserviette mit Spitzenborte. Das Ganze stellte ein Ritual dar und dauerte ziemlich lange. Schließlich setzte sie sich auf das verschlissene Ende eines Sofas, wo sie vermutlich den Großteil des Tages mit Lesen und Fernsehen verbrachte. Sie genoss es offensichtlich, Gesellschaft zu haben, auch wenn der Anlass dazu nicht erfreulich war. Ich fragte mich, ob sie wohl jemals Besuch bekam, und wenn, von wem.
»Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, untersuche ich als Chief Medical Examiner den Tod von Beryl Madison«, bemerkte ich. »Bisher wissen wir noch viel zu wenig über sie und die Leute, die sie gekannt haben.«
Mrs. McTigue trank mit ausdruckslosem Gesicht ihren Portwein. Ich hatte mich durch meinen ständigen Umgang mit Polizei und Rechtsanwälten schon so daran gewöhnt, sofort zur Sache zu kommen, dass ich bisweilen vergaß, dass man dem Rest der Menschheit manchmal Honig ums Maul schmieren musste. Das Biskuit war butterzart und wirklich gut. Ich sagte ihr das.
»Oh, vielen Dank.« Sie lächelte. »Nehmen Sie doch noch eines, ich habe noch mehr draußen.«
»Mrs. McTigue«, versuchte ich es noch mal, »haben Sie Beryl Madison gekannt, bevor Sie sie im letzten Herbst einluden, vor Ihrer Vereinigung zu sprechen?«
»Aber ja«, antwortete sie. »Zumindest indirekt, denn ich war schon seit Jahren ein Fan von ihr und ihren Büchern. Historische Romane lese ich nämlich am liebsten.«
»Woher wussten Sie, dass sie diese Bücher geschrieben hatte«, fragte ich, »wo Beryl sie doch unter Pseudonymen veröffentlichte? Ihr richtiger Name ist nie auf einem Schutzumschlag oder in der Autorenbeschreibung erschienen.«
Ich hatte in der Bibliothek einige von Beryls Büchern daraufhin durchgesehen.
»Das ist richtig. Ich vermute, dass ich zu den wenigen Leuten gehöre, die wussten, wer sie wirklich war – und zwar wegen Joe.«
»Ihrem Mann?«
»Er und Mr. Harper waren Freunde«, antwortete sie. »Ich meine, soweit man bei Mr. Harper von Freundschaft reden kann. Sie lernten sich über Joes berufliche Tätigkeit kennen. Damit fing es an.«
»Welchen Beruf übte Ihr Mann denn aus?«, fragte ich und fand, dass meine Gastgeberin viel weniger verkalkt war, als ich ursprünglich angenommen hatte.
»Er war Bauunternehmer. Als Mr. Harper Cutler Grove kaufte, war das Haus stark renovierungsbedürftig. Joe hielt sich fast zwei Jahre dort draußen auf, um die Arbeiten zu leiten.«
Eigentlich hätte diese Assoziation sofort bei mir klingeln müssen. McTigue Hoch- und Tiefbau und McTigue Bauholz waren die größten Baufirmen in Richmond und besaßen Zweigstellen in ganz Virginia.
»Das war vor mehr als fünfzehn Jahren«, fuhr Mrs. McTigue fort. »Bei dieser Arbeit in Cutler Grove lernte Joe auch Beryl kennen. Sie kam ein paarmal mit Mr. Harper zur Baustelle, und als das Haus fertig war, zog sie mit ein. Sie war sehr jung.« Sie schwieg für einen Moment. »Ich erinnere mich noch, dass Joe mir damals erzählte, dass Mr. Harper ein schönes, junges Mädchen, das zudem eine begabte Schriftstellerin sei, adoptiert habe. Ich glaube, sie war eine Waise. Auf jeden Fall war es traurig. Natürlich hat damals niemand laut darüber gesprochen.« Sie setzte ihr Glas sorgfältig ab und ging langsam durch das Zimmer zu ihrem Sekretär. Sie zog eine Schublade auf und nahm einen beigen, mittelgroßen Briefumschlag heraus.
»Hier«, sagte sie. Ihre Hände zitterten, als sie ihn mir herüberreichte. »Dies ist das einzige Bild, das ich von ihnen habe.«
In dem Umschlag lag ein leeres Blatt schweren Hadernpapiers, das um ein altes, etwas überbelichtetes Schwarzweißfoto gefaltet war. Ein zartes, hübsches Mädchen, etwa zwischen fünfzehn und achtzehn, stand zwischen zwei stattlichen, braungebrannten Männern in Wanderkleidung. Die drei lehnten sich eng aneinander und blinzelten ins strahlend helle Sonnenlicht.
»Das ist Joe«, sagte Mrs. McTigue und deutete auf den Mann links von dem Mädchen, das sicherlich die junge Beryl Madison war. Die Ärmel eines khakifarbenen Hemdes waren bis zu den Ellbogen seiner muskulösen Arme hochgekrempelt, und der Schirm einer Baseballmütze beschattete seine Augen. Rechts von Beryl stand ein großer, weißhaariger Mann. Cary Harper, wie Mrs. McTigue sagte. »Es wurde unten am Fluss aufgenommen«, erzählte sie. »Damals, als Joe an dem Haus arbeitete. Mr. Harper war schon damals schlohweiß. Sie wissen doch, man sagt, sein Haar sei weiß geworden, als er gerade dreißig war und The Jagged Corner schrieb.«
»Dieses Foto wurde in Cutler Grove aufgenommen?«
»Ja«, antwortete sie.
Beryls Gesicht faszinierte mich. Ein Gesicht, das viel zu weise und wissend für einen so jungen Menschen war; ernst und voller Sehnsucht und Trauer, wie ich es von Kindern kannte, die man misshandelt und im Stich gelassen hatte.
»Beryl war damals noch ein Kind«, sagte Mrs. McTigue.
»Sie dürfte wohl sechzehn oder siebzehn Jahre alt gewesen sein?«
»Ja, da könnten Sie recht haben«, antwortete sie und sah zu, wie ich den Bogen Papier wieder um das Foto faltete und sorgfältig in den Umschlag steckte. »Ich habe das erst nach Joes Tod gefunden. Ich vermute, dass einer von seinen Leuten die Aufnahme gemacht hat.«
Sie legte den Umschlag in die Schublade zurück, und als sie sich wieder gesetzt hatte, fuhr sie fort: »Ich glaube, einer der Gründe, warum Joe so gut mit Mr. Harper auskam, war wohl der, dass Joe, wenn es um anderer Leute Angelegenheiten ging, schweigen konnte wie ein Grab. Ich bin mir sicher, dass er eine ganze Menge nicht einmal mir erzählt hat.« Mit einem matten Lächeln starrte sie an die Wand.
»Es war dann anscheinend Mr. Harper, der Ihrem Mann erzählt hatte, dass Beryls Bücher veröffentlicht wurden«, bemerkte ich.
Sie lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf mich und sah mich erstaunt an. »Wissen Sie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob mir Joe jemals verraten hat, woher er das so genau wusste, Dr. Scarpetta. Was für ein hübscher Name. Ist er spanisch?«
»Italienisch.«
»Oh! Sicher sind Sie eine gute Köchin!«
»Ich koche ganz gern«, sagte ich und nippte an meinem Portwein. »Also, ganz offensichtlich hat Mr. Harper Ihrem Mann von Beryls Büchern erzählt.«
»Ach, du meine Güte!« Sie runzelte die Stirn. »Es ist schon komisch, dass Sie darauf zu sprechen kommen. Ich habe an diese Möglichkeit nie gedacht. Aber Mr. Harper muss es ihm irgendwann einmal erzählt haben. Woher sonst hätte Joe das wissen sollen? Denn gewusst hat er es. Als Flag of Honor erschien, schenkte er mir ein Exemplar davon zu Weihnachten.«
Sie stand wieder auf, suchte in verschiedenen Bücherregalen und brachte mir schließlich einen dicken Band. »Es steht eine Widmung drin«, bemerkte sie stolz. Ich öffnete das Buch und sah in weitausholenden Buchstaben die Unterschrift »Emily Stratton«, vom Dezember vor genau zehn Jahren.
»Ihr erstes Buch«, sagte ich.
»Vermutlich eines der ersten, die sie jemals signiert hat.« Mrs. McTigue strahlte. »Ich glaube, dass Joe es über Mr. Harper bekommen hat. Ja, ich bin mir sicher. Wie sonst hätte er es bekommen können?«
»Haben Sie noch andere signierte Ausgaben?«
»Nicht von ihr. Aber ich habe alle ihre Bücher und habe sie auch alle gelesen, die meisten davon sogar zwei- oder dreimal.« Sie zögerte, und ihre Augen wurden größer. »War es wirklich so, wie die Zeitungen es beschrieben haben?«
»Ja.« Ich sagte ihr nicht die ganze Wahrheit. Beryls Tod war sehr viel brutaler gewesen als alles, was darüber in die Nachrichten gelangt war.
Sie griff nach einem weiteren Käsebiskuit, und für einen Moment schien sie den Tränen nahe zu sein.
»Erzählen Sie mir, was im vergangenen November passierte«, bat ich. »Es ist ja jetzt schon fast ein Jahr her, seit sie vor Ihrer Gruppe gesprochen hat, Mrs. McTigue. Es war für die Daughters of the American Revolution, nicht wahr?«
»Die Lesung fand auf unserem alljährlichen Literatenfrühstück statt. Es ist der Höhepunkt des Jahres, und wir laden einen ganz besonderen Redner dazu ein, einen Schriftsteller – meistens einen berühmten. Da ich damals turnusgemäß den Vorsitz im Komitee innehatte, fiel mir die Aufgabe zu, die Veranstaltung zu organisieren und den Redner zu finden. Ich war von Anfang an für Beryl, aber es gab da eine Reihe von Hindernissen. Ich wusste nicht, wie ich sie ausfindig machen konnte. Sie besaß eine Geheimnummer, und ich hatte keine Ahnung, wo sie lebte, nie im Traum hätte ich daran gedacht, dass sie direkt hier, mitten in Richmond, wohnte. Schließlich bat ich Joe, mir zu helfen.«
Sie zögerte und lachte ein wenig verstört. »Wissen Sie, ich glaube, zuerst habe ich versucht, mir zu beweisen, dass ich die Sache allein erledigen könnte. Und Joe hatte ja so viel zu tun. Nun gut, eines Abends rief er Mr. Harper an, und am nächsten Morgen klingelte mein Telefon. Ich werde nie vergessen, wie überrascht ich war. Es verschlug mir fast die Sprache, als sie mir ihren Namen nannte.«
Ihr Telefon. Bisher hatte ich nie dran gedacht, dass Beryl eine Geheimnummer hatte. In den Berichten von Officer Reed war davon nicht die Rede gewesen. Wusste Marino etwas davon?
»Sie nahm die Einladung an, was mich natürlich sehr freute, und fragte dann das Übliche«, erzählte Mrs. McTigue. »Wie groß die Gruppe voraussichtlich sein werde. Ich sagte ihr, zwischen zwei- und dreihundert Leuten. Um wie viel Uhr und wie lange sie sprechen solle und Ähnliches. Sie war ausgesprochen höflich, wirklich ganz bezaubernd. Aber nicht allzu gesprächig. Und eines war ungewöhnlich: Sie legte keinen Wert darauf, ihre Bücher mitzubringen. Die anderen Schriftsteller bestehen sonst immer darauf, ihre Bücher mitzubringen, müssen Sie wissen. Sie signieren und verkaufen sie hinterher. Beryl sagte, dass sie das nicht mache, und sie verzichtete auch auf ihr Honorar. Es war wirklich sehr ungewöhnlich. Wie nett und bescheiden von ihr, dachte ich.«
»Bestanden die Zuhörer nur aus Frauen?«, fragte ich.
Sie dachte nach. »Ich glaube, ein paar von uns haben ihre Ehemänner mitgebracht, aber in der Hauptsache setzte sich das Publikum aus Frauen zusammen. Das ist fast immer so.«
Das hatte ich mir gedacht. Es erschien mir unwahrscheinlich, dass sich Beryls Mörder an diesem Novembertag unter ihren Bewunderern befunden haben sollte.
»Hat sie eigentlich häufig Einladungen wie die Ihre angenommen?«, fragte ich.
»O nein!«, beeilte sich Mrs. McTigue zu sagen. »Ich weiß genau, dass sie das nicht tat, wenigstens nicht hier bei uns. Sonst hätte ich davon gehört und wäre die Erste gewesen, die sich eine Karte dafür besorgt hätte. Sie kam mir vor wie eine junge Frau, die wenig Wert auf Öffentlichkeit legte, die schrieb, weil sie Freude daran hatte. Das erklärt auch ihre Pseudonyme. Schriftsteller, die ihre Identität so wie sie verschleiern, wagen sich ganz selten in die Öffentlichkeit. Und ich bin sicher, sie hätte auch für mich keine Ausnahme gemacht, wenn da nicht Joes Verbindung zu Mr. Harper gewesen wäre.«
»Es sieht so aus, als hätte sie nahezu alles für Mr. Harper getan«, bemerkte ich.
»Ja, ich glaube schon.«
»Haben Sie ihn jemals getroffen?«
»Ja.«
»Was für einen Eindruck hatten Sie von ihm?«
»Vielleicht ist er zurückhaltend«, erwiderte sie, »aber mir kommt er manchmal wie ein unglücklicher Mann vor, der sich für ein wenig besser als alle anderen hält. Ich würde sagen, dass er schon eine eindrucksvolle Figur abgibt.« Sie schweifte wieder ab, und der Funken in ihren Augen war erloschen. »Mein Mann war ihm jedenfalls treu ergeben.«
»Wann haben Sie Mr. Harper zum letzten Mal getroffen?«
»Joe starb im vergangenen Frühjahr.«
»Sie haben Mr. Harper also seit dem Tod Ihres Mannes nicht mehr gesehen?«
Sie schüttelte den Kopf und verlor sich in ihre eigenen, bitteren Erinnerungen, von denen ich nichts wusste. Ich fragte mich, was wirklich zwischen Cary Harper und Mr. McTigue vorgefallen war. Hatten sie üble Geschäfte miteinander gemacht?
Oder hatte Harpers Einfluss Mr. McTigue so verändert, dass er nicht mehr derselbe Mann war, den seine Frau geliebt hatte? Oder vielleicht war Harper einfach nur egoistisch und rücksichtslos.
»Ich habe gehört, dass er eine Schwester hat. Cary Harper lebt doch mit seiner Schwester zusammen, oder?«, fragte ich.
Zu meiner Überraschung presste Mrs. McTigue ihre Lippen zusammen, und Tränen stiegen ihr in die Augen.
Ich stellte mein Glas auf den Tisch und nahm meine Handtasche.
Sie folgte mir zur Tür.
Vorsichtig hakte ich nach. »Hat Beryl Ihnen oder Ihrem Mann jemals geschrieben?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Wissen Sie, ob sie noch andere Freunde hatte? Hat Ihr Mann vielleicht einmal jemanden erwähnt?«
Wieder schüttelte sie den Kopf.
»Wen könnte sie mit ›M‹, dem Buchstaben M, gemeint haben?«
Mrs. McTigue starrte traurig in den leeren Gang, ihre Hand lag auf dem Türgriff. Als sie mich ansah, blickten ihre tränengefüllten Augen durch mich hindurch. »Es gibt in zwei Romanen von ihr einen ›P‹ und einen ›A‹. Ich glaube, es waren Spione der Nordstaaten. Ach, du meine Güte! Ich fürchte, ich habe den Herd nicht abgedreht.« Sie blinzelte ein paarmal, als ob sie direkt in die Sonne geschaut hätte. »Sie kommen mich doch hoffentlich wieder einmal besuchen?«
»Aber gern.« Ich drückte freundlich ihren Arm und ging.
Sofort, als ich zu Hause war, rief ich meine Mutter an und war auf einmal froh, die üblichen Ermahnungen und Vorträge zu hören. Ihre starke Stimme klang auf ihre unumwundene Art direkt liebevoll.
»Bei uns war es die ganze Woche lang über dreißig Grad heiß, und im Fernseher berichteten sie, dass ihr in Richmond nicht einmal zehn Grad hattet«, sagte sie. »Da friert es doch schon fast. Hat es schon geschneit?«
»Nein, Mutter. Bis jetzt hat es noch nicht geschneit. Wie geht es deiner Hüfte?«
»Den Umständen entsprechend gut. Ich häkle gerade eine Kniedecke, ich dachte, du könntest sie über deine Beine legen, wenn du im Büro arbeitest. Lucy hat nach dir gefragt.«
Ich hatte schon wochenlang nicht mehr mit meiner Nichte gesprochen.
»Sie arbeitet in der Schule gerade an so einem naturwissenschaftlichen Projekt«, fuhr meine Mutter fort. »Es ist ein sprechender Roboter, stell dir vor. Sie hat ihn neulich abends mitgebracht und den armen Sindbad so erschreckt, dass er unters Bett kroch …«
Sindbad war ein boshafter, gemeiner, verdorbener und ungezogener Kater, ein grau-schwarz gestreifter Streuner, der meiner Mutter beim Einkaufen in Miami Beach eines Morgens hartnäckig hinterhergelaufen war. Wenn ich zu Besuch kam, beschränkte sich Sindbads Gastfreundschaft darauf, dass er sich auf den Kühlschrank hockte und blöd auf mich herunterglotzte.
»Rate mal, wen ich neulich getroffen habe«, sagte ich, ein wenig zu lebhaft.
Der Wunsch, mit jemandem darüber zu sprechen, war plötzlich übermächtig. Meine Mutter kannte meine Vergangenheit, zumindest das meiste davon. »Kannst du dich noch an Mark James erinnern?«
Schweigen.
»Er war in Washington und hat bei mir vorbeigeschaut.«
»Natürlich erinnere ich mich an ihn.«
»Er wollte einen Fall mit mir besprechen. Du weißt doch, er ist Anwalt. In, äh, Chicago.« Ich trat schleunigst den Rückzug an. »Er hatte geschäftlich in Washington zu tun.« Je mehr ich sagte, desto schlimmer erschien mir ihr vorwurfsvolles Schweigen.
»Soso. Nun, ich erinnere mich noch gut daran, dass du wegen ihm fast gestorben wärest, Katie.«
Immer wenn sie mich »Katie« nannte, war ich auf einmal wieder zehn Jahre alt.