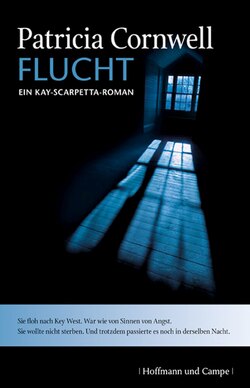Читать книгу Flucht - Patricia Cornwell - Страница 9
2
ОглавлениеAuf meiner langen Fahrt nach Hause schien der Vollmond über Richmond. Nur die hartnäckigsten Kinder drehten noch ihre Halloween-Runden von Haus zu Haus. Die Scheinwerfer meines Wagens beleuchteten ihre grässlichen Masken und furchteinflößenden kleinen Silhouetten. Ich fragte mich, wie oft sie heute wohl vergeblich an meiner Tür geläutet hatten. Mein Haus war ganz besonders beliebt bei ihnen. Ich hatte keine Kinder und schenkte ihnen vielleicht deshalb immer übertrieben viele Süßigkeiten. Morgen würde ich vier volle Tüten Schokoladenriegel an meine Mitarbeiter verteilen müssen.
Als ich die Treppe hinaufstieg, begann das Telefon zu klingeln. Kurz bevor sich der Anrufbeantworter einschaltete, riss ich den Hörer von der Gabel. Die Stimme war mir zunächst fremd, aber dann erkannte ich sie, und mein Herz schlug plötzlich schneller.
»Kay? Ich bin’s, Mark. Gott sei Dank bist du zu Hause …« Mark James’ Stimme klang so, als spräche er vom Boden eines Ölfasses, und ich konnte im Hintergrund Autos vorbeifahren hören. »Wo bist du?«, brachte ich heraus, und ich wusste, dass sich das so anhörte, als sei ich ziemlich entnervt. »Auf dem Highway 95, etwa achtzig Kilometer nördlich von Richmond.«
Ich setzte mich auf die Bettkante.
»In einer Telefonzelle«, fuhr er fort. »Du musst mir beschreiben, wie ich zu deinem Haus komme.« Ein lauter Lastwagen dröhnte vorüber, dann erst konnte er weitersprechen: »Ich würde dich gern sehen, Kay. Ich war die ganze Woche über in Washington und habe seit dem späten Nachmittag versucht, dich zu erwischen. Jetzt habe ich einfach auf gut Glück ein Auto gemietet. Ist das okay?«
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte.
»Ich dachte, wir könnten zusammen etwas trinken und ein wenig darüber reden, wie es uns ergangen ist«, sagte der Mann, der mir einmal das Herz gebrochen hatte. »Ich habe ein Zimmer im Radisson reserviert. Morgen früh fliegt eine Maschine von Richmond zurück nach Chicago. Ich dachte … Ich habe etwas mit dir zu besprechen.«
Ich konnte mir nicht vorstellen, was Mark und ich zu besprechen hätten.
»Ist es okay?«, fragte er noch einmal.
Nein, es war nicht okay! Doch ich sagte: »Aber natürlich, Mark. Ich freue mich darauf, dich zu sehen.«
Nachdem ich ihm den Weg beschrieben hatte, ging ich ins Badezimmer, um mich frisch zu machen. Ich rekapitulierte. Dreizehn Jahre waren vergangen, seit wir zusammen Jura studiert hatten. Jetzt war mein Haar mehr grau als blond, und als ich Mark das letzte Mal gesehen hatte, trug ich es lang. Meine Augen waren auch nicht mehr so blau wie früher. Der unvoreingenommene Spiegel erinnerte mich unbarmherzig und kalt daran, dass ich die neununddreißig schon überschritten hatte und dass es so etwas wie Gesichtslifting gab. Mark war in meiner Erinnerung immer noch knapp fünfundzwanzig, wie damals, als er das Objekt meiner Leidenschaft und Abhängigkeit und schließlich meiner tiefsten Verzweiflung geworden war. Seit es mit ihm vorbei war, hatte ich nur noch gearbeitet.
Er fuhr anscheinend immer noch schnell und liebte ausgefallene Autos. Weniger als fünfundvierzig Minuten später öffnete ich meine Haustür und beobachtete, wie er aus seinem gemieteten Sterling stieg. Er war immer noch der Mark, den ich gekannt hatte, mit demselben durchtrainierten Körper und seinem selbstbewussten, langbeinigen Gang. Energisch stieg er die Stufen hinauf und lächelte ein wenig. Nach einer schnellen Umarmung blieb er einen Moment lang verlegen in der Diele stehen und wusste nicht, was er sagen sollte. »Trinkst du immer noch Scotch?«, fragte ich schließlich.
»Das hat sich nicht geändert«, erwiderte er und folgte mir in die Küche.
Ich holte den Glenfiddich aus der Bar und mixte ihm automatisch seinen Drink genau so, wie ich es vor so langer Zeit getan hatte. Zwei Schuss Whisky, Eis und einen Spritzer Selterswasser. Er folgte mir mit den Augen, als ich durch die Küche ging und die Drinks auf den Tisch stellte. Er nahm einen Schluck, starrte in sein Glas und ließ die Eiswürfel darin herumkreisen, so wie er es früher getan hatte, wenn er gestresst war. Ich sah ihn lange und aufmerksam an, seine eleganten Gesichtszüge, hohen Wangenknochen und seine klaren grauen Augen. Sein dunkles Haar färbte sich an den Schläfen etwas grau.
Dann lenkte ich meine Aufmerksamkeit wieder auf das sich langsam in seinem Glas drehende Eis. »Ich nehme an, du arbeitest jetzt bei einer Kanzlei in Chicago?«
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und schaute mich an. »Ich mache jetzt hauptsächlich Berufungen, nur ab und zu noch einen Prozess. Gelegentlich treffe ich Diesner, und von ihm weiß ich, dass du jetzt hier in Richmond bist.«
Diesner war der Chief Medical Examiner in Chicago. Ich sah ihn auf Kongressen, und wir saßen zusammen in einigen Komitees. Er hatte nie erwähnt, dass er Mark James kannte, und woher er über meine Verbindung zu Mark informiert war, war mir ein Rätsel.
»Ich habe den Fehler begangen, ihm zu erzählen, dass ich dich auf der Universität gekannt habe. Jetzt bringt er von Zeit zu Zeit die Rede auf dich, um mir einen Stich zu versetzen«, erklärte Mark, der meine Gedanken erraten hatte.
Das glaubte ich gern. Diesner war so mürrisch wie ein alter Ziegenbock und nicht gerade ein besonderer Freund von Strafverteidigern. Einige seiner theatralischen Schlachten im Gerichtssaal waren bereits Legende geworden.
Mark sagte: »Wie die meisten Forensiker ist Diesner immer für die Anklage. Wenn ich einen Mörder vertrete, bin ich für ihn automatisch der böse Bube. Manchmal schaut er bei mir rein und erzählt mir ganz beiläufig von einem Artikel, den du gerade veröffentlicht hast, oder von einem besonders schauerlichen Fall, an dem du arbeitest. Dr. Scarpetta. Die berühmte Chief Scarpetta.« Er lachte, aber nicht mit den Augen.
»Du behauptest, wir stünden immer nur auf Seiten der Anklage, und das ist nicht fair«, antwortete ich. »Es sieht nämlich nur so aus. Wenn unsere Beweise für den Angeklagten sprechen, kommt ein Fall gar nicht erst vor Gericht.«
»Kay, ich weiß doch, was los ist«, sagte er mit diesem Lass-es-gut-sein-Ton in der Stimme, an den ich mich noch sehr gut erinnerte. »Mir ist klar, was du täglich anschauen musst. Und wenn ich du wäre, würde ich die Schweinehunde auch am liebsten auf dem elektrischen Stuhl sehen.«
»Ja, du weißt, was ich anschauen muss, Mark«, fing ich an. Es war ein uralter Streit zwischen uns. Ich konnte es einfach nicht glauben. Er war noch nicht einmal fünfzehn Minuten hier, und wir knüpften genau dort wieder an, wo wir damals aufgehört hatten. Einige unserer schlimmsten Kräche hatten sich um genau dieses Thema gedreht. Als ich Mark zum ersten Mal traf, war ich bereits eine fertig ausgebildete Ärztin und Forensikerin und studierte in Georgetown Jura. Ich hatte die dunkle Seite des Verbrechens gesehen, die Grausamkeit und die sinnlosen Tragödien. Ich hatte mit meinen behandschuhten Händen in den blutigen Niederungen des Todes herumgewühlt, während Mark, der Wunderknabe von einer Elite-Universität, sich unter einem Schwerverbrechen das mutwillige Verkratzen des Lacks an seinem Jaguar vorstellte. Mark wollte damals Anwalt werden, weil sein Vater und sein Großvater bereits Anwälte gewesen waren. Ich war Katholikin, Mark Protestant. Meine Herkunft war italienisch, seine so englisch wie die von Prinz Charles. Ich war in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, er in einem der wohlhabendsten Wohnviertel Bostons. Ich hatte mir eine Ehe mit ihm früher einfach himmlisch vorgestellt.
»Du hast dich nicht verändert, Kay«, sagte er. »Außer, dass du entschlossener und härter wirkst. Ich wette, dass man sich im Gerichtssaal ganz schön vor dir in Acht nehmen muss.«
»Ich glaube nicht, dass ich hart bin.«
»Das soll keine Kritik sein. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass du phantastisch aussiehst.« Er sah sich in der Küche um. »Und Erfolg hast du anscheinend auch. Bist du glücklich?«
»Ich mag Virginia«, antwortete ich und sah ihn dabei nicht an. »Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, sind die Winter hier, aber ich glaube, dass du es in dieser Hinsicht noch schlimmer getroffen hast. Wie kannst du es in diesen scheußlichen sechs Monaten nur in Chicago aushalten?«
»Um die Wahrheit zu sagen, ich habe mich noch immer nicht daran gewöhnt. Aber für dich wäre es nichts. Du als Gewächshausblume aus Miami würdest dort nicht einen einzigen Monat bleiben.« Er nippte an seinem Drink. »Bist du verheiratet?«
»Ich war es.«
»Hmmm.« Er legte die Stirn in Falten, während er nachdachte. »War da nicht ein Tony sowieso …? Jetzt fällt es mir ein. Du hattest da was mit Tony … Benedetti, richtig? Am Ende unseres dritten Jahres.«
Es erstaunte mich, dass Mark das bemerkt hatte, mehr noch, dass er sich daran erinnerte.
»Wir sind geschieden. Schon lange«, erwiderte ich.
»Das tut mir leid«, sagte er mit sanfter Stimme.
Ich griff nach meinem Drink.
»Hast du einen Freund, einen netten womöglich?«, fragte er.
»Im Moment habe ich niemanden. Ob nett oder nicht.«
Mark lachte nicht mehr so viel wie früher. Freiwillig und sachlich erklärte er: »Vor ein paar Jahren hätte ich fast geheiratet, aber es hat nicht hingehauen. Oder vielleicht sollte ich ehrlich sein und gestehen, dass ich in der letzten Minute panische Angst bekam.«
Es fiel mir schwer, zu glauben, dass er nie geheiratet hatte. Wieder ahnte er, was ich dachte.
»Das war nach dem Tod von Janet.« Er zögerte. »Ich war verheiratet.«
»Janet?«
Seine Eiswürfel kreisten wieder. »Ich lernte sie in Pittsburgh kennen, nachdem ich Georgetown verlassen hatte. Sie war Steueranwältin in der Kanzlei.«
Ich beobachtete ihn genau, und was ich sah, verblüffte mich. Mark war anders als früher. Seine Ausstrahlung, die ich damals so anziehend gefunden hatte, hatte sich verändert. Ich konnte nicht genau sagen, wie, aber ich glaubte, dass sie dunkler, schwermütiger geworden war.
»Ein Autounfall«, erklärte er. »An einem Samstagabend. Sie fuhr los, um Popcorn zu holen. Wir wollten uns den Spätfilm ansehen. Ein Betrunkener kam ihr auf ihrer Spur entgegen. Er hatte nicht einmal das Licht seines Autos angeschaltet.«
»O Gott, Mark, das tut mir leid«, sagte ich. »Das ist ja schrecklich.«
»Es passierte vor acht Jahren.«
»Hattet ihr Kinder?«, fragte ich leise.
Er schüttelte den Kopf.
Wir schwiegen.
»Meine Kanzlei eröffnet ein Büro in Washington«, bemerkte er, als sich unsere Blicke trafen.
Ich antwortete nicht.
»Es könnte sein, dass ich nach Washington versetzt werde und dorthin ziehen muss. Wir expandieren wie verrückt und sind jetzt etwa hundert Anwälte mit Büros in New York, Atlanta und Houston.«
»Wann würdest du denn umziehen?«, fragte ich ihn ganz ruhig.
»Am 1. Januar nächsten Jahres.«
»Ist das sicher?«
»Ich habe die Schnauze voll von Chicago, Kay. Ich brauche Tapetenwechsel. Ich wollte es dich wissen lassen, das ist der Grund, weshalb ich hier bin, oder sagen wir, der Hauptgrund. Ich möchte nicht nach Washington ziehen und dort irgendwann zufällig mit dir zusammentreffen. Ich würde gern in Nord-Virginia wohnen. Du arbeitest in Nord-Virginia. Früher oder später würden wir uns sicher im Theater oder in einem Restaurant zufällig über den Weg laufen. Das will ich nicht.«
Ich stellte mir vor, im Konzertsaal des Kennedy Center zu sitzen und drei Reihen vor mir Mark zu entdecken, der einer hübschen, jungen Begleiterin etwas ins Ohr flüsterte. Ich wurde an einen alten Schmerz erinnert, einen Schmerz, der damals so intensiv gewesen war, dass ich ihn körperlich gespürt hatte. Ich hatte nie einen anderen Mann als ihn angeschaut. Er war der alleinige Brennpunkt meiner Gefühle gewesen. Zuerst hatte nur ein Teil von mir geahnt, dass dies nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. Später wusste ich es dann genau.
»Das war mein Hauptgrund«, wiederholte er, jetzt ganz der Anwalt, der sein Eröffnungsplädoyer hält, »aber da ist noch etwas anderes, was mit uns beiden nichts zu tun hat.«
Ich sagte nichts.
»Vor ein paar Tagen wurde hier in Richmond eine Frau ermordet. Beryl Madison …«
Mein erstaunter Gesichtsausdruck ließ ihn einen Moment innehalten.
»Berger, einer unserer Seniorpartner, erzählte mir davon, als er mich in meinem Hotel in Washington anrief. Ich würde gern mit dir darüber sprechen.«
»Was hast du damit zu tun?«, fragte ich. »Hast du sie etwa gekannt?«
»Flüchtig. Ich habe sie einmal getroffen, letzten Winter in New York. Unser Büro dort befasst sich mit Medienrecht. Beryl hatte Probleme, einen Streit über einen Vertrag, und sie beauftragte Orndorff & Berger damit, die Sache für sie ins Reine zu bringen. Ich war zufällig in New York, als sie eine Unterredung mit Sparacino, dem für ihren Fall zuständigen Anwalt, führte. Sparacino lud mich ein, mit den beiden im Algonquin zu Mittag zu essen.«
»Wenn du glaubst, dass dieser Streit, den du erwähnt hast, irgendetwas mit ihrer Ermordung zu tun haben könnte, dann solltest du das der Polizei erzählen, nicht mir«, sagte ich ärgerlich.
»Kay«, antwortete er, »meine Kanzlei weiß nicht das Geringste davon, dass ich mit dir rede, okay? Als mich Berger gestern anrief, ging es um etwas ganz anderes, verstehst du? Er hat im Verlauf des Gesprächs den Mord an Beryl Madison erwähnt, weil er wollte, dass ich mich in den hiesigen Zeitungen über den Fall informiere.«
»Gut. Im Klartext heißt das, informiere dich über den Fall, bei deiner Ex- …«
Ich spürte, wie ich rot wurde. Ex-was?
»So ist es nicht.« Er blickte zur Seite. »Ich dachte an dich und wollte mit dir telefonieren, bevor Berger anrief, bevor ich die Sache mit Beryl erfuhr. Zwei verdammte Nächte lang habe ich vor dem Telefon gesessen. Ich habe mir deine Nummer von der Auskunft geben lassen, aber ich habe mich einfach nicht getraut, dich anzurufen. Wenn Berger mir nicht erzählt hätte, was passiert ist, hätte ich es vermutlich nie getan. Vielleicht war Beryl ein willkommener Vorwand. So viel gebe ich zu. Aber es ist nicht so, wie du denkst …«
Ich hörte nicht zu. Es erschreckte mich, wie gern ich ihm glauben wollte. »Wenn deine Kanzlei sich für den Mord interessiert, dann sag mir genau, warum.«
Er dachte einen Moment lang nach. »Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein berechtigtes Interesse an dem Mord haben. Vielleicht kommt es aus einem ganz persönlichen Gefühl des Schreckens heraus. Es war ein fürchterlicher Schock für diejenigen von uns, die sie gekannt hatten. Außerdem kann ich dir verraten, dass sie sich mitten in einem ziemlich heftigen Streit befand. Aufgrund eines Vertrags, den sie vor acht Jahren unterschrieben hatte, wurde ihr ganz schön übel mitgespielt. Die Geschichte ist sehr kompliziert. Und sie hat etwas mit Cary Harper zu tun.«
»Dem Schriftsteller?«, fragte ich verblüfft. »Dem Cary Harper?«
»Wie du vielleicht weißt«, sagte Mark, »wohnt er nicht weit von hier in Cutler Grove, einer alten Plantage aus dem achtzehnten Jahrhundert. Sie liegt am Ufer des James River, in Williamsburg.«
Ich versuchte mir ins Gedächtnis zu rufen, was ich über Harper gelesen hatte. Vor etwa zwanzig Jahren hatte er mit einem Roman den Pulitzerpreis gewonnen. Er lebte sehr zurückgezogen zusammen mit seiner Schwester. Oder war es seine Tante? Um Harpers Privatleben rankten sich die wildesten Gerüchte. Je mehr er die Reporter austrickste und Interviews verweigerte, desto heftiger schossen die Spekulationen über ihn ins Kraut.
Ich zündete mir eine Zigarette an.
»Ich habe gehofft, du hättest damit aufgehört«, sagte er.
»Dazu müsste man mir schon ein Stück meines Vorderhirns herausoperieren.«
»Das wenige, was ich weiß, ist schnell erzählt. Beryl hatte als Teenager, bis sie etwa zwanzig war, eine Art Beziehung mit Harper. Eine Zeitlang lebte sie sogar mit ihm und seiner Schwester in seinem Haus. Beryl war für ihn eine hoffnungsvolle junge Autorin, die talentierte Tochter, die er selbst nie hatte. Er nahm sie unter seine Fittiche. Durch seine Vermittlung konnte sie schon im Alter von nur zweiundzwanzig Jahren unter dem Namen Stratton ihren ersten Roman veröffentlichen, eine pseudo-literarische Liebesschnulze. Harper ließ sich sogar dazu herab, ein paar Worte für den Schutzumschlag des Buches zu schreiben, irgendetwas von einer aufregenden jungen Autorin, die er entdeckt habe. Viele Leute rümpften damals darüber die Nase. Ihr Roman gehörte eher dem Bereich der kommerziellen Unterhaltungsliteratur an und war kein Werk von hohem künstlerischem Rang. Außerdem hatte man schon jahrelang kein Wort mehr von Harper gehört.«
»Was hat das mit ihren Vertragsstreitigkeiten zu tun?«
Mark antwortete ironisch: »Harper mag ja leicht auf eine ihn anbetende junge Dame hereinfallen, aber er ist auch ein ganz schön durchtriebener Bastard. Bevor er ihrem Buch zur Veröffentlichung verhalf, zwang er sie, einen Vertrag zu unterzeichnen. In diesem wurde Beryl untersagt, etwas über ihn zu schreiben, solange er und seine Schwester am Leben waren. Harper ist erst Mitte fünfzig und seine Schwester ein paar Jahre älter. Im Grunde hinderte der Vertrag Beryl bis an ihr Lebensende daran, etwas Autobiographisches zu schreiben, denn wie konnte sie das, ohne Harper zu erwähnen?«
»Sie hätte es schon gekonnt«, antwortete ich, »aber ohne Harper hätte sich das Buch nur schlecht verkauft.«
»Genau.«
»Warum hat sie so viele Pseudonyme verwendet? War das ein Teil ihrer Vereinbarungen mit Harper?«
»Ich denke schon. Ich glaube, er wollte, dass Beryl sein Geheimnis blieb. Er hatte ihr literarischen Erfolg verschafft, aber er wollte sie vor der Welt versteckt halten. So ist Beryl Madisons Name nicht gerade übermäßig bekannt, obwohl ihre Bücher finanziell erfolgreich waren.«
»Darf ich annehmen, dass sie vorhatte, diesen Vertrag zu verletzen, und deshalb zu Orndorff & Berger kam?«
Er nippte an seinem Glas. »Erinnere dich bitte daran, dass sie nicht meine Klientin war. Deshalb bin ich nicht über alle Einzelheiten des Falls unterrichtet. Aber ich vermute, dass sie sich ausgebrannt fühlte und einmal etwas wirklich Bedeutendes schreiben wollte. Und über einen anderen Teil der Geschichte weißt du vermutlich schon Bescheid. Anscheinend hatte sie Probleme, jemand bedrohte und belästigte sie …«
»Wann?«
»Im vergangenen Winter, etwa zu der Zeit, als ich sie beim Lunch traf. Ich glaube, es war Ende Februar.«
»Weiter!«, sagte ich fasziniert.
»Sie hatte keine Ahnung, wer sie bedrohte. Ob das begann, bevor sie anfing, dieses neue Buch zu schreiben, kann ich dir nicht sagen.«
»Wie wollte sie es schaffen, ungestraft ihren Vertrag zu verletzen?«
»Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das wirklich vorhatte«, antwortete Mark, »aber Sparacino plante, Harper vor eine Alternative zu stellen. Entweder er spielte mit. In diesem Fall wäre das fertige Produkt ziemlich harmlos ausgefallen. Mit anderen Worten, Harper hätte eine gewisse Zensur ausüben dürfen. Wenn er aber auf stur geschaltet hätte, hätte Sparacino die Geschichte der Presse und dem Fernsehen zugespielt. Harper war in der Zwickmühle. Sicher, er hätte Beryl verklagen können, aber so viel Geld hatte sie auch wieder nicht, viel zu wenig jedenfalls im Vergleich zu dem, was er hätte verlangen müssen. Außerdem hätte ein Prozess nur jedermann auf Beryls Buch aufmerksam gemacht und ihm zu einem Riesenerfolg verholfen. Harper konnte eigentlich gar nicht gewinnen.«
»Hätte er denn nicht die Veröffentlichung mit einer einstweiligen Verfügung stoppen können?«, fragte ich.
»Das hätte nur noch mehr Werbung für ihr Buch bedeutet. Die Druckerpressen anzuhalten hätte ihm eine Millionenauflage beschert.«
»Und jetzt ist sie tot.« Ich schaute auf meine im Aschenbecher verglimmende Zigarette. »Ich nehme an, dass das Buch noch nicht fertig ist. Harper braucht sich also keine Sorgen mehr zu machen. Ist es das, worauf du hinauswillst, Mark? Dass Harper etwas mit ihrer Ermordung zu tun haben könnte?«
»Ich habe dir nur ein paar Hintergrundinformationen gegeben«, antwortete er.
Seine klaren Augen blickten direkt in meine. Ich erinnerte mich mit Unbehagen daran, wie unglaublich unnahbar sie wirken konnten.
»Was denkst du?«
Ich verriet ihm nicht, was ich wirklich dachte. Nämlich, dass ich mich fragte, warum er mir all das erzählte. Dass Beryl nicht seine Klientin gewesen war, hatte nichts zu bedeuten. Er kannte den Ehrenkodex der Rechtsanwälte genau, der unmissverständlich besagte, dass das Wissen eines Anwalts automatisch auch alle anderen Mitglieder der Kanzlei zum Schweigen verpflichtet. Er stand auf der Schwelle zu einer Unkorrektheit, und das passte ebenso wenig zu dem pflichtbewussten Mark James, den ich kannte, als wenn er mit einer gut sichtbaren Tätowierung bei mir hereinspaziert wäre.
»Ich glaube, du solltest besser mal mit Marino sprechen, der die Untersuchung leitet«, antwortete ich. »Sonst muss ich ihm erzählen, was du mir gerade gesagt hast. In beiden Fällen wird er in deiner Kanzlei herumschnüffeln und Fragen stellen.«
»Soll er doch. Das ist kein Problem für mich.«
Wir waren einen Moment lang still.
»Wie war sie?«, fragte ich und räusperte mich.
»Ich sagte dir schon, dass ich sie nur einmal getroffen habe. Sie war irgendwie bemerkenswert. Dynamisch, witzig, attraktiv und ganz in Weiß. Sie hatte ein phantastisches, schneeweißes Kostüm an. Auf der anderen Seite erschien sie mir ziemlich reserviert. Sie verbarg viele Geheimnisse, Tiefen, die niemand jemals hätte ausloten können. Und sie trank eine Menge, wenigstens an diesem Tag. Sie hatte bereits drei Cocktails zu sich genommen, was ich ziemlich viel fand, wo es doch erst Mittag war. Aber vielleicht stellte das eine Ausnahme dar. Sie war nervös, verstört und angespannt. Der Grund, aus dem sie zu Orndorff & Berger kam, war ja kein erfreulicher. Ich bin sicher, dass diese Geschichte mit Harper sie sehr mitgenommen hat.«
»Was hat sie getrunken?«
»Bitte?«
»Die drei Cocktails. Woraus bestanden sie?«, fragte ich.
Er runzelte die Stirn und starrte quer durch die Küche. »Mein Gott, das weiß ich doch nicht mehr, Kay. Was macht das für einen Unterschied?«
»Ich weiß nicht genau«, sagte ich und dachte an ihre Hausbar.
»Hat sie über die Drohungen gesprochen, die sie erhielt? Ich meine, tat sie es in deiner Gegenwart?«
»Ja. Und Sparacino hat sie ebenfalls erwähnt. Ich weiß nur, dass sie sehr eindeutige Telefonanrufe bekam. Es war immer dieselbe Stimme, niemand, den sie kannte, wenigstens behauptete sie das. Und es gab noch andere merkwürdige Vorfälle. An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, es ist zu lange her.«
»Hat sie diese Vorfälle festgehalten?«, fragte ich.
»Das weiß ich nicht.«
»Und sie hatte keine Ahnung, wer sie bedrohte und warum?«
»Diesen Eindruck vermittelte sie zumindest.« Er schob seinen Stuhl zurück. Es war fast Mitternacht.
Als ich ihn zur Tür brachte, fiel mir plötzlich etwas ein. »Sparacino«, sagte ich. »Wie heißt er mit Vornamen?«
»Robert«, antwortete er.
»Mit der Abkürzung ›M‹ könnte er nicht gemeint sein, oder?«
»Nein«, sagte er und schaute mich neugierig an.
Es folgte eine gespannte Pause.
»Fahr vorsichtig!«
»Gute Nacht, Kay«, erwiderte er zögernd.
Vielleicht war es nur Einbildung, aber einen Moment lang dachte ich, er würde mich küssen. Dann ging er entschlossen die Stufen hinunter, und ich war schon wieder im Haus, als ich ihn losfahren hörte.
Der folgende Morgen war fürchterlich hektisch. Fielding informierte uns in der Konferenz, dass wir fünf Autopsien durchzuführen hätten, unter anderem die eines »Treibers«, einer fast verwesten Wasserleiche aus dem Fluss, eine Aufgabe, die jeden von uns aufstöhnen ließ. Richmond hatte zwei eben Erschossene herübergeschickt, einen davon konnte ich noch erledigen, bevor ich losraste, um im John Marshall Court House bei der Gerichtsverhandlung eines anderen Schusswaffenmordes als Zeugin aufzutreten und anschließend mit einer meiner studentischen Hilfskräfte im Medical College zu Mittag zu essen. Während der ganzen Zeit versuchte ich angestrengt, Marks Besuch vollständig aus meinen Gedanken zu verbannen.
Aber je verzweifelter ich mich bemühte, nicht an ihn zu denken, desto mehr dachte ich an ihn. Er war vorsichtig. Er war stur. Es passte so gar nicht zu ihm, mit mir nach über zehn Jahren des Schweigens auf einmal wieder in Kontakt zu treten.
Am frühen Nachmittag gab ich schließlich auf und wählte Marinos Telefonnummer.
»Ich wollte eben bei Ihnen anrufen«, legte er los, bevor ich auch nur ein Wort herausgebracht hatte, »bin gerade am Losfahren. Können Sie mich in einer Stunde oder, sagen wir besser, in eineinhalb in Bentons Büro treffen?«
»Was soll das?« Ich hatte ihm noch nicht einmal gesagt, warum ich angerufen hatte.
»Ich bekomme endlich Beryls Akten in die Finger. Ich dachte, Sie würden gern dabei sein.«
Er legte auf, ohne sich zu verabschieden, wie er es immer tat.
Zur verabredeten Zeit fuhr ich die East Grace Street entlang und parkte an der ersten Parkuhr, die einen halbwegs vertretbaren Fußmarsch von meinem Ziel entfernt war. Das moderne zehnstöckige Bürogebäude ragte wie ein Leuchtturm aus einem tristen Meer von Ramschläden, die sich hochtrabend Antiquitätenhandlungen nannten, und kleinen, schmierigen Restaurants, deren Spezialitäten in Wirklichkeit keine waren. Merkwürdige Gestalten drückten sich auf den zerbröckelnden Gehsteigen herum.
Ich wies mich auf der Sicherheitswache in der Lobby aus und fuhr mit dem Aufzug in den fünften Stock. Am Ende des Gangs befand sich eine Holztür ohne Namensschild. Der Standort von Richmonds FBI-Einsatzbüro war eines der bestgehüteten Geheimnisse der Stadt. Es war so unauffällig wie ein Agent in Zivilkleidung. Ein junger Mann saß hinter einem Tisch, der die Hälfte der hinteren Wand einnahm, und blickte zu mir herüber, während er telefonierte. Er verdeckte mit einer Hand die Sprechmuschel und hob die Augenbrauen zu einem fragenden »Kann ich Ihnen helfen?«. Ich erklärte, warum ich hier war, und er bot mir einen Stuhl an.
Der Vorraum war klein und ausgesprochen maskulin eingerichtet. Die Polstermöbel waren aus kräftigem blauschwarzem Leder, und auf dem Kaffeetisch stapelten sich verschiedene Sportmagazine. An den holzgetäfelten Wänden hingen wie in einer Verbrechergalerie die Fotografien von früheren FBI-Chefs, daneben Dienstmedaillen und eine Messingplatte, auf der die Namen der im Dienst gestorbenen FBI-Agenten eingraviert waren. Ab und zu öffnete sich die Eingangstür, und große, durchtrainierte Männer, die dunkelfarbige Anzüge und Sonnenbrillen trugen, gingen vorbei, ohne auch nur in meine Richtung zu blicken.
Benton Wesley benahm sich manchmal genauso preußisch streng wie der Rest von ihnen, aber im Lauf der Jahre hatte er meinen Respekt gewonnen. Hinter dem eisenharten FBI-Gehabe verbarg sich ein freundlicher und interessanter Mensch. Er wirkte energisch und tatkräftig, selbst wenn er saß, und sah immer adrett aus in seinen schwarzen Anzughosen und seinem gestärkten weißen Hemd. Seine Krawatte war modisch schmal und perfekt gebunden, das schwarze Halfter aus Korbgeflecht an seinem Gürtel sah ohne die .38er, die er niemals im Büro trug, leer und verlassen aus. Ich hatte Wesley eine ganze Zeitlang nicht gesehen, aber er hatte sich nicht verändert. Er war sportlich und auf eine raue Art gutaussehend mit seinem vor der Zeit silbergrau gewordenen Haar, das mich bei jeder Begegnung mit ihm aufs Neue überraschte.
»Tut mir leid, dass ich Sie warten ließ, Kay«, begrüßte er mich lächelnd.
Sein Händedruck war vertrauenerweckend fest, ohne im Geringsten machoartig zu wirken. Manche Polizisten und Anwälte drücken einem die Hand zusammen wie eine hydraulische Presse und brechen einem fast die Finger dabei. »Marino ist hier«, fuhr Wesley fort. »Ich musste noch ein paar Sachen mit ihm durchgehen, bevor wir Sie hinzuziehen konnten.«
Er hielt die Tür auf, und ich folgte ihm in einen leeren Gang. Er führte mich in ein kleines Büro und ging weiter, um Kaffee zu holen.
»Gestern Nacht haben sie endlich den Computer wieder zum Laufen gekriegt«, sagte Marino. Er lehnte sich in seinem Stuhl bequem zurück und studierte interessiert einen nagelneu aussehenden .357er Revolver.
»Computer? Welchen Computer?« Hatte ich etwa meine Zigaretten vergessen? Nein. Sie waren wieder einmal ganz unten in meiner Handtasche.
»Im Hauptquartier. Er stürzt alle paar Minuten ab. Zumindest habe ich jetzt endlich Ausdrucke von den Anzeigen. Sehr interessant. Jedenfalls meiner Meinung nach.«
»Von Beryl?«, fragte ich.
»Erraten!« Er legte die Waffe auf Wesleys Schreibtisch. »Nettes Ding. Der Glückspilz hat sie letzten Monat in Tampa beim Kongress der Polizeichefs in der Tombola gewonnen. Ich gewinne nicht einmal zwei Dollar in der Lotterie.«
Meine Gedanken schweiften ab. Wesleys Schreibtisch war übersät mit Telefonnotizen, Berichten, Videobändern und dicken braunen Umschlägen voller Papiere und Fotos, die, wie ich annahm, zu Fällen gehörten, die ihm verschiedene Polizeidienststellen zur Durchsicht gegeben hatten. In einem Wandregal lagen hinter Glastüren ausgefallene Waffen. Ein Schwert, ein Schlagring, eine selbstgebastelte Pistole und ein afrikanischer Speer – Jagdtrophäen und Geschenke von dankbaren Schülern. Ein altmodisches Foto zeigte William Webster, wie er Wesley vor einem Hubschrauber der Marines die Hand schüttelte. Nirgendwo fand sich der kleinste Hinweis darauf, dass Wesley eine Frau und drei Kinder hatte. FBI-Agenten schirmen wie die meisten Polizisten ihr Privatleben eifersüchtig vor der Außenwelt ab, ganz besonders dann, wenn sie das Böse mit all seinen Schrecken kennengelernt haben. Wesley erarbeitete hauptsächlich Persönlichkeitsprofile von Tatverdächtigen. Er sah die Fotografien von unvorstellbar grausam abgeschlachteten Opfern und verhörte danach die Täter im Zuchthaus. Er hat Bestien vom Schlage eines Charles Manson und Ted Bundy Auge in Auge gegenübergesessen.
Wesley kam mit zwei Styroportassen voll Kaffee für Marino und mich zurück. Wesley vergaß nie, dass ich den Kaffee schwarz trinke und immer einen Aschenbecher in meiner Nähe brauche. Marino nahm einen dünnen Stapel von fotokopierten Polizeiberichten von seinem Schoß und blätterte darin herum.
»Zunächst einmal muss ich sagen, dass es nur drei sind. Drei Berichte, die wir archiviert haben. Der erste ist vom 11.?März, neun Uhr dreißig. Beryl Madison hatte in der Nacht zuvor den Notdienst angerufen und verlangt, dass ein Beamter zu ihr ins Haus käme, um eine Anzeige aufzunehmen. Dem Anruf wurde nur eine niedrige Dringlichkeitsstufe beigemessen, was nicht weiter verwunderlich ist, denn auf den Straßen war der Teufel los. Erst am Morgen konnte ein Beamter bei ihr vorbeischauen, Jim Reed, seit fünf Jahren in der Abteilung.« Er schaute hoch zu mir.
Ich schüttelte den Kopf. Reed kannte ich nicht.
Marino begann den Bericht zu überfliegen. »Reed nahm also die Anzeige auf. Beryl Madison war sehr erregt und gab zu Protokoll, sie habe am Sonntagabend um acht Uhr fünfzehn einen Telefonanruf erhalten, in dem jemand sie bedroht habe. Eine Stimme, die sie als männlich und möglicherweise einem Weißen gehörend identifizierte, hatte Folgendes gesagt: ›Ich glaube, du hast mich vermisst, Beryl. Aber ich passe ständig auf dich auf, auch wenn du mich nicht sehen kannst. Ich sehe dich. Du kannst zwar weglaufen, aber du kannst dich nicht verstecken.‹
Weiter steht in dem Protokoll: Der Anrufer erklärte, dass er Miss Madison beobachtet habe, wie sie vor einem Supermarkt am Morgen eine Zeitung gekauft habe. Er beschrieb genau, was sie angehabt hatte: ›Einen roten Jogging-Anzug und keinen BH.‹ Sie bestätigte, dass sie gegen zehn Uhr zu dem Supermarkt in der Rosemount Avenue gefahren sei und genau diese Sachen getragen habe. Sie hatte vor dem Supermarkt geparkt und die Washington Post aus einem Verkaufsautomaten genommen. Sie war nicht in den Laden gegangen und hatte auch in dieser Gegend niemanden bemerkt. Dass der Anrufer diese Einzelheiten wusste, versetzte sie in Schrecken, und sie vermutete, dass er sie verfolgt habe. Die Frage, ob sie jemals bemerkt habe, dass ihr jemand gefolgt sei, verneinte sie allerdings.«
Marino wandte sich der zweiten Seite zu, dem internen Teil des Berichts, und fasste zusammen: »Reed schreibt hier, dass Miss Madison offensichtlich nicht bereit gewesen sei, im Einzelnen zu erläutern, womit ihr der Anrufer gedroht habe. Wiederholt danach befragt, äußerte sie nur, dass der Anrufer ›obszön‹ geworden sei und gemeint habe, wenn er sich vorstelle, wie sie nackt aussähe, dann wolle er sie ›töten‹. An dieser Stelle, sagte Miss Madison, habe sie aufgelegt.«
Marino legte die Fotokopie auf den Rand von Wesleys Schreibtisch.
»Was hat Officer Reed ihr geraten?«, fragte ich.
»Das Übliche«, sagte Marino. »Er riet ihr, sich Aufzeichnungen zu machen. Wenn sie wieder einen Anruf erhielte, solle sie Datum, Uhrzeit und den Inhalt des Gesprächs aufschreiben. Er empfahl ihr auch, ihre Türen abzuschließen, die Fenster geschlossen zu halten und vielleicht eine Alarmanlage einbauen zu lassen. Und wenn ihr irgendwelche Autos verdächtig vorkämen, solle sie die Nummer notieren und die Polizei verständigen.«
Ich dachte daran, was Mark mir über sein Mittagessen mit Beryl im vergangenen Februar erzählt hatte. »Hat sie gesagt, dass diese Drohung, die sie am 11. März zu Protokoll gegeben hat, die erste gewesen sei, die sie erhalten habe?«
Jetzt antwortete Wesley, während er sich den Bericht angelte: »Anscheinend nicht.« Er blätterte um. »Wie Reed hier schreibt, hat sie erklärt, sie habe seit Anfang des Jahres belästigende Anrufe bekommen, die Polizei aber erst jetzt davon in Kenntnis gesetzt. Es scheint so, dass die früheren Anrufe weniger häufig und auch nicht so eindeutig gewesen waren wie der, den sie an diesem Sonntagabend, dem 10. März, erhielt.«
»War sie sicher, dass die früheren Anrufe von demselben Mann stammten?«, fragte ich Marino.
»Sie sagte Reed, dass die Stimme gleich geklungen habe«, antwortete er. »Es war die eines Weißen, leise und artikuliert. Die Stimme gehörte niemandem aus ihrem Bekanntenkreis, wenigstens behauptete sie das.«
Marino nahm den zweiten Bericht in die Hand und fuhr fort: »Beryl rief Officer Reed am Dienstagabend um sieben Uhr achtzehn über seinen Pager an. Sie sagte, sie müsse ihn sehen, und er kam weniger als eine Stunde später zu ihr ins Haus, kurz nach acht also. Wieder war sie, diesem Bericht zufolge, völlig durcheinander. Sie sagte, sie habe einen weiteren Drohanruf erhalten und sofort danach die Nummer von Reeds Pager angerufen. Es war derselbe Mann, dieselbe Stimme wie das letzte Mal. Und der Inhalt war auch ähnlich wie bei dem Anruf am 10. März.«
Marino zitierte wörtlich aus dem Bericht: »›Ich weiß, dass du mich vermisst hast, Beryl. Ich werde bald zu dir kommen. Ich weiß, wo du wohnst, ich weiß alles über dich. Du kannst weglaufen, aber du kannst dich nicht vor mir verstecken.‹ Dann sagte er noch, er wisse genau, dass sie ein neues Auto fahre, einen schwarzen Honda, und dass er letzte Nacht, als sie es in der Auffahrt abgestellt habe, die Antenne abgebrochen habe. In der Anzeige ist festgehalten, dass ihr Auto wirklich in dieser Nacht in der Auffahrt geparkt war, und als sie an diesem Dienstagmorgen das Haus verließ, hatte sie die abgebrochene Antenne bemerkt. Sie befand sich noch am Wagen, war aber so stark nach hinten abgeknickt, dass sie unbrauchbar war. Der Officer ging nach draußen, sah sich den Wagen an und fand die Antenne in genau dem in der Anzeige beschriebenen Zustand.«
»Was hat Officer Reed unternommen?«, fragte ich.
Marino schlug die zweite Seite auf und sagte: »Er riet ihr, von nun an den Wagen in die Garage zu stellen. Sie entgegnete, dass sie die Garage nie benutze, weil sie vorhabe, sie in ein Büro umzuwandeln. Dann schlug er vor, sie solle die Nachbarn bitten, auf fremde Fahrzeuge in der Nähe ihres Hauses oder auf Personen, die ihr Grundstück betraten, zu achten. Er schreibt in diesem Bericht auch, dass sie ihn gefragt habe, ob sie sich eine Handfeuerwaffe zulegen solle.«
»Ist das alles?«, fragte ich. »Was ist mit den Aufzeichnungen, die zu führen Reed ihr geraten hatte? Steht über die irgendetwas in dem Bericht?«
»Nein. Reed notierte im internen Teil des Berichts: ›Die Reaktion der Klägerin auf die abgebrochene Antenne erschien übertrieben. Sie erregte sich außerordentlich und beschimpfte den aufnehmenden Beamten.‹« Marino schaute auf. »Das heißt im Klartext, Reed hat ihr nicht geglaubt. Vielleicht, dass sie die Antenne selbst abgebrochen und sich die Geschichte mit den Drohanrufen aus den Fingern gesogen hätte.«
»O Gott«, murmelte ich angeekelt.
»Hey. Wissen Sie eigentlich, wie viele Knallköpfe regelmäßig mit so einer Scheiße daherkommen? Dauernd rufen irgendwelche Frauen an, die Schnitte oder Kratzer haben, und behaupten, sie seien vergewaltigt worden. Manche von ihnen haben sich die Geschichte einfach ausgedacht. Die haben eine Schraube locker und wollen, dass man sich um sie kümmert …«
Ich wusste alles über eingebildete Krankheiten und Verletzungen, über phantastische Lügengeschichten, Milieustörungen und Psychosen, die Menschen dazu bringen, dem eigenen Körper schreckliche Krankheiten und Verletzungen zu wünschen und sogar zuzufügen. Ich brauchte keine Belehrungen von Marino.
»Weiter«, drängte ich, »was geschah dann?«
Er legte den zweiten Bericht auf Wesleys Tisch und nahm den dritten zur Hand: »Beryl rief Reed wieder an, diesmal am 1. Juni, einem Samstag, um Viertel nach elf am Vormittag. Er kam um vier Uhr nachmittags desselben Tages zu ihr und traf die Klägerin in einer verstörten und feindseligen Stimmung an …«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte ich trocken, »sie hat fünf verdammte Stunden auf ihn gewartet.«
»Miss Madison«, Marino ignorierte mich und las Wort für Wort vor, »erklärte, sie habe um elf Uhr vormittags von demselben Mann einen Anruf erhalten mit folgendem Wortlaut: ›Vermisst du mich immer noch? Bald, Beryl, bald. Ich war in der vergangenen Nacht bei dir. Du warst nicht zu Hause. Bleichst du deine Haare? Ich hoffe nicht.‹ An dieser Stelle, sagte Miss Madison, die blond ist, habe sie versucht, mit ihm zu reden. Sie flehte ihn an, sie in Ruhe zu lassen, fragte ihn, wer er sei und warum er ihr das antue. Sie sagte, er habe nicht geantwortet und aufgelegt. Sie bestätigte, dass sie in der vergangenen Nacht, in der der Anrufer bei ihrem Haus gewesen sein wollte, ausgegangen war. Auf die Frage des Officer, wo sie gewesen sei, wich sie aus und erklärte lediglich, sie sei nicht in der Stadt gewesen.«
»Und was tat Officer Reed dieses Mal, um einer Frau in Not zu helfen?«, fragte ich.
Marino lächelte mild. »Er riet ihr, sich einen Hund anzuschaffen, und sie meinte, dass sie eine Hundeallergie habe.«
Wesley öffnete einen Aktendeckel. »Kay, Sie sehen das im Rückblick, im Licht eines schrecklichen Verbrechens, das bereits begangen wurde. Aber Reed musste die Sache vom anderen Ende her beurteilen. Betrachten Sie das Ganze einmal von seiner Warte. Da ist diese junge Frau, die allein lebt. Sie wird hysterisch. Reed tut alles für sie, was er nur kann – gibt ihr sogar die Nummer seines Pagers. Er meldet sich prompt, zumindest beim ersten Mal. Aber sie weicht seinen gezielten Fragen aus. Außerdem hat sie keine Beweise. Jeder Officer wäre da skeptisch geworden.«
»Ich an seiner Stelle«, pflichtete Marino bei, »hätte mir auch gedacht, dass die Frau einfach einsam war. Dass sie beachtet werden und das Gefühl haben wollte, dass sich jemand um sie kümmert. Oder dass irgendein Kerl sie sitzengelassen hat und das ganze Theater der Auftakt zu einem Rachefeldzug gegen ihn war.«
»Richtig!«, entfuhr es mir, bevor ich mich zurückhalten konnte. »Und wenn ihr Ehemann oder ihr Freund gedroht hätte, sie zu töten, hätten Sie auch nichts anderes gedacht. Und Beryl wäre ganz genauso gestorben.«
»Vielleicht«, sagte Marino gereizt. »Aber wenn es ihr Ehemann gewesen wäre – vorausgesetzt, sie hätte einen gehabt –, dann hätte ich wenigstens einen gottverdammten Verdächtigen, und der Richter könnte einen gottverdammten Haftbefehl für den Penner erlassen.«
»Haftbefehle sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind«, gab ich zurück. Mein Ärger brachte mich an die Grenzen meiner Selbstkontrolle. Es verging nicht ein Jahr, in dem ich nicht ein halbes Dutzend Frauen obduzieren musste, die von Ehemännern oder Freunden, gegen die ein Richter einen Haftbefehl erlassen hatte, auf brutalste Weise getötet worden waren.
Nach einer langen Pause fragte ich Wesley: »Hat Reed eigentlich nie vorgeschlagen, ihr Telefon zu überwachen?«
»Das hätte nichts genützt«, antwortete er, »Telefone anzuzapfen oder Fangschaltungen zu legen ist nicht einfach. Die Telefongesellschaft verlangt eine lange Liste von Anrufen und stichfeste Beweise, dass die Belästigung wirklich stattgefunden hat.«
»Hatte sie denn keine stichhaltigen Beweise?«
Wesley schüttelte langsam den Kopf. »Dazu wären mehr Anrufe nötig gewesen, als sie erhalten hat, Kay. Eine ganze Menge mehr. Und sie hätten mit einer gewissen Regelmäßigkeit erfolgen müssen, eindeutig belegt. Ohne all das können Sie eine Fangschaltung vergessen.«
»Wie es scheint«, fügte Marino an, »hat Beryl nur einen oder zwei dieser Anrufe im Monat bekommen. Und sie hat die verflixten Aufzeichnungen, die Reed ihr ans Herz gelegt hatte, nicht geführt. Wenigstens haben wir sie bisher noch nicht gefunden. Anscheinend hat sie auch keinen der Anrufe auf Tonband aufgenommen.«
»Großer Gott«, sagte ich, »da bedroht dich jemand mit dem Tod, und du brauchst einen verdammten Kongressbeschluss, damit das irgendjemand ernst nimmt.«
Wesley antwortete nicht.
Marino schnaubte verächtlich. »Das ist doch dasselbe wie bei Ihnen, Doc. Da gibt es ja auch keine vorbeugende Medizin. Wir sind auch nichts anderes als eine verdammte Putzkolonne, die nach einem Verbrechen aufräumen muss. Solange nicht knallharte Beweise vorliegen, wie zum Beispiel eine Leiche, sind uns die Hände gebunden.«
»Beryls Benehmen hätte eigentlich Beweis genug sein müssen«, antwortete ich. »Schauen Sie sich doch nur diese Berichte an. Sie hat alles getan, was Officer Reed ihr vorgeschlagen hat. Er sagte, sie solle sich eine Alarmanlage einbauen lassen, und sie hat es getan. Er sagte, sie solle den Wagen in der Garage parken, und sie hat es ebenfalls getan, obwohl sie die Garage in ein Büro umwandeln wollte. Sie hat sich von ihm wegen einer Handfeuerwaffe beraten lassen, ist losgegangen und hat sich eine gekauft. Und jedes Mal telefonierte sie mit Reed, sofort nachdem der Mörder sie angerufen hatte. Sie hat also nicht Stunden oder Tage gewartet und dann erst die Polizei verständigt.«
Wesley breitete Papiere auf seinem Schreibtisch aus. Fotokopien von Beryls Briefen aus Key West, den Bericht und die Skizzen vom Tatort und eine Serie von Polaroidbildern, die den Hof und die Innenräume ihres Hauses und schließlich ihre Leiche in dem Zimmer im ersten Stock zeigten. Er studierte alles schweigend und mit hartem Gesichtsausdruck. Es war das Signal, fortzufahren. Wir hatten uns lange genug gegenseitig Vorwürfe gemacht. Was die Polizei getan oder unterlassen hatte, war nicht mehr wichtig. Jetzt galt es, den Mörder zu finden.
»Was mir Kopfzerbrechen bereitet«, begann Wesley, »sind einige Widersprüche im Obduktionsbefund. Die Drohanrufe, die sie bekam, deuten darauf hin, dass der Täter vermutlich ein Psychopath ist. Jemand, der Beryl monatelang nachgeschlichen ist und sie bedroht hat, jemand, der sie nur aus der Ferne gekannt zu haben scheint. Ganz ohne Zweifel zog er die meiste Befriedigung aus seinen Phantasien, aus der Phase vor dem eigentlichen Verbrechen. Vielleicht hat er nur deshalb endgültig zugeschlagen, weil sie ihn durch ihre Flucht aus der Stadt frustriert hatte. Vielleicht fürchtete er, dass sie für immer wegziehen könnte, und hat sie deshalb ermordet, sobald sie zurück war.«
»Er hat sich von ihr total verarscht gefühlt«, warf Marino ein.
Wesley blickte auf die Fotos und fuhr fort: »Hier wiederum sehe ich eine sehr starke Wut, und genau da beginnen die Ungereimtheiten. Diese Wut richtete sich anscheinend direkt gegen sie. Ganz besonders fällt das bei den Verstümmelungen in ihrem Gesicht auf.« Er klopfte mit dem Zeigefinger auf eines der Fotos. »Das Gesicht steht für die Person. Beim typischen sadistischen Sexualmord bleibt das Gesicht des Opfers fast immer unversehrt. Das Opfer ist bei diesen Morden ein Symbol, keine individuelle Person. Es hat für den Täter kein Gesicht, weil es für ihn ein Niemand ist. Wenn er etwas verstümmelt, dann die Brüste oder die Genitalien …« Er zögerte, einen irritierten Zug um die Augen. »Bei Beryls Ermordung spielen persönliche Motive eine Rolle. Das zerfetzte Gesicht und die vielen Stichwunden, von denen schon eine tödlich gewesen wäre, deuten darauf hin, dass ihr Mörder sie gekannt hat, vielleicht sogar gut. Es muss jemand gewesen sein, den eine persönliche, starke Besessenheit mit ihr verband. Aber zu diesem Täterbild passt nicht, dass er sie aus der Ferne belauert haben und ihr heimlich gefolgt sein soll. Darin zeigt sich mehr das Verhalten eines Mörders, der eine Fremde tötet.«
Marino spielte wieder mit Wesleys .357er-Tombolagewinn herum. Er ließ die Trommel rotieren und sagte: »Wollen Sie meine Meinung dazu hören? Ich glaube, die Ratte bildet sich ein, Gott zu sein. Solange man sich an seine Spielregeln hält, haut er einem keins über die Rübe. Beryl hat die Regeln verletzt, indem sie die Stadt verlassen und vor ihrem Haus ein ›Zu verkaufen‹-Schild aufgestellt hat. Damit war der Spaß für ihn vorbei. Sie hat gegen die Regeln verstoßen, also musste sie bestraft werden.«
»Was für ein Bild machen Sie sich von ihm?«, fragte ich.
»Weißer, Mittzwanziger bis Mittdreißiger. Intelligent, aus einer kaputten Familie, in der es keine Vaterfigur für ihn gab. Vielleicht wurde er auch als Kind missbraucht, körperlich oder seelisch oder beides. Er ist ein Einzelgänger. Das bedeutet jedoch nicht, dass er auch allein lebt. Er könnte verheiratet sein, denn er kann sich geschickt hinter einer bürgerlichen Fassade verbergen. Er führt ein Doppelleben. Eines, das für die Augen der Welt bestimmt ist, und ein zweites mit einer dunkleren Seite. Er ist obsessiv-kompulsiv und ein Voyeur«, antwortete Wesley.
»Stimmt!«, murmelte Marino sarkastisch. »Das trifft für die Hälfte aller Penner zu, mit denen ich zu tun habe.«
Wesley zuckte mit den Achseln. »Vielleicht sind das auch Schüsse in den Ofen, Pete. Ich bin mir über die Geschichte noch nicht völlig im Klaren. Er könnte auch ein ewiger Verlierer sein, der noch zu Hause bei seiner Mutter lebt. Vielleicht ist er auch vorbestraft, war im Irrenhaus oder im Gefängnis. Zum Teufel, möglicherweise arbeitet er auch in einer großen Firma in der Innenstadt und hat keine kriminelle oder psychiatrische Vorgeschichte. Es sieht so aus, als habe er Beryl hauptsächlich abends angerufen. Nur einmal hat er, soweit wir wissen, untertags angerufen, und das war an einem Samstag. Sie arbeitete zu Hause und verbrachte die meiste Zeit dort. Er rief sie an, wenn es für ihn am einfachsten war, und nicht dann, wenn die Wahrscheinlichkeit, sie zu erreichen, am größten schien. Ich bin fast geneigt anzunehmen, dass er in einem ganz normalen Job von neun bis um fünf arbeitet und am Wochenende frei hat.«
»Es sei denn, er hat sie von seiner Arbeit aus angerufen«, sagte Marino.
»Die Möglichkeit besteht natürlich immer«, gab Wesley zu.
»Wie ist das mit seinem Alter?«, fragte ich. »Meinen Sie nicht, dass er möglicherweise älter sein könnte, als Sie ihn schätzen?«
»Es wäre ungewöhnlich«, sagte Wesley, »aber möglich ist alles.«
Ich trank meinen Kaffee, der mittlerweile kalt geworden war, und berichtete ihnen schließlich, was mir Mark über Beryls Vertragsquerelen und ihre rätselhafte Beziehung zu Cary Harper erzählt hatte. Als ich geendet hatte, schauten mich Wesley und Marino neugierig an. Erstens klang dieser überraschende nächtliche Besuch eines Chicagoer Anwalts ein wenig merkwürdig. Und zweitens hatte ich ihre Überlegungen aus der Bahn geworfen. Der Gedanke, dass Beryls Ermordung tatsächlich ein Motiv zugrunde liegen könnte, war den beiden wahrscheinlich bisher nicht gekommen, genauso wenig wie er mir vor dem Gespräch gestern Nacht gekommen wäre. Bei den meisten Sexualverbrechen fehlt ein eindeutiges Motiv im klassischen Sinn. Die Täter begehen das Verbrechen, weil sie es genießen und die Gelegenheit gerade günstig ist.
»Ein Kumpel von mir ist Polizist in Williamsburg«, sagte Marino. »Er hat mir einmal erzählt, dass Harper eine echte Ratte ist, ein Eigenbrötler. Fährt herum in einem alten Rolls-Royce und spricht mit niemandem. Lebt in dem großen Herrenhaus am Fluss, in das er keinen hineinlässt. Und der Kerl ist alt, Doc.«
»So alt nun auch wieder nicht«, widersprach ich, »vielleicht Mitte fünfzig. Aber es stimmt, er lebt zurückgezogen. Ich glaube, zusammen mit seiner Schwester.«
»Es scheint ein bisschen weit hergeholt«, sagte Wesley, »aber schauen Sie doch einmal, wie weit Sie der Sache nachgehen können, Pete. Vielleicht hat Harper wenigstens eine Idee, wer dieser ›M‹ sein könnte, dem Beryl geschrieben hat. Offensichtlich ist es jemand, den sie gut gekannt hat, ein Freund oder ein Liebhaber. Irgendjemand da draußen muss doch wissen, wer er ist. Wenn wir das herausfinden, sind wir schon ein Stück weiter.«
Marino gefiel das nicht. »Ich weiß, wovon ich rede«, beharrte er. »Dieser Harper wird nicht freiwillig mit mir sprechen, und ich habe nicht genügend in der Hand, um ihn dazu zu zwingen. Ich glaube auch nicht, dass er Beryl umgebracht hat, auch wenn er vielleicht ein Motiv dafür hätte. Ich meine, er hätte sie einfach abgemurkst und damit basta. Wozu die Geschichte sechs, sieben Monate in die Länge ziehen? Außerdem hätte sie seine Stimme erkannt, wenn er der Anrufer gewesen wäre.«
»Harper hätte jemanden damit beauftragen können«, sagte Wesley.
»Gut. Und wir hätten sie dann eine Woche später mit einer schönen, sauberen Schusswunde im Hinterkopf gefunden«, antwortete Marino. »Professionelle Killer schleichen nicht wochenlang um ihre Opfer herum, bedrohen sie nicht, benutzen kein Messer zum Töten. Außerdem vergewaltigen sie ihre Opfer normalerweise nicht.«
»Die meisten von ihnen tun das nicht«, bestätigte Wesley, »aber wir sind nicht sicher, ob überhaupt eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Wir haben keine Samenflüssigkeit gefunden.«
Er schaute zu mir herüber, und ich nickte zustimmend. »Vielleicht war der Kerl funktionsgestört. Andererseits legte er ihren Körper vielleicht so hin, dass wir ein Sexualdelikt vermuten mussten. Wenn wirklich jemand für dieses Verbrechen angeheuert wurde, kommt es darauf an, um wen es sich dabei handelte und welchen Plan er ausführen sollte. Wenn Beryl zum Beispiel zu einer Zeit erschossen aufgefunden worden wäre, in der sie sich mitten in einem Streit mit Harper befand, hätte ihn die Polizei ganz oben auf ihre Verdachtsliste gesetzt. Wenn aber ihr Tod wie das Werk eines sexuellen Sadisten aussieht, denkt niemand an Harper.«
Marino starrte unbewegt auf das Regal im Hintergrund. Sein fleischiges Gesicht war gerötet. Langsam und beunruhigend blickte er zu mir herüber und fragte: »Was wissen Sie sonst noch über das Buch, an dem sie schrieb?«
»Nur das, was ich schon erzählt habe. Es war autobiographisch, und wahrscheinlich bedrohte es Harpers guten Ruf«, antwortete ich.
»Hat sie daran dort unten in Key West gearbeitet?«
»Das nehme ich an. Ich bin mir allerdings nicht sicher«, gestand ich.
Er zögerte. »Nun, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wir haben nichts dergleichen in ihrem Haus gefunden.«
Sogar Wesley war erstaunt. »Und das Manuskript in ihrem Schlafzimmer?«
»Ach das.« Marino griff nach seinen Zigaretten. »Ich habe kurz hineingeschaut. Es ist so eine Bürgerkriegsromanze mit viel Herz und Schmerz. Ganz bestimmt nicht das, wovon Doc Scarpetta gesprochen hat.«
»Hat es einen Titel, oder steht ein Datum drauf?«, fragte ich.
»Nein. Es scheint nicht einmal vollständig zu sein. Es war nicht dicker als so …« Marino zeigte zwischen Daumen und Zeigefinger einen Spalt von etwa zweieinhalb Zentimetern. »An den Rändern seiner Seiten waren jede Menge handschriftliche Änderungen notiert, und etwa zehn Seiten waren ganz mit der Hand geschrieben.«
»Wir sollten alle ihre Papiere und ihre Computerdisketten noch einmal gründlich durchgehen, ob sich nicht doch irgendwo dieses autobiographische Manuskript findet«, forderte Wesley.
»Außerdem müssen wir herausfinden, ob sie einen Literaturagenten hatte und wer ihr Verleger war. Vielleicht hat sie jemandem das Manuskript geschickt, bevor sie Key West verließ. Wir sollten abklären, ob sie das Ding mit zurück nach Richmond genommen hat. Wenn sie es mit hierhergebracht hat und es jetzt verschwunden ist, haben wir einen wichtigen Hinweis, um nicht mehr zu sagen.«
Wesley blickte auf seine Uhr. Er schob seinen Stuhl zurück und meinte dann entschuldigend: »In fünf Minuten habe ich eine andere Verabredung.« Er führte uns hinaus in die Lobby.
Ich konnte Marino einfach nicht loswerden. Er bestand darauf, mit mir zu meinem Auto zu gehen.
»Man muss immer die Augen offen halten.« Er war schon wieder mitten in einer seiner »Überleben in der Großstadt«-Predigten, wie er sie mir in der Vergangenheit schon hundertmal gehalten hatte. »Viele Frauen vergessen das immer wieder. Ich sehe sie ständig herumlaufen, ohne die leiseste Ahnung, dass sie gerade jemand anstarrt oder ihnen vielleicht schon folgt. Und wenn Sie bei Ihrem Auto sind, dann halten Sie Ihren verdammten Schlüssel bereit und schauen unter den Wagen, okay? Erstaunlich, wie wenig Frauen auch daran nicht denken. Wenn Sie dann fahren und bemerken, dass Ihnen jemand folgt, was tun Sie dann?«
Ich ignorierte ihn.
»Fahren Sie zur nächsten Feuerwehrwache, okay? Warum das? Weil dort immer jemand ist. Sogar an Weihnachten morgens um zwei. Also, immer zur Feuerwehr.«
Ich wartete auf eine Lücke im Verkehr und suchte unterdessen nach meinem Autoschlüssel. Als ich über die Straße blickte, sah ich ein verdächtiges weißes Rechteck unter dem Scheibenwischer meines Dienstwagens. Hatte ich schon wieder nicht genügend Geld in die Parkuhr geworfen? Verdammt.
»Üble Typen sind überall«, dozierte Marino weiter. »Wenn Sie auf dem Nachhauseweg sind oder gerade einkaufen gehen, müssen Sie sich angewöhnen, auf sie zu achten.«
Ich warf ihm einen bösen Blick zu und lief über die Straße.
»Hey«, sagte er, als wir bei meinem Auto waren, »seien Sie doch nicht sauer auf mich. Sie sollten froh sein, dass ich über Ihnen schwebe wie ein Schutzengel.«
Die Parkuhr war vor genau einer Viertelstunde abgelaufen. Ich riss den Strafzettel von meiner Windschutzscheibe, faltete ihn zusammen und stopfte ihn Marino in seine Hemdtasche.
»Wenn Sie zurück zur Polizeizentrale schweben«, erwiderte ich, »dann kümmern Sie sich doch bitte um das hier.«
Er grollte vor sich hin, und ich fuhr los.