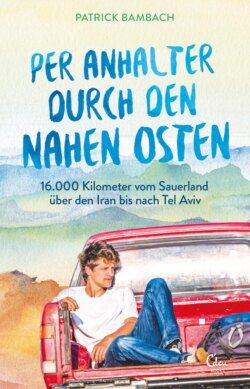Читать книгу Per Anhalter durch den Nahen Osten - Patrick Bambach - Страница 6
Osteuropa: Auf zu den Nachbarn! Erfahrung und Überregulierung
ОглавлениеEs ist ein wenig trüb, leichter Nebel, unangenehme, feuchte Kälte. Also schönstes Frühlingswetter fürs Sauerland. Mein Vater biegt von der Autobahn ab und setzt mich neben einem Haufen Schutt an der Raststätte aus: ein Zeichen von Zuneigung – in meiner Familie werden die Kinder noch persönlich ausgesetzt. Der Abschied verläuft reibungslos, was keinesfalls selbstverständlich ist.
Bei einem der unzähligen vorangegangenen Aussetzversuche hatte ich bis zum Rasthof hinter dem Steuer gesessen, mit meinen Eltern als Beifahrer. Ich hatte mich verabschiedet, direkt eine Mitfahrgelegenheit gefunden und war davongedüst. Kurz darauf klingelte mein Handy. Am anderen Ende der Leitung war der Genpool, aus dem ich gemixt wurde. Er fragte mich empört, ob ich intellektueller Geisterfahrer den Autoschlüssel eingesteckt hätte.
Hatte ich. Das Glück ist mit den Dummen, die Physik allerdings nicht. So fand ich zwar sofort eine Abfahrt, um mich rausschmeißen zu lassen. Das änderte allerdings wenig an der Tatsache, dass ich eine halbe Stunde lang zu Fuß bewundern konnte, wie weit ein Pkw in ein paar Minuten auf der Autobahn fahren kann. Erfahrung kann auch als Zustand beschrieben werden, nicht nur alle möglichen Fehler zu kennen, sondern auch schon gemacht zu haben. Seit diesem Tag darf ich nicht mehr hinters Steuer. Das ist die Kehrseite von Erfahrung: Gleich darauf folgt häufig Überregulierung.
Mit EU-Mitteln nach Prag
Die Reise beginnt. Mit Warten. In Vertretermanier und mit vergleichbarer Würdigung durch die Angesprochenen beginne ich mein Handwerk. Ich spreche Leute beim Tanken an, ernte eine halbe Stunde Kopfschütteln und Schweigen. Schließlich werde ich fündig und bekomme 150 Kilometer und ein Sandwich geschenkt. An der nächsten Tankstelle folgt direkt ein Anschlusstreffer, und einen Rasthof später zeigt das Navi des dritten Autos bereits auf Prag. Auto und Sprit sind steuerzahlerfinanziert, denn es wird von zwei tschechischen Angestellten im EU-Parlament gefahren.
Im leidenden Tonfall erzählen sie die Fahrt über von den Vorurteilen gegen die EU, mit denen sie zu Hause zu kämpfen haben. Allgegenwärtig sei das Gejammer, dass die Tschechen nur einzahlen würden und nichts von der EU zurückbekämen. Eine vertraute Diskussion, komplexes Thema. Schwer verrechenbare Handelsvorteile und Subventionen und dann noch das Problem, das allgemein aus WGs bekannt ist. Irgendwie glaubt immer jeder, er sei der Einzige, der regelmäßig die Spülmaschine ausräumt.
Tramper sind entweder Opportunisten oder Menschen, die nass am Straßenrand stehen. Mit dem Diskutieren lasse ich es immer langsam angehen. Als Tramper sehe ich mich doch eher im Angestelltenverhältnis, und davon abgesehen will ich die Welt kennenlernen und nicht mein Gesülze wiederkäuen. So belasse ich es, wenn überhaupt, bei Gegenargumenten, die in höfliche, naive Fragen verpackt sind. Das muss als Beitrag für eine bessere Welt ausreichen. Wenn ich dann mal groß bin und selbst ein Auto habe, kann ich noch früh genug Tramper mit meinen Lebensweisheiten in die Verzweiflung treiben.
»Ja, das kenne ich aus Deutschland«, sage ich. »Bei uns denken auch immer alle, wir würden nur zahlen.«
Gelächter. Immer noch leicht amüsiert, aber anerkennend antwortet mir die Frau: »Das stimmt ja auch, ihr zahlt nur. Ich benutze es in Tschechien deshalb auch immer als Argument. Schaut her, die Deutschen zahlen wirklich nur und meckern trotzdem nicht.«
Ich finde es ja prinzipiell schön, wenn leicht verkürzte Argumente aus Deutschland helfen, um im Ausland Sympathien für die EU zu sammeln. Aber uns Deutsche des Nichtmeckerns zu bezichtigen, empfinde ich dann doch als ein wenig pietätlos. Gerade als ich verbal zu einer rhetorischen Kampffrage ausholen will, um für meinen Nationalstolz einzutreten, verkünden meine Fahrer jedoch schon, dass wir Prag erreicht haben. Die beiden lassen mich an einer Bushaltestelle raus, verabschieden sich und schenken mir noch ein Ticket, um in die Stadt zu kommen. Vornehmlich, weil ich noch kein tschechisches Geld habe, vermutlich jedoch mit der Intention, den defizitären Länderfinanzausgleich in Ordnung zu bringen.
Der erste Trampabschnitt ist erfolgreich gemeistert. Zumindest fast. Wie gewohnt drohe ich auf den letzten Metern zu scheitern. Ich will bei einem Bekannten übernachten, den ich ebenfalls in Tokio kennengelernt habe. Mit dem Bus bin ich zurechtgekommen, das Stadtviertel und seine Straße habe ich ganz analog, ohne Smartphone, gefunden, nur sein Haus bleibt unaufspürbar und sein Handy nicht anwählbar.
Als Trostpreis finde ich aber immerhin eine Bar. Alkohol ist ja seit Anbeginn der Zeit ein bewährtes Mittel zur Problemlösung. Inmitten einer Gruppe tschechischer Studenten lösen sich meine Probleme dann auch ganz allmählich auf, bis mich mein Gastgeber findet, um mit mir weitere Probleme zu lösen. In Tschechien kann der gemeine Student und Alkoholiker sogar recht preiswert Probleme lösen, denn das Bier kostet selbst in Bars nur rund einen Euro.
Gedankenversunken falle ich ins erste fremde Bett und frage mich, wie die Tschechen bei den Bierpreisen überhaupt über irgendetwas klagen können. Eine Frage, die mir mein dröhnender Kopf am nächsten Morgen problemlos beantworten kann.
Lieber weniger besichtigen als viel zu schnell
Drei Tage nach unserem Skype-Gespräch landet Yuki in Prag. Von hier aus soll es gemächlich losgehen. Wir haben uns vorgenommen, in jeder Stadt mindestens drei Nächte zu verbringen, denn Hektik ist die größte aller Reisegeißeln. Ich will jedes Mal zu viel sehen, sprinte von Fleck zu Fleck und sehe am Ende nicht wesentlich mehr als meine Freunde zu Hause auf ihren Postkarten. Sich beim Reisen nicht zu viel vorzunehmen, lieber wenig richtig, als vieles gar nicht zu erkunden, fällt in die Kategorie von Lebensweisheiten wie »Wer früh genug für eine Prüfung lernt, erspart sich Stress«. Offensichtliches, aber wer hält sich daran?
Ich glaube nicht, dass es definierbar ist, ab wann man genau für eine Prüfung lernen muss. Oder ab wann man sich bei einer Reise zu viel vorgenommen hat. Vom Urlauber zum Kurzurlauber über den Langzeitreisenden bis hin zum Aussteiger endet die Diskussion irgendwann immer in der Behauptung, dass man in einer Stadt gewohnt haben muss, um sie richtig zu kennen. Das wäre dann aber kein Reisen mehr.
Die Zeitspanne von drei Nächten ist schließlich nur das schlichte Rechenergebnis aus Yukis Zeit geteilt durch die Anzahl der Städte, die wir besichtigen wollen. Die Anzahl der Städte hat sich ihrerseits aus der realistischerweise trampbaren Distanz ergeben. Mit ein wenig manipulativem Wohlwollen sind bei der Rechnung die drei Tage und alle Hauptstädte auf der Route herausgekommen. Oder mit anderen Worten: die Orte mit den meisten Sehenswürdigkeiten. Und Bratislava.
Der Startplatz: Zwischen Warten und einen Hinterhalt legen
Erwähnenswert an Bratislava ist vor allem, dass es schwer ist, aus der Stadt rauszukommen. Auf die Autobahn zu gelangen ist verworren bis abenteuerlich, was insofern praktisch ist, als Abenteuer ohnehin genau das sind, was Tramper suchen. Tramper liebten schon immer die Begegnung mit dem Unbekannten, stürzten sich ins Ungewisse, scheuten keine Unwägbarkeit.
Und dann kam das Internet. Das digitale Zeitalter hat auch das Trampen nicht ungeschoren davonkommen lassen. Mal davon abgesehen, dass ich nach jedem Tramp einen Facebook-Freund mehr habe, streckt heutzutage kein Tramper mehr seinen Daumen aus der Tür, bevor er nicht aus dem Netz weiß, wo er zum Starten hinmuss und wie er zu dem beschriebenen Platz gelangt. Dazu hat er heute mehr Aufklärungsmittel zur Verfügung als die Alliierten im Zweiten Weltkrieg.
Bei der Suche nach einem Startplatz in Bratislava finde ich jedoch nur eindeutig zweideutige Ergebnisse. Auf hitchwiki.org, der Wikipedia für Tramper, können sich die Autoren für Bratislava nicht so recht auf einen Ort einigen, und auch die Google-Earth-Analyse offenbart keine Schwachstelle, die eine Trampflucht aus der Stadt erlaubt. So bleibt uns nur eine vierzigminütige Tramfahrt zum falschen Ende der Stadt, um vom dortigen Rasthof über die Stadtautobahn zum eigentlich logischeren Rasthof zu trampen.
Kleine Enzyklopädie der Tramper-Mitnehmer
Trampen ist eine lehrreiche Erfahrung in Sachen Diskriminierung für Menschen, die sonst nichts haben, weswegen sie diskriminiert werden. Wenn Tramper nicht hübsch und nicht weiblich sind, drohen ihnen nicht selten misstrauische und verächtliche Blicke. Oder sie werden ganz ignoriert.
Menschen reagieren verängstigt, wenn ich sie anspreche, Kinder werden von mir weggezogen, manchmal folgen Beschimpfungen. Unangenehmer als die Beschimpfungen sind allerdings die Gedanken der ›freundlichen‹ Menschen. Sie sind ihnen förmlich von der Stirn abzulesen: »Ich weiß nicht … man hört ja so viel. Du könntest sonst wer Gefährliches sein. Da bleibe ich lieber alleine im Auto sitzen.«
Als Tramper überspiele ich meine Enttäuschung mit einem Gefühl der Überlegenheit, im Glauben, es besser zu wissen als die vielen Angstgesteuerten. Doch wenn ich selbst unerwartet und liebevoll mit einem »Ey, das da hinten is’ meine Karre. 250 PS. Willste mit?« angesprochen werde, fühle ich mich ertappt. Wenn es drauf ankommt, verhalte ich mich nicht anders und entscheide mich doch lieber einmal zu oft für die Oberflächlichkeit. Was vorher abschätzig als Vorurteile gehandelt wurde, wird dann wieder zum rationalen Selbstschutz, nicht weil alle Checker Anfang zwanzig mit selbst angeschraubten Heckspoilern und LED-Unterbodenbeleuchtung zu unsicher und riskant fahren. Sondern weil: »Hach, ich weiß halt nicht, besser nicht, man hört ja so viel …«
Auch Tramper unterteilen fleißig die gesamte Menschheit in mutwillige und weniger mutwillige Mitnehmer. Allerdings ist die Einteilung etwas subjektiv, denn der Eindruck hängt sehr von der Aura des Trampers ab. Ich gehöre zu der Gattung Mitte zwanzig, Babyface, mit der Statur eines Zuckerwatteverkäufers, gehüllt in eine brave Schwiegersohn-Kollektion.
Die beste Klientel ist die Gattung der Außendienstmitarbeiter im Firmen-Audi oder besorgter Mütter, die, bevor sie mich mitnehmen, immer versichern, dass sie so etwas eigentlich nicht machen. Ein 35-jähriger, 2,10 Meter großer trampender Gothic-Punk teilt meine Beurteilung vermutlich nicht ganz.
Es gibt aber noch andere Gattungen, deren Exemplare einem auf jedem Rasthof aufs Neue begegnen. So auch in Bratislava. Uns begegnet dort ein sympathischer Zeitgenosse, der zu ›einer wissenschaftlich ausführlich beschriebenen trampophilen‹ Gattung gehört.
Diese Gattung sticht durch ein Dieter Bohlen nachempfundenes Äußeres hervor und ist insgesamt eine angenehme Erscheinung. Es ist eine Oberklassewagen fahrende Art, von der Laien vermuten würden, dass sie Tramper maximal ein paar Meter mitnähme. Das aber auch nur, wenn sich der Anhalter bei voller Fahrt auf die Motorhaube wirft.
Das gleiche Automodell wird in der Regel noch von zwei anderen Arten gefahren. Zum einen gibt es da eine wohlhabende Spezies, die äußerlich in keinem Golfklub der Welt auffallen würde und früher meist selbst trampend unterwegs war und daher heute eifrige Mitnehmer sind. Gesetzt den Fall, jemand traut sich, sie zu fragen. Diese Gattung darf wiederum nicht mit einer äußerlich täuschend ähnlichen verwechselt werden. Sie hat einen anderen Stoffwechsel und ernährt sich von schlechter Laune und Empörung. Diese ›trampophobe‹ Gattung ist anatomisch nicht in der Lage, den Kopf bei Fragen nach links oder rechts zu drehen. Stattdessen muss ihr kognitives Zentrum erschütterungsfrei schräg nach oben ausgerichtet bleiben. Als weiteres Klassifizierungsmerkmal gilt ihr unverwechselbarer Gesichtsausdruck, der irgendwo zwischen Unantastbarkeit und Entrüstung angesiedelt ist. Die Mimik ist frei von jeglicher Regung. Es ist, als würde eine römische Marmorstatue mit Jacke vor einem stehen. Werden solche Exemplare angesprochen, kommt es in ihrem Gesichtsausdruck zu einer minimalen, aber charakteristischen Veränderung. Sie ist vergleichbar mit dem leicht verstimmten Gemüt, das Julius Caesar auf diversen Gemälden zeigt, als er im Senat mit 47 Messern zum Rücktritt motiviert wurde.
Neben dieser Gattung gibt es natürlich noch den freundlichen Durchschnittsbürger. Der ist allerdings auch nur durchschnittlich alle dreißig Minuten hilfreich. So passiert es nicht selten, dass man zwanzig locker-sympathisch aussehende Leute anspricht, die dann genauso locker und sympathisch antworten, dass sie in die andere Richtung oder nach Hogwarts führen, dass ihr Auto leider voll sei, weil eine Jacke und ein Schokoriegel auf der Rückbank lägen, oder dass sie einfach keine Zeit hätten – außer um in Ruhe zu rauchen, Kaffee zu trinken, Scheiben zu putzen. Dinge, die gemacht werden müssen, wenn man total spät dran ist.
So auch dieses Mal. Nachdem wir das Ausredenpflichtprogramm durchlaufen haben, macht unser Dieter, was die souveränen Dieters häufig machen. Zunächst folgt irritiert die Antwort, dass er natürlich in die Richtung fahre, wohin solle er von hier auch sonst fahren. Dann folgt die Verwunderung über die zweite Frage und die Antwort: »Natürlich, warum sollte ich euch denn nicht mitnehmen?«
Von vielen sympathischen Mitbürgern kenne ich Antworten auf seine Gegenfrage, allerdings gilt auch hier: Niemand mag Besserwisser. So geht es dann freundlich und zügig im gut klimatisierten BMW zum nächsten Rasthof.
Nettigkeit oder Dienstleistung?
Unsere nächsten Retter halten. Sie haben ein Auto mit polnischem Kennzeichen, weshalb ich zunächst eigentlich gar nicht fragen will. Nicht dass ich etwas gegen Polen habe, nur beim Trampen meide ich Autos von dort, da es in Polen normal ist, ein wenig Spritgeld zu verlangen, was für dreihundert Kilometer auch schon mal mehr sein kann.
Ich habe Prinzipien, aber während des Wartens habe ich meist genügend Zeit, sie loszuwerden. Also fragen wir die beiden, ernten ein »Ja!« und glückliche 15 Minuten. Die beiden erzählen, dass sie Ukrainer sind. Der eine Wahlhelfer Klitschkos, wobei er hauptsächlich die Botschaft verkündet, dass Klitschko nur zwei Dinge kann, nämlich ehrlich und unbestechlich sein. Das spreche für ihn, denn diese beiden Fähigkeiten brächten die anderen Politiker in der Ukraine nicht mit.
Kurz darauf legen wir stimmungstechnisch einen abrupten Wechsel ein, der nur mit einem Frontalcrash in die Leitplanke zu überbieten gewesen wäre.
»Würdet ihr 15 Euro zum Sprit dazugeben?«
»Mist«, schießt es mir durch den Kopf.
Beim Trampen bezahle ich allerdings nicht, schon gar nicht, wenn ich den halben Tag mit Warten verbracht habe und mir vom gleichen Geld ein Eis und ein Zugticket hätte kaufen können. Wenn ich vorher nach Geld gefragt werde, fahre ich einfach nicht mit. Im Nachhinein zu fragen finde ich noch schlimmer, da sich nach der Klärung mindestens eine Partei reingelegt fühlt, weil Erwartungen nicht erfüllt werden.
Im Anschluss ist die freundschaftliche Stimmung im Auto nur schwer wiederherstellbar. Für mich wird damit aus einer erstaunlich netten Geste, die einen an das Gute in der Welt glauben lässt, ein rein geschäftlicher Vorgang, der einem genau das Gegenteil zeigen will. Das Gefühl ist in etwa so erbaulich wie die Frage nach einem Unkostenbeitrag nach einem One-Night-Stand. Nach einer solchen Situation käme auch niemand auf die Idee zu sagen: »Hab dich nicht so, 15 Euro für Sex ist jetzt echt nicht so viel.« Ist es auch nicht, aber umsonst ist es nun mal etwas anderes. Das Abenteuer und das Gefühl, vom anderen geschätzt zu werden, verkommen zur Dienstleistung.
Natürlich sind auch mit Dienstleistern nette Gespräche möglich. Dass dies, von Ausnahmefällen abgesehen, eher selten vorkommt, ist oft bei der Mitfahrgelegenheit erlebbar. Nach fünf Minuten schlafe ich dort in der Regel entweder ein oder bin in mein Buch versunken, gesetzt den Fall, eines von beiden ist möglich. Manchmal bleibt mir eingequetscht zwischen vier Personen und 19 Ellenbogen außer einer Runde Twister nicht viel, was ich machen kann. Das ist beim Trampen nicht der Fall und bedeutet häufig etwas eingeschränkten Fahrkomfort. Ich fahre mit irgendwem grob in die richtige Richtung. Wechsle ein paarmal das Fahrzeug und weiß dabei nicht mal, wie lange es dauert. Es können Minuten sein, wenn es dumm läuft, sogar Stunden. Manchmal strande ich und komme bis zum nächsten Morgen gar nicht mehr vom Fleck. Mit Glück wird der exakte Zielort vom Fahrer angefahren. In ungünstigen Fällen muss der Reisende sich sogar noch abholen lassen oder ewig mit dem Bus die letzten Meter in der Stadt überwinden. Das klingt nicht nach etwas, wofür man bezahlen müsste. Außer man ist Bahnfahrer. Aber selbst Bahnfahrer verlangen schließlich ab einer gewissen Wartezeit ihr Geld zurück.
Ich versuche, den beiden durch meine unglaublich spannenden Erlebnisse und tief greifenden philosophischen Erkenntnisse zu beweisen, was für eine Bereicherung es sein kann, einen Tramper mitzunehmen.
Vermutlich nehmen sie nie wieder einen Tramper mit. Immerhin bedanken sie sich herzlich und meinen, Couchsurfing ausprobieren zu wollen. Das Thema habe ich nicht ganz ohne Hintergedanken erwähnt. Der Wink, dass auch ich ständig Leute bei mir kostenlos übernachten lasse, sollte den Schmarotzer-Geruch, der an mir haftet, etwas reduzieren. Überzeugter, missionierender Couchsurfer bin ich jedoch auf jeden Fall. Sowohl als Gastgeber als auch als Reisender gibt es keine bessere Art, Menschen kennenzulernen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis versuchen wir vergeblich, unseren mexikanischen Couchsurfer aus Budapest zu erreichen. Aber was erwarten wir auch? Wir haben ihm schließlich nichts gezahlt.