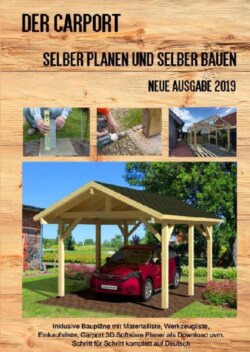Читать книгу Der Carport - Patrick Weinand-Diez - Страница 6
Grundwissen Holzbau
ОглавлениеZu keinem anderen Werkstoff hat der Mensch eine so enge Beziehung wie zu Holz.
Seit Jahrtausenden ist es das wichtigste und meist verbreitete Naturprodukt für weite Bereiche des menschlichen Lebens.
Der Sammelbegriff Holzbau umfasst die Be- und Verarbeitung des Werkstoffes Holz.
Holz ist ein vielseitig einsetzbares Material und wird von den verschiedensten Berufsgruppen verarbeitet. Im Bauwesen wird es für Zimmerer- und Holzbauarbeiten sowie Schalarbeiten benötigt.
Holz ist ein leicht zu bearbeitender Werkstoff und war daher bei unseren Vorfahren der meist verwendete Baustoff. Im Verlaufe der Jahrhunderte wurde die Technik des Holzbaus zu hoher Vollendung entwickelt.
Das beweisen die vielen noch heute erhaltenen Fachwerkbauten. Da der Fachwerkbau durch den Stein- und Betonbau ersetzt wurde, beinhalten die Arbeiten des Zimmerers (Zimmermann) in der heutigen Zeit vorwiegend das Herstellen und den Einbau von Holzdecken und Dachstühlen aber auch Treppen und Innenausbau sowie Fenster, Türen und Möbel.
Beim Rohstoff Holz werden die beiden Hauptgruppen Laub- und Nadelhölzer unterschieden.
Laubhölzer sind z B.: Eiche — Esche — Kiefer — Ahorn — Linde — Tanne — Birke — Rotbuche — Fichte — Weißbuche — Erle
Nadelhölzer sind z. B.: Kiefer — Tanne — Fichte — Lärche
Die Laubhölzer werden hauptsächlich im Innenausbau, für Möbel und zur Furnierherstellung, verwendet; die Nadelhölzer als Bauholz für Zimmer- und Holzbauarbeiten.
Die Handelsware Schnittholz
Handelsware ist die übliche Bezeichnung für geschnittenes Holz in marktgängigen Sorten und Abmessungen.
Der Begriff Schnittholz
Mit Schnittholz werden Holzerzeugnisse bezeichnet, die durch das Auftrennen des Rundholzes (Baumstämme) im Sägewerk, parallel zur Stammachse, entstanden sind und zwar: Bretter — Bohlen — Dachlatten — Kanthölzer — Balken
Das abgelängte Rundholz wird auf seine günstigste Ausnutzung geprüft. Nach einer Einschnittskizze erfolgt der Einschnitt.
Die Norm DIN 4074 unterscheidet bei Kanthölzern und Balken Schnittklassen und Güteklassen. Schnittklassen geben an, wie viel Baumkante an einem im Sägewerk geschnittenen Kantholz oder Balken zulässig sind.
Güteklassen beschreiben die Anforderungen an die Beschaffenheit des eingeschnittenen Holzes hinsichtlich der zulässigen Anzahl und Größe der Aste und der zulässigen Tragfähigkeit des Holzes.
Erläuterung der Schnittholzarten
Die DIN-Normen unterscheiden gehobelte und ungehobelte Hölzer. In der Zimmerei werden hauptsachlich ungehobelte Hölzer verwendet, mit Ausnahme von Ausbauten z. B. Treppen, Fußböden oder Gesimsen. Bretter sind besäumte oder unbesäumte Schnitthölzer aus Nadel- oder Laubholz. Die Dicken im ungehobelten Zustand betragen mindestens 10 mm und höchstens 35 mm. Bohlen sind besäumte oder unbesäumte Schnitthölzer von 40 mm bis höchstens 120 mm Dicke.
Kanthölzer sind Schnitthölzer von quadratischem oder rechteckigem Querschnitt mit einer Seitenlänge von mindestens 6 cm und höchstens 18 cm (Bild 2). Balken sind Schnitthölzer, bei denen eine Seitenlänge des rechteckigen oder quadratischen Querschnittes mindestens 20 cm beträgt. Dachlatten sind Schnitthölzer, bei denen die Querschnittsfläche nicht größer als 32 cm2 ist Abmessungen: 24/48, 30/50, 40/60 mm, Doppellatten 50/80 mm.
Grundsätze beim Verarbeiten von Holz
Der Aufbau des natürlich gewachsenen Werkstoffes Holz bestimmt seine Eigenschaften und damit seine Verwendung.
Holz hat vorteilhafte Eigenschaften:
leichte Gewinnung und Bearbeitung; große Elastizität; geringes Gewicht
Und nachteilige Eigenschaften:
leichte Brennbarkeit; Arbeiten des Holzes; Wertminderung durch Holzfehler; Anfälligkeit für Krankheiten
Arbeiten des Holzes
Frisch gefälltes Holz ist sehr feucht. Der Gehalt an Wasser kann zwischen 60 und 150%, bezogen auf das Darrgewicht, betragen. Man unterscheidet freies Wasser und gebundenes Wasser.
Freies Wasser befindet sich in den Zellhohlräumen und verflüchtigt sich verhältnismäßig schnell. Es hat keinen Einfluss auf das Quellen und Schwinden des Holzes. Gebundenes Wasser dagegen befindet sich in den Zellwänden.
Nach dem Einschnitt hat Holz einen Feuchtegehalt von ca. 30%, man spricht vom Fasersättigungspunkt. Darunter versteht man die Fähigkeit der Zellwände, Wasser zu binden. Nach 1 bis 2jähriger Lagerung in einem Schuppen, hat Holz noch einen Feuchtegehalt von ca. 15%, es ist lufttrocken und darf für Bauarbeiten verwendet werden.
Holz ist ein hygroskopischer Werkstoff mit der Fähigkeit, sich dem Feuchtigkeitsgehalt der umgebenden Luft anzupassen.
Nehmen die Zellwände des ausgetrockneten Holzes Feuchtigkeit aus der Luft auf, dann dehnen sie sich.
Das Holz quillt.
Verdunstet Wasser aus den Zellwänden, so ziehen sie sich zusammen.
Das Holz schwindet.
Diese Eigenart des Holzes — zu schwinden und zu quellen — bezeichnet man als das Arbeiten des Holzes. Das Maß des Schwindens und des Quellens ist bei den einzelnen Holzarten sehr unterschiedlich.
Das Holz schwindet und quillt in seinen einzelnen Ausdehnungen verschieden stark.
Das größte Schwindmaß tritt in tangentialer Richtung bis etwa 10% auf, in radialer Richtung bis 5% und in axialer Richtung bis 0,2%. Das Holz arbeitet ständig, weil es sich dem Feuchtigkeitsgehalt der umgebenden Luft anpasst.
Diese Eigenart muss der Zimmerer bei seinen Holzverbindungen berücksichtigen.
Das Holz arbeitet ständig, weil es sich dem Feuchtigkeitsgehalt der umgebenden Luft anpasst. Diese Eigenart muss der Holzbauer bei seinen Holzverbindungen berücksichtigen.
Durch dieses ungleiche Verhalten des Holzes in den verschiedenen Richtungen und Bereichen entstehen beim Schwinden Spannungen im Holzkörper, die die schon erwähnten Form- und Maßänderungen zur Folge haben. Am Beispiel eines zu Brettern aufgeschnittenen Stammes zeigen sich die Formänderungen beim Schwinden besonders deutlich. Sie sind umso größer, je mehr Splintholz ein Brett hat bzw. je weiter das Brett vom Kern des Stammes entfernt liegt. Nach der Lage der Bretter im Stamm werden sie als Kern-, Mittel- und Seitenbretter bezeichnet.
Seitenbretter haben größere Formänderungen als Mittelbretter, sie wölben sich mehr. Auf der dem Kern abgewandten Seite des Brettes ist die Mehrzahl der Jahrringe länger als auf der dem Kern zugewandten Seite.
Beim Schwinden verkürzen sich die Jahrringe und das Brett wird auf dieser Seite hohl. Diese Brett- seite wird in der Praxis als linke Seite bezeichnet.
Die dem Kern zugewandte Seite, also die runde Brettseite, wird als rechte Seite bezeichnet.
Beim Schwinden des Kernbrettes ergeben sich kaum Formänderungen. Das Brett bleibt gerade (die Jahrringe sind auf beiden Seiten gleichlang angeschnitten). Ein Kernbrett hat stehende Jahrringe.
Auch Kanthölzer und Balken schwinden und quellen. Je schneller die äußeren Schichten austrocknen, desto größer werden die Spannungen. Sie können dazu führen, dass das Holz im Splintholzbereich reißt.
Die Risse verlaufen dann in radialer Richtung von außen nach innen. Man bezeichnet sie als Trockenrisse. Die Trockenrisse setzen den Wert des Holzes herab. Kanthölzer mit Trockenrissen können jedoch als Bauholz verwendet werden.
Kern- oder Markrisse beginnen im Mark und laufen radial nach außen. Sie sind durch ungleichmäßiges Schwinden entstanden. Der innere Zusammenhalt der Faser ist nicht mehr gegeben, und deshalb können solche Hölzer nicht verwendet werden.
Das Bauholz muss nach dem Bearbeiten (Herstellen der Verbindungen), jedoch vor dem Einbau, gegen tierische und pflanzliche Schädlinge geschützt werden. Es gibt Holzschutzmittel auf öliger und auf salziger Basis, die sowohl im Tränk- als auch Streich- oder Sprühverfahren aufgebracht werden können.
Begriffe im Holzbau und seine Erläuterungen
Anreißen
Festlegen einer Länge, Breite, Dicke usw. mit einem Bleistift, einer Reißnadel o. ä.
Abbund
Anreißen und Zuarbeiten der Hölzer für Dachkonstruktionen, Fachwerkwände usw.
Bundgeschirr
Das wichtigste Werkzeug des Zimmerers ist sein eigenes Bundgeschirr. Dazu gehören: Winkeleisen, Latthammer, Klopfholz, Stemmeisen (in verschiedenen Breiten), Axt, Stoßaxt, Handsägen, Gliedermaßstab und Bleistift.
Bundseite
Die Seite eines Balkens oder Kantholzes, auf der das Bundzeichen angebracht wird.
DIN-Normen
DIN ist ein Verbandszeichen des Deutschen Instituts für Normung, deren Arbeitsergebnisse unter dem Zeichen DIN als Deutsche Norm herausgegeben werden. Die Normen enthalten z.B. Angaben über Begriffe, Güte, Abmessungen, Baustoffe.
Drehwuchs
Drehwüchsige Stämme ergeben beim Einschneiden im Sägewerk windschiefe Kanthölzer oder Bretter. Die Holzfasern verlaufen nicht achsenparallel, sondern drehen sich schraubenartig um die Stammachse.
Lot- und fluchtrecht
Senkrechte Lage von Kanten bzw. zwei oder mehrere Kanten bilden eine Flucht, die als eine gerade Linie erscheint.
Maßstab auf Zeichnungen (z B M 1-10 — cm)
Auf einer Zeichnung dargestellte Verkleinerung von Bauwerken oder Bauteilen in einem angegebenen Verhältnis. M. 1:10 — cm bedeutet: 1 cm auf der Zeichnung entspricht 10 cm natürlicher Größe. Die Angaben — m bzw. — m, cm, mm sind auch möglich.
Höhenlagen
Festgelegte Höhenlagen in Schnitten, Ansichten und Grundrissen mit Angabe der Höhenzahl. Leere Dreiecke bezeichnen fertige Höhenlagen, volle Dreiecke Rohbauhöhenlagen.
Schädlinge
Schädlinge können im wachsenden und eingebauten Holz auftreten. Schädlinge im eingebauten Holz sind z.B. der Hausschwamm und der Hausbock. Das eingebaute Holz ist zu schützen.
Schrank, schränken
Damit die Sägen das Holz durchtrennen können und nicht klemmen, müssen die Zähne wechselseitig abgebogen, d.h. geschränkt werden.
Verstreichen
Anreißen eines Zapfens oder Zapfenloches von der Bundseite her.
Werkzeuge zur Bearbeitung des Holzes
Der Gliedermaßstab wird zum Messen von Längen, Breiten und Dicken verwendet.
Er ist im Normalfall 2 m lang und hat eine Einteilung in cm und mm.
Die Einzelglieder sind ca. 20 cm lang und miteinander durch Federgelenke verbunden.
Zimmererwinkel werden zum Prüfen und Anreißen (Anzeichnen) rechter Winkel (Rechter Winkel = 90 verwendet. Es besteht aus Stahl mit federnden, langen Schenkeln. Die Länge des langen Schenkels beträgt in der Regel 80 cm. Kurze Winkel sind für den Zimmerer weniger gut geeignet, da die zu verarbeitenden Hölzer nicht immer gerade sind und bei kürzeren Winkelschenkeln sich Ungenauigkeiten beim Anreißen einstellen.
Das Streichmaß verwendete der Zimmerer früher beim Abbund, heute ist es, infolge der maschinellen Bearbeitung der Hölzer, seltener in Gebrauch. Ein Streichmaß kann man sich aus einem dünnen Brett oder Sperrholz selbst anfertigen. Es wird hauptsächlich zum Verstreichen von Löchern und Zapfen verwendet.
Die Stellschmiege ist ein Hilfsmittel zum Anreißen, Abnehmen und Übertragen beliebiger Winkel. Sie besteht aus dem Anschlag und der Zunge. Die Zunge ist beweglich und kann mit einer Flügelmutter in jeder beliebigen Schräge festgehalten werden.
Das Lot ist das einfachste Gerät zum Prüfen von senkrechten Kanten und Flächen.
Es wird vor allem dort verwendet, wo eine Wasserwaage nicht angehalten werden kann oder ihre Handhabung zu umständlich wäre.
Die Fluchtschnur wird zur Festlegung gerader, durch gehender Kanten und Linien benötigt. Die Länge beträgt 10 bis 20 m. Im Notfall kann die Schnur des Spitzlotes verwendet werden.
Die Wasserwaage wird zum Prüfen lot- und waage- rechter Kanten bzw. Flächen verwendet. Sie besteht aus Teakholz oder Leichtmetall und ist im Normalfall 80 bis 100 cm lang. Zum Wiegen sind zwei Libellen (Waage- und Lotlibelle) eingebaut Das sind leicht gebogene Glasröhrchen, sie sind mit einer Flüssigkeit, die nicht gefrieren kann, soweit gefüllt, dass eine kleine Luftblase verbleibt. Wenn sich die Luftblase zwischen den markierten Eichstrichen befindet, dann ist die Wasserwaage im Lot oder in der Waagerechten.
Der Zimmerer-Bleistift wird zum Anreißen aller vorkommenden Zimmerarbeiten verwendet. Die Bleistiftmine ist rechteckig; zum Anreißen soll sie immer angespitzt sein. Die Verwendung von Kopierstiften auf dem Bau ist nicht gestattet, weil bei Feuchtigkeit Verfärbungen des Holzes entstehen.
Die Stoß- oder Stichaxt ist eigentlich ein langes Stemmeisen mit einem oberen Griff und ganz aus Stahl. Die Schneide besteht aus Werkzeugstahl. Sie wird zum Putzen von Verblattungen und Zapfen sowie zum Nachputzen von Schmiegen verwendet Ihre Länge beträgt ca. 50 cm. Vorsicht bei der Handhabung, sie ist ein nicht ungefährliches Werkzeug.
Die Axt wirkt als Keil und wird zum Abschlagen von Holzteilen, zum groben Anputzen von Zapfen, zum Einschlagen von langen Nägeln (Sparrennägeln) und als sonstiges Schlagwerkzeug verwendet. Die Stiellänge beträgt etwa 70 cm, das Gewicht 1500 bis 2250 g.
Das Beil ist eine kleinere Ausführung der Axt und wird für leichtere Arbeiten verwendet. Stiellänge etwa 40 cm.
Der Latthammer wird zum Einschlagen und zum Ziehen von Nägeln verwendet. Er soll auf seiner Schlagfläche eine Riffelung aufweisen. Damit wird eine bessere Griffigkeit erreicht und ein Abrutschen (Verletzungsgefahr!) vermieden. Das Gewicht beträgt 500 bis 800 g.
Kneif- oder Beißzangen werden zum Ablängen von Draht und zum Ziehen von Nägeln verwendet.
Ein Richtscheit ist eine vollkommen gerade Latte mit parallelen Kanten, meist aus Leichtmetall. Es wird verwendet, um Kanten und Flächen auf Geradlinigkeit und Ebenheit zu überprüfen. In Verbindung mit der Wasserwaage können größere Abstände überbrückt werden. Die Länge beträgt 1,50 bis 5,00 m.
Der Fuchsschwanz wird zum Trennen und Ablängen von Latten, Brettern und Platten verwendet. Das Sägeblatt hat eine trapezförmige Form. Die Sägezähne sind auf Stoß gefeilt und leicht geschränkt. Die Länge des Sägeblattes beträgt ca. 60 cm
Die Stichsäge wird zum Ausschneiden von Löchern oder geschweiften. Kanten verwendet. Das Sägeblatt läuft spitz aus; es ist im Rücken dünner als an der Zahnspitzenlinie. Die Sägezähne sind auf Stoß gefeilt und nicht geschränkt. Die Länge beträgt 40 cm.
Stemmeisen, Stecheisen oder Stechbeitel sind unentbehrliche Werkzeuge des Zimmerers. Er verwendet Stemmeisen von unterschiedlicher Breite. Das gebräuchlichste Stemmeisen hat eine Breite von 30 bis 35 mm und wird hauptsächlich zum Stemmen von Zapfenlöchern und zum Anputzen von Zapfen verwendet. Schmalere Stemmeisen eignen sich zum Ausstemmen schmaler Zapfenlöcher. Die Hefte sind aus Weißbuche, Buchsbaum oder Kunststoff gefertigt.
Das Klopfholz besteht aus Weißbuchenholz oder aus dem sehr festen, aber auch schweren Pockholz. Es werden die vierkantige Form mit zwei Schlagbahnen an den Stirnseiten und das runde Klopfholz unter schieden. Beim runden Klopfholz dienen die Langholzflächen als Schlagbahnen. Sie nutzen sich zwar schneller ab, als das Hirnholz beim vierkantigen Klopfholz, haben aber eine größere Schlagfläche.
Mit dem Hammer oder dem Beil darf nicht gestemmt werden, weil die harten Flächen dieser Werkzeuge die Aufschlagfläche des Heftes zerstören oder aufspalten würden. (Unfallgefahr!)
Die Hand-, Gestell- oder Spannsäge besteht aus einem Holzgestell mit einem Steg.
Das Sägeblatt greift mit den Angeln in die Handgriffe (Zapfen) und wird mit Stiften festgehalten.
Die Handgriffe und somit auch das Sägeblatt sind drehbar. Gespannt wird die Säge durch eine Schnur mit Knebel (Spanner) oder durch Draht, welcher durch eine Flügelmutter festgezogen wird.
Nach der Benutzung ist das Sägeblatt immer zu entspannen. Der Vorteil dieser Säge ist das geringe Gewicht und die Möglichkeit, das Sägeblatt schnell auszuwechseln.
Die Sägeblätter unterscheiden sich in der Wirkungsweise und in den Anwendungsmöglichkeiten:
a) Stoßsägenblatt Dieses Blatt wird bei trockenem Holz zur Erzielung gerader Schnitte verwendet.
b) Trennsägenblatt Die Zähne sind stark auf Stoß gefeilt. Das Blatt eignet sich zum Trennen parallel zur Faserrichtung.
c) Schweifsägenblatt Das Sägenblatt ist sehr schmal (8 bis 12 mm). Mit ihm kann man Rundungen schneiden.
d) Absetzsägenblatt Das Sägeblatt hat sehr kurze, feine Zähne und ist für sehr feine Arbeiten, meist am gehobelten Holz vorgesehen.
e) Grünschneiderblatt Die Sägezahnform entspricht der der Schrotsäge. Diese Säge eignet sich speziell für Schnitte quer zur Faserrichtung.
Bohrer mit Ringgriff sind Handbohrer zum Vor- bohren von Nagel- und Schraubenlöchern. Sie werden auch als Nagel- oder Schneckenbohrer bezeichnet.
Diese Bohrer gibt es mit schneckenförmigem Bohrgewinde und Ringgriff (Form A) oder mit Spiralnut, zweimal gedreht, und mit einem einfachen Ringgriff (Form B).
Bohrer mit Ringgriff haben Durchmesser von 2.10 mm.
Schlangenbohrer haben um den Schaft (Halm) herum angeordnete „Förderschlangen“ oder Spiralwindungen. Sie können einen oder zwei Vorschneider haben. Alle Schlangenbohrer haben eine Zentrierspitze mit Einziehgewinde.
Zum Einspannen in die Bohrwinde haben die Bohrer am Ende des Schaftes einen Vierkant (Kolben). „lrwin-Bohrer“ (Form C) haben weite, eingängige Förderschlangen und eignen sich zum Bohren von tiefen Löchern in Quer- und Hirnholz.
Sie sind besonders zum Bohren von Weichholz geeignet. „Douglas-Bohrer“ (Form A) haben doppelgängige Förderschlangen und eignen sich zum Bohren von tiefen Löchern in Querholz (besonders Hartholz).
Stangen-Schneckenbohrer haben einen als Stange ausgebildeten Schaft. Sie sind am Ende mit einem Ohr zur Aufnahme eines Holzgriffes (Knebel) versehen.
Der Spiralbohrer hat zwei Spiralnuten und wird vorwiegend als Maschinenbohrer verwendet Er hat als Holzbohrer eine Zentrierspitze und zwei Vorschneider.
Zentrumbohrer haben eine Zentrierspitze mit oder ohne Einziehgewinde, einen Spanabheber und einen Vorschneider. Der einfache Zentrumbohrer hat eine dreikantige Zentrierspitze oder Einziehgewinde und gibt dem Bohrer die zentrische Führung.
Er wird für Bohrlöcher mit größerem Durchmesser und geringer Tiefe verwendet. Für Bohrungen im Hirnholz ist er nicht geeignet.
Der Forstnerbohrer hat eine kurze Zentrierspitze, eine geschlossene Umfangschneide und zwei Spanabheber im zylindrischen, leicht konischen Schneidkopf.
Er wird zum Ausbohren von Ästen für flache Bohrlöcher mit ebenem Grund und für Löcher mit offenem Rand verwendet.
Der Krauskopf (Versenker) hat kegelförmig angeordnete Schneiden mit schabender Wirkung. Er wird zum Versenken von Schraubenköpfen, zum Entgraten von Bohrlöchern und zum Aufreiben von Dübellöchern verwendet.
Die einfache Bohrwinde oder Brustleier besteht aus einem Stahlbügel mit Brustknopf, dem Handgriff und dem Mundstück mit Futter, in das die Bohrer gesteckt werden. Drei- oder Vierbackenfutter ermöglichen zentrisches Einspannen der Bohrer. Die verbesserte Form ist die Bohrwinde mit Knarre oder Ratsche. Der große Vorteil der Knarre besteht darin, dass die Winde gedreht werden kann, ohne dass sich der Bohrer dreht. Die Knarre hat also nach rückwärts und nach vorwärts einen Freilauf. Bohrwinden mit Knarre werden verwendet, wenn der zur Verfügung stehende Raum keine ununterbrochenen Drehungen zulässt, z.B. beim Bohren in einer Ecke. In das Zahnrad der Knarre greift bei der Vorwärtsbewegung eine Feder, die es weiter- schiebt. Beim Zurückdrehen „knarrt“ die Feder über die Zähne hinweg.
Die Bohrmaschine
Ohne Schlagwerk, wird zum Bohren verschiedener Werkstoffe wie Metalle, Holz, Kunststoffe u.s.w. eingesetzt. Mit Schlagwerk, wird zum Bohren von Beton, Stein und ähnlichen harten Werkstoffen eingesetzt. Bohrmaschinen werden mit einer oder mehreren Drehfrequenzen und/oder Drehfrequenzbeeinflussung hergestellt. Einige Baureihen haben außerdem noch die Möglichkeit von Rechtslauf auf Links- lauf umzuschalten.
Schrobb- oder Schrupphobel werden für Vorarbeiten und zum Beseitigen grober Unebenheiten bei gewölbten Brettern verwendet. Das Hobeleisen ist stark rund geschliffen. Beim Schruppen fallen dicke Spane an, deshalb hat dieser Hobel ein großes Maul. Hobeleisenbreite: 30, 33 mm.
Der Schlichthobel wird zum Abhobeln rauher Flächen und zum Schlichten vorgeschruppter Flächen benutzt. Die Kanten des Hobeleisens sind nur leicht gebrochen.
Das ergibt einen kräftigen Span, aber keine vollkommen glatte Fläche. Hobeleisenbreite: 45, 48, 51 mm.
Der Doppelhobel wird vorwiegend zum Glätten und zum Abfasen von Flächen verwendet.
Der Hobelspan ist sehr fein, weil er durch die am Hobeleisen aufgeschraubte Klappe (daher Doppelhobel) sofort nach dem Abheben gebrochen wird.
Das Einreißen (Spalten) des Holzes wird vermieden. Hobeleisenbreite: 45, 48, 51 mm.
Der Grundhobel hat eine völlig andere Form. Das Eisen des Grundhobels ist rechtwinklig abgebogen und wird durch eine Schraube gehalten. Mit diesem Hobel werden Vertiefungen ausgearbeitet (z. B. Nuten bei Gratleisten).
Die wird zum Fügen und zum Abrichten großer Flächen und Kanten benutzt. Sie nimmt kleinere und größere Unebenheiten ab.
Der Handgriff für die rechte Hand dient der besseren Führung der Rauhbank.
Es wird unterschieden in:
- Die einfache Rauhbank ohne Klappe
- Und die Rauhbank mit Klappe.
Die Dreikantfeile wird zum Schärfen der Handsäge benötigt. Das Feilenblatt hat einen gleichseitig-dreieckigen Querschnitt und soll scharf im Hieb sein. Die Schwertfeile wird zum Schärfen von Handsägen mit Grünschneiderblättern benutzt. Die Flachfeile wird zum Schärfen von Schrotsägen benutzt. Alle Feilen müssen in einem Feilenheft befestigt sein.
Zum Schärfen wird das Sägeblatt in einen gut schließenden Feilkolben eingespannt. Das Sägeblatt kann auch in einen Schraubstock oder mit zwei Brettern in die Hobelbank eingespannt werden.
Das Schränkeisen ist mit einer Anzahl von Ein- schnitten versehen, die wegen unterschiedlicher Blattdicke und Bezahnungstiefe verschieden groß sind.
Zur Erzielung eines einwandfreien Schrankes ist die Schränkzange vorzuziehen. Mit der Stell- schraube kann die Schränkung genau eingestellt werden.
Der Schleifstein ist meist ein Natursandstein. Beim Schleifen muss er nass gehalten werden. Entweder läuft der Stein im unteren Bereich durch Wasser, oder er wird von oben befeuchtet. Der Schleifstein dient zum Schärfen der Stemm- und Hobeleisen, von Äxten, Beilen und Stoßäxten. Oft werden die Eisen auch auf einer schnell laufenden Schmirgelscheibe geschliffen (Trockenschliff).
Die Abziehsteine entfernen den Grat an den geschliffenen Eisen und geben den letzten Schliff. Sie bestehen aus feinkörnigem Naturstein oder aus künstlichem Material. Sie werden mit Wasser oder 01 befeuchtet.
Arbeitsböcke
Zum Anreißen, Zuschneiden und Bearbeiten der Hölzer werden Böcke benutzt, die meist vom Zimmerer selbst hergestellt werden.
Es werden folgende Arten unterschieden:
Der Süddeutsche Zimmerbock
Er besteht aus einem etwa 2,00 bis 2,50 m langen Holm mit den Abmessungen 14/16 oder 14/18 cm und senkrecht stehenden Beinen. Die Höhe des Bockes beträgt etwa 50 bis 60 cm.