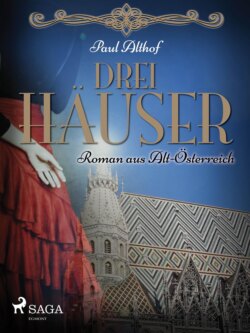Читать книгу Drei Häuser - Paul Althof - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеVor dem Winzerhause von Szent Györgyvár wimmelte eine Schar junger Küchlein um die alte Glucke. Kleinen Bällchen gleich überkugelten sie sich, stießen aneinander und plusterten sich auf, als hätten sie das lange geübt und waren doch erst vorige Woche aus dem Ei gekrochen. Alle hatten braun gesprenkelte Federn, bis auf ein einziges, das über und über goldgelb, in der Sonne förmlich leuchtete. Plötzlich gackerte die Henne laut warnend. Das Vierergespann der Gutsherrschaft kam drüben auf der Landstraße vorgefahren.
Eine ältliche Bonne stieg aus, die mit unendlicher Vorsicht — die jungen Pferde standen ja niemals völlig ruhig — einen etwa neunjährigen Knaben aus dem Wagen heben wollte. Er stieß ihr aber den Ellbogen ins Gesicht und sprang mit einem Satz auf den Boden.
„Er ist couragiert, der kleine, gnädige Herr Baron“, sagte der hagere Winzer mit einem verlegenen, meckernden Lachen. Die Winzerin trat hinzu, barfuß, breithüftig, einen schweren Obstkorb tragend. „Ich küsse die Hände, Euere Gnaden, Herr Baron! Schöne reife Kirschen gefällig? Belieben zu kosten, bitte!“
Der Knabe fuhr mit beiden Händen in den Korb und stopfte sich den Mund voll.
„Schlucken Sie keinen Kern, Falco!“ flehte die Bonne.
Ein Sprühregen von Kirschkernen, der auf das demutsvoll geneigte Haupt des Winzers niederprasselte, enthob sie dieser Sorge.
„Jesus Maria!“ rief plötzlich die Winzerin, „Sie bluten ja, Fräulein! Ihre Nase blutet!“
„Wahrhaftig, Falco hat mich beim Aussteigen ein wenig gestoßen.“
„Sie sind auch im Gesicht zerkratzt. Kommen Sie, ich gebe Ihnen Wasser.“ Und sie führte die Bonne in die Küche, in der es nach saurem Rahm und frischem Brot roch. Das alte Fräulein tauchte ihr Taschentuch in einen irdenen Wasserkrug und seufzte: „Der kleine Baron ist so lebhaft! Er kratzt, wenn man ihm nicht gleich seinen Willen tut. Die Gräfin gestattet ihm alles. Und zu Hause, in Trento, sitzt er bei Tisch obenan, weil er einmal Minister werden soll.“
Die Winzerin wiegte den Kopf staunend hin und her.
„Ja“, prahlte die Bonne, „der junge Baron Falco wird einmal sehr reich sein, er erbt nicht bloß die schöne Villa Casalanza bei Trient, sondern auch die großen Weingüter, die sein Vater in Italien besitzt und von seinem Oheim Don Carlo einen Palast in Verona, ganz aus Marmor gebaut!“
„Hörst du, Katicza? Aus Marmor!“ rief der alte Winzer, wie berauscht von dieser Vorstellung. „So reich ist wohl unsere hiesige Herrschaft nicht, aber eine gute, eine großartig gute Herrschaft haben wir. Wenn mir unsere gnädige Frau Baronin sagt: ‚Pista, du bist ein Esel!‘ so geht mir das Herz auf, denn ich weiß, daß sie es aufrichtig mit mir meint. Und trotzdem sie eine Italienerin ist und keine Ungarin, verehrt man sie wie eine Mutter. Ja, und die Bevölkerung verdankt ihr, daß wir ein ordentliches Spital und sogar einen Kindergarten gekriegt haben. Nun, und wie gefällt es dem Herrn Gast, dem kleinen Herrn Baron, drinnen in Kanizsa, in unserer schönen Stadt?“
„Sie stinkt nach Stroh und Enten“, erwiderte der Knabe, eine Grimasse schneidend.
„Na, na!“ fiel da eine Frauenstimme, gutmütig lachend, ein. „Schön braun gebratene Enten wird er aber doch gern schnabulieren, der Bub!“
Die Bonne wendete sich um wie eine Windfahne, wenn plötzlich eine schärfere Luft weht. Wer hatte da ihren kleinen Baron einfach „Bub“ genannt? Mit einem unendlich geringschätzigen Achselzucken stellte sie fest, daß es die Bálint gewesen war, die Frau des Cymbalspielers der Zigeunerkapelle. Vier Kinder umringten das Weib und ein fünftes schien auf dem Wege zu sein.
„Bei Ihnen ist es ja wieder einmal so weit?“ sagte die Bonne mit einem mißbilligenden Blick auf den schwangeren Leib der Bálint. „Wozu brauchen arme Leute so viele Kinder?“
„Das können Sie nicht verstehen, Fräulein“, lächelte Eva Bálint, „denn Sie haben immer bloß für Lohn fremde Kinder gehütet und keine eigenen aufgezogen.“
Die Bonne wurde rot vor Ärger. Der hohe weiße Kragen schien sie plötzlich zu würgen, aber sie richtete sich kerzengerade auf und zischte: „Es ist geradezu unanständig! Haben Sie an vier hungrigen Mäulern nicht genug?“
„Gott hat immer gesorgt, daß sie satt wurden“, entgegnete die Frau des Cymbalspielers. „Mein Mann gibt auch Klavierstunden. Er ist ja der einzige von seiner Musikbande, der nach Noten spielen kann. Und ich hab jetzt die Ausstattung der jungen Baronin Amadé zu sticken bekommen. O, ihre Mutter, die Baronin Teresa ist so gut zu meinen Kindern! Sie hat uns heut zur Kirschenernte in ihren Weingarten eingeladen.“
„Mutter! Komm heraus! Er bringt die Küchlein um!“ schrie einer der Knaben.
Falco hatte draußen mit den Kücken gespielt. War es seine Schuld, daß das Spielzeug so wenig Bestand hatte? Ein Kücken lag tot auf der Erde. Ein zweites klemmte er zwischen seine kleinen, kräftigen Hände fest und beobachtete, wie es die Augen verdrehte und wie sich der Schnabel langsam öffnete. Das mißfiel ihm und er warf es gegen die Planke, daß es nur so klatschte. So wollte er es auch mit dem großen, gelben Kücken machen. Die Henne zeterte laut, aber er fing es schnell.
„Nicht die Hühnchen töten, lieber, goldener, gnädiger Herr Baron!“ rief die Winzerin. Er hörte nicht auf sie.
„Lass’ das arme Hendel los!“ mischte sich Frau Bálint ein und versuchte, das Tierchen zu befreien. Aber nach kurzem Streit, stellte ihr der Knabe ein Bein und sie stürzte auf der feuchten Lehmerde ausgleitend, vornüber gegen den Bretterzaun. Einigermaßen überrascht, ließ Falco das gelbe Kücken fahren. Es war gerettet.
Doch Eva Bálint lag bleich und halb ohnmächtig auf dem Boden. Ihre Kinder weinten. Der Winzer stand hilflos daneben. Die Winzerin holte den Herrschaftskutscher Antal. Der war aus der Hauptstadt und verstand sich besser auf solche Dinge.
„Halt’ mir die Pferde!“ befahl er dem Winzer. „Und du, Katicza, bring einen Schluck Sliwowitz, es kann auch Wein sein.“
Doch Eva berührte den angebotenen Trunk nicht und stöhnte schwer. „Wir müssen sie nach Hause bringen“, sagte der Kutscher. „Helft mir, sie zum Wagen tragen.“
„Das geht doch nicht!“ eiferte die Bonne.
„Es geht schon, Fräulein. Der kleine Baron steigt zu mir auf den Kutschbock.“
„Ja, auf den Bock!“ wiederholte Falco lustig. Ihm war der ganze Vorgang ein Zeitvertreib.
Eva Bálint wurde sorgfältig im Fond des herrschaftlichen Wagens untergebracht. Zu ihrer Linken setzte Antal ihr Töchterchen Regine, gegenüber mußten ihr jüngster Bub Pali und die schmollende Bonne sitzen. Den beiden älteren Knaben, Bernhard und Jozsi, wurde aufgetragen, zu Fuß heimzuwandern.
Antal fuhr im langsamen Trab. An seinen Pferden war alles gebändigte Kraft. Jetzt gab’s keinen Übermut, bitte! Kein Ohrenspitzen! Gleichmäßig schollen die Hufschläge über die Landstraße, einen feinen Staubschleier auf den Alleepappeln zurücklassend. Feuerrot sank die Sonne. Ein Ziehbrunnen hob sich dunkel gegen den flammenden Horizont ab. Der Pferdehirt, der dort einige Fohlen tränkte, stand noch lange ehrfürchtig grüßend, den Hut in der Hand.
Als der Wagen am Friedhof vorbeirollte, ging über Frau Bálints Gesicht ein Zucken. Sie faßte das Händchen der kleinen Regine und zwang sich, von Schmerz zerrissen, von Angst gefoltert, zur Ruhe.
Endlich schimmerten zwischen blühenden Akazienbäumen die ersten Häuser der Stadt, niedrige, demütige Bauernhäuser, die vor dem Vierergespann der Herrschaft Front machten wie ihre Bewohner. An einem solchen ebenerdigen Häuschen hielt Antal die Pferde an. „Wo ist der Zigeuner Bálint?“ rief er vom Kutschbock herab.
Ein nicht mehr junger Mann von hagerem, dunklem Typus kam auf den Anruf heraus und wollte heiter grüßen. Da sah er die Totenblässe auf Evas Zügen. Mit unendlicher Zartheit nahm er die Frau in seine Arme, und trug sie ins Haus.
„Es ist nichts, Bálint ...“, stammelte sie, „es ist wirklich gar nichts ..., du brauchst keine Sorg’ zu haben. Bernhard und Jozsi kommen gleich nach ...“
„Soll ich nicht die Madame Gruber holen?“
„Ja, bis die Kinder ihr Nachtmahl bekommen haben, kannst sie vielleicht rufen.“
In der Nacht kam ein Mädchen zur Welt. Ein winziges, schwaches Acht-Monat-Kind, das von der Hebamme zuerst für tot gehalten wurde, aber plötzlich die Augen öffnete, bläulich dunkle, erschrockene Augen, die zu früh aus dem Traum des Werdens zur Qual des Seins erweckt worden waren.
Am Morgen berichtete der Kutscher Antal seiner Herrschaft den vortägigen Unfall der Zigeunerfrau. Baronin Teresa Amadé, eine stattliche Dame von fünfundvierzig Jahren, stand in einen schwarzen Kaschmirschal gehüllt, auf dem Treppenabsatz vor der Gesindeküche und hörte mit wachsender Besorgnis von dem Unheil, das ihr Neffe Falco angerichtet hatte. „Warum wurde mir das alles nicht schon gestern gemeldet?“ fragte sie streng.
„Ich hab’s nicht sagen dürfen“, seufzte Antal. „Die Baronin Casalanza hat das Kinderfräulein zu mir in den Stall geschickt ...“
„Und hat dir ein Trinkgeld gegeben, damit du schweigst ...“
„Geben wollen, Euer Gnaden, geben wollen, aber der Antal hat es nicht genommen.“
„Das ist recht. Spanne schnell die Jucker an. Wo ist Falco?“ Der Knabe kam, als er den Ruf der Baronin hörte, durch die beiden Höfe des weitläufigen Familienhauses gerannt: „Tante Teresa! Kauf’ mir eine neue Schießscheibe. Die alte ist kaput!“
„Nein. Jetzt mußt du mit mir kommen und die Frau, der du gestern ein Bein gestellt hast, um Verzeihung bitten! Eine arme, kranke Frau. Schäme dich!“
Der junge Missetäter ballte die Fäuste, doch er wagte keine Erwiderung. Einige Minuten später saß er manierlich neben seiner Tante im Wagen, und nach kurzer Fahrt hielt derselbe in einer Seitengasse vor dem ärmlichen Hause des Cymbalspielers Bálint.
Die Baronin hatte zwei lebende Hühner und einige Flaschen Wein mitgebracht. Falco mußte ein Glas mit eingemachten Früchten tragen. Er kniff die Lippen zusammen, als er den düsteren, mit Ziegeln gepflasterten Hausflur betrat.
Der Zigeuner erhob sich beim Anblick der Besucher, schwer und langsam wie ein Mensch, der eine Last auf den Schultern trägt. Teresa ging gleich auf die Wiege zu, welche scheinbar eiligst herbeigeschafft, noch staubig und voller Spinnweben, das Neugeborene aufgenommen hatte. „Da kann ich ja schon Glück wünschen! Ist es ein Mädchen?“ fragte sie.
Der Mann nickte schweigend.
„Was haben Sie, Bálint?“
„Meine Frau ist fast daran gestorben.“
„Santa Madonna! Wie geht es ihr jetzt?“
„Sie fiebert. Wenn ihr Gott nicht hilft ...“
„Ich will zu ihr ... Falco, du bleibst dort stehen. Und rühre die Wiege nicht an! Wenn dieses Kind eine traurige Jugend hätte, so wäre es durch deine Schuld!“
Falco war über den ungemein strengen Ton, den seine Tante anschlug, etwas verblüfft. Immerhin war er froh, daß er nicht zu der kranken Frau hineingehen und Abbitte leisten mußte.
„Wie heißt das Kind?“ fragte er behutsam.
„Es wird Rozsinka heißen“, antwortete Bálint. „Wir hatten es erst im Sommer erwartet. Nun blüht’s schon im Mai.“
„Nicht Rozsinka“, widersprach der Knabe. „Nennt es lieber italienisch: Fiorenza!“
Die Türe schloß sich hinter der Baronin und dem Zigeuner. Falco konnte der Versuchung nicht widerstehen, sich der Wiege zu nähern. Da war etwas Interessanteres als die Kücken, die man zerdrückte und wegwarf. Scheu tippte er an des Kindes winziger Faust, die sich wie ein Rosenkelch öffnete und über seinen Zeigefinger wieder schloß. Nun wagte er nicht, sich zu bewegen, „Fiorenza ..., Fiore ...“, sprach er in singendem Ton.
Nach einer Weile kam die Baronin mit einem ernsten Gesicht zurück. „Ich werde gleich meinen Arzt schicken“, sprach sie, „und wenn es nötig ist, werde ich mich um eine Amme kümmern.“
Da trat Bernhard, der älteste Sohn Bálints, in die Stube: „Vater, ich brauch’ eine Geige ...“, sagte er und stockte, als er Falcos ansichtig wurde. Dieser musterte den Zigeunerknaben mit feindlichen Blicken, und weil er ihm doch eigentlich nichts anhaben konnte, gab er wenigstens der Wiege einen Stoß, daß sie hoch hinauf schnellte. Die Baronin faßte ihn mit festem Zugriff am Arm. Bernhard zog sich eingeschüchtert in die dunkelste Ecke zurück.
„Komm näher!“ ermunterte ihn die Baronin.
„Seit wann spielst du Geige?“
„Küß die Hand, Euer Gnaden. Bitte, ich hab immer gespielt. Aber die Malacz-Banda nimmt mich nicht auf, weil meine Violin’ zu schlecht ist.“
„Malacz-Banda? Ein malacz ist doch ein Ferkel.“
„Jawohl. Zu dienen. Die alten Zigeuner, die in den Herrschaftshäusern und im Hotel Krone spielen, haben die jungen Zigeuner ‚Ferkel-Banda‘ geschimpft.“
„Ich wollte die Zigeuner heute zu mir bestellen, weil ich abends Gäste erwarte ...“, sagte die Baronin zögernd.
„Bitte, die alte Banda ist heute nach Gelse gegangen, zu einer Bauernhochzeit. Soll man sie zurückrufen?“
„Keinesfalls. Eine Hochzeit ist etwas Wichtiges“, lächelte Teresa, „und dein Vater ist nicht mitgegangen?“
Der Cymbalist zuckte die Achseln. „Heut soll ein anderer spielen.“
„Wenn Euer Gnaden sich einmal die jungen Zigeuner anhören wollten ...“, meinte Bernhard schüchtern.
„Vielleicht. Aber glaubst du nicht, daß du noch zu jung bist, um nächtelang aufzuspielen?“
„O nein, küß die Hände. Ich bin doch schon zwölf Jahre vorüber und wenn ich eine ordentliche Violin’ hätt’, könnt’ ich etwas verdienen.“
Teresa betrachtete freundlich das ernste Knabengesicht mit der mächtig gewölbten Stirn und dem festen Kinn. „Auf deine Empfehlung hin will ich es mit den ‚Ferkel-Zigeunern‘ versuchen! Sie sollen heut Abend zu mir kommen. Und du auch. Vielleicht kann dir mein Sohn eine Geige leihen ...“
Die Baronin reichte dem Vater Bálint die Hand zum Abschied. Falco stapfte ohne Gruß hinterdrein.
Auf dem Heimweg wurde beim Arzt und beim Apotheker angehalten. Es war fast Mittag, als der gelbe Korbwagen in die Einfahrt des Amadé’schen Hauses rollte. Sepp Knöll, der Kellermeister, half Teresa beim Aussteigen. „Der Herr von Kwiecinski ist vor einer Stunde angekommen, Euer Gnaden. Unsere Weinfässer haben vor Schreck gezittert. Müssen wir heut grad den Neunundsechziger anzapfen? Schad’ wär’s um den Wein.“
„Mache dir nichts draus, Sepp“, lächelte die Baronin, „Herr von Kwiecinski wird ihn nicht allein trinken. Heute Abend wird getanzt.“
„Das ist gut. Den Herren Offizieren geben wir ihn ja gern.“
„Du kannst auch ein paar Flaschen Champagner heraufschicken.“
Ein schönes, hochgewachsenes Mädchen kam die Treppe herauf und umarmte die Baronin: „Du bist ein Engel, Mama! Ich weiß schon, daß du die Zigeuner für heute Abend bestellt hast. Ich habe es eben auf dem Korso erfahren. Die ganze Garnison weiß es schon!“
„Ich kann nicht die ganze Garnison einladen, Antonietta, aber ich gestatte dir, eine würdige Auswahl zu treffen.“
„Sei unbesorgt, Mama! Die schönsten Offiziere des Regimentes werden abends antreten.“
„Du meinst wohl der Schönste?“ neckte Teresa und küßte die Errötende zärtlich.
„Onkel Kasimir ist angekommen“, sagte Antonietta, verlegen ablenkend.
„Jawohl, Knöll hat es mir gerade vorhin gemeldet.“
„Serviteur! Serviteur!“ krähte die hohe Stimme des Mannes, von welchem eben die Rede war. „Meine charmante Nichte habe ich schon begrüßt. Kompliment! A la bonheur! Und meiner adorierten Schwägerin habe ich den Vorzug, jetzt endlich die Hände küssen zu dürfen. Sie sehen brillant aus, Teresa! Imposante Gestalt! Immer noch gefährlich schön! Ces yeux! Diese feurigen Augen! ... Ich komme heute à la fortune du pot, teuerste Teresa!“
„Machen Sie mich nicht eitel und danken Sie dem Himmel, Kasimir, denn er meint es gut mit Ihnen: Wir haben gestern Schweine geschlachtet.“
„Ich bin, ma foi, au ciel! Aber Ihre Backhühner, teuerste Schwägerin, Ihre Backhühner, auf die ich mich gefreut, von denen ich geträumt habe! Quel delice!“
„Keine Sorge, Kasimir! Für Backhühner ist vorgesehen.“
„Magnifique! Doch unter der Bedingung, teure Schwägerin, daß ich bei Tische neben Ihnen sitzen darf, denn Sie essen wenig. Die andern nehmen sich vor mir die besten Stücke aus der Schüssel. Besonders Ihr cher fils Béla. Eine delikate Fasanenbrust, auf die ich gespitzt hatte, schnappte er mir einmal vor der Nase weg, bevor ich: attention! sagen konnte.“
„Sie werden diesesmal zu Ihrem Rechte kommen! Aber wollen wir nicht Stasia aufsuchen?“
„Stasia? Ich habe meine chère soeur Stasia vorhin schon gesehen. Sie komponierte gerade eine Musikpièce und war nervös. Ha, da kommt ja mon cher neveu Falco! Warum grüßt er nicht seinen guten Onkel Kasimir? He? Ist er vielleicht auch schon nervös? He?“
„Nein. Nur etwas schlecht erzogen“, lachte Antoinetta.
„Er macht leider dumme Streiche“, setzte Teresia hinzu.
„Mais que voulez-vous? Un enfant! Ein Kind!“
„Ja, ein Kind. Ein einziges Kind. Stasia verzieht ihn. Wenn er Geschwister hätte ...“
„Noch Geschwister? Horreur! Stasia hat ihre Musik und ihre Nerven. Aber noch Kinder? A quoi bon?“
Unter solchen Gesprächen war Kwiecinski mit Teresa über einen nach dem Hofe offenen Gang geschritten, der zu den Fremdenzimmern führte. Aus einem dieser Zimmer scholl ihnen energisches Klavierspiel entgegen.
Anastasia Baronin Casalanza, geborene Kwiecinska saß im Frisiermantel vor dem Pianino und spielte rauschende Passagen. Sie warf ihre schmalen Hände mit bewußter Grazie empor, kreuzte sie gelegentlich mit preziös hochgestelltem Gelenk und begleitete den Rhythmus der Musik durch leichtes Wiegen ihres Kopfes. Eine kaskadenartige Lockenfrisur unter einem neumodischen Spitzenschleier verlieh diesem kapriziösen Frauenkopf eine gewisse anmutige Würde. „Was sagen Sie zu meinem Walzer, liebste Schwägerin?“ fragte sie mit tiefer, sanfter Stimme.
„Exquisit!“ krähte Kasimir.
„Ja, Sie sind eine begabte Komponistin!“ lächelte Teresa gütig. „Ich selbst verstehe wenig von der Tonkunst. Meine Kinder Béla und Antonietta haben das Musiktalent nur von ihrem Vater. Ich komme eigentlich zu Ihnen, liebe Stasia, um Ihnen einige Worte über Falco zu sagen ...“
„Ist ihm etwas zugestoßen?“ schrie Stasia hysterisch.
„Nein, nein! Nicht das mindeste! Beruhigen Sie sich! ..., aber eben läutet es zu Tische ... und Sie sind noch nicht angekleidet ...“
„Noch nicht einmal geschnürt“, sagte Stasia. „Aber ich kann auch im Négligé speisen. Ist mein Peignoir nicht hübsch genug?“
„Sehr hübsch“, gab Teresa zu, „aber es sind drei Herren bei Tische.“
„Bah! Kasimir und Béla zählen doch nicht ...“
„Und Don Carlo?“
„Unser Vetter zählt als Mann noch weniger; er ist Geistlicher und gegen Frauenschönheit gewappnet.“ Sie warf aber doch einen bunten Schal um die Schultern.
Im Speisesaal wartete hochaufgerichtet, in seiner korrekten schwarzen Soutane, Don Carlo Casalanza. Sein feines Imperatorengesicht blieb unbewegt, als ihm Stasia mit ihrer schmeichelnden Altstimme auf Italienisch guten Tag wünschte. Er hatte sich bis dahin mit Falco unterhalten, hatte den Knaben in verschiedenen Lehrfächern geprüft und die Überzeugung gewonnen, daß viel Versäumtes nachzuholen sei.
„Möchtest du mit mir ins Konvikt kommen?“ hatte er den Kleinen gefragt. „Dort findest du Knaben deines Alters, kannst endlich etwas Ordentliches lernen, wirst auch Fecht- und Reitunterricht erhalten ...“
„Gibt es dort auch Gouvernanten?“ fragte Falco mißtrauisch. „Wirklich nicht? Dann gehe ich mit dir!“
„Niemals trenne ich mich von Falco!“ sagte Stasia. „Sein Vater wollte ihn schon in Trient in die Schule schicken, aber ich gab es nicht zu.“
Es entstand eine verlegene Pause, dann sagte Falco laut und bestimmt: „Zio Carlo, ich will bei dir bleiben.“ „Das werden wir sehen!“ schrie Stasia. „In eine Kutte lasse ich meinen Falco nicht stecken!“
„O nein, ich bekomme eine schöne Uniform und einen Degen!“ jubelte der Knabe.
„Ich glaube, Stasia, daß es ein Glück für Falco wäre, unter Don Carlos Obhut zu kommen“, warf Teresa ein.
„Was hat Falco denn verbrochen?“ lachte Stasia gereizt. „Zwei jungen Hühnern den Kragen umgedreht. Soll er dafür in eine Erziehungsanstalt gesperrt werden? Ich will den Bauern ihre Hühner bezahlen und damit wird die Sache erledigt sein!“
Teresa wollte etwas erwidern, da traf sie ein Blick Don Carlos, und sie schwieg.
„Zwei Hühner!“ quietschte Kasimir. „C’est incroyable! Unsere teure Teresa mit ihrem weichen Gemüt hat gewiß die armen Tierchen bedauert. Aber wieviele Hühner haben wir schon gefühllos verspeist! Sie auch, venerandissimo Don Carlo! Sie auch!“
„Ganz recht, denn es wäre Unsinn, wenn wir das Geflügel, welches meine Mutter eigens züchtet, verschmähen würden!“ rief Béla, der junge Sohn des Hauses. „Und ich stelle den Antrag, diesen gespickten Plattenseefisch in Sardellensauce, mit andächtigem Schweigen zu genießen.“
„Falco! Lassen Sie sich Zeit! Sie werden eine Gräte schlucken!“ jammerte die Bonne dazwischen. „Warum legen Sie ihm nicht vor, Mademoiselle?“ schalt Stasia. „Er hat ein schlechtes Stück genommen!“
„Sie irren, liebe Stasia“, lächelte Don Carlo nachsichtig, „etwas Schlechtes kommt nicht auf diese Tafel. Hier wird alles in Güte und in Fülle geboten. In diesem Hause der Wohlfahrt, wie ich es nennen möchte, will uns Teresa jedes Gastmahl zum Feste machen.“
„Haus der Wohlfahrt?“ wiederholte Baronin Teresa lachend. „Ich soll wohl darin mit meinem Schwergewicht die Göttin Abondanza vorstellen?“ — „Nein, die edle Gastfreundschaft“, antwortete der Geistliche, „denn sonst wäre das Haus der Wohlfahrt ein ganz und gar materialistisches Haus. Herr Kwiecinski hat betont, daß ich kein Genußverächter wäre. Er hat recht. Ich erwarte von dieser Tafel mehr, als daß ich mit allen Primeurs und Leckerbissen gefüllt, vom Speisen aufstehe. Ein Wein wie dieser —“ er hielt das Glas gegen die Sonne, „ein edler Tropfen wie dieser volle, blumige Eigenbau, kann manchen sinnlos berauschen, kann aber auch wundervoll begeistern. Drei Gastmähler in der Geschichte der Menschheit will ich euch als Beispiel anführen, um euch meinen Gedanken klar zu machen. Ein Gastmahl, das nur dem Körper schwelgerische Genüsse bot, war das Gelage des Belsazar. Eine ungeheure Kluft trennt diese Orgie vom Gastmahl des Plato. Und eine Welt liegt zwischen jenen heidnischne Symposien und dem letzten Abendmahl unseres Erlösers.“
„Zio Carlo“, flüsterte Antonietta nach einer Pause, „ist nicht das Tischgebet wie eine Anrufung des Heiligen Geistes? Warum hat es sich fast nur bei den Bauern und bei den Juden erhalten?“
„Ne parlez pas des Juifs!“ zankte Kasimir. „Juden und Zigeuner sind mir horribel!“
„Ich werde mich aber um die Familie des Zigeuners Balint kümmern müssen“, erklärte Teresa. „Seinem Weib geht es schlecht.“
„Voilà!“ rief Kasimir. „Zuerst die Hühner, dann die Zigeuner! Unsere mitleidige Teresa wird uns jene sympatische Zigeunerfamilie noch zu Tische laden!“
Teresa lächelte. „Sie haben es fast erraten, Kasimir, denn Sie werden einen Sohn des Cymbalisten Bálint heut Abend mit seiner Zigeunerbande bei mir spielen hören.“
„Ich kann den Vater Bálint gut leiden“, warf Béla ein. „Er war unser erster Klavierlehrer. Er unterrichtet für 25 Kreuzer pro Stunde. Wie haben wir ihn als Kinder gequält! Nicht wahr, Antonietta? Er ist durch und durch Musiker und spielt fast alle Instrumente. Vielleicht wäre er in einer großen Stadt berühmt geworden. Aber er hat kein rechtes Glück gehabt, bis er seine Frau gefunden hat, die in sein armseliges Zigeunerleben ein bißchen Ordnung bringt.“
„Ich will später nach ihr sehen“, sagte Antonietta hilfsbereit.
Stasia, die sich bei diesen Gesprächen langweilte, hatte sich mit einem Glas Eispunsch auf den Diwan zurückgezogen und löffelte, nachlässig in den Kissen liegend, die süße Zwischenspeise, bis die Schüsseln mit den Backhühnern aufgetragen wurden.
Am nachmittag fuhren die Gäste in der Amadéschen Galakarosse auf ein Nachbargut zum Croquetspiel, das als letzte Modeneuheit auf vornehmen Landsitzen eingeführt worden war. Teresa setzte indessen mit Hilfe ihrer Dienerschaft, einen selten benützten Saal instand. Niemand betrieb derlei Vorbereitungen besser als Sepp Knöll, der junge Kellermeister, der sich nebenbei mit Blumenzucht beschäftigte und seine schönsten blühenden Kamelien- und Rhododendronstöcke herbei trug. Er baute auch eine Art von Verschlag für die Musiker auf, nagelte pompösen Samt darüber, kletterte auf Leitern, fuhr respektvoll zart mit dem Staubwedel über die Familienbilder und stand schließlich eine Zeitlang nachdenklich vor dem lebensgroßen Porträt des vor zehn Jahren verstorbenen Barons Joseph Amadé, der im grünen, verschnürten Rock der achtundvierziger Jahre, mit schwarzgelocktem, über dem linken Ohr gescheitelten Haar und martialisch wildem Schnurbart abkonterfeit worden war. Sepp wußte vom Hörensagen, daß sich der Baron in Wien als Revolutionär verdächtig gemacht hatte, und daß das Leben Amadés nur durch ein persönliches Gnadengesuch seiner außerordentlich schönen Gattin gerettet worden war. Und Antonietta, die Tochter dieses Mannes hatte sich, wie Sepp es ahnte, in einen kaiserlichen, österreichischen Offizier verliebt, würde ihn heiraten und vielleicht gar ihren Wohnsitz in Sepps Vaterstadt, in Wien, nehmen. Schwer vermißte er hier im ungarischen Tiefland die sanften Hügel des Wiener Waldes, die Föhrenwälder um Mödling. Dort lag sein geliebter Garten. Dort stand sein Häuschen, das er an Sommergäste vermietet hatte, um in den Dienst der Baronin zu treten. Hier in Ungarn gab es eine heißere, gnadenreichere Sonne, eine fruchtbarere Scholle, doch Sepp sehnte sich zuweilen unbändig nach der Heimat. Und diese Sehnsucht lag ihm wohl von seiner Mutter her im Blut.
Baronin Teresa hatte, nach einen Umweg über die Küche, in welcher die Mehlspeisköchin Torten mit kunstvollen Glasuren herstellte, an die Zimmertüre Don Carlos geklopft, und hatte ihn bei einer Pfeife gewöhnlichen Knasters und der Lektüre des Seneca überrascht. Er erhob sich und bot ihr den Platz in seinem Lehnstuhl an, aber sie zog für sich ein Tabouret herzu und setzte sich ihm gegenüber. Er merkte an ihrem Schweigen, daß sie etwas auf dem Herzen hatte.
„Un affare serio“, sagte sie endlich, „eine ernste Sache, cugino! Wenn Falco noch ein Jahr bei Stasia bleibt, wird kein richtiger Mensch aus ihm. Er ist jetzt schon ein kleines Ungeheuer.“
„Ebbene. So müssen wir eben einen Menschen aus ihm machen! Einen Menschen, der auf den Namen Casalanza Anspruch erheben darf. Soweit das bei einem Sohne Stasias möglich sein wird.“
„Du hast eine Antipathie gegen Stasia ...“ „Bada! Sie ist Kwiecinskis Schwester. Schau dir doch den lieben Casimiro an! Un’ affarista! Ein Nutznießer und Schmarotzer! Ein Haus der Wohlfahrt, wie das deinige, zieht solches Gelichter an. Ich sehe dich und Antonietta ungern in dieser Gesellschaft. Antonietta, das unschuldige Kind.“
„Willst du ihren Ehebund segnen, cugino?“
„Mit dem blonden Oberlieutenant?“
„Baron Lambrecht.“
„Ich ahnte etwas. Warum muß es ein Offizier sein und noch dazu ein Tedesco? Ich weiß, was du entgegnen willst: tadellose Familie, etwas Vermögen, in Wiener Neustadt akademisch ausgebildet, strenge Zucht, gute Manieren, alles recht gut, aber doch — ein Fremder.“
„Antonietta liebt ihn.“
„Sie könnte es sich doch noch überlegen.“
„Soll ihr das Herz brechen? Ich will nicht, daß mein Kind unglücklich wird.“
„Es ist die erste Liebe. Das gibt sich.“
„Gerade die erste Liebe opfert man am schwersten und vergißt man niemals.“
„Teresa?“
„Wir sind darüber hinaus, doch möchte ich sorgen, daß wenigstens Antonietta das Glück in ihrer Liebe finde.“