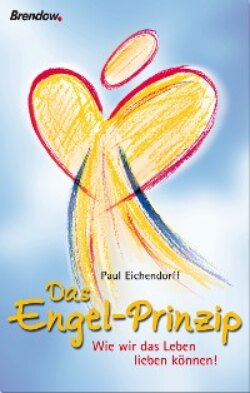Читать книгу Das Engel-Prinzip - Paul Eichendorff - Страница 8
Raus aus dem Leistungsprinzip
ОглавлениеKürzlich habe ich meinen alten Bekannten Martin getroffen.
»Na, wie geht’s?«, fragte ich ihn, als wir uns auf der Straße begegneten.
»Gut, danke«, antwortete Martin, »ich habe da gerade einen Spitzenauftrag an Land gezogen.«
»Glückwunsch«, sagte ich.
Wir plauderten dann noch ein wenig über seinen Coup und verabschiedeten uns recht schnell wieder voneinander.
Normalerweise hätte ich über die Begegnung nicht weiter nachgedacht. Warum auch? Was soll denn Besonderes daran sein?
Die Antwort ist: überhaupt nichts!
Und genau das ist das Besondere daran.
Die meisten von uns beantworten nämlich die Frage danach, wie es uns geht, stets mit einer Aussage über das, was wir tun. Wir würden oft gar nicht erst auf die Idee kommen, auf ein »Wie geht’s?« in uns hineinzuhorchen und eine echte Auskunft über das zu geben, was uns wirklich bewegt und ausmacht.
»Natürlich nicht!«, höre ich schon die Protestrufe. »Das würde unseren Gesprächspartner ja auch völlig überfordern!« Und es ist wahr. Hätte Martin auf meine Frage entgegnet, dass es ihm gut geht, weil er sich mit sich selbst gerade einfach pudelwohl fühlt, hätte ich das zumindest ungewöhnlich gefunden. Wahrscheinlich sogar etwas befremdlich.
Wir sind durch die Generationen so geprägt, dass wir uns in erster Linie über das definieren, was wir leisten. Ob wir uns gut oder schlecht fühlen, hängt vor allem davon ab, ob wir in unseren eigenen und den Augen der Gesellschaft erfolgreich sind. Dabei geht es natürlich nicht nur um Aufträge und berufliche Fortschritte. Je nach Persönlichkeit, kann die Erfolgsdefinition auch abhängig sein vom perfekten Körper, vom teuren Auto oder der Beliebtheit im Freundeskreis. Und auch Verhaltensweisen, die im ersten Moment nur positiv erscheinen, können in Wahrheit Masken sein, die wir aufsetzen, um zu gefallen. »Ich will immer fröhlich wirken, weil die Menschen mich sonst nicht mehr mögen«, kann ein solches Muster sein. Oder: »Ich teile grundsätzlich die Meinung der anderen, damit ich nicht anecke.«
Was auch immer Ihr Wertemaßstab ist, unter dem Strich kommt dasselbe heraus: Wir sehnen uns nach Wertschätzung für das, was wir leisten.
Nicht für das, was wir sind.
Als ich studierte, hatte ich eine Kommilitonin namens Sandra. Sie war eine durchschnittlich hübsche junge Frau, sympathisch, aber nicht weiter auffällig. Wir sahen uns gelegentlich, hatten einige gemeinsame Kurse, aber ich habe sie eigentlich nicht weiter beachtet und auch sonst zeigte kaum jemand gesteigertes Interesse an ihr.
Das änderte sich schlagartig, als in der Uni-Zeitung ein Bericht über sie veröffentlicht wurde. Während wir anderen Studenten nebenbei kellnern gingen oder Zeitungen austrugen, war sie, so erfuhren wir überrascht aus dem Artikel, Synchronsprecherin beim Fernsehen. Und mehr noch: Sandra war sogar die deutsche Stimme einer der beliebtesten amerikanischen Serien-Darstellerinnen überhaupt. Heiliger Strohsack! Wir hatten ja keine Ahnung gehabt!
Und plötzlich sahen wir unsere vermeintliche Durchschnitts-Kommilitonin mit ganz anderen Augen. Plötzlich schauten wir uns nach ihr um, wollten mit ihr ins Gespräch kommen und nahmen ihre Meinung ernst. Sie schien uns sogar attraktiver als vorher und gehörte über Nacht zu den beliebtesten Frauen der Uni.
Dabei hatte Sandra sich ja gar nicht verändert. Sie war die Gleiche, die sie auch vorher gewesen war. Aber auf der unsichtbaren Skala in unseren Köpfen, die den Wert eines Menschen an Äußerlichkeiten misst, war sie durch diese neue Information doch rasant nach oben geschnellt.
Diese Werteskala, mit der wir Menschen taxieren, steckt in jedem von uns. Oft ganz unbewusst ordnen wir neue Bekanntschaften in dieses Raster ein: Wie erfolgreich ist mein Nachbar? Wie wortgewandt der neue Kollege? Wie attraktiv die Verkäuferin in der Bäckerei?
Wir geben den Menschen um uns herum einen Wert, der eindeutig von den Idealen unserer Gesellschaft und unserer persönlichen Wahrnehmung abhängig ist.
Und wir vergleichen auch unseren eigenen vermeintlichen Wert mit dem, den wir auf diese Weise unseren Mitmenschen zugeordnet haben.
Wenn jemand innerhalb dieses Leistungssystems einen scheinbar höheren Wert hat, als wir selbst, entstehen entweder Neid und Konkurrenzdenken oder Bewunderung und der Wunsch, von diesem Menschen anerkannt zu werden, um von seinem »Glanz« etwas abzubekommen und darin selbst ein wenig baden zu können.
Damals an der Uni waren wir alle jedenfalls plötzlich wahnsinnig stolz darauf, von Sandra angelächelt zu werden. Mit ihr ins Gespräch vertieft gesehen zu werden, sorgte dafür, dass auch die eigene Beliebtheit größer wurde. Also versuchten eine Menge Leute, sich mit ihr ins Gespräch zu vertiefen! Auch wenn wir eigentlich total langweilig fanden, was sie zu sagen hatte. Aber dann später zu erzählen: »Jaja, als ich vorhin mit Sandra gesprochen habe, da hat sie gesagt …«, und die bewundernden Blicke der anderen dafür zu ernten, war wie eine wunderbare Selbstwert-Spritze für die eigene Seele.
Rückblickend erscheint mir diese Anekdote aus der Uni eigentlich ziemlich albern. Einerseits. Ich sage mir, dass wir damals eben jung waren und ich inzwischen ja viel reifer geworden bin und die Dinge natürlich längst ganz anders sehe. Ich tröste mich damit, dass es mir jetzt wohl egal wäre, ob irgendeine Bekannte einen tollen Job hat oder nicht.
Aber dann ist da das Andererseits. Und das hält mir vor Augen, dass ich zwar tatsächlich älter und hoffentlich auch wirklich etwas weiser geworden bin, aber dass diese merkwürdige Skala in meinem Kopf nach wie vor ganz schön aktiv ist, auch wenn sie inzwischen vielleicht nicht mehr nach exakt denselben Prinzipien arbeitet. Und dass sie weiter dafür sorgt, dass ich nicht nur andere Menschen, sondern auch mich selbst immer wieder vorschnell mit einem zweifelhaften, weil sehr oberflächlichen, »Wert« versehe.
Es gibt wohl kaum jemanden, der von sich behaupten kann, von dieser Art des Leistungsdenkens frei zu sein. Mal ehrlich: Wer von uns würde wohl einem verlausten Obdachlosen auf der Straße die gleiche Wertschätzung entgegenbringen wie einem offensichtlich erfolgreichen, millionenschweren Manager?
Wenn wir gefragt würden, welches Leben wir gern führen wollen – das des Obdachlosen oder das des Managers –, würden wir auch nur eine Sekunde lang zögern?
Würden wir die Gegenfrage stellen, wer von den beiden denn glücklicher ist? Mal ehrlich: Höchstwahrscheinlich nicht.
Wir gehen davon aus, dass Glück daraus entsteht, anerkannt zu sein. Wir nehmen, ohne tiefer darüber nachzudenken, an, dass der Manager der Glücklichere ist. Schließlich hat er Geld, Macht, Einfluss und die Bewunderung vieler Menschen. Er ist ganz offensichtlich einer der Gewinner unserer Leistungsgesellschaft. Und auf unserer inneren Werteskala scheint damit merkwürdigerweise auch festgelegt, dass dieser Mensch deshalb wohl auch glücklich sein muss.
Und wir glauben außerdem sofort fest daran, dass auch wir glücklicher wären, wenn wir »mehr« hätten. Mehr von den Faktoren, die uns scheinbar besser, wichtiger und liebenswerter machen. Nein, das muss nichts mit Reichtum zu tun haben. Es gibt eine gigantische Auswahl an erstrebenswerten Zielen in unserem »Leistungsland«.
Vor einigen Jahren ist eine meiner Nichten an Magersucht gestorben. Lilly war als Jugendliche etwas pummelig, dann, in den Teenagerjahren, hat sie enorm abgenommen. Ich habe ihre Gewichtsschwankungen und ihr ganzes Leben nur aus der Ferne beobachtet, wir sahen uns eigentlich nur etwa ein- oder zweimal im Jahr auf Familienfesten. Trotzdem hatte ich irgendwann im Laufe der Jahre die Gelegenheit, ein Gespräch mit ihr alleine zu führen.
»Entschuldige, Lilly«, sagte ich vorsichtig, »du bist ganz schön dünn geworden …«
»Und?«, reagierte sie misstrauisch.
»Warum hast du so abgenommen?«, fragte ich sie ganz direkt.
Und bekam eine ebenso direkte Antwort:
»Weil niemand fette Frauen mag!«
Drei Jahre später ist Lilly tragischerweise gestorben. Sie hat sich zu Tode gehungert. Dahinter stand der übertriebene Wunsch, anerkannt zu werden. Auf Lillys Werteskala hatten sich die Maßstäbe so krankhaft verschoben, dass am Ende nur noch die Frage nach Aussehen und Gewicht zählten.
Die arme Lilly ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber eines von vielen, die deutlich machen, wie das Leistungsdenken unsere Herzen verändern und schließlich wirklich kaputt machen kann.
Nein, zugegeben, die meisten Menschen sterben natürlich nicht gleich an den Folgen dieses verdrehten Wertesystems.
Aber sie leben auch nie wirklich.
Viele Frauen nehmen wahre Höllenqualen auf sich, um dem Schönheitsideal der Models auf den Titelseiten der Zeitschriften zu entsprechen, viele Männer sind begieriger hinter einem Porsche und einem »dicken Konto« her, als der sprichwörtliche Teufel hinter einer armen Seele. Wir versuchen vergeblich, unsere inneren Löcher mit Äußerlichkeiten zu füllen. Wir wollen immer mehr, wir setzen alles daran, unseren vermeintlichen Image-Wert zu steigern, und verlieren dabei das Wesentliche, nämlich unser eigentliches Selbst, aus den Augen.
Doch die Wahrheit ist: Je mehr wir uns darauf einlassen, uns von diesen verzerrten Erfolgsmaßstäben dirigieren zu lassen, desto unglücklicher werden wir! Je mehr wir darauf aus sind, »besser« zu werden, müssen wir einsehen, dass es immer jemanden gibt, der noch »besser« ist. Und dieser Jemand wird dann plötzlich zu einem Vor- oder einem Feindbild, das es zu übertreffen gilt.
Immer weiter begeben wir uns damit in eine Spirale, die uns unweigerlich und rasant nach unten zu ziehen vermag.
Ein weiteres, erschreckendes Beispiel dafür ist die steigende Zahl von Burnout-Patienten. Experten gehen mittlerweile davon aus, dass in einigen Jahren 15 bis 20 % der Bevölkerung unter dem Erschöpfungszustand des Burnout-Syndroms leiden werden. Viele dieser Menschen sind, zumindest anfangs, davon getrieben, mehr leisten zu wollen. Sie sind von dem Wunsch gesteuert, mehr erreichen, mehr verdienen, mehr Anerkennung erfahren zu »müssen«. Und noch kurz bevor der Zusammenbruch kommt, glaubt ein Großteil der Betroffenen, glücklich werden zu können, wenn sie nur dieses eine, nächste Ziel erreichen.
Genauso wie Lilly bis zuletzt glaubte, dass nur »dieses eine Kilo zu viel« dem Glück noch im Wege stünde.
Wir haben uns offensichtlich von diesem unsichtbaren Image-Wert-System abhängig gemacht. Es legt fest, wie glücklich wir eigentlich sein »dürfen«.
Unsere Wahrnehmung, unsere Wünsche und unser Handeln sind längst von diesen selbstgemachten Regeln geprägt: Leistungsdenken, Neid und dem Streben nach Anerkennung durch Erfolg.
Die unmittelbare Folge ist, dass viele von uns mit Leib und Seele einer grundsätzlich negativen und selbstzerstörerischen Fühl- und Denkweise zum Opfer gefallen sind:
»Wenn ich nicht das habe, was der und der hat, werden die Menschen mich nicht mögen. Wenn ich nicht so hübsch aussehe wie die und die, werden sie mich nicht lieben. Wenn ich nicht so reich bin wie der und der, halten die Leute mich bestimmt für einen Versager.«
Wir definieren uns meist über das, was die Welt in uns sieht. Und die Sehnsucht, die hinter all dem steckt, und die wir ja alle in uns tragen, ist »einfach geliebt zu sein«.
Wir suchen auf diese Weise unser Glück. Aber in diesem Teufelskreis aus falschen Vorstellungen werden wir es leider nicht finden.
Der Haken bleibt nämlich: Auch wenn wir denken, wir seien damit auf dem Weg zu mehr Glück, führt diese Denkweise des »Mehr-Erreichen-und-Haben-Müssens« in Wirklichkeit zu immer mehr Unzufriedenheit und Unglück, mehr Leere und Unsicherheit. Der Psychotherapeut und Sozialwissenschaftler Erich Fromm hat es in seinem berühmtesten Buch mal auf den Punkt gebracht: Es geht bei der Suche nach dem inneren Glück, der Lebensliebe, gar nicht ums »Haben«. Es geht ums »Sein«.
Dummerweise hat der Wunsch nach der Anerkennung der »anderen« viele von uns längst ängstlich gemacht:
Wir fürchten, nicht mehr dazuzugehören und aus der Geborgenheit der Gruppe herauszufallen. Das, was alle erstreben, »muss ja wohl irgendwie erstrebenswert sein, sonst hätte doch wohl längst mal irgendjemand auf die Bremse getreten«. Oder?
Aber dieser »Irgendjemand« sind wir in Wirklichkeit selbst. Ebenso wie wir ja auch die »anderen« sind (nämlich aus der Sicht aller anderen!). Solange wir also nicht selbst auf die Bremse treten, geht die Fahrt einfach in halsbrecherischem Tempo weiter.
Geben wir es zu: Der Leistungsdruck, unter dem wir uns täglich bewegen und der uns so oft zu zermalmen droht, ist selbstgemacht.
Noch ein kleines Beispiel dazu aus meinem Leben: Als Junge hatte ich einen Freund, Mike, der ein ziemlicher Rabauke war. Er war in unserer Schule sehr angesehen, weil er sich freche Sachen traute, die sonst keiner machte. Er war beliebt, weil er ein »harter Kerl« war und weil alle Respekt vor seinen Respektlosigkeiten hatten. Eigentlich steckte dahinter nichts als Angst. Also war er beliebt, obwohl, oder gerade weil er eigentlich unbeliebt war! Eines Tages überredete er mich, im Schultreppenhaus einen mit Wasser gefüllten Luftballon auf unseren Physik-Lehrer fallen zu lassen. Ich machte mit, weil ich auf die Anerkennung von Mike und den anderen Jungs hoffte. Der Luftballon fiel und platzte mit Karacho auf der Anzugjacke des armen Lehrers. Ich wurde erwischt und bekam mächtigen Ärger. Der Schuldirektor kam sogar zu uns nach Hause und führte ein ernstes Gespräch mit meinen Eltern. Anschließend fragte meine Mutter mich mit sehr besorgter Miene:
»Meine Güte, wieso hast du das nur getan?«
Und ich antwortete kleinlaut:
»Naja, weil Mike es doch gesagt hat.«
Meine Mutter reagierte mit dem weltberühmten Spruch: »Und wenn Mike sagt ›Spring von der Brücke‹, springst du dann auch?«
Mir scheint, wir alle stehen mit Mike auf der Brücke und hoffen, dass er das mit dem Springen eben nicht sagt. Aber so ganz sicher können wir da nicht sein.
Nochmals: Tief in uns steckt diese Angst, nicht »dazuzugehören«, die Angst zu versagen, nicht mithalten zu können. Angst, nicht geliebt, nicht anerkannt, also nicht erfolgreich zu sein und deshalb unser persönliches Glück nicht finden zu können. Deshalb tun und erstreben wir Dinge, die eigentlich nur sehr wenig oder rein gar nichts mit uns selbst zu tun haben.
Tatsächlich funktioniert es aber genau andersherum: Nicht Erfolg macht glücklich, sondern: Glück macht erfolgreich. Nein, nicht unbedingt und nicht nur im geschäftlichen Sinne (obwohl auch das statistisch erwiesen ist). Auch nicht automatisch auf den Laufstegen der internationalen Modewelt, aber in unseren Herzen.
Wir können endlich »erfolgreich« darin sein, wir selbst zu werden.
Es macht nämlich glücklich, sich auf die »richtige Seite« zu stellen. Und die ist nicht unbedingt da, wo alle stehen. Die richtige Seite ist immer da, wo man selbst ist. Dazu gehört es, sich zu fragen: Bin ich einer, der von der Brücke springt, wenn Mike es sagt? Bin ich einer, der aus freien Stücken einen Wasserballon auf einen Lehrer werfen würde, wenn Mike es nicht sagt? Werden die Menschen mich tatsächlich mehr lieben, wenn ich fünfzehn Kilo weniger wiege? Wer bin ich eigentlich wirklich unter all diesem Druck des Gefallenmüssens? Wer sind wir alle? Eine Meute von Lemmingen, die als Grüppchen stets dem lautesten Blöken folgt? Oder sind wir Individuen, jeder Einzelne von uns mit einem wunderbaren und einzigartigen Wert versehen, der womöglich rein gar nichts mit dem Leistungsprinzip, nichts mit Schönsein, nichts mit tollen Aufträgen und schicken teuren Autos zu tun hat?
Ob sich diese Spirale des destruktiven Erfolgs-Denkens wohl umdrehen lässt? Einfach so? Können wir diese negative Weltsicht durch eine positive ersetzen?
Ja, wir können! Natürlich! Aber wie? Wie sollen wir das hinkriegen, wenn unsere Vorbilder – unsere Eltern, unsere Popstars, unsere Politiker, unsere Gurus – es uns seit Ewigkeiten anders vorleben?
Die Antwort kann nur sein: Suchen wir uns einfach andere Vorbilder! Wir brauchen dafür allerdings jemanden, von dem wir ganz sicher sein können, dass er nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Jemanden, der sich nicht über Leistung definiert. Jemanden, der selbstlos ist und der uns einfach nur Gutes will, ohne sich davon selbst Anerkennung oder Karrierechancen oder Ruhm zu versprechen.
Wir brauchen dafür einen Engel. Oder am besten: viele Engel.
* * *