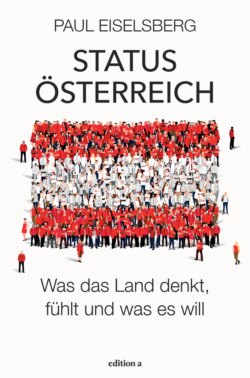Читать книгу Status Österreich - Paul Eiselsberg - Страница 7
Der Wandel und seine vielen Gesichter EIGENSTUDIE – AUGUST 2018
ОглавлениеSeit jeher sind wir Menschen dem Wandel unterworfen. Sei es beispielsweise die agrarische Revolution, als wir sesshaft wurden, seien es die Umwälzungen der industriellen Revolutionen. Jede dieser Epochen, aber auch die vielen Zeitalter dazwischen, brachten deutliche Veränderungen mit sich, hatten auch ihre ganz eigenen Herausforderungen, denen die Menschheit sich zu stellen, die sie zu meistern hatte – an denen sie wuchs und meist auch vorankam.
Ob in der Steinzeit, in der Antike, im Mittelalter oder heute, in der Moderne. Veränderte globale Rahmenbedingungen haben immer schon Anpassung bedeutet. Sich neu ausrichten im Leben. Und es scheint, als würden gerade die vergangenen Jahrzehnte, insbesondere aber die allerletzten Jahre, wie ein Teilchenbeschleuniger auf unsere Existenz einwirken. Wir schießen nur so durchs Leben in dieser immer noch rasanteren, noch komplexeren Welt. Eine Welt, die deshalb von vielen aber auch als zunehmend unsicher empfunden wird.
Für uns Meinungsforscher sind das ungemein spannende, aber auch ungemein fordernde Zeiten. Denn es gilt zu erforschen, in welchem Takt das Herz der Bevölkerung schlägt. Fragen wie diese beschäftigen uns daher: Wohin schlägt das Stimmungsbarometer der Österreicher heute, anno 2018, aus? Wenn die Menschen sich tatsächlich unsicher fühlen, woran liegt das? Wissen wir – egal, ob in der Politik, in der Wirtschaft oder auch in eigenen, privaten Belangen – überhaupt noch, was richtig oder falsch ist? Hat der Kompass unserer ganz persönlichen Orientierung seine Wirkung verloren? Wer ist davon wie stark betroffen?
Genau diesen Fragen wollen wir uns gleich ganz zu Beginn dieses Buches widmen.
Jeder Fünfte im Land klagt über eine generelle Orientierungslosigkeit, weiß nicht, was in der Politik, der Wirtschaft und in allgemeinen Lebensfragen richtig ist und was nicht. Weiteren 4 von 10 Österreichern ergeht es ähnlich, wenngleich in etwas abgeschwächter Form. Dennoch: Im Vergleich zu jenen, die einen fehlenden Halt in den Lebensfragen so gar nicht oder kaum ausmachen wollen, ist es eine absolute Mehrheit. Denn 6 von 10 Menschen sagen: Ja, wir haben die Orientierung verloren. Die Kompassnadel unseres Lebens schlägt auf eine Weise aus, dass wir nicht mehr so richtig sagen können, wo es langgeht, wohin uns das Leben noch führt – und wie wir damit umgehen, wie wir noch Leitlinien ausmachen sollen, an denen wir die dringlichen Fragen des Zusammenlebens in der Gesellschaft lösen können.
Betrachten wir die Ergebnisse nun durch die Lupe gesellschaftlicher Schichten. Die Männer empfinden diese Orientierungslosigkeit ganz ähnlich wie die Frauen. Den Jungen ergeht es ganz ähnlich wie den Alten. Einzig dort, wo die Bildung höher ist als im Schnitt, wissen Herr und Frau Österreicher etwas mehr mit dem komplexen Leben anzufangen, zeigen sich also etwas orientierter. Doch selbst in dieser höherstehenden Schicht ist es nicht so, dass jeder felsenfest mit beiden Beinen im Leben steht – das Maß der Orientierungslosigkeit ist nur nicht so voll wie bei den anderen.
Wie, haben wir IMAS-Forscher erst uns selbst und später auch die repräsentative Bevölkerung gefragt, sah es damit in der jüngeren Vergangenheit aus? Sagen wir, vor zehn Jahren? Vor allem in puncto Sicherheitsgefühl? War das damals auch schon so wie heute?
Auch hier liefern uns die Menschen der Alpenrepublik sehr klare Aussagen. Ja, sagt beinahe jeder Zweite (46 Prozent), in ganz persönlichen Lebenslagen empfinde ich weit weniger Sicherheit als noch vor zehn Jahren. Nur jeder Dritte (34 Prozent) vermeint keinerlei Veränderung zu verspüren, und nur rund jeder Achte nimmt für sich in Anspruch, sich heute sicherer zu fühlen als noch im Jahr 2008.
Auffällig dabei: Frauen, ältere Menschen über sechzig und jene mit einfacherer Schulbildung scheinen ihre Sicherheit überproportional stark verloren zu haben. Der Schluss, der sich daraus ziehen lässt: Wenn bereits die Hälfte der Bevölkerung allein den vergangenen rund zehn Jahren einen Verlust an Sicherheit attestiert, so dürfte dieses Gefühl im Verhältnis eines noch längeren Zeitraumes entsprechend steigen, das Unsicherheitsempfinden also im Vergleich zu vor zwanzig oder dreißig Jahren noch deutlicher ausgeprägt sein.
Und wie sieht es mit der gesamten Bevölkerung aus der Sicht des Einzelnen aus? Wie ergeht es also den anderen?
Die Zahlen der Erhebungen sind nicht minder eindeutig: Denke ich an die anderen, an alle Österreicher zusammen, so bin ich davon überzeugt, dass sie sich in persönlichen Lebenslagen unsicherer fühlen als noch vor zehn oder vielleicht zwanzig Jahren. 6 von 10 Menschen (58 Prozent) empfinden das genauso.
Besonders stark ausgeprägt ist dieses Empfinden bei den älteren Menschen, der Generation über sechzig. Nur rund jeder Vierte in Österreich meint hingegen: Nein, es ist wie immer. Wir fühlen uns nicht unsicherer als damals. Und überhaupt nur jeder Zehnte gab an, dass sich die Bevölkerung im Allgemeinen heute sicherer fühlen würde als früher.
Weniger Orientierung und mehr Unsicherheit. Damit geht also – empirisch unterlegt – der Wandel der österreichischen Gesellschaft zurzeit einher.
Also wollten wir es naturgemäß genauer wissen und gingen in die Tiefe. Dafür legten wir den eintausend Personen aller Altersgruppen und sozialen Schichten fünf Begriffspaare vor. Gegensatzpaare wie positiv/negativ, sicher/unsicher oder auch langsam/schnell. An ihnen, baten wir, sollten sie den Wandel in Österreich festmachen, indem sie auf einer siebenstelligen Skala Noten vergaben.
Sofort zu erkennen ist, dass das Tempo, mit dem der gesellschaftliche Wandel in den Augen der Bevölkerung voranschreitet, hoch ist. Sehr hoch. Im Vergleich zu den anderen vier Kategorien ergab sich hier mit der Durchschnittsnote 4, 9 der größte Wert.
Überrascht hat uns dieser Befund allerdings nicht – denn schon bei Untersuchungen in den vergangenen Jahren konnten wir das gleiche Bild erkennen.
Das Fazit daraus: Die Menschen empfinden eine starke Diskrepanz zwischen der gefühlten Geschwindigkeit des Wandels und jener, die sie gerne hätten. Das Tempo ist den meisten einfach zu hoch. Im Verhältnis 59 zu 12 überwiegt der Eindruck einer schnellen und nicht langsamen Welt.
Wer nun vermutet, das hätte vor allem mit zunehmendem Alter zu tun, geht fehl. Ohne die Studien zu kennen, würde man verständlicherweise davon ausgehen, dass die Jungen mit der Rasanz der gesellschaftlichen Entwicklung wesentlich entspannter oder professioneller oder wie immer umzugehen wüssten. Schließlich sind sie es, die damit aufgewachsen sind, die also eine andere Art von Leben gar nicht kennen.
Und doch zeigt sich: Wir alle, ob zwanzig oder siebzig, sehnen uns nach Entschleunigung. Die Bewusstseinsbilder im Bereich des aktuellen Gesellschaftswandels sind also querbeet durch alle Altersschichten ident. Es gibt kein Gefälle, wie man vielleicht vermuten könnte.
Auch bei dem Begriffspaar sicher/unsicher ergibt sich ein deutlicher und wenig überraschender Befund. Er bestätigt letztlich nur, was wir bereits bei der generell attestierten Orientierungslosigkeit und dem Gefühl wachsender Unsicherheit gehört haben. Nur jeder Vierte (27 Prozent) sagte hier, sich auf der sicheren Seite zu sehen. Im Verhältnis 51 zu 27 überwiegt die Unsicherheit gegenüber der Sicherheit.
Spannend ist natürlich auch die Frage, wie komplex wir Österreicher die Welt um uns herum empfinden. Überfrachtet sie uns zur Gänze? Oder ist alles ohnehin ganz einfach?
Die Grafik zur Grundstimmung zum Wandel zeigt es an: Die Komplexität überwiegt im Verhältnis 44 zu 26. Allerdings muss hier festgehalten werden, dass beinahe ein Drittel der Menschen (31 Prozent) sich nicht so recht im Klaren darüber ist, wohin das Pendel des persönlichen Empfindens ausschlägt. Komplex oder doch eher in Richtung simpel? Ein Viertel wiederum sagt, alles in allem ist der Wandel der Gesellschaft relativ einfach. Besonders stark empfinden erwartungsgemäß ältere Menschen die Komplexität der Veränderung. Und auch jene, die höchste Bildungsabschlüsse aufweisen.
Doch wohin geht dieser Wandel? In welche Richtung, oder anders gefragt: auf welcher Ebene spielt er sich ab? National oder eher international?
Bei dieser Frage sind sich die Österreicher so gar nicht im Klaren. Vielmehr ist es eine Art Pattstellung (38:34), mit leichter Tendenz in Richtung international. Betrachten wir das Ergebnis aus soziodemoskopischer Sicht, so sehen wir: Männer und höher gebildete Menschen neigen überdurchschnittlich dazu, den Wandel eher in den eigenen Gewässern zu verorten, also im Land selbst.
Allgemein kann gesagt werden: Globalisierung hin, Globalisierung her, der Megatrend scheint keinen entscheidenden Eindruck zu hinterlassen, was die Internationalität des Wandels betrifft. Auch nicht, dass der Fortschritt, die vielen Innovationen aus allen Himmelsrichtungen auf uns niederprasseln. Gehen wir in unserer Interpretation dieser Zahlen nun einen Schritt weiter, so könnten wir sagen: Wandel ist beides – national und international gleichermaßen. Er hat also mehr als nur ein Gesicht.
Komplex, unsicher, rasant – und in seiner Herkunft nicht klar einzuordnen. Nun könnte man meinen, dass bei dem Begriffspaar positiv/negativ auf der Hand liegt, wohin die Reise geht, wofür sich die österreichische Seele entscheidet.
Überraschenderweise ist das nicht der Fall. Trotz all der genannten Faktoren ist das generelle Empfinden der Menschen in Sachen Wandel mehrheitlich positiv. Und zwar nicht hauchdünn, sondern relativ eindeutig. 45 Prozent tendenziell positiv, 27 Prozent, ein starkes Viertel also, negativ. Wobei gesagt werden muss: Ein zweites starkes Viertel (28 Prozent) kann sich nicht so recht entscheiden, ob gut oder schlecht. Wenig überraschend hingegen, dass ein negatives Empfinden des Wandels eher bei Menschen über sechzig vorzufinden ist. Und bei jenen mit höherer Schulbildung.
Mit diesen Daten im Gepäck wollten wir dem Bewusstsein der Österreicher noch einen Schritt näherkommen. Wenn die Orientierungslosigkeit schon wächst und das Gefühl der Sicherheit sinkt – in welchen Lebensbereichen ist das wie stark? Gibt es Orte oder Situationen, wo wir uns sicher fühlen, wo wir Halt und Stabilität finden?
Durchaus, die gibt es, wie die Ergebnisse klar veranschaulichen. Familie ist so ein Ort, wo wir uns sicher fühlen. Aber auch die eigenen Überzeugungen sorgen für Halt. Das Wissen, welche Werte wir an unsere Kinder, an die nachfolgenden Generationen weitergeben und damit bewahrt sehen wollen. Beispielsweise eine gesunde Lebensweise. Eine klare Entscheidung zwischen Beruf und Familienorientierung.
In einer Hinsicht müssen die Ergebnisse aber etwas relativiert werden. Kein einziger Lebensbereich erreichte in der sogenannten Top-Box, der Rubrik »sehr sicher« also, die Zwei-Fünftel-Marke.
Sorgenfalten hingegen sind in den Gesichtern der Österreicher zu finden, wenn es um den Vertrauensverlust in die Politik geht. Hier ist das größte Gefühl von Unsicherheit und Unbehagen festzustellen. Immerhin sehen sich 4 von 10 Mitbürger als unsicher darin, welchem heimischen Politiker sie überhaupt noch Glauben schenken können. Nur die Älteren brechen diesen Trend und haben einen leicht positiven Saldo. Jene, die im Gegenzug uneingeschränkt Vertrauen in die Politik haben und die Note 1 von 7 vergeben, sind in einer verschwindenden Minderheit. Nur jeder Vierzehnte glaubt sehr sicher daran.
Die Gründe für dieses Misstrauen liegen ebenfalls auf der Hand: Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Parteien weder ihre Sorgen ernst nehmen noch ihre persönlichen Interessen mit Nachdruck vertreten. Der Vertrauensverlust in die Politik ist demnach relativ groß.
Aber auch die Verlässlichkeit der Medien lässt in den Augen der Menschen einiges zu wünschen übrig. Sowohl das Verhältnis zu den traditionellen, klassischen Medien wie auch jenes zu den neuen, sozialen scheint ins Schwanken geraten zu sein.
Stellt man nun einen direkten Vergleich in Sachen Glaubwürdigkeit an, so ergibt sich: Das Empfinden der Menschen im Land, Zeitungen, Radio oder Fernsehen Glauben schenken zu können, ist mit einem Verhältnis von 40 zu 35 gerade noch positiv.
Interessanterweise sind gerade die Jüngeren – die sogenannten Digital Natives – eher skeptisch, was die Glaubwürdigkeit der klassischen Medien betrifft. Und das, obwohl sie diese Medien gar nicht so intensiv und häufig nutzen wie ältere Menschen.
Ergänzend dazu haben wir auch die Internet-Nutzer befragt, was man in Social Media preisgeben soll und was nicht. Oder anders gesagt, wie sicher sich die Menschen dabei fühlen, wenn sie Informationen ins Netz stellen. Beinahe die Hälfte (48 Prozent) meinte, sie wäre davon überzeugt, es mehr oder weniger richtig zu tun. Nur jeder Vierte (26 Prozent) tendierte zum Gegenteil.
Überraschend aber auch dieser Trend – diesmal bei der Frage, ob man Gütesiegeln (vor allem bei Lebensmitteln) Vertrauen schenken könne. Immerhin ein Drittel ist davon ganz und gar nicht überzeugt (Note 5+6+7), 45 Prozent wiederum stufen diese Siegel als vertrauenswürdig ein. Dies ist insofern bemerkenswert, als die Befragten bei der Frage nach persönlichen Aspekten der Lebensführung (»Wie ich die Umwelt durch mein eigenes Verhalten schützen kann« oder auch »Wie ich gesund leben kann«) eindeutig Zuversicht und Klarheit an den Tag legten.
Bemerkenswert auch das Resultat auf die Frage, wie sicher sich die Menschen fühlen, wenn sie nachts alleine auf die Straße gehen: 56 Prozent fühlen sich (eher) sicher, 29 (eher) nicht.
So wenig die steigende Unsicherheit alle Lebensbereiche der Österreicher erfasst, so einfach ist es auch nicht, die ebenfalls steigende Orientierungslosigkeit auf alle Lebenssituationen umzulegen. Dabei gilt es zu differenzieren. Denn im Leben von Herrn und Frau Österreicher gibt es ausgesprochen starke Orientierungspunkte. Und andererseits welche, die nur wenig Einfluss haben. Auch diesen Parametern in Sachen Orientierung wollten wir nachspüren.
Einmal mehr stehen auch hier die Familie, die eigene Sicht der Dinge und jene Werte, die wir Menschen in uns tragen und für die wir auch eintreten, an vorderster Stelle.
Auffällig ist dabei, dass Frauen häufiger die Familie als Ankerpunkt nennen. Die persönlichen Werte wiederum sind für die Generation über sechzig von besonderer Bedeutung. Komponenten wie Freunde, Ausbildung und Beruf folgen. Auch sie, scheint es, dienen (wenngleich etwas abgeschwächt) als Kompass fürs Leben.
Je weiter wir uns allerdings vom eigenen Umfeld wegbewegen, desto indifferenter werden die Begriffe in ihrer Bedeutung für uns. Sie verlieren an Wirkkraft, helfen uns nicht entscheidend bei der Suche nach dem richtigen Weg. Die klassischen Klammern früherer Generationen wie zum Beispiel die Kirche oder andere Glaubensgemeinschaften, aber auch politische Größen früherer Tage haben heute kaum noch wesentlichen Einfluss auf uns. Diese klassischen Klammern der Gesellschaft haben scheinbar ausgedient. Sie erfüllen ihre Funktion als Leuchttürme der Gesellschaft, die sie einmal waren, nicht länger – wenigstens nicht für eine Mehrheit oder für große Gruppen der Bevölkerung.
Es ist da eine Lücke entstanden, die auch das klassische Ehrenamt oder diverse Non-Profit-Organisationen nicht füllen können. Aus alledem lässt sich dieser Schluss ableiten: Der Rückzug in die eigenen vier Wände, hinter den eigenen Gartenzaun, das klassische Cocooning also, erfährt durch das vorherrschende Meinungsklima in Österreich zusätzlichen Antrieb. Er wird aber dadurch nicht bloß verstärkt, sondern oft erst ausgelöst.
Nicht unerwähnt darf in dem Zusammenhang auch dieser empirische Eindruck bleiben, der sich in den vergangenen Jahren eingestellt hat: Die Grundstimmung im Land ist zwiespältig. In der langfristigen Betrachtung und Perspektive überwiegt ein eher negatives Gefühl in Bezug auf die Gesellschaft. Manche haben dafür diesen Ausdruck parat:
Abstiegsangst.
Die tiefe Sorge also, dass wir den zweifelsohne hohen bis sehr hohen Lebensstandard auf Dauer nicht halten könnten. Immerhin denkt beinahe die Hälfte jener, die mit besonderer Sorge auf die kommenden zehn Jahre vorausblicken, dass sich ihre eigene finanzielle Situation entscheidend verschlechtern werde. Eine Grundhaltung, die naturgemäß in vielen Bereichen des täglichen Lebens mitschwingt, wie aus dem IMAS-Report 27/2016 hervorgeht.