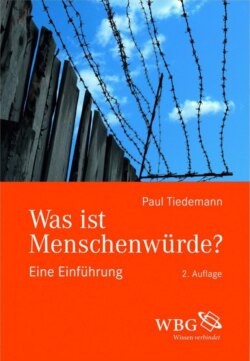Читать книгу Was ist Menschenwürde - Paul Tiedemann - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL I Wie die Menschenwürde ins Recht kam
ОглавлениеDas Wort „Menschenwürde“ (auch: Würde des Menschen, der Person, der Persönlichkeit, des Individuums oder das Adjektiv „menschenwürdig“) war vor dem zwanzigsten Jahrhundert weltweit nirgendwo Bestandteil der Sprache des Rechts. Es gehörte weder zum Sprachschatz der Gesetz- und Verfassunggeber noch zu dem der Rechtsgelehrten. Erstmals taucht der Begriff in Art. 151 der Weimarer Reichsverfassung von 1919 auf. Dem folgte die faschistische Verfassung Portugals von 1933 (Art. 6). Schließlich findet er sich noch in der Präambel der Verfassung Irlands von 1937. In allen drei Fällen steht der Begriff im Zusammenhang mit der Aufgabe des Staates, für Lebensverhältnisse zu sorgen, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Als Bedingung für diesen Zustand werden die ökonomischen Verhältnisse angesehen, sei es im Sinne der Gewährleistung des materiellen Existenzminimums (so die portugiesische Verfassung) oder sei es mehr im Sinne der Gewährleistung von Verteilungsgerechtigkeit (so die deutsche Verfassung). Eine wesentlich umfassendere Bedeutung erhält der Begriff der Menschenwürde erst mit seiner völkerrechtlichen Rezeption.
1. Vereinte Nationen
Die Charta der Vereinten Nationen
Der erste internationale Vertrag, der die Würde des Menschen erwähnt, ist die Gründungsurkunde (Charta) der Vereinten Nationen. In ihrer Präambel ist die Rede von
unserem Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Person.
Die Präambel und insbesondere die zitierte Passage gehen auf einen Vorschlag zurück, den der südafrikanische Ministerpräsident JAN CHRISTIAAN SMUTS (1870–1950) in die Beratungen der Charta auf der Gründungskonferenz von San Francisco (25. April bis 26. Juni 1945) eingebracht hat. In diesem Textvorschlag war von der Entschlossenheit der Hohen Vertragschließenden Parteien die Rede,
den Glauben an fundamentale Menschenrechte (fundamental human rights), an die Unantastbarkeit (sanctity) und an den höchsten Wert (ultimate value) der menschlichen Persönlichkeit (human personality) wieder herzustellen (re-establish).
Diesen Vorschlag nahm die Konferenz im Grundsatz an, verwies den Text aber an ein Redaktionskomitee, das ihn etwas eleganter fassen, inhaltlich aber nicht verändern sollte. Das Komitee legte eine leicht geänderte Fassung vor, in der das Wort sanctity durch dignity ersetzt, statt von ultimative value nur noch von value (später noch geändert in: worth) die Rede war und human personality durch every human being ersetzt wurde. Die geänderte Fassung wurde bis auf einen Punkt so akzeptiert. Nur hinsichtlich der Ersetzung von human personality durch every human being gab es noch eine Diskussion. Man einigte sich in diesem Punkt schließlich auf einen Kompromiss und ersetzte beide Vorschläge durch human person.
Die Entstehungsgeschichte zeigt, dass die Formulierung SMUTS’ abgesehen von diesem Punkt dem Sinn nach akzeptiert worden ist und man nur aus stilistischen und ästhetischen Gründen den Wortlaut modifiziert hat. Dies erlaubt folgende historische Auslegung der Würdeklausel in der Präambel der UN-Charta:
Das Wort dignity (Würde) ersetzt das Wort sanctity (Unantastbarkeit). Da diese Ersetzung nur aus stilistischen Gründen erfolgte, also den Sinn nicht verändern sollte, kann man schließen, dass für die Konferenz von San Fransisco die Begriffe Würde und Unantastbarkeit inhaltsgleich sind. Das deckt sich auch mit dem Sprachgebrauch von JAN SMUTS, der anlässlich einer Rede im Mai 1944 seinen Grundgedanken mit den Worten „the dignity of human personality“ ausgedrückt hat.
Die Endfassung setzt das Wort worth an die Stelle von value mit der Begründung, dass value eher auf ökonomische Zusammenhänge bezogen sei bzw. besser auf Sachen (material) passe als auf Menschen. Das zeigt, dass hier bewusst nicht von einem relativen Wert oder einem Tauschwert die Rede sein sollte. Gemeint ist mit worth vielmehr ein letzter oder höchster, unbedingter oder absoluter Wert. Nun sind allerdings dignity und sanctity ebenfalls Wertbegriffe. Auch sie verweisen auf einen letzten, höchsten oder absoluten Wert. Daraus folgt: dignity und worth sind zwei Wörter für den identischen Sinngehalt. Es handelt sich um ein klassisches Beispiel für eine Zwillingsformel, deren Funktion darin besteht, durch eine Verdoppelung des Sinngehalts denselben besonders zu betonen und in seiner Bedeutung hervorzuheben.
Von besonderem Interesse ist die Kontroverse um die Begriffe human personality bzw. every human being, die schließlich zu der Formulierung human person führte. Dem Redaktionskomitee kam es offensichtlich darauf an, klarzumachen, dass die Würde nicht nur jeder Persönlichkeit anhaftet, sondern jedem Menschen. Es rechnete also mit der Möglichkeit, dass man Persönlichkeit in einem einschränkenden Sinne verstehen kann, demzufolge nicht jeder Mensch auch schon eine Persönlichkeit ist. Tatsächlich stellte sich heraus, dass SMUTS bewusst den Begriff der Persönlichkeit gewählt hatte und dass er damit tatsächlich eine einschränkende Bedeutung verband. Denn der südafrikanische Ministerpräsident wollte diese Änderung nicht akzeptieren. Er sah offensichtlich mehr darin als bloß eine redaktionelle Korrektur. Vielmehr hatte die Klausel durch diese Änderung für ihn jetzt eine andere Bedeutung. Deshalb beklagte er sich darüber, dass er mit der Formulierung des Redaktionsausschusses sein „Baby“ nicht mehr wiedererkennen könne. Doch seine Forderung, es bei personality zu belassen, stieß auf unüberwindlichen Widerstand. Wohl zum Zwecke der Gesichtswahrung wurde schließlich vorgeschlagen, every human being durch human person zu ersetzen. Der Sache nach war damit SMUTS aber gescheitert. Denn wenn man auch in Frage stellen kann, ob jeder Mensch eine Persönlichkeit ist, so lässt sich doch schwerlich bestreiten, dass jeder Mensch eine Person ist. (Die Konferenz hatte Sonderprobleme wie den Status von Embryonen oder von Apallikern nicht im Blick!) Von einem menschlichen Wesen zu sagen, es sei eine Persönlichkeit, ist nicht dasselbe wie zu sagen, es sei eine Person. Vielmehr bezeichnet Persönlichkeit besondere Qualitäten, die nicht jeder Person zugesprochen werden. Das gilt nicht nur in der deutschen Sprache, sondern auch in der Verhandlungssprache, der sich insbesondere SMUTS bediente, also dem Englischen. So kann man etwa in der Encyclopedia Britannica zum Stichwort „personality“ nachlesen: „The characteristic way on which a particular individual thinks, feels, and behaves. Personality embraces a person’s moods, attitudes, and opinions and is most clearly expressed in his interactions with other people. Personality is those behavioral characteristics, both inherent and acquired, that distinguish each individual and are observable in his relations to the environment and to the social group.“
Vor diesem Hintergrund wird klar, warum SMUTS den Begriff der Persönlichkeit präferierte. Denn damit verbindet sich die Vorstellung einer besonders distinguierten Form von Menschsein, während Person jeder Mensch ist, zumindest aber jeder handlungs- und zurechnungsfähige Mensch. Das Menschsein und das Personsein konnte SMUTS der farbigen und schwarzen Bevölkerung seines Landes schwerlich absprechen, die Persönlichkeit schon. Das Wort Persönlichkeit hätte es erlaubt, das Würdekonzept von vornherein nur auf die weiße Rasse anzuwenden, die nach dem Glauben der Holländisch Reformierten Kirche, deren Geistlicher SMUTS einmal werden wollte, von Gott besonders ausgewählt und über alle anderen Rassen gesetzt worden ist. Indem SMUTS also von Persönlichkeit sprach, versuchte er, das Würdekonzept gleichsam rassistisch umzubiegen. Dieser Versuch ist gescheitert.
Eine besondere Bemerkung verdienen die Verwendung des Begriffs Glaube (faith) und die religiöse Begründung, die SMUTS für seinen Textvorschlag vortrug. Wenn man seinem Biographen KENNETH INGHAM glauben darf, sah sich SMUTS, der sich unter dem Einfluss seiner späteren Frau vom Studium der Theologie ab- und dem Jurastudium zugewandt hatte, wegen dieser Abwendung von seiner theologischen Berufung zeitlebens in besonderer Weise den Idealen der Humanität verpflichtet – soweit das eben mit seinem rassistischen Vorverständnis vereinbar war. Das erklärt die spezifisch religiöse Rede vom Glauben an die Menschenrechte und die Menschenwürde.
Die Zustimmung der Konferenz zu dieser religiösen Ausdrucksweise lässt sich allerdings nicht mit einem derartigen theologischen Hintergrund ihrer Teilnehmer erklären. Aufschluss gibt insoweit ein Statement des Vorsitzenden der Kommission I vom 15. Juni 1945, der die Präambel als die „Ideologie“ der zu gründenden internationalen Organisation bezeichnete und betonte, dass der Erfolg der neuen Organisation entscheidend von der weltweiten öffentlichen Meinung abhinge. Deshalb sei es wichtig, die Charta nicht nur so präzise zu formulieren wie irgend möglich, sondern vor allem in ihren ersten Zeilen eine Sprache zu finden, die Wärme und Einfachheit ausstrahlt und Anklang in den Herzen der Menschen findet. Es ging der Konferenz von San Francisco also um die durchaus kalkulierte Instrumentalisierung religiöser Rede zur emotionalen Mobilisierung der Weltöffentlichkeit und nicht um eine theologische Fundierung der Menschenrechte und der Menschenwürde.
Dabei ist dem Umstand Beachtung zu schenken, dass die Endfassung der Präambel nicht, wie der Entwurf der südafrikanischen Delegation, von einer Wiederherstellung (re-establish) des Glaubens spricht, sondern von einer Bestätigung oder Beteuerung (reaffirm). Es geht also nicht um die Erfindung und Postulierung eines Glaubens, der bis dahin nicht oder nicht mehr existierte, sondern um die Bekräftigung eines empirisch bereits vorhandenen Glaubens. Er findet seine Grundlage nicht in der Charta, sondern die Charta findet ihre Grundlage in diesem Glauben. Von einer Ideologie im Sinne einer manipulativen Doktrin könnte man nur dann sprechen, wenn es diesen Glauben tatsächlich gar nicht gibt; wenn er also eigentlich eine Erfindung ist, die mit den Mitteln der Charta erst propagiert und damit etabliert werden soll. Handelt es sich dagegen um einen Glauben, der tatsächlich tief im Bewusstsein der Menschen verankert ist, so ist gegen eine Instrumentalisierung zum Zwecke emotionaler Mobilisierung nichts einzuwenden. Der strategisch motivierte Appell an emotional tief verwurzelte Glaubensüberzeugungen ist ein zulässiges Mittel der Mobilisierung, sofern es um einen Glauben geht, den die Autoren und die Adressaten des Appells tatsächlich miteinander teilen.
Der Rekurs auf den Glauben an Menschenwürde und Menschenrechte war im Jahre 1945 alles andere als ein klarer und durchdachter, auf seine Tragfähigkeit hin erprobter Gedanke. Er war eine höchst amorphe und verschwommene Hoffnung, die sich mit der neuen Weltorganisation verband. Dies macht es einerseits verständlich, warum der Begriff der Menschenwürde in diesem Dokument nicht näher bestimmt oder gar definiert ist. Es macht aber andererseits auch deutlich, dass diese nähere Bestimmung keineswegs für alle Zeiten als ausgeschlossen galt. Vielmehr erwartete man eine Konkretisierung in dem Maße, wie sich die Hoffnung in der Wirklichkeit bewähren sollte.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Die UN-Charta sieht als eines ihrer Organe einen Wirtschafts- und Sozialrat vor, der unter anderem auch Empfehlungen abgeben kann, um die Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern (Art. 62 Abs. 2 UN-Charta). In diesem Zusammenhang kann er auch Übereinkommen entwerfen und der Generalversammlung vorlegen (Art. 62 Abs. 3 UN-Charta). Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe kann er eine spezielle Kommission einsetzen (Art. 68 UN-Charta). Dem kam der Wirtschafts- und Sozialrat schon bald nach Inkrafttreten der UN-Charta durch die Schaffung der UN-Menschenrechtskommission nach, die den Auftrag erhielt, eine International Bill of Human Rights auszuarbeiten. Diese sollte neben einer allgemeinen Erklärung zur theoretischen Definition der Menschenrechte einen verbindlichen Vertrag enthalten sowie ein internationales Überwachungsverfahren. Da schon bald erhebliche Divergenzen über die rechtliche Verbindlichkeit eines solchen Vertragswerks aufkamen, konzentrierte sich die Kommission zunächst auf die Ausarbeitung einer theoretischen, rechtlich nicht verbindlichen Erklärung, die als Resolution der Generalversammlung verabschiedet werden sollte. Aus dieser Arbeit ging die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) hervor, die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit 48 Stimmen bei 8 Stimmenthaltungen und ohne Gegenstimme angenommen worden ist.
Die AEMR widmet der Menschenwürde in der Präambel zwei Absätze und außerdem im Regelungsteil den ersten Artikel. Während die Präambel im fünften Absatz die Formel aus der Präambel der UN-Charta von dem Glauben an die grundlegenden Menschenrechte und an die Würde und den Wert der menschlichen Person wiederholt und damit die Kontinuität zwischen der UN-Charta und der AEMR aufzeigt, bringt sie im ersten Absatz einige Präzisierungen. Dort heißt es:
Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet …
Weitere wichtige Bestimmungen zum Begriff der Menschenwürde finden sich in Artikel 1 AEMR. Dort heißt es:
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Die Menschenrechtskommission schuf ein Drafting Committee, dem unter der Leitung von ELEANORE ROOSEVELT insgesamt acht Mitglieder angehörten. Dieses Komitee richtete eine Arbeitsgruppe ein, die aus dem Franzosen RENÉ CASSIN, dem Libanesen CHARLES MALIK und dem Briten GEOFFREY WILSON bestand. Die Arbeitsgruppe beauftragte CASSIN mit der Ausarbeitung eines Entwurfs. CASSINS Entwurf enthielt folgenden ersten Artikel:
Alle Menschen (men) sind als Mitglieder einer Familie frei, sie besitzen gleiche Würde und Rechte, und sollen einander als Brüder betrachten.
Die Arbeitsgruppe fügte auf Anregung von CHARLES MALIK „Ausgestattet mit Vernunft“ ein und fand schließlich folgende Formulierung:
Alle Menschen (men) sind Brüder. Ausgestattet mit Vernunft und als Mitglieder einer Familie sind sie frei und besitzen gleiche Würde und Rechte.
Im Drafting Committee wurde dieser Entwurf der Arbeitsgruppe geringfügig umformuliert, vor allem aber um den Gedanken ergänzt, dass der Mensch nicht nur mit Vernunft, sondern auch mit Gewissen ausgestattet sei. Dieser Vorschlag geht auf den Chinesen CHANG zurück. CHANGS Vorschlag basierte auf einem chinesischen Wort, das wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie „Zwei-Mensch-Neigung“ oder „Bewusstsein des Mitmenschen“ bzw. Mitgefühl. In der Debatte um diesen Punkt betonte Malik, das „A und O“ des ganzen Menschenrechtskonzepts sei die Würde des Menschen, die auf seiner Vernunft und seinem Gewissen beruhe. Das Drafting Committee legte der Kommission schließlich folgende Fassung vor:
Alle Menschen (men) sind Brüder. Ausgestattet mit Vernunft und Gewissen sind sie Mitglieder einer Familie. Sie sind frei und besitzen gleiche Freiheit und Würde.
Die Kommission beschäftigte sich mit dem Entwurf während ihrer zweiten Sitzungsperiode im Dezember 1947 in Genf. Sie bildete erneut eine Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von ELEANORE ROOSEVELT, der auch CASSIN als Berichterstatter angehörte. Die Arbeitsgruppe kritisierte den Satz, dass alle Menschen Brüder seien, zum einen unter Hinweis darauf, dass diese Aussage religiös und philosophisch zu voraussetzungsvoll sei, zum anderen, dass sie zu abstrakt sei. Der sowjetische Delegierte BOGOMOLOW schlug stattdessen vor, es solle besser von einer Pflicht zur Brüderlichkeit gesprochen werden. Im Übrigen hielt er den ganzen Text wegen seiner philosophischen und religiösen Konnotationen für zu abstrakt, zu pompös und lächerlich. Er wollte ihn ersatzlos gestrichen haben.
CASSIN erarbeitete zusammen mit dem philippinischen Delegierten CARLOS P. RÓMULO schließlich eine neue Formulierung aus, die einen Teil der Einwände berücksichtigte, die dann von der Kommission bei 5 Enthaltungen ohne Gegenstimme angenommen wurde:
Alle Menschen (men) sind frei und gleich geboren in Würde und Rechten. Sie sind von Natur aus (by nature) ausgestattet mit Vernunft und Gewissen und sollen einander behandeln wie Brüder.
BOGOMOLOWS grundsätzliche Bedenken gegen die Aufnahme philosophischer, religiöser oder ideologischer Grundprinzipien in die Deklaration wurden von vielen Mitgliedern der Menschenrechtskommission geteilt. Diese Bedenken hatten noch dadurch Gewicht erhalten, dass die UNESCO im Jahre 1947 eine theoretische Untersuchung über die Grundlagen einer universalen Menschenrechtserklärung durchgeführt hatte und zu diesem Zweck insgesamt 150 Philosophen, Sozialforscher, Juristen und Schriftsteller aus aller Welt zu den philosophischen und weltanschaulichen Voraussetzungen der Menschenrechte befragt hatte. Das Ergebnis wurde der Menschenrechtskommission im Sommer 1947 vorgelegt, wobei der Direktor der UNESCO seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, dass das Papier hilfreich sein könne, um Klarheit in die Debatten zu bringen und den Grund zu legen für ein konstruktives Übereinkommen. Die Kommission betrachtete das Papier aber keineswegs als hilfreich. Denn es dokumentierte im Kern, dass es über die Frage der Menschenrechte zahlreiche grundlegend verschiedene und sich widersprechende Konzepte gab, in deren Offenlegung man eher ein Hindernis auf dem Weg zu einer gemeinsamen Erklärung sah denn eine Hilfe. Sie hielt das Dokument daher unter Verschluss. Es wurde erst 1949, also nach Verabschiedung der AEMR, von der UNESCO selbst veröffentlicht.
In den ersten Monaten des Jahres 1948 gingen bei der Menschenrechtskommission noch eine Reihe von Änderungswünschen ein. Brasilien wandte sich gegen die Formel „sollen einander behandeln wie Brüder“ mit der Begründung, dass dies eine Pflicht impliziere und es bei den Menschenrechten eben um Rechte und nicht um Pflichten gehe. Dagegen forderte Neuseeland eine Formulierung, in der von der Bindung der Menschen untereinander als Brüder durch Pflichten die Rede war. Letztlich folgte die Kommission jedoch einem Vorschlag des Wirtschafts- und Sozialrates, der die Bindung an Pflichten eher abschwächen sollte durch die Formulierung „sollen einander behandeln im Geiste der Brüderlichkeit“.
Es ist interessant zu sehen, dass viele Delegierte im Laufe der Beratungen widersprüchliche Forderungen erhoben. Das deutet darauf hin, dass den Schöpfern der AEMR bei der Idee der Menschenrechte, denen sie Ausdruck verleihen wollten, noch vieles äußerst unklar war. So kritisierte beispielsweise die brasilianische Delegation den „philosophischen und mystischen Charakter“ des Artikels 1 und forderte zugleich einige Zeit später, die Legitimation der Menschenrechte auf Gott zurückzuführen und nicht darauf, dass die Menschen mit Vernunft und Gewissen ausgestattet seien. Denn „unglücklicherweise [seien] keineswegs alle Menschen mit Vernunft und Gewissen ausgestattet“. Der chinesische Delegierte CHANG, der entscheidend die Bezugnahme auf Vernunft und Gewissen als Grundlage der Menschenrechte mitgestaltet hatte, forderte später die ersatzlose Streichung dieser Formulierung, weil dadurch gerade jene philosophischen Überzeugungen Eingang in die Deklaration fänden, über die eine Einigung nicht möglich sei. Dem widersprach der Libanese MALIK, der betonte, dass es nun einmal Vernunft und Gewissen seien, die den Menschen vom Tier unterschieden. Damit konnte er CHANG überzeugen und sogar der sowjetische Delegierte PAWLOW stimmte der Auffassung MALIKS zu, forderte aber, keine Aussage darüber zu machen, wer oder was den Menschen mit Vernunft und Gewissen ausgestattet habe. Der Ausdruck „durch die Natur“ (by nature) sollte ebenso vermieden werden wie eine Bezugnahme auf Gott.
Während ihrer dritten Sitzungsperiode im Mai/Juni 1948 nahm die Menschenrechtskommission diese Anregungen und Forderungen teilweise auf und änderte die Formulierung noch in zwei Punkten ab. Das Wort „men“ wurde durch „human beings“ ersetzt und „like brothers“ wurde ersetzt durch „in the spirit of brotherhood“. „By nature“ blieb jedoch zunächst erhalten. So legte die Menschenrechtskommission den Entwurf dem Wirtschafts- und Sozialrat vor, der ihn am 25. und 26. August 1947 beriet und dann unverändert an die Generalversammlung weiterleitete, die zunächst wiederum einen Ausschuss damit befasste.
Dieser Ausschuss benötigte für die Diskussion des Artikels 1 allein sechs Sitzungen, mehr als zu jedem anderen Artikel des Entwurfs. Die meisten Delegierten aller 58 UN-Mitglieder, die in dem Ausschuss vertreten waren, bejahten die grundlegende inhaltliche Bedeutung des Artikels 1. Kontroversen gab es nur über die Frage, ob dieser Text in den Regelungsteil gehört oder in die Präambel. Während Letzteres mit dem Argument gefordert wurde, dass in diesem Text nur von Fakten die Rede sei, aber nicht von Normen, machte die Gegenseite geltend, dass der Artikel ein Prinzip bestätige, welches alle folgenden Artikel impliziere. Der Norweger FREDE CASTBERG machte geltend, dass bei der Interpretation internationaler Rechtstexte den Artikeln wegen deren Verbindlichkeit größeres Gewicht beigemessen werde als der Präambel. Der Hauptautor des Textes, RENÉ CASSIN, führte aus, dass die Öffentlichkeit diesen Text, wenn er in der Präambel stünde, als bloße Erklärung eines Ideals auffassen würde. Es ginge aber darum, dass diese Prinzipien lebenswichtige Bedeutung („vital importance“) erhielten. Die in Artikel 1 zum Ausdruck kommenden Prinzipien müssten den Doktrinen des Faschismus mit Verbindlichkeit entgegengesetzt werden. Schließlich wies der Ausschuss mit 26 gegen 6 Stimmen bei 10 Enthaltungen (darunter alle sozialistischen Staaten) den Antrag auf Verlagerung des Textes vom Regelungsteil in die Präambel zurück.
Der Ausschuss diskutierte auch noch einmal die Frage nach dem Ursprung der Menschenrechte, die bereits in der Menschenrechtskommission kontrovers diskutiert worden war. Die Formel „endowed by nature with …“ konnte auf die Natur des Menschen bezogen werden, zu dessen spezifischen Merkmalen Vernunft und Gewissen gehören. Die Formel konnte aber auch als Benennung einer dem Menschen übergeordneten Wesenheit begriffen werden, die den Menschen mit Vernunft und Gewissen ausgestattet hat. In diesem Sinne wurde der Ausdruck von einigen südamerikanischen Staaten, angeführt von Brasilien, verstanden, die nicht einsehen konnten, warum sie dieses metaphysische Bekenntnis zur Natur akzeptieren sollten, und stattdessen forderten, als „Ausstatter“ nicht die Natur, sondern Gott zu benennen. Dieser Vorschlag machte die ambivalente Bedeutung des Ausdrucks „by nature“ erst für alle deutlich. Weil klar war, dass ein solches partikulares religiöses oder metaphysisches Bekenntnis niemals die Akzeptanz aller UN-Mitglieder finden konnte, einigte man sich darauf, „by nature“ ersatzlos zu streichen. Brasilien nahm darauf seinen Vorschlag, Gott zum Ursprung der Menschenrechte zu erklären, zurück.
Welche Veränderung hat die Behandlung der Menschenwürde in der AEMR im Vergleich zur UN-Charta gebracht? – Die Formulierung „allen Mitgliedern der menschlichen Familie“ macht klar, dass die Würde nicht nur einigen Menschen zugeschrieben wird und eine Differenzierung nach Rasse, Geschlecht oder Staatsangehörigkeit grundsätzlich ausgeschlossen ist. Die Würde wird vielmehr allen Menschen zugesprochen. Es wird ferner durch die Verwendung des Wortes „innewohnend“ (inherent) deutlich, dass die Würde nicht von irgendeiner Form der Leistung abhängig ist. Sie muss nicht erst erworben werden. Jeder Mensch besitzt sie allein schon kraft seines Menschseins. Sie wird deshalb auch nicht erst durch die Entwicklung oder Entfaltung zu einer Persönlichkeit begründet.
Der erste Absatz der Präambel benutzt ein neues Wort für das Verhältnis des Menschen zur Würde. Es ist nicht vom Glauben an die Würde die Rede, sondern von ihrer Anerkennung. Das darf allerdings nicht so verstanden werden, dass die Würde durch ihre Anerkennung überhaupt erst konstituiert wird. Denn der erste Absatz darf nicht ohne den fünften Absatz der Präambel gelesen werden, wo weiterhin vom Glauben an die Würde des Menschen die Rede ist. Die Anerkennung beruht also auf diesem Glauben. Die Menschenwürde wird als etwas gedacht, das unabhängig vom Vollzug der Anerkennung existiert und an dessen Existenz wir glauben. Die Anerkennung, von der hier die Rede ist, kann also nur normativ verstanden werden: Weil wir an die Würde des Menschen glauben, sind wir verpflichtet, sie anzuerkennen, also zu achten und zu respektieren. Erst wenn unser tief verwurzeltes Wissen um die Menschenwürde durch Akte der Anerkennung äußerlich sichtbar wird, kann sie zur Grundlage der Freiheit, Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt werden. Damit bringt Artikel 1 AEMR deutlich den vorstaatlichen Charakter der Menschenwürde und der Menschenrechte zum Ausdruck. Die Menschenwürde wird nicht durch staatliches Recht verliehen, sondern muss bei aller Rechtsetzung schon immer als gegeben vorausgesetzt werden.
Soweit in der AEMR von der Würde des Menschen und nicht mehr von der Würde der Person die Rede ist, hat es den Anschein, dass der Kreis der Träger von Menschenwürde damit erweitert wird. Nicht nur die Person, also das handlungs- und zurechnungsfähige menschliche Individuum, sondern jedes Exemplar der Gattung Homo sapiens scheint zum Träger der Menschenwürde erklärt zu werden, also auch Embryonen, Säuglinge, Kleinkinder, ebenso wie ohne Gehirn geborene menschliche Lebewesen und Komapatienten. Tatsächlich zeigen die Materialien aber, dass eine solche Ausweitung nicht bewusst ins Auge gefasst worden ist. Eine solche Interpretation wird vielmehr durch den zweiten Satz des Artikels 1 AEMR eher in Frage gestellt. Dieser Satz gibt nämlich die Kriterien an, um derentwillen dem Menschen Würde zukommt, nämlich seine Ausstattung mit Vernunft und Gewissen. Dieser Zusammenhang von Menschenwürde einerseits und Vernunft und Gewissen andererseits wird aus einer Äußerung des Vertreters des Libanon deutlich: „Der Entwurf soll auch feststellen, dass alle Menschen frei geboren sind und gleich in Würde und Rechten, weil sie durch die Natur mit Vernunft und Gewissen ausgestattet sind. Der letztgenannte Umstand legt dem Menschen sowohl die Pflicht auf, im Geiste der Brüderlichkeit zu handeln als auch das Recht auf Gleichheit und Freiheit“ (zit. n. DICKE 1992, 172 Fn. 41).
Wie immer man Vernunft und Gewissen näher fassen mag, es handelt sich jedenfalls um Eigenschaften, die die Zurechnungsfähigkeit begründen und folglich genau das, was eine Person ausmacht. Nur Personen können auch Adressaten von Pflichten und Appellen sein. Nur an sie kann also auch die Aufforderung gerichtet sein, einander im Geiste der Brüderlichkeit zu begegnen.
Die Internationalen Pakte von 1966
Parallel zu der Arbeit an der AEMR nahm ein Ausschuss der Kommission für Menschenrechte bereits im Juni 1947 die Arbeit an einem Entwurf eines Menschenrechtsvertrages auf. Auf Grund der sich verhärtenden Ost-West-Spannungen und dem von den kommunistischen Staaten geforderten Primat wirtschaftlicher und sozialer Rechte kam es schließlich zur Ausarbeitung von zwei Pakten, nämlich dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR) und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR). Im Jahre 1954 legte die Kommission die Entwürfe beider Pakte der Generalversammlung vor. Sie wurden schließlich am 19. Dezember 1966 von der Generalversammlung der UN ohne Abstimmung angenommen und traten mit der vorgesehenen Anzahl von 35 Ratifikationen im Jahre 1976 in Kraft. Beide Pakte enthalten in ihrer Präambel folgende gleichlautende Formulierung:
In der Erwägung, dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten Grundsätzen die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft innewohnenden Würde und der Gleichheit und Unveräußerlichkeit ihrer Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, …
Der Absatz wiederholt die Formulierung aus dem ersten Absatz der AEMR, wobei allerdings jetzt statt von den Mitgliedern der menschlichen Familie von den Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft die Rede ist. In den Beratungen des Absatzes war von Jugoslawien eine Formulierung vorgeschlagen worden, wonach die Menschenrechte ihre Grundlage in den allgemeinen Rechtsprinzipien haben sollten, die von allen zivilisierten Nationen anerkannt sind. Ein anderer Vorschlag Jugoslawiens wollte darauf abstellen, dass die Menschenrechte in den allgemeinen Rechtsprinzipien gründen, die die Menschheit in ihrem Bemühen entwickelt hat, zu Fortschritt, Wohlstand und demokratischer Entwicklung zu kommen. Vor allem die libanesischen und die australischen Mitglieder im Menschenrechtsausschuss widersprachen diesen Vorschlägen und machten geltend, dass die Menschenrechte dem Menschen als etwas zugehören, das ihm unveräußerlich sei. Diese Rechte konstituierten im Verhältnis zum positiven Recht ein vorgehendes und höheres Recht. Libanon schlug deshalb als Alternative eine Formulierung vor, wonach die Rechte und Freiheiten aus der dem Menschen innewohnenden Würde fließen. Australien wollte denselben Gedanken mit der Wendung zum Ausdruck bringen, dass die Menschenrechte aus der Menschenwürde abzuleiten sind. Schließlich einigte man sich mit 11 Stimmen gegen 7 Enthaltungen in der Kommission darauf, die Frage der Grundlage der Menschenrechte aus dem Zusammenhang des ersten Absatzes zu trennen und zum Gegenstand eines eigenen zweiten Absatzes zu machen, wobei man dabei die australische Formulierung übernahm:
In der Erkenntnis, dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde ableiten …
Die Formel macht deutlich, dass die Menschenrechte nicht aus dem positiven Recht hervorgehen, sondern aus der Menschenwürde. Es handelt sich um Rechtsgrundsätze, die aus einem Prinzip abzuleiten sind, welches seine Geltungskraft nicht menschlicher Setzung verdankt, sondern dem Menschen inhärent, ihm also mit seiner Existenz vorgegeben ist. Die Formulierung macht zugleich deutlich, dass mit Menschenwürde nicht selbst schon ein Recht gemeint ist, denn die Rechte folgen aus der Menschenwürde, nicht etwa aus einem Recht auf Menschenwürde. Die Formulierung spricht also von einem Recht aus Würde, nicht aber von einem Recht auf Würde.
Wie dieser Ableitungszusammenhang näher zu verstehen ist, erklären weder der Text noch die Materialien zu den Pakten. Einen Hinweis darf man aber der Resolution 37/200 der Generalversammlung vom 18. Dezember 1982 entnehmen, wo es im fünften Absatz der Präambel heißt, dass es die Menschenwürde sei, durch die alle Menschenrechte gerechtfertigt würden. („Aware … that social development must be based on respect for the dignity of man from which all human rights derive their justification.“) Der Herleitungszusammenhang ist also ein Zusammenhang der Rechtfertigung. Die Menschenwürde definiert den Geltungsgrund der Menschenrechte und bildet zugleich einen kritischen Maßstab für die Frage, ob bestimmte politische Forderungen, die mit dem Anspruch erhoben werden, Menschenrechte zu sein, tatsächlich als Menschenrecht anzuerkennen sind oder nicht. Dieser Gedanke findet sich seitdem auch in weiteren UN-Konventionen und Deklarationen der Generalversammlung.
2. Regionale internationale Organisationen
Die völkerrrechtliche Implementierung der Menschenrechte erfolgte nicht nur im Rahmen der Vereinten Nationen, also gewissermaßen auf globaler Ebene. Insbesondere die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wirkte vielmehr darüber hinaus auch sehr befruchtend auf die Ausarbeitung regionaler Menschenrechtserklärungen. Die erste derartige regionale Menschenrechtskonvention ging aus der Tätigkeit des Europarates hervor. Die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK) begründet unmittelbar geltendes Recht, auf das sich die betroffenen Bürger nicht nur – nach Maßgabe des nationalen Rechts – vor den eigenen nationalen Behörden der Vertragsstaaten berufen können, sondern auch vor dem durch die Konvention geschaffenen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg (EuGMR).
An dem Vorbild der EMRK orientiert sich die von der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) aufgelegte Amerikanische Menschenrechtskonvention (AMRK) von 1978. Auch diese Konvention hat einen Gerichtshof für Menschenrechte (IACourtHR) eingerichtet und kennt die Möglichkeit der Individualbeschwerde. Vierundzwanzig der fünfunddreißig Mitgliedstaaten der OAS haben die AMRK ratifiziert. Die USA und Kanada gehören nicht dazu.
Regionale Menschenrechtskonventionen gibt es außerdem für die Mitglieder der Afrikanischen Union (früher Organisation für Afrikanische Einheit) und für die Anden-Gemeinschaft, der die Staaten Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Peru und Venezuela angehören. Beide Organisationen verfügen über einen eigenen Gerichtshof.
Mit Ausnahme der EMRK enthalten alle diese Konventionen Bezugnahmen auf die Menschenwürde, ohne dass sich diesen Formulierungen neue Gesichtspunkte für die Klärung des Begriffs entnehmen ließen. Auch die Gerichtshöfe haben nichts zur Klärung beigetragen. Während der Anden-Gerichtshof und der afrikanische Gerichtshof bisher überhaupt keine Rechtsprechung zu den Menschenrechten entwickelt haben, finden sich in der Rechtsprechung des IACourtHR nur sehr spärliche Bezugnahmen auf die Menschenwürde. In einem Urteil aus dem Jahre 1995, in dem es um die Verletzung des Rechts auf Leben geht, gebraucht der Gerichtshof den Begriff der Menschenwürde in einer Weise, die ihn als Bezeichnung für den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz erscheinen lässt (IACourtHR 19.1.1995 Tz 74f.). Der Staat dürfe zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Ordnung nicht jedes Mittel einsetzen, um seine Zwecke zu erreichen, denn er unterliege dem Recht und der Moralität: „Missachtung der Menschenwürde kann nicht die Basis staatlichen Handelns sein.“ Im nächsten Absatz der Entscheidung ist dann von der Dis proportionalität des Gewalteinsatzes die Rede. Menschenwürde verlangt also nach diesen Formulierungen offenbar die Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Seine Verletzung ist eine Verletzung der Menschenwürde.
In einer Entscheidung aus dem Jahre 2011 fasst der Gerichtshof den Begriff der Menschenwürde allerdings qualitativ. So sieht er zum einem in einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung eine Verletzung der Menschenwürde und leitet andererseits aus der Menschenwürde ein ungeschriebenes neues Menschenrecht ab, nämlich das Recht auf Identität (IACourtHR 24.02.2011 TZ 94, 123). Außerdem bezeichnet der Gerichtshof das Verschwindenlassen von Personen als Verletzung des Rechts auf menschenwürdige Behandlung der Angehörigen, für die die Ungewissheit über den Verbleib des Opfers eine Verletzung der eigenen geistigen und seelischen Unversehrtheit darstelle (IACourtHR 24.02.2011 TZ 133).
Obwohl die EMRK die Menschenwürde nicht erwähnt, hat sich der EuGMR gelegentlich dieses Begriffs bedient. Insbesondere in Entscheidungen über die Prügelstrafe und in einer Entscheidung zu der Frage, ob der Staat einem Ehemann Straffreiheit zu gewähren hat, der dem Wunsch seiner nicht bewegungsfähigen und sterbenskranken Frau folgen will, sie zu töten, spricht der EuGMR von der Menschenwürde. Aber auch hier hat man den Eindruck, dass der Begriff im Sinne eines Topos verstanden wird, der im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsprinzips Gegenstand einer Abwägung mit anderen, insbesondere öffentlichen Interessen sein kann. Ein irgendwie gearteter Zusammenhang dieser Rechtsprechung mit der Rezeptionsgeschichte der Menschen würde auf UN-Ebene lässt sich nicht erkennen.
Dass die Menschenwürde auf der Ebene des Europarates als Abwägungstopos verstanden wird, belegt auch das im November 1996 beschlossene „Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin – Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin“. Dieses allgemein auch kurz als Bioethik-Konvention bezeichnete Übereinkommen liegt seit April 1997 beim Europarat zur Unterzeichnung aus. Nach dem Stand vom Januar 2013 ist es von 29 der 46 Mitgliedstaaten ratifiziert worden (Internet-Seite des Europarates).
In dieser Konvention taucht der Begriff der Menschenwürde nicht nur im Titel, sondern auch dreimal in der Präambel sowie schließlich einmal im Regelungsteil auf. In der Präambel ist ausgeführt, dass der Missbrauch von Biologie und Medizin zu Handlungen führen könne, die die Menschenwürde gefährden. Deshalb sollen mit dieser Konvention die Maßnahmen ergriffen werden, die erforderlich seien, um die Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin zu schützen. Artikel 1 verpflichtet die Vertragsparteien zu diesem Schutz. In Artikel 2 werden dann Abwägungskriterien auf der Basis von individuellen und kollektiven Interessen formuliert. Das stellt die Menschenwürde als vorstaatliche absolute Schranke rechtlichen Gestaltungsspielraums in Frage. Insbesondere Art. 17 Abs. 2 ist Gegenstand heftiger Kritik, erlaubt er doch unter gewissen Umständen den Eingriff in die körperliche Integrität von Personen, die nicht einwilligungsfähig sind, zu Zwecken der Forschung, auch wenn diese keinen unmittelbaren Nutzen für den Betroffenen hat. Hier werden also unter dem ausdrücklichen Titel der Menschenwürde unter gewissen Umständen Verfahrensweisen ausdrücklich erlaubt, die einer ausschließlichen Instrumentalisierung gleichkommen. Dies ist umso erstaunlicher, als der Europarat den Zusammenhang zwischen Menschenwürde und Instrumentalisierungsverbot an anderer Stelle, nämlich im Zusammenhang mit dem Verbot des Klonens, ausdrücklich betont (Zusatzprotokoll zur Bioethik-Konvention über das Verbot des Klonens von menschlichen Lebewesen vom 12. Januar 1998).
Die Bioethik-Konvention ist nach wie vor stark umstritten. Sie steht unter dem Verdacht, eher dem Schutz der Interessen der Wissenschaft an ungestörter Forschung zu dienen als dem Schutz der Menschenwürde der betroffenen Personen. Deshalb ist die Konvention von wichtigen Mitgliedstaaten des Europarates wie etwa der Bundesrepublik Deutschland bis heute (Stand März 2014) nicht unterschrieben worden.
3. Staatliches Verfassungsrecht
Deutsche Landesverfassungen nach 1945
Die ersten nationalen Verfassungen nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Gründung der Vereinten Nationen, in denen auf die Menschenwürde Bezug genommen wird, waren die Verfassungen der von den Besatzungsmächten neu errichteten deutschen Länder Württemberg-Baden, Bayern, Hessen und Bremen. Während die erst genannte Verfassung die Menschenwürde allerdings nur in der Präambel erwähnt, finden sich in der bayerischen (Art. 100) und der bremischen (Art. 5) Verfassung Regelungen, die den Staat darauf verpflichten, die Würde der menschlichen Persönlichkeit (!) zu achten. Auch die hessische Verfassung spricht an drei Stellen von der Menschenwürde. Zwei Stellen stehen im Zusammenhang mit den ökonomischen Lebensbedingungen und damit in der Tradition der Weimarer Reichsverfassung. Artikel 3 HV („Leben und Gesundheit, Ehre und Würde des Menschen sind unantastbar“) stellt die Menschenwürde dagegen in einen neuen Zusammenhang. In den Beratungen der verfassungsberatenden Landesversammlung wurde die Menschenwürde nicht diskutiert, so dass offen bleibt, welche Vorstellungen die Autoren der Verfassung damit verbunden haben und was sie unter Menschenwürde verstanden. Ein Zusammenhang mit dem Diskussionskontext auf UN-Ebene lässt sich jedenfalls nur sehr bedingt feststellen. Die Menschenwürde wird nicht als vorstaatliches Fundamentalprinzip verstanden, aus dem die Menschenrechte abgeleitet werden können, sondern selbst als ein Menschenrecht neben anderen, dessen Schutzbereich inhaltlich allerdings im Dunkeln bleibt.
Das gilt auch für die Beratungen der bayerischen Verfassung. Die bayerische Regelung wurde auf Initiative des Staatsrechtlers HANS NAWIASKY in die Verfassung aufgenommen. NAWIASKY hatte seinen Vorschlag damit begründet, dass die Klausel „nach den Geschehnissen der vergangenen Zeit“ unbedingt notwendig sei. Der Vorschlag wurde ohne weitere Diskussion angenommen, so dass wir nicht wissen können, welche Vorstellungen der Verfassungsausschuss mit der Klausel genau verband. NAWIASKY selbst erläutert seine Vorstellungen in seiner Kommentierung der Bayerischen Verfassung. Dort heißt es: „Auch diese Vorschrift atmet den Geist des Humanismus und dient der Betonung der Anerkennung der menschlichen Persönlichkeit im neuen Staat, dessen Wert in der nationalsozialistischen Ära auf ein Minimum herabgedrückt worden war.“ Und einige Sätze weiter: „Der Natur der Sache nach handelt es sich um ein Menschenrecht“ (NAWIASKY/LEUSSER 1948, 183).
Das Grundgesetz
Mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 erhält die Menschenwürde eine neue Qualität. Zum ersten Mal wird in dieser nationalen Verfassung der geistige Zusammenhang zu der UN-Charta und zu der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hergestellt, indem die Menschenwürde mit den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten in Verbindung gebracht wird, die die Grundlage des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt sind. Auch hinsichtlich der Stellung im Gesamttext der Verfassung erhält die Menschenwürde hier einen besonders prominenten Platz, indem sie nicht nur an den Anfang des Abschnitts über die Grundrechte gestellt wird, sondern auch an den Anfang der gesamten Verfassung. Artikel 1 GG lautet:
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
Auch unter den Schöpfern des Grundgesetzes gab es kein gemeinsames Vorverständnis darüber, was Menschenwürde eigentlich genau bedeuten soll. Die Gemeinsamkeit erschöpfte sich vielmehr in dem Wunsch, auf die vorstaatliche Grundlage des Staates hinzuweisen und darauf, dass das Recht nach einem Maßstab beurteilt werden kann, den es nicht selbst geschaffen hat. Wie diese vorstaatliche Grundlage aber genau zu denken sei, darüber herrschte Dissens. Insoweit entsprach die Situation derjenigen auf der UN-Ebene. Die sich gegenüberstehenden unterschiedlichen Verständnisse wurden jedoch in der deutschen Debatte etwas deutlicher. Der Standpunkt der sozialdemokratischen Abgeordneten und ihres Wortführers CARLO SCHMID wird in einer Passage aus dessen Lebenserinnerungen klar. Dort schreibt SCHMID, es sei ihm darum gegangen, seine Kollegen davon zu überzeugen, dass „Freiheit, Selbstverantwortung und Gerechtigkeit die Würde des Menschen ausmachen, und dass diese Würde gebietet, dass jeder die Freiheit und die Selbstachtung eines jeden anderen achtet und sein Leben nicht auf Kosten der Lebensmöglichkeiten des anderen führt“ (SCHMID 1979, 372). In einem Aufsatz aus dem Jahre 1946, der wohl frühesten Publikation nach dem Kriege, die sich mit der Menschenwürde beschäftigt, hatte SCHMID bereits ausgeführt, es komme da rauf an, eine neue Rechtsordnung zu schaffen, die das Individuum als eine Person anerkenne, die ihren Sinn in sich selbst trage und darum niemals zu einem Mittel zu Zwecken irgendeiner Art herabgewürdigt werden dürfe (SCHMID 1946, 2).
Nach diesem Ansatz steht allein die Freiheit des Menschen im Vordergrund, die Freiheit nach eigenem Lebensplan sein Leben zu gestalten und weder durch den Staat noch durch sonst eine Macht daran gehindert zu werden. Dass der Einzelne dabei auch gegenüber seinen Mitmenschen und der Gemeinschaft Verantwortung trägt, war dabei selbstverständlich mitbedacht. Doch diese Verantwortung beruhte auf der Anerkennung der Würde und des Selbstbestimmungsrechts des Mitmenschen. Nur soweit dieser betroffen ist, dürfen nach diesem Ansatz dem Individuum Grenzen auferlegt werden. Andere Gründe können eine Beschränkung der Freiheit nicht rechtfertigen. Allerdings blieb dabei ungeklärt, ob tatsächlich jede Freiheit zu tun und zu lassen, was man will, bereits ein Postulat der Menschenwürde sei, oder ob es auf eine Freiheit in einem anspruchsvolleren Sinne ankomme.
Nach der Überzeugung der christlich-konservativen Abgeordneten war die Menschenwürde dagegen nicht nur Grund und Quelle des Rechts auf Freiheit, sondern auch Legitimationsgrund für die Auferlegung von Pflichten. Das wird an der Argumentation des Abgeordneten HANS-CHRISTOPH SEEBOHM besonders deutlich. Er trug vor, aus der vom Gewissen bestimmten Freiheit entwickele sich das Verantwortungsbewusstsein, aus dem heraus allein der Mensch zu sozialem Handeln fähig sei. Das Gewissen aber sei von Gott gegeben. Und nur deshalb gebe es auch ein Recht auf Freiheit. Freiheit wird hier also verstanden als die Freiheit, der Stimme Gottes zu folgen, die sich im Gewissen äußert. Die Menschenrechte werden deshalb nur „im Rahmen der ihm … von Gott auferlegten Verpflichtungen gewährleistet“.
Offenbar prallten hier zwei grundsätzlich verschiedene Begriffe von Menschenwürde aufeinander. Die christlich-konservative Fraktion sah die Menschenwürde in der Freiheit zum Gehorsam gegen die Gebote Gottes gegeben, die im Zweifel der kirchlichen Interpretation unterliegen und nach dem traditionellen Verständnis regelmäßig mit den staatlichen Geboten übereinstimmen; die sozialdemokratisch-liberale Fraktion sah die Menschenwürde in erster Linie in dem Recht der Selbstverantwortung und freien Entfaltung des Individuums, dessen Grenzen nur die gleichen Rechte des anderen sein können, nicht aber ein höheres göttliches oder staatliches Gebot.
Der freidemokratische Abgeordnete und spätere Bundespräsident THEODOR HEUß war der Meinung, dass man den Sinn des Begriffs der Menschenwürde nicht näher aufklären müsse. Denn jede solche Aufklärung käme einer „moralischen Überprüfung“ gleich. Es sei aber, so kann man sein Argument verstehen, nicht Aufgabe einer Verfassung, die ihr zugrunde liegenden moralischen Überzeugungen noch zu begründen und zu rechtfertigen. Die Würde des Menschen müsse deshalb „als nicht interpretierte These“ in das Grundgesetz aufgenommen werden. Damit beendete er die Debatte.
HEUß hat offenbar übersehen, dass es nicht nur um die Rechtfertigung eines moralischen Konzepts ging, sondern auch um seinen Inhalt. Denn Inhalt und Rechtfertigung lassen sich nicht voneinander trennen. Die Weise der Rechtfertigung entscheidet über den Inhalt. Indem man die Frage der Rechtfertigung offen ließ, ließ man auch die Frage nach dem Inhalt offen.
Eine Parallele zu dem Wort von der „nicht interpretierten These“ findet sich bei dem Interpreten der Schweizerischen Bundesverfassung JÖRG PAUL MÜLLER. Seine folgende Formulierung macht besonders deutlich, welche fatalen Folgen die Unbestimmtheit des Inhalts der Menschenwürde hat: „Der Satz von der Menschenwürde eröffnet für die Grundlegung und Konkretisierung [!!] der Verfassung die philosophische Perspektive eines letztlich nicht fassbaren [!!] Eigentlichen des Menschseins“ (MÜLLER 1999, 4). Ein letztlich nicht Fassbares soll also der Konkretisierung der Verfassung dienen! Als in diesem Sinne „nicht interpretierte These“ hat die Würdeklausel keinerlei Inhalt. Ohne Inhalt kann ihr aber auch keine rechtliche Bedeutung zukommen.
Die Menschenwürdeklausel des Grundgesetzes darf deshalb nicht als ein „letztlich nicht Fassbares“, sondern sie muss als ein Formelkompromiss verstanden werden. Man war sich zwar einig darin, dass es einen letzten Maßstab geben muss, der durch den Staat und das Recht nicht gesetzt sein darf, sondern an dem sich Staat und Recht messen lassen müssen, um Unrechtssysteme jederzeit identifizieren, kritisieren und vermeiden zu können. Zugleich war man sich jedoch uneinig darin, worin genau dieser Maßstab besteht. In Kenntnis des unterschiedlichen Verständnisses einerseits und vielleicht auch der Ungeklärtheit des eigenen Verständnisses andererseits einigte man sich auf die Verwendung eines bestimmten Wortlautes und war sich dabei bewusst, dass man sich nur über Worte einigte, nicht aber über deren Bedeutung. Politische Formelkompromisse im Bereich der Rechtsetzung sind gewöhnlich mit der Erwartung verbunden, dass Rechtsprechung und juristische Lehre die bestehenden Unklarheiten mit der Zeit beseitigen und eine einheitliche, hinreichend bestimmte und für alle akzeptable Auslegung entwickeln werden. Was aus dieser Erwartung geworden ist, soll im nächsten Kapitel dargestellt werden.
Der Siegeszug der Menschenwürde
Die Menschenwürdeklausel des Grundgesetzes blieb zunächst ein Unikat. Weitere nationale Verfassungen aus den späten 40er Jahren beschränken sich darauf, die Menschenwürde jeweils im Zusammenhang mit den ökonomischen Existenzgrundlagen des Menschen zu nennen (DDR, Italien).
Erst in den 70er Jahren kommt es zu einer Welle neuer Verfassungen, die in einem allgemeineren Sinne auf die Menschenwürde Bezug nehmen. In Europa handelt es sich dabei außer im Falle Schwedens um jene Staaten, die sich im Anschluss an die Beseitigung faschistischer und diktatorischer Regime neue Verfassungen zu geben hatten, nämlich Griechenland, Portugal und Spanien. Im Jahre 1952 wurde in die Verfassung von Costa Rica eine Klausel eingefügt, die dem Wortlaut des Artikel 1 Abs. 1 Satz 1 GG entspricht. Der US-Bundesstaat Montana übernimmt diese Klausel im Jahre 1972 und auch die Verfassung von Louisiana (1974) spricht von einem „Right to Individual Dignity“.
Eine zweite Welle kennzeichnet die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Abgesehen von Belgien und Finnland sind es wiederum vor allem zahlreiche Staaten, die sich vom Joch diktatorischer und menschenfeindlicher Herrschaft befreit haben. Das gilt für die Staaten des ehemaligen Ostblocks, aber auch für afrikanische (u.a. Malawi, Südafrika) Staaten. Israel gibt sich im März 1992 das Grundgesetz über Menschenwürde und Freiheit. Auch in Südamerika ist die Anerkennung der Menschenwürde Resultat zahlreicher Verfassungsreformen. Als Folge der Ereignisse vom 11. September 2001 findet die Menschenwürde schließlich auch Eingang in die Verfassung Afghanistans.
In Europa gipfelt die Entwicklung schließlich in dem Vertrag über die Europäische Union in der Verfassung des Vertrags von Lissabon (2007) und dessen Grundrechtsteil, die Charta der Grundrechte. Artikel 2 des Vertrages nennt die Menschenwürde an erster Stelle einer Reihe von Werten, auf denen die Union ruht. Die Charta enthält ein erstes Kapitel, das mit „Menschenwürde“ überschrieben ist und aus fünf Artikeln besteht.
Während man den Materialien über die Entstehung des Grundgesetzes immerhin entnehmen kann, dass sich die Abgeordneten des Parlamentarischen Rates um ein gemeinsames Verständnis der Menschenwürde bemühten und zu diesem Zweck ihre unterschiedlichen Vorstellungen wenigstens formulierten oder doch zumindest andeuteten und – in Grenzen – auch darüber stritten, fand in anderen Ländern im Rahmen der Implementierung der Würdeklausel in das nationale Verfassungsrecht so gut wie keine Debatte statt. Die Formulierungen in den Verfassungstexten weichen im Einzelnen stark voneinander ab und lassen einen mehr oder weniger großen Abstand zu dem Menschenwürdediskurs auf UN-Ebene erkennen. Zur Frage, was Menschenwürde genau bedeuten soll, schweigen sich sowohl die Verfassungstexte als auch die Dokumente über ihre Beratung aus.
4. Menschenwürde als ungeschriebenes Verfassungsrecht
Der Siegeszug des Verfassungsbegriffs Menschenwürde zeigt sich nicht nur darin, dass er seit den 40er Jahren auf allen Kontinenten in immer mehr Verfassungen verankert worden ist. Er übt vielmehr auch auf die Richterschaft zahlreicher Staaten eine große Faszination aus, deren geschriebene Verfassungen den Begriff nicht erwähnen. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass die obersten Gerichtshöfe solcher Länder die Menschenwürde als ungeschriebenen Grundsatz der Verfassung in das nationale Verfassungsrecht hineingedeutet haben (z.B. Frankreich, Österreich). In einigen Staaten wurde diese richterrechtliche Entwicklung später von der Verfassunggebung nachvollzogen und der bereits anerkannte Grundsatz der Menschenwürde in das geschriebene Recht übernommen (z.B. Israel, Polen, Schweiz).
Von besonderem Interesse ist dabei die Entwicklung in Frankreich, zumal sie auf die Debatte in Großbritannien nachhaltige Bedeutung gewinnen sollte. In der französischen Verfassung vom 4. Oktober 1958 fehlt es an jeglichem Hinweis auf die Menschenwürde. Auch die erste Nachkriegsverfassung vom 27. Oktober 1946 kannte die Menschenwürde nicht, obwohl ihr ein Entwurf vom Frühjahr 1946 vorausgegangen war, in dem der Begriff dignité de la personne humaine mehrfach vorkommt. Auch im Rahmen der Debatte um die Verfassungsänderung 1993 gab es Bestrebungen, die Menschenwürde in die Verfassung aufzunehmen, die jedoch letztlich an der erforderlichen Mehrheit scheiterten. Das hielt das französische Verfassungsgericht, den Conseil d’Etat, jedoch nicht davon ab, im Jahre 1994 die Menschenwürde zu einem Grundsatz der französischen Verfassung zu erklären (CC 27.7.1994). Zu diesem Zweck unternahm er große Anstrengungen, dieses Prizip aus dem Text der Verfassung herauszulesen, obwohl es darin nicht enthalten war. Mit dieser Entscheidung war in Frankreich ein neues Diskussionsfeld eröffnet. Die Menschenwürde findet seitdem sowohl in der Rechtsprechung als auch in der Literatur zunehmend Beachtung, auch wenn über seine Bedeutung die größte Uneinigkeit herrscht.
5. Ablehnung des Menschenwürdekonzepts
Die von den Vereinten Nationen inaugurierte Idee der Menschenwürde fiel keineswegs überall in der Welt auf fruchtbaren Boden. In einigen Staaten wird das Konzept der Menschenwürde als juristisches Prinzip dezidiert abgelehnt, selbst wenn es in der Verfassung erwähnt wird (Beispiele: Portugal, Spanien, Italien). Die Verfassungsjuristen dieser Länder sind der Ansicht, dass der Begriff der Menschenwürde nicht in einem juristischen Sinne operationalisiert werden kann. Es handele sich gewissermaßen um Verfassungslyrik, mit der der Jurist nichts anfangen könne und die er deshalb zu ignorieren habe.
In Großbritannien hält man die Menschenwürdeklausel nicht einfach nur für irrelevant, sondern vor allem für gefährlich. Das englische Verfassungsrecht, bei dem es sich ohnehin weitgehend um ungeschriebenes Recht handelt, würde der Einführung der Menschenwürde im Wege des Richterrechts zwar nicht grundsätzlich entgegenstehen. Die herrschende Auffassung unter den englischen Juristen verhält sich dazu aber entschieden ablehnend. Man hält die Menschenwürde für eine Idee, die „too imprecise and intangible [ist] to appeal to Engish lawyers“ (NEILL 1999, 22).
In den Jahren 1999/2000 erschien die erste monographische Abhandlung zu diesem Thema aus der Feder eines britischen Autors. DAVID FELDMAN führte gewichtige Gründe dafür an, dass die britische Jurisprudenz und Judikatur auf die Rezeption des Konzepts der Menschenwürde lieber verzichten sollte. Dabei beruft er sich als abschreckendes Beispiel auf die Entwicklung in Frankreich. Die Unklarheit des Konzepts erlaube es den Gerichten, sofern sie auf der Basis der Menschenwürde judizieren dürften, sich an die Stelle des Gesetzgebers zu setzen und ihre eigenen moralischen Überzeugungen für allgemein verbindlich zu erklären. Obwohl das Konzept ursprünglich im Zusammenhang mit der AEMR die philosophische Grundlage der individuellen Freiheit habe sein sollen, zeige die Rezeption in Frankreich, dass das Gegenteil bewirkt werde, wenn man die Menschenwürde als justiziables Konzept betrachte. Mit ihm lasse sich nämlich die Einschränkung der individuellen Freiheit rechtfertigen.
Tatsächlich hatte man in Frankreich das Konzept der Menschenwürde vornehmlich dafür herangezogen, die Entfaltungsfreiheit der Menschen zu beschränken. So wurde einem kleinwüchsigen Menschen unter Berufung auf die Menschenwürde verboten, sich gegen Gage auf öffentlichen Veranstaltungen als Wurfgeschoss eines „Zwergenweitwurf“-Wettbewerbs zur Verfügung zu stellen. FELDMAN sieht darin staatlichen Paternalismus, der den Bürger dazu zwingt, so zu leben, wie der Staat es für menschenwürdig hält.