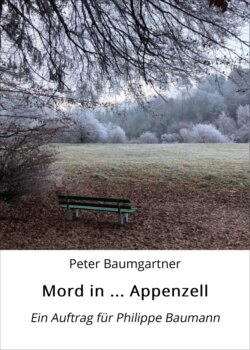Читать книгу Mord in ... Appenzell - Peter Baumgartner - Страница 4
Philippe Baumann
ОглавлениеPhilippe Baumann ist pensionierter Polizist und er darf auf eine lange Zeit als Kriminalpolizist bei der Kantonspolizei Bern zurückblicken. In dieser Zeit hatte er wohl so alles gesehen und erlebt, was man als Polizist sehen oder erleben kann. Hochs und Tiefs wechselten sich ab, und mit Erfolg oder Misserfolg musste Philippe lernen umzugehen. Dies gelang ihm meistens recht gut und trotzdem wurmte es ihn immer wieder, wenn man der Täterschaft nicht auf die Spur kam. Er hatte den Ehrgeiz, Verbrechen aufzuklären, und auch eine gewisse Hartnäckigkeit durfte er für sich in Anspruch nehmen. Trotzdem musste er ab und zu feststellen, dass es in der Verbrechensbekämpfung Grenzen gibt, die nur der Kommissar Zufall mit dem bekannten Quäntchen Glück überschreiten kann. Er selber hatte sich an «law & order» zu halten und dies grenzte ihn zuweilen ganz schön ein.
Heute geniesst Philippe seine freie Zeit, die er meistens im Garten verbringt, wobei ihm der eine oder andere Fall wieder in den Sinn kommt. So auch dieser …
Es war im Juni 1996, als der Kommandant der Kantonspolizei Bern Philippe in seinem Büro aufsuchte. Dies war mehr als ungewöhnlich. Normalerweise liess der Kommandant seine Mitarbeiter zu sich kommen und diese hatten sich dann auf einen Stuhl zu setzen, der dem Kommandanten an seinem Pult genau vis-à-vis stand. Es gab nur diesen einen Stuhl und dieser war schon recht in die Jahre gekommen. Eigentlich und richtig betrachtet, hatte sich Philippe noch nie diesem Prozedere unterwerfen müssen; er konnte hier nur vom Hörensagen reden.
Der Grund des Besuchs war der Folgende: Vor rund einer Woche sei im Garten des Kapuzinerklosters in Appenzell eine männliche Person jungen Alters tot aufgefunden worden. Die Todesursache sei unklar und man könne zum jetzigen Zeitpunkt ein Verbrechen nicht ausschliessen.
Die Kollegen in Appenzell seien nun an die KKPKS – die Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz – gelangt und sie hätten um Unterstützung nachgesucht. Dabei sei ihm in den Sinn gekommen, dass er – Philippe – dort ja einmal zur Schule gegangen sei und er deshalb aus seiner Sicht die richtige Person sei, die er entsenden könne. Er wolle seinem Kollegen dies so mitteilen und er gehe davon aus, dass Philippe damit einverstanden sei.
Was hätte Philippe anderes sagen können, als dass er sein Möglichstes tun werde und dass er den Kommandanten auf dem Laufenden halten werde.
Bereits am übernächsten Tag wollte sich Philippe auf den Weg machen. Sein direkter Vorgesetzter war selbstverständlich nicht glücklich über den Entscheid des Kommandanten, musste die Kröte aber schlucken und was noch viel schlimmer war: er musste die anstehenden Aufgaben von Philippe übernehmen.
Erfahrungsgemäss konnten sich solche Ermittlungen in die Länge ziehen, und der direkte Vorgesetzte seufzte deshalb auch dementsprechend. Trotzdem wünschte er Philippe viel Glück.
Auch bei Philippe zuhause war man nicht nur glücklich über diesen Entscheid. Seine Frau hatte fortan alle anstehenden Aufgaben alleine zu erledigen, und die beiden Jungs im Alter von zwei und vier Jahren würden sie voll und ganz in Beschlag nehmen.
Noch während Philippe in seiner Hollywood-Schaukel sass, kamen in ihm all seine Erinnerungen hoch: Schönes und weniger Schönes wechselten sich dabei ab. Philippe hatte immerhin sechs Jahre seiner Jugend in Appenzell verbracht und diese waren nicht ohne. Mit gut 15 Jahren trat er ins Internat ein und mit knapp 21 Jahren verliess er die Internatsschule.
Seine Wohn- und Ausbildungsstätte war das Kollegium St. Antonius; geführt von Kapuzinern des Franziskanerordens.
Was dies bedeutete, war Philippe zu Beginn wenig klar, und er musste sich zuerst einmal zurechtfinden. Der Einstieg war «stotzig und steil» und dies im wahrsten Sinn des Wortes.
Philippe bekam eine Nummer: er war die Nummer «116». Und mit dieser Nummer mussten all seine Sachen, von den Unterhosen, über die Socken bis hin zu seiner Jacke beschriftet werden. Dies hatte so zu geschehen, dass die Nummer auch nach dem Waschen noch erkennbar war und folglich mittels eines kleinen, bedruckten Stofffetzens aufgenäht werden musste. Seine Mutter hatte alle Hände voll zu tun, um den Anforderungen der Schulleitung gerecht zu werden.
Das Kollegium St. Antonius war wie gesagt ein «Internat» und bedeutete eigentlich nichts anderes, als dass man «eingesperrt» war. Schliesslich bedeutet das lateinische Wort «internus» auf Deutsch ‘im Inneren befindlich’.
Der Begriff «Internat» entstand im 19. Jahrhundert und leitet sich vom lateinischen Wort «internus, interna oder internum» ab, was auf Deutsch eben in etwa bedeutet, wie «im Inneren befindlich» zu sein, oder auch als «einheimisch» bezeichnet werden kann. Mit der zweiten Begriffsumschreibung konnte sich Philippe nie richtig anfreunden. Der Gegenbegriff von Internat ist das Externat; dieser Begriff war Philippe schon einiges sympathischer.
Ja, man war eingesperrt – vom Morgen bis am Abend, und in der Nacht sowieso. Der Tagesablauf sah in etwa so aus:
Morgens um 0600 Uhr war Tagwache. Die Nacht verbrachte man in einer Zelle, bestehend aus einem schmalen Bett mit einem Beistelltischchen. Das war’s. Die Zellen trennten sich voneinander mit einem dünnen Holzverschlag zur Seite und einem Vorhang am Fussende des Bettes. Das Ganze nahm höchstens vier Quadratmeter Platz in Anspruch, womit in einem Schlafsaal locker zwischen 50 und 100 «Insassen» untergebracht werden konnten. Von diesen Schlafsälen gab es mehrere.
Nach der Tagwache stand die überwachte Morgentoilette auf dem Programm. Mit freiem Oberkörper galt es den Kopf, die Achseln und den Rest des Rumpfes zu reinigen. Zur Verfügung standen Seife und kaltes Wasser. Warmes Wasser war Mangelware. Auch auf das Duschen musste verzichtet werden; eine Dusche stand nur nach der Sportstunde auf dem Programm und dann hiess es schnell zu sein, ansonsten sich die Temperatur des Wassers dem Gefrierpunkt näherte.
Alsdann war «studium» angesagt und dies vor dem Frühstück. Von 0630 bis 0730 galt es das Versäumte vom Vortag nachzuholen. Das Wort ‘studium’ ist das Nomen oder Hauptwort zum Verb oder Tätigkeitswort «studere», was in etwa so viel heisst wie: sich bemühen, sich sogar eifrig bemühen, sich etwas widmen oder nach etwas streben. Was es hingegen nicht heisst: Mühe haben, und dies war zumeist der Fall!
Frühstück war dann um 0730 Uhr: Brot vom Vor-vor-Tag stand auf dem Tisch und dazu gab es verdünnte Milch. Wer einen Brotaufstrich wünschte, musste diesen selber mitbringen. Auch wer etwas in die verdünnte Milch wollte, musste selber dafür aufkommen. Voilà.
Pünktlich um 0815 Uhr begann der Unterricht. Zumeist mit Latein und dann oftmals noch mit einer Doppellektion. Danach standen Französisch oder Deutsch und schliesslich Mathematik auf dem Stundenplan.
Mittagessen war um 1215 Uhr, bevor um 1300 -1345 Uhr wiederum Studium auf dem Programm stand. Der Nachmittag gesellte sich in etwa gleich wie der Vormittag. Um 1600 Uhr war Schulschluss, danach ging es aber erst richtig los. Studium, Studium, Studium und dies ohne Ende: von 1700 – 1900 Uhr und von 2000 – 2130 Uhr … Um 2200 Uhr war Lichterlöschen.
Die Tage liefen alle in etwa gleich ab. Am Mittwochnachmittag durfte ein wenig Sport betrieben werden, jedoch durfte das Areal des Internats anfänglich nicht verlassen werden. Am Samstagmorgen war natürlich ebenfalls Schule und der Nachmittag präsentierte sich ähnlich wie der Mittwoch. Der Sonntag war Ruhetag, aber nur für diejenigen, die das Pflichtprogramm erfüllt hatten. Für die anderen galt «studere», «studere», «studere» …
Das Ganze dauerte ein Jahr; danach besserte sich die Situation allmählich.
Mit der Zeit wurde sie sogar erträglich, um nicht zu sagen willkommen. Die geregelten Zeiten halfen einem das Notwendigste mit auf den Weg zu nehmen und in der übrigen Zeit konnte man sich «vernünftig» weiterentwickeln. Der Schlafsaal machte Zweier- oder Dreierzimmer Platz und der Selbstständigkeit wurde je länger je mehr Rechnung getragen.
Es entwickelten sich Freundschaften, die über lange Jahre hinweg Bestand hielten und zum Teil noch heute gepflegt werden.
Philippe wählte für seine Reise nach Appenzell die Bahn. Diese führte ihn über Zürich in Richtung St. Gallen. In Gossau musste er auf die Appenzeller-Bahn umsteigen. Diese führte ihn über Herisau nach Waldstatt. Von dort weiter nach Urnäsch, Jakobsbad und vorbei an Gonten, bis der Zug nach einer guten Dreiviertelstunde in Appenzell ankam. Distanzmässig lagen die beiden Ortschaften Gossau und Appenzell lediglich etwa 20 km auseinander. Wer jedoch die hügelige Landschaft im Appenzellerland kennt, begreift, dass die Bahn für diese Wegstrecke etwas länger braucht.
Philippe liess sich im Restaurant «Traube» an der Marktgasse 7 in Appenzell einquartieren. Das Restaurant war zugleich ein kleines Hotel und es verfügte über sechs Gästezimmer. Das Zimmer war mit viel Liebe zum Detail eingerichtet, verfügte über ein Doppelbett, ein separates Bad mit WC und Dusche, eine Garderobe, einen Kleiderschrank, eine Sitzgelegenheit und sogar einen Fernseher. – Alles was sich Philippe wünschte. Das Frühstück war im Preis inbegriffen.
Das Restaurant Traube kannte Philippe von früher her. Früher war es das Stammlokal der Studentenverbindung «Rotacher», in der Philippe während seiner Zeit in Appenzell Aktivmitglied war. Er erinnerte sich gerne an diese Zeit, wenngleich er seiner Rolle als «Fuchsmajor» vermutlich nicht immer gerecht wurde. Das «Chorale» war nie so seine Sache, und so wurde er auch in der hauseigenen Musikkapelle zum Paukenschlagen verdonnert. Doch selbst dort konnte man ihn nicht brauchen, womit er mit Verdacht aus den Pflichten als ‘Pauken Ede’ entlassen wurde. – Der Verdacht war vielleicht nicht einmal so unbegründet, widerstrebe es Philippe doch sehr, seine kostbare Freizeit mit für ihn Unnützem zu vergeuden.
Schon als kleiner Junge bereitete ihm das Notenlesen beim Klavierspielen Kopfzerbrechen, und er konnte sich viel eher zig Automarken merken als den Unterschied zwischen Dur und Moll.
Und wenn das Ganze dann noch in Richtung Oktave ging, war er völlig überfordert. Für ihn war eine Oktave etwa das gleiche wie ein Oktopus, also ein Krake mit acht Armen. Da war ihm der Krake noch lieber.
Am darauffolgenden Tag wollte Philippe sich bei seinen Kollegen auf der Hauptwache melden. Vorweg wollte er sich allerdings noch ein wenig im Dorf oder im Hauptort des Kantons Appenzell-Innerrhoden umsehen, um zu schauen, ob ihm das eine oder andere noch bekannt vorkomme.
Das erste, was er hörte, war folgendes: «Jetz lueg emol wie die aagmoolet isch. Das gseht aber aadlig us. Und wie sie de ander aapfuderet het. Das isch ase gsi, das i fascht vom Stuhl abikeit wär.»
In ähnlichem Stil ging es weiter, und Philippe musste schon früher ab und zu nachfragen, was sein Gegenüber denn gesagt hatte und er bat um eine «Übersetzung», worauf er stets ungläubig angeschaut wurde.