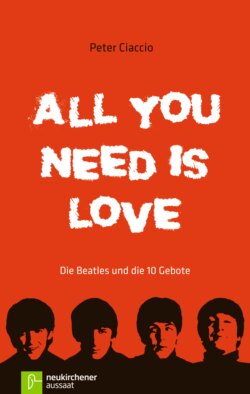Читать книгу All you need is love - Peter Ciaccio - Страница 6
Wer waren eigentlich die Beatles?
ОглавлениеIm Jahre 1984 stellte die italienische Rock-Gruppe „Stadio“ in einem ihrer Songs1 diese Frage und brachte es damit auf den Punkt: die Beatles – wer waren sie eigentlich? Auf diese Frage kann man unterschiedliche Antworten geben. Eine erste besagt, dass es eine Band bestehend aus vier jungen Männern war: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Sie wurden allesamt in Liverpool geboren, wuchsen auch dort auf und waren zwischen 1957 und 1970 aktiv. Ihre erste Single Love Me Do / PS: I Love You kam vor genau 50 Jahren (am 5. Oktober 1962) auf den Markt. Selbst die Auflösung der Band und der Tod zweier Mitglieder schadete ihrem Erfolg nicht, denn die im Jahr 2000 erschienene Sammlung Beatles I, die alle Singles enthält, die sich in den englischen und/oder amerikanischen Charts auf Platz eins platzierten, ist mit über 31 Millionen verkaufter Exemplare noch immer der meistverkaufte Tonträger des 21. Jahrhunderts.
Eine weitere Antwort auf die Frage lautet, dass die Beatles die einflussreichste Musikgruppe in der Geschichte der „leichten“ Unterhaltungsmusik war, deren Einfluss derart weit reichte, dass fraglich ist, ob das Adjektiv „leicht“ wirklich zutrifft. Die Beatles waren die Ersten, die Tourneen rund um den Globus unternahmen und Tausende und Abertausende von Fans in Ekstase versetzten, die Ersten, die ein nur von einem Streichquartett begleitetes Pop-Stück aufnahmen (Eleanor Rigby, 1966), die Ersten, die das Mittel des Films als Vorläufer des Videoclips einsetzten (A Hard Day’s Night).2 Die Beatles waren die Ersten, die kleinen Unebenheiten in der Aufnahme einen künstlerischen Wert beimaßen und sie sogar in der endgültigen Version des Songs beibehielten (erinnernswert ist das Gitarren-Feedback3 zu Beginn von I Feel Fine, 1964). Sie waren die Ersten, die Stücke aufnahmen, die länger als drei Minuten dauerten, und die Ersten, die die Texte ihrer Songs veröffentlichten.4 Zusammen mit den Alben Pet Sounds von den Beach Boys und Freak Out! von Frank Zappa (beide aus dem Jahr 1966) ist Sgt. Pepper zudem eines der ersten Konzeptalben in der Geschichte der Popmusik. Es ist also ein Musikalbum, das nicht nur einfach Songs aneinanderreiht, sondern bei dem die Lieder in einem Gesamtzusammenhang stehen. Schließlich waren die Beatles auch die Ersten, die vom Publikum in einer Weise verehrt wurden, die einerseits den unbändigen Hass christlicher Gruppierungen, die die Beatles für mehr oder weniger satanisch hielten, schürte, andererseits aber auch dazu führen konnte, dass selbst Menschen wie Charles Manson, die dem Bösen verfallen waren, sich von den Beatles inspiriert fühlten. Wie ein schlechter Scherz des Schicksals mutet es an, dass die Beatles hierfür einen Preis bezahlen mussten, den niemand je zahlen sollte: die Ermordung John Lennons. Ein Krimineller, dessen Name – so wie seinerzeit von Yoko Ono und Paul McCartney gewünscht – auch in diesem Buch unerwähnt bleibt.5 Eine dritte, sicherlich zynischere, aber deswegen nicht weniger wahre Antwort auf die Frage, wer die Beatles waren, lautet, dass die Beatles sowohl in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft eine „Marke“ verkörperten bzw. verkörpern. Auf der ganzen Welt lässt sich diese Marke verkaufen und als Markenzeichen benutzen, und zwar sowohl die einzelnen zu regelrechten Ikonen stilisierten Bandmitglieder als auch die Musikgruppe an sich. Die Marke „Beatles“ wird zudem mit einer ganz bestimmten Epoche, nämlich den 1960ern assoziiert, der Zeit des Swinging London. In dieser Zeit kamen die Miniröcke von Mary Quant auf den Markt und ein neuer graziler Frauentypus wurde „geboren“, verkörpert durch die Schauspielerin Audrey Hepburn und das Fotomodell Twiggy. Es war die Zeit der sexuellen Revolution (losgetreten durch die Verbreitung der Antibabypille), die Zeit der Proteste gegen den Vietnamkrieg und eine Epoche, in der Drogen im großen Stil konsumiert wurden. Unvergessen bleiben auch der Aston Martin von James Bond, die großartigen Fußballkünste eines Pelé und die Reden von Martin Luther King. All dies geschah in einem außergewöhnlichen Jahrzehnt, an dessen Anfang der von der Sowjetunion erfolgreich ins All geschossene Satellit Sputnik und die Errichtung der Berliner Mauer standen und an dessen Ende Neil Armstrong sogar auf dem Mond landete.
Der Versuch, das Phänomen Beatles zu analysieren, mag daher an Untersuchungen anderer „globaler Marken“ wie etwa Harry Potter oder gewisser Werke berühmter Filmemacher erinnern, oder gar an den Versuch, das Phänomen der Globalisierung an sich beschreiben zu wollen. Aber die Beatles sind nicht einfach nur ein Abbild der beginnenden Globalisierung, sondern vielmehr wie eine Wasserscheide zwischen einer Welt, die es nicht mehr gibt, und unserer Welt von heute. Ihr Auftreten markiert eine Zäsur, deren Auswirkungen die Geschichte nachhaltiger beeinflusst haben, als es der natürliche Lauf der Zeiten und das Aufeinanderfolgen der Generationen vermocht hätten. Wenige Personen der Geschichte können es unter diesem Gesichtspunkt mit den Beatles aufnehmen. Unter diesen sticht Martin Luther hervor, der zwar im Mittelalter lebte, jedoch noch heute als einer der Väter der Moderne gilt. Natürlich hatten die Beatles weder die Möglichkeit, per E-Mail zu kommunizieren, noch haben sie je das World Wide Web kennengelernt. John Lennon verstarb viel zu früh und konnte somit den Fall der Berliner Mauer nicht mehr miterleben, während George Harrison kurz nach dem Angriff auf die Zwillingstürme von New York starb. Aber es steht außer Frage, dass die vier Pilzköpfe aus Liverpool die Protagonisten einer Zeit waren, in der gewaltige Veränderungen geschahen, deren Folgen, sowohl im Positiven wie im Negativen, bis hinein in unsere heutige Zeit reichen.
Die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts beschreiben auch im Hinblick auf die Rolle, die die Kirche in der westlichen Gesellschaft einnimmt, einen Wendepunkt, der sich mit nichts anderem als den bedeutenden Umwälzungen vergleichen lässt, zu denen es im 15. Jahrhundert infolge der Reformation Martin Luthers kam. Am 8. April 1966 erschien die amerikanische Wochenzeitschrift „Time“ mit einem Titelcover, das explosiver nicht hätte sein können:
In nüchternen roten Lettern auf schwarzem Hintergrund prangte der einsame Schriftzug „Is God dead?“ („Ist Gott tot?“). In jenen Jahren, die stark von der Philosophie Nietzsches des ausgehenden 19. Jahrhunderts geprägt waren, theoretisierten einige amerikanische Theologen sogar über eine sogenannte „Gott-ist-tot-Theologie“, auch wenn sie sich hinsichtlich der konkreten Bedeutung dieser Begrifflichkeit untereinander nicht ganz einig waren. Vermutlich kam die Frage, ob Gott tot ist, in diesen Jahren deshalb auf, weil es die unerbittlichsten Jahre des Kalten Krieges waren und den Menschen die Gefahr, dass der Planet für immer zerstört werden könnte, real vor Augen stand. Das II. Vatikanische Konzil und die Befreiungstheologie kennzeichneten die katholische Welt jener Zeit. Das führte dazu, dass sich sogar die katholische Kirche in dem spannenden Dialog über diese Themen als ernstzunehmender Gesprächspartner qualifizierte. Leider hat das päpstliche Lehramt diese Ansätze in den letzten 30 Jahren wieder stark beschnitten, wenn nicht gar komplett zurückgenommen. Außerdem veränderte sich auch die Vorstellung vom Begriff der Mission, denn mit der Selbstständigkeit der europäischen Kolonien in Afrika und Asien endete auch die Ära des Kolonialismus. Die Kirchengemeinden, die seinerzeit dort durch Mission entstandenen waren, emanzipierten sich nun von ihren Mutterkirchen. Die zwischen Europa bzw. Nordamerika und den Ländern der südlichen Hemisphäre bestehenden Kräfteverhältnisse der Christenheit fingen an, sich zu verändern. Das Christentum, so wie es sich heute in unserer Gesellschaft darstellt, muss als direkte Konsequenz der Auseinandersetzung gesehen werden, die in jenen Jahren zwischen Gesellschaft und Kirchen erfolgte.
Die Beatles waren Teil einer Bewegung, die gegen all das rebellierte, was zum Establishment gehörte (dieser Begriff kann mit „konstituierte“ bzw. „etablierte Macht“ übersetzt werden), und auch die Kirche verkörperte einen Teil davon, genauso wie der Staat, das Militär, das Großkapital und ein Schul- und Erziehungssystem, das nur dem Zweck zu dienen schien, den Menschen in ein System zu pressen, das seine Individualität auslöscht. Ein Jahrzehnt später lieferte die englische Komikergruppe Monty Python in einer Folge von Der Sinn des Lebens (Terry Jones, 1981) eine im Geiste der sechziger Jahre interpretierte bitter-ironische Darstellung des englischen Schulsystems, in welchem Gleichmacherei und Klassenbewusstsein keine Widersprüche sind. In dieser Episode richtet die Schule die Massen darauf ab, sich im Krieg als Kanonenfutter verheizen zu lassen. Angeregt durch seine bekannten und provokanten Söhne (die Beatles und Monty Python) muss das ehemalige Weltreich Großbritannien nun, nachdem es seine vierhundertjährige Vormachtstellung eingebüßt hat, über sich und seine Position in der Welt nachdenken.
Wie reagierten die Kirchen seinerzeit darauf? Auf zweierlei Weise, nämlich indem sie das Phänomen der Rebellion gegen das Establishment entweder bekämpften oder ignorierten. In beiden Fällen war das Resultat, dass eine Mauer aufgebaut wurde. Dies war eine der großen Zäsuren in der Geschichte der Kirche, die sich in ihrem Ausmaß und ihrer Härte nur mit dem Prozess gegen Galileo Galilei vergleichen lässt. Über Jahrhunderte hinweg waren die christlichen Kirchen eins mit der Gesellschaft, und dies dank ihrer Fähigkeit, mit ihr in Dialog zu treten. Mit dem Auftreten Galileis verschließt sich die Kirche jedoch gegenüber den Wissenschaften, mit dem Auftreten der Beatles verschließt sie sich höchstoffiziell gegenüber der Populärkultur. Der hohe Preis, der dafür gezahlt wurde, ist Säkularisierung – die Herauskristallisierung einer Gesellschaft, die so lebt, als ob Gott nicht existierte. Eine Welt, in der die Kirche nur ein Akteur der Gesellschaft unter vielen ist, so wie es die Gewerkschaften, die Parteien oder die Vereine sind. Eine Welt, in der Gott nicht mehr der Ausgangspunkt für alles und für alle ist, sondern in der man Mühe hat, ihn überhaupt ins Gespräch zu bringen.
Vielleicht muss all dies aber auch gar nicht zum Nachteil des Glaubens wirken. Es ist ja fast unmöglich, eine Zeit zum Ideal zu erheben, die wir selbst nicht miterlebt haben und in der die Kirchen sehr viel mehr Bedeutung hatten als heute, in der die christliche Botschaft wahrscheinlich aber auch verwässert worden war. Ein Vorbote dieser Entwicklung war beispielsweise im 18. Jahrhundert die religiöse Erweckung, die wie ein Alarmsignal für eine Kirche wirkte, die sich mehr und mehr an die säkulare Welt angepasst hatte, anstatt in ihr als ein Licht zu leuchten. Die Rebellion einer gesamten Generation junger Menschen gegenüber den Kirchen ist aber nicht unbedingt gleichbedeutend mit einer Rebellion gegen Jesus Christus. Den Protest gegen die Kirche als Teil des Establishments kann man auch unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass hier zwischen Glaube einerseits und Religion andererseits unterschieden wird. Dem Glauben wird hierbei eher positiver gegenübergestanden als der Religion. Diese Unterscheidung, die u. a. vom Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer und auch Karl Barth ganz bewusst vorgenommen wurde, ermöglichte überhaupt erst das Überleben der christlichen Botschaft und der Kirchen nach Auschwitz.
Mein Vorhaben nun, den Einfluss, den die Beatles auf die Gesellschaft hatten, von einem christlichen Standpunkt her zu untersuchen und mich zu diesem Zweck mit ihren Liedern und Liedtexten zu befassen, versteht sich daher weder als ein weiterer Zensurversuch mit erhobenem Zeigefinger noch als eine verspätete Rehabilitierung.6
Die vorliegende Analyse versteht sich lediglich als bescheidener Versuch, den Dialog zwischen dem christlichem Glauben und der Popkultur, der vor einem halben Jahrhundert so abrupt abgerissen ist, wieder aufzunehmen. Zu diesem Zweck schauen wir uns das Phänomen der Beatles noch einmal genauer an und lassen uns dabei von einer Richtschnur leiten, die so gar nicht zu den Beatles zu passen scheint, die aber im Leben vieler Menschen auch heute noch eine Kompass-Funktion hat: den Zehn Geboten.
Die Zehn Gebote sind nicht einfach nur eine Reihe von Vorschriften, sondern beschreiben das maßgebende Urmodell der Beziehung zwischen Mensch und Gott bzw. zwischen Mensch und Mensch, und zwar im Spannungsbogen der Zeiten: von der Vergangenheit („der Herr, dein Gott, hat dich errettet“) über die Wahl, die der Mensch im Heute zu treffen hat, bis hin zu einer Zukunft, in der die Liebe allgegenwärtig herrscht. Oder, wie es die Beatles formulieren würden, schlicht als Aufforderung zu lieben – love.
1 Anmerkung der Übersetzerin: Der Titel des Songs lautet „Chiedi chi erano i Beatles“ (Frag’ mal, wer die Beatles waren).
2 Hierbei handelt es sich um einen Film von Richard Lester, in Deutschland 1964 unter dem Titel Yeah Yeah Yeah erschienen.
3 Unter Feedback, d. h. unter akustischer Rückkoppelung, versteht man einen schrillen Störton, der durch einen Verstärker hervorgerufen wird, der zu nahe an das Mikrofon oder an den Tonabnehmer gestellt wurde.
4 Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967, und The Beatles, 1968).
5 War sein Motiv für diese unglückselige Tat ja gewesen, durch sie Berühmtheit zu erlangen.
6 Am 10. April 2010 wurde von der amtlichen (Tages-)Zeitung des Apostolischen Stuhls „L’osservatore romano“ (Der Römische Beobachter) eine die Beatles betreffende Rehabilitierung veröffentlicht, für die Ringo Starr nur die lakonische Reaktion „I couldn’t care less!“ (das tangiert mich überhaupt nicht) übrig hatte.