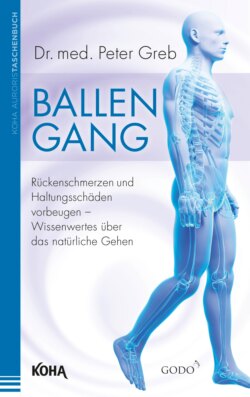Читать книгу Ballengang - Peter Greb - Страница 9
ОглавлениеDas Gehverhalten des Menschen
»Das wahre Wunder besteht nicht darin,
auf dem Wasser zu wandeln,
sondern auf der Erde zu gehen.«
Thich Nhat Hanh: Ich pflanze ein Lächeln
Die platonischen Seelenkräfte und GODO
Platon beschrieb die Seele in den folgenden drei Teilen: Wollen – Denken – Fühlen. Goethe verinnerlichte diese Erkenntnis in seinem zum Volkslied gewordenen Gedicht: »Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn …« Er ließ sich von seiner Seele spazieren führen.
Nach einem dreißigjährigen Studium des Goethe-Nachlasses in Weimar erkannte Rudolf Steiner, der spätere Begründer der Anthroposophie und der Waldorfschulen, dass Wollen, Denken und Fühlen die drei Tätigkeiten unserer Seele sind. Er nannte sie explizit: SEELENTATEN. Dabei wird der Körper zum Instrument des Ausdruckes dieser drei Seelentaten. Somit ist auch unser Gang deren Ausdruck; sie können in jedem Schritt gesondert erfahren werden.
Bisher macht man sich das nur in der Heileurythmie zunutze. Durch das sogenannte dreigliedrige Schreiten »Heben – Tragen – Stellen« (Wollen – Denken – Fühlen) wirkt sie heilend auf Körper-, Sprach- und Wahrnehmungsstörungen ein.
Beim Stotterer drücken sich Wollen – Denken – Fühlen gleichzeitig aus. Es bildet sich ein Sprachknoten, der durch bewusstes Schreiten, das heißt durch die Entschleunigung der einzelnen Seelentaten, entwirrt werden kann (Heileurythmie).
Die platonischen Seelenkräfte werden heileurythmisch, also lediglich therapeutisch, oder in der Eurythmie als Kunstform genutzt. Ich habe nur ganz wenige Menschen getroffen, die aus einer solchen Erziehung als Ballengänger hervorgegangen sind. Dazu gehören einige ehemalige Mitglieder der Loheland-Schule in Hessen, die nach anthroposophischen Grundsätzen geführt wird. Auch die israelische Künstlerin Ruth Arion (1912–1988) war in ihrer Jugend mit dieser Bewegung in Berührung gekommen. Sie erinnerte sich, zwischen 1926 und 1936 im »königlichen Gang« geschritten zu sein. Während unseres Gespräches wurde ihr plötzlich klar, dass sie erst nach ihrer Flucht vor den Nazis bei der Arbeit am Fließband im Kibbuz den »königlichen Gang« vergessen habe. Viele Jahre später durfte ich sie wieder daran erinnern.
Jeder Schritt lässt sich als eine Folge von Gesten begreifen. Diese Gesten sind, wie wir erfahren haben, Ausdruck unserer Seelentaten. Ihr Sinngehalt und ihre Aufeinanderfolge unterscheiden sich je nach unserer Gangart, also je nachdem, ob wir uns als Hackengänger oder als Ballengänger bewegen.
Das Ruhen und das Wollen, die beiden ersten Phasen jeden Schrittes, sind bei Hackengängern wie bei Ballengängern gleich:
Ruhen
Vor aller Bewegung ist Ruhe. Wenn wir stehen, können wir sagen: »Ich ruhe.« Durch diesen kleinen, bewusst gesprochenen oder gedachten Satz machen wir uns die Geste des Ruhens innerlich real und fühlbar. Legen Sie das Buch für eine oder zwei Minuten beiseite, stellen Sie sich aufrecht und mit schulterbreit parallel gestellten Füßen hin, schließen Sie die Augen, atmen Sie dabei tief und ruhig aus und ein und denken Sie: »Ich ruhe.«
Wollen
Um aus der Ruheposition, aus dem Stand in die Bewegung zu kommen, bedarf es eines Willensimpulses. Dazu können wir uns selbst sagen: »Ich will.« In diesem Moment löst sich die Ferse von der Erde. Das Abheben ist Ausdruck eines umgesetzten Impulses der Seele und geschieht zeitgleich mit der »Ich will«-Geste als Lösung der Ferse von der Erde. Damit Sie das wirklich fühlen, bitte ich Sie erneut, das Buch wegzulegen und mehrere Schritte zu machen. Konzentrieren Sie sich dabei auf den Moment, in dem das Heben der Ferse gleichzeitig mit einem laut gesprochenen »Ich will!« wahrgenommen wird.
Der japanische Meister Ha ku yushi sagte: »Der Atem des rechten Menschen ist ein Atmen mit den Fersen.« Bei der GODO-Meditation, die ich auch gerne »dynamisches GODO-Yoga« nenne, entspricht das Lösen der Ferse dem Moment der beginnenden Einatmung. Probieren Sie es doch gleich einmal aus.
Denken
Der freie, gelöste Fuß, das sogenannte Spielbein, durchmisst den Raum, wobei die äußere Welt an uns vorübergleitet, wir uns durch sie hindurchschieben, etwa so, wie die Gedanken sich immer neu bildend und wieder verblassend unsere Köpfe durchziehen. Hier können wir uns bewusst werden, dass die Seele sagt: »Ich denke.« Dabei schwebt das Spielbein frei wie ein Gedanke über der Erde.
Bei diesem Bewegungsabschnitt scheiden sich die Geister. Der Hackengänger hebt nämlich seine Fußspitze hoch, bevor er die Erde mit der Ferse betritt, während der Ballengänger seinen Fuß locker hängen lässt und deshalb der Erde mit Ge(h)fühl begegnet.
Was hier geschieht, bedarf einer besonderen Betrachtung, denn es handelt sich um die Kernproblematik des Hackenganges.
Ganganalyse
Die Gestik des Hackenganges
Da wir bisher selber in jedem Schritt die Erde mit der Ferse zuerst berühren, ist uns der Anblick unserer Mitmenschen, die mit der Ferse voran die Erde betreten, derart vertraut, dass wir zunächst nichts Auffälliges wahrnehmen. Aber schauen wir einmal ganz genau hin! Es bedarf einer besonderen Konzentration, wenn man ein gewohntes Bild mit frischem Blick erfassen möchte. Nehmen Sie sich dafür wirklich etwas Zeit …
Bisher galt uns ein solcher Anblick als normal und natürlich
Erst wenn wir den Hackengang analysieren, begreifen wir, dass er nicht nur eine mechanische Fortbewegungsart darstellt, sondern dass sein Ablauf eine Folge bedeutsamer Gesten enthält, mit denen wir der Welt begegnen und für die wir auf eine ungeahnte Weise verantwortlich sind.
In der erhobenen Fußspitze offenbart sich die Geste der Abwehr und der Zurückhaltung im Gefühl. Dieser Ausdruck besagt: »Ich will nicht fühlen, ich habe kein Vertrauen.«
Es gibt eine Möglichkeit, uns das, was wir mit den Füßen unbewusst und ungefühlt ausdrücken, über unsere Hände spürbar zu machen. Dazu bitten wir eine Person, die völlig unvorbereitet ist, uns die Hand zu reichen. Wir strecken unsere Hand so aus, als wollten wir ihre Hand empfangen, ziehen die unsere jedoch gleich wieder mit der Geste der Abwehr (einem Heben der Finger und Vorschieben der Handwurzel) zurück.
Beiden tut diese paradox abwehrende Geste »weh«: dem, der sie erzeugt, und dem, gegen den sie sich wendet.
Genau das ist es, was jeder Hackengänger mit jedem Schritt sich selbst, seinem Nächsten und der Erde antut. Ob sich die Erde wohl ebenso schlecht fühlt, wenn wir ihr bei zurückgehaltener Fußspitze »zwangs-läufig« mit der Hacke begegnen? Und wie fühlen wir uns selbst dabei – bisher ohne es deutlich und bewusst zu merken? Könnte das der Grund dafür sein, dass wir der Erde so wenig Liebe und Achtsamkeit entgegenbringen? Diese Geste macht uns zu Fremden auf dieser Erde. Dementsprechend denken, fühlen und handeln wir.
Die gestische Bedeutung der aufstampfenden Ferse heißt Wut und »Ich will nicht« oder »Ich will nicht wollen«. So zart und leichtfüßig Einzelne auch über die Hacke abrollend gehen mögen – ein gewisses Stampfen, eine Erschütterung können wir nicht unterdrücken. Marschierende Soldaten können durch ihren Fersenauftritt im Gleichschritt die Statik einer Brücke gefährden. (Deshalb gab es im Zweiten Weltkrieg entsprechende Verbotsschilder.) In den höchsten Gebäuden unserer Städte ist das Vibrieren der Fußböden ein Problem, das durch den Auftritt mit High Heels erzeugt wird.
Prüfen Sie es selbst noch einmal: Halten Sie sich mit je einem Finger die Ohren zu und gehen Sie schnellen Schrittes auf Ihre gewohnte Weise. Lauschen Sie dabei in sich hinein. So können Sie über die Knochenleitung ein »Tock-tock-tock« wahrnehmen, das von den Fersen bis zu ihrem Schädel hinauf echot. Der Fersenstoß erschüttert nicht nur die Wirbelsäule und Gelenke und damit die Muskulatur, sondern auch alle Organe und vermittelt unserer Körpervorstellung unnötig erhöhte Schwerkraftwerte. Außerdem drücken wir gestisch mit jedem Hackengangschritt immer wieder »Ich will (zwar losgehen) – Ich will nicht (fühlen/wollen)« aus. Das begründet einen Zwiespalt des reinen Willens. Fühlen Sie doch mal in sich hinein, wenn Sie sagen: »Ich will – – – nicht.« Ist das nicht superparadox, also der Widerspruch in sich? So landen wir zwar genau da, wo wir hinwollten, aber wir drücken aus, dass wir gar nichts wollen, weder fühlen noch wollen. Es ist offensichtlich, dass wir diese gefühlsverneinende Geste mit jedem Hackengangschritt aktiv erzeugen, und es ist folgerichtig, anzunehmen, dass wir im Gehirn und in der gesellschaftlichen Begegnung damit ein Programm der Abwehr installieren.
In der Kinesiologie hat sich gezeigt, dass eine ablehnende, verweigernde mentale Haltung und die dazugehörigen Gesten zu einem schwachen Muskeltest führen. Das sollte unter anderem der Allergieforschung zu denken geben, da Allergien sehr häufig durch Überforderungen ausgelöst werden können.
Das sogenannte Marschieren auf der Stelle und das militärische Marschieren
Das militärische Marschieren ist eine besonders ausgeprägte Form des Hackenganges, bei der im Gleichschritt über die Hacke gegangen wird. Ganz anders verhält es sich beim sogenannten Marschieren auf der Stelle, bei dem man mit den Armen kräftig mitschwingt und die Schultern derart mitbewegt, dass die gesamte Wirbelsäule eine spiralige Bewegung um ihre zentrale Achse ausführt. Probieren Sie es aus! Denn wenn Sie genau hinsehen und in sich hineinfühlen, erkennen Sie sofort, dass es sich um eine ausgeprägte Ballengangbewegung handelt. Tatsächlich ist es schier unmöglich, beim »Auf-der-Stelle-Marschieren« mit der Hacke zuerst aufzusetzen.
Wie im Kapitel »Forschung und Erkenntnisse durch Beobachtung« beschrieben, hat das Gehen auf der Stelle eine ausgesprochen harmonisierende Wirkung auf Geist und Körper, das heißt, die Hirnhälften werden synchronisiert. Kinesiologen nutzen das, weil sichere Testungen nur in diesem Zustand möglich sind. Vor Jahren, als ich der Kinesiologen-Vereinigung auf ihrem Kongress in Kirchzarten die Zusammenhänge erklären konnte, rief dies großes Erstaunen hervor. Seitdem wissen sie, dass ein Ballengänger schon synchronisiert zu ihnen kommt.
Sobald wir uns allerdings vom »Marschieren auf der Stelle« in den Raum bewegen, verfallen wir unwillkürlich in den gewohnten Hackengang, das wirkliche Marschieren, das offensichtlich das Gegenteil einer Harmonisierung bewirkt. Beim Marschieren werden die Arme zwar gegensinnig vorwärts und rückwärts geschwungen, die Schultern aber gerade auf der steifen Wirbelsäule festgehalten. Es wird vermieden, die Körpermitte als Ursprung für einen spiraligen Bewegungsimpuls gegenläufig mitschwingen zu lassen. Auch die Bewegung der Hüften wird unterdrückt.
Eine besondere Art des Marschierens war der preußische Stechschritt, der heute noch von der russischen Armee praktiziert wird, bis die Fußgelenke schmerzen. Dabei exerziert man mit gestrecktem Bein und steif gestrecktem Fußgelenk und knallt mit den Vorfußballen voran auf die Erde auf. Ein solch expressives Marschieren über die Ballen muss gelernt werden und eignet sich besonders zum Paradieren.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts beherrschten nur die Gardeoffiziere Preußens einen derart tadellosen »Stechschritt«, dass er allem Volk imponierte. Die jungen Männer im Lande wollten gerne auch so sein wie diese schmucken und bis in die Zehenspitzen erweckten Kadetten und Offiziere Preußens. Sie hatten allerdings nicht den Paradestechschritt gelernt, sodass aus »normalen« Hackengängern ein großes Heer von marschierenden Soldaten aus den Schulbänken herausrannte. Da das militärische Marschieren eine Verstärkung des schlichten Hackenganges darstellt, erhöhten sich mit jedem Hackenstoß die Schwerkraft-Empfindung und die Aggression in jedem einzelnen Soldaten – natürlich unbewusst. Die »Vermehrung« der eigenen Masse floss zusammen mit der großen Masse und schien von ihr getragen zu werden. Was bisher unbewusst blieb, wird durch GODO plötzlich fühlbar.
GODO zeigt: Wer einmal schreitet, marschiert nie wieder.