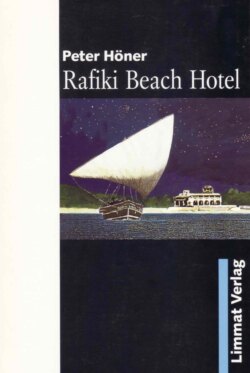Читать книгу Rafiki Beach Hotel - Peter Höner - Страница 4
L A M U : Montag, den vierten April …
ОглавлениеÜber dem Festland und der Insel Manda hellt die Dämmerung den Himmel auf. Ein sanftes Licht breitet sich aus, und das Stahlgrau des Wassers wechselt seine Farbe. Aus dem seichten Meer steigen das Grünblau, aus den Tiefen das fast tintige Dunkelblau des Ozeans, bis die ersten Sonnenstrahlen übers Wasser funkeln, sich in den weissen Schaumkronen der Brandung brechen und das Meer vom Himmel trennen.
In der Bucht hinter Shela füllt der Eseltreiber Hamischi Kamani die Strohtaschen seiner Esel mit Korallensand. Bereits im Begriff den Rückweg nach Lamu anzutreten, entdeckt er etwas unterhalb der Marke von Blättern, Tang und Holzstückchen, die den Höchststand der letzten Flut anzeigen, den verdrehten Körper einer Frau, nackt und von Krabben aufgerissen, die sich in den toten Körper zwängen.
Sein Entsetzen überwindend, reisst er die Schaufel aus einer der sandgefüllten Taschen und läuft schreiend auf die Leiche zu, vertreibt die Krabben, rollt den Körper mit seiner Schaufel in den höher gelegenen Ufersand, deckt ihn mit Sand zu und eilt mit seinen Eseln, so schnell er kann, in die Stadt zurück.
Das zweimotorige Kleinflugzeug der «Equator Airlines» steht startklar in der flimmernden Hitze der Asphaltpiste in Mombasa. Vorne rechts klemmt sich der Privatdetektiv Jürg Mettler, ein grosser, kräftiger Mann, mit kurzgeschnittenen Haaren, kleinen, lebhaften Augen, von buschigen Brauen überschattet, auf den Sitz hinter dem Doppelsteuer neben den Piloten.
«Guten Flug und: Schöne Tage in Lamu».
Der Angestellte der «Equator Airlines» gibt dem Piloten die Flugscheine der Passagiere und drückt die Türe zu. Der Pilot lacht, kichert in die hohle Hand. Mettler schüttelt den Kopf.
«Warum lachen Sie? Steht die Insel unter Wasser?»
«Nein, nein, Entschuldigung, aber die Art wie er das sagte: Schöne Tage ...»
Misstrauisch und unfreundlich schaut Mettler den kenianischen Piloten an, der sich eine Schirmmütze in die Stirn zieht. Ein verwaschenes Mützchen mit dem bekannten Schriftzug einer Schweizer Zeitung.
«Ein Geschenk. I like it very much.»
Ein Pilot, der mit einer Werbemütze für das «Badener-Tagblatt» fliegt? Mettler, ein Aktenköfferchen auf den Knien, presst seinen schweren Körper gegen die Rückenlehne des kleinen Sitzes und zieht den Bauch ein, um nicht gegen den gabligen Steuerknüppel zu stossen. Der Pilot schaltet die Bordlautsprecher ein, spricht in sein Funkgerät, die Lautsprecher knacken und rauschen, irgendwo antwortet eine unverständliche Stimme, kauderwelscht in mehreren Sprachen – Mettler ist kurz davor, wieder auszusteigen, noch ist es Zeit – als der Pilot zwischen Steuerknüppel, Aktentasche, Mettlers Bauch und dessen krampfhaft verschränkten Armen nach der Türe greift, diese verriegelt, auch ein zweites Schloss unter dem Dach in seine Sicherheitsposition zieht und die Bremsen löst. Geschickt lenkt er das kleine Flugzeug in die Pistenmitte, jagt über Markierungen und Aufsetzpunktbefeuerung und hebt das Flugzeug in die Luft.
Wie sich der Pilot seinen Weg zwischen Himmel und Erde sucht, einem Wolkenturm ausweichend, einen anderen überfliegend, macht demjenigen Spass, der sich ohne Angst den Flugkünsten des Piloten überlassen kann, Mettler gelingt dies nicht.
Er traut weder dem Piloten noch der Maschine, und wenn er seinen Blick dem Flugzeugflügel entlang schweifen lässt, entdeckt er laufend kleinere Mängel. Eine aufgeplatzte Blindniete. Eine lose Kreuzschlitzschraube. Abblätternde Farbe. Alles Vorboten weit gravierenderer Mängel. Wenn dann gar der Pilot mit dem Mittelfinger gegen die Gläser der Kontrollanzeigen im Cockpit klopft, um die Anzeigenadeln, die sich verklemmt haben, wieder frei zu bekommen, bricht Mettler der kalte Schweiss aus. Er glaubt, in einer fliegenden Schrottkiste zu hocken, der jederzeit irgendetwas abbrechen kann, wo Leitungen lecken, Kontakte verschmutzen, die Zündung aussetzt, oder ein Fahrgestell klemmt, eine Seitenruderflosse sich aus ihren Scharnieren löst. Nein, Fliegen hat für Mettler keinen Reiz.
Der Flug dauert nicht lange. Nach einer guten Stunde setzt der Pilot zur Landung an. In einem sanften Bogen zieht er über Lamu hinweg und steuert auf den kleinen Flughafen der gegenüberliegenden Insel zu. Aus dem Buschwerk der Mangroven taucht ein kurzes Stück rotbrauner Piste, der Pilot drosselt die Geschwindigkeit, kaum spürbar setzen die Räder auf, die Maschine ist gelandet.
«Willkommen in Lamu.»
Die Hitze ist unerträglich. Kein Wind, keine kühlende Brise über den Mangrovensümpfen, nichts, nur diese lähmend feuchte Glut. Die kleine Gruppe der Lamureisenden steht neben dem Flugzeug und wartet darauf, dass das Gepäck ausgeladen wird. Eine Schar zudringlicher Träger umringen die Touristen.
«Das erste Mal in Lamu?»
«Welches Hotel? Haben sie schon eine Unterkunft?»
«Wie lange bleiben Sie? »
«Boot?»
Mettler folgt den beiden Halbwüchsigen, die mit seiner Reisetasche losziehen, wohin weiss er nicht, doch es wird wohl alles seine Ordnung haben. Schon beginnt seine Hose im Schritt zu kleben. Die schwüle Luft verursacht ihm Atembeschwerden und der milchgraue, gleissende Himmel blendet ihn so, dass er hastig nach seiner Sonnenbrille sucht, die er sich auf die Nase klemmt. Die beiden Träger hat er längst aus den Augen verloren. Er trottet mit den soeben angekommenen Touristen, die alle wie Mettler unter ähnlichen Hitzesymptomen leiden, auf dem schmalen Pfad durch den Mangrovensumpf.
Einzig eine junge Mutter mit Kind scheint gegen den Überfall der erdrückenden Hitze gefeit zu sein und beschreibt ihrem Sohn oder der Tochter die Schönheiten der Mangroven, die in der Tat, jetzt im April, viele farbige Blätter haben, rote, gelbe, braune, was bei dem vom Baum gefallenen Laub, das zwischen den Mangrovenstrünken auf dem Wasser tanzt, an einen europäischen Buchenlaubteppich im Herbst erinnert.
Die Nachricht des Eseltreibers Hamischi Kamani, dass am Strand die Leiche einer Frau, einer Weissen liegt, löst in der Polizeistation Lamus eine Flut von Ausreden aus. Die Bereitschaftspolizei will den Fall an die Kriminalpolizei übergeben. Die Kriminalpolizei weigert sich und informiert die Hafen- und Wasserpolizei. Diese verteidigt sich. Die Tote sei am Strand gefunden worden und falle deshalb nicht mehr in ihren Kompetenzbereich. Die ganze Angelegenheit sei äusserst delikat und ein Fall für den Geheimdienst.
Erst die Order des Polizeichefs, dass sich alle Organe der Vollzugspolizei um den Fall zu kümmern haben, veranlasst den Chef der Kriminalpolizei, Mister Tetu, einen älteren Kikuyu, der von allen als Chef anerkannt wird, seinen Assistenten Mwasi und ein paar weitere Leute zu beauftragen, in die Bucht hinauszufahren und die Ertrunkene zu bergen.
Das grosse Motorboot, eine altersschwache Dieseldau, ist bereits übervoll. Doch da Mettler die beiden Burschen mit seiner Tasche im Bug des ehemaligen Segelschiffs entdeckt, klettert er über den schmalen Steg ins Boot, wo er sich auf einen kistenförmigen Aufbau in der Mitte des Schiffes hockt. Die Bretter dämpfen die Vibrationen des Dieselveteranen allerdings kaum, so dass sich Mettler schon nach wenigen Minuten mit kribbelndem Hintern ein neues Plätzchen sucht. Er quetscht sich zwischen eine Gruppe schwarz gekleideter Frauen, die ihr Kichern über den schwitzenden Mann hinter ihren Buibuis verstecken.
Auch auf dem Wasser regt sich kein Lüftchen. Die Hitze lagert wie ein Klumpen unverändert über Land und Meer. Lamu döst in der Mittagssonne, grau und flach.
Die Überfahrt von Manda nach Lamu dauert nur wenige Minuten. Mettler hockt eingekeilt zwischen den Frauen, die fröhlich schwatzen, und überlässt sich dem Schaukeln des Schiffes, das sich träge durch das scheinbar unbewegte Wasser pflügt. Langsam zeichnen sich die Umrisse der Stadt Lamu ab. Einzelne Gebäude, die langgestreckte Hafenmole, die wenigen grünen Tupfer grösserer Baumgruppen, meistens Kokospalmen. Aber, obwohl Mettler glaubte, sich an Lamu recht gut erinnern zu können, weckt die Stadtfassade keine konkreten Erinnerungen. Die schmalen, hohen Häuser, die vielen Bögen und Durchbrüche könnten genauso gut in Spanien oder Sizilien sein: Die Hafenansicht eines grösseren Fischerdorfes, wie er sie schon oft gesehen zu haben glaubt, nichts Besonderes, wenn auch immer wieder von einer pittoresken Schönheit, für die so viele seiner Zeitgenossen schwärmen, Mettler allerdings nicht, und der deswegen auch die verschämten Ausbrüche des Entzückens seiner Mitreisenden mehr belächelt als nachvollziehen kann. Vielleicht ist es aber auch nur die Hitze, die sich wie ein Schleier zwischen seine Wahrnehmungen schiebt und ihn, trotz Sonnenbrille, zwingt, die Augen zusammenzukneifen, wenn er mehr als nur gerade die groben Umrisse der Stadt erkennen will. Gequält schliesst er die Augen, schiebt die Sonnenbrille in die Stirn und reibt sich die Nasenwurzel: Kopfschmerzen wird er haben, so viel weiss er schon.
Es ist nicht schwer, den Ort zu finden, wo Hamischi die Leiche mit Sand zugeschaufelt hat. Mittlerweile versammelt sich dort eine Gruppe von Einheimischen. fast ausschliesslich junge Männer, keine Frauen. Sie haben das entstellte Gesicht der Frauenleiche frei gemacht und diskutieren darüber, wer die Ertrunkene sein könnte. Während die einen behaupten, es handle sich um eine Touristin, die seit einer Woche in Shelas einzigem Hotel «Rafiki» wohne, so vermuten andere, die Frau sei die Freundin eines «Beachboys», Lady Gertrud. Eine dritte Gruppe will die Tote noch nie gesehen haben, was die Männer, um sich wichtig zu machen, sogar beschwören wollen.
Der Polizeiassistent Mwasi hört sich in aller Ruhe die verschiedenen Versionen an. Dann beauftragt er einen seiner Leute, den Strand nach möglichen Spuren, wie zum Beispiel den Kleidern der Toten oder Badeutensilien abzusuchen, zwei weiteren befiehlt er, die Tote, sobald die Flut zurückkehrt, auf das Motorboot zu schaffen und nach Lamu zu fahren, während er selbst den Strand entlang gehen will, um sich sowohl im Hotel «Rafiki» als auch in Lady Gertruds Haus umzusehen. Seine Anweisungen sind klar und von einer derart selbstverständlichen und ruhigen Art, dass sie den immer hitziger gewordenen Diskussionen um die Identität der Toten ein Ende machen.
Auch nach der Ankunft des Bootes in Lamu geben die beiden Burschen Mettlers Gepäck nicht aus den Händen.
Die Uferstrasse längs der Kaimauer liegt verlassen in der Mittagshitze. Im Schatten der wenigen Bäume stehen ein paar Esel, in den wenigen Restaurants sitzen kaum Leute, und die Büros der Verwaltung, Polizei, der Reise- und Fluggesellschaften, aufgereiht wie auf einer Hühnerstange, sind geschlossen. Die Leute, die das Boot in Empfang nahmen, verlaufen sich schnell, verschwinden in kleineren Gruppen in den schattigen Gässchen der Stadt. Die schwüle Hitze, mit Gerüchen aller Art gesättigt, legt sich wie ein feuchtklebriger Mantel um Mettler, der nur mit Mühe seinen Trägern folgen kann. Bereits haben sie die sogenannte Hauptstrasse wieder verlassen und sind mehrmals in immer engere Gassen abgebogen, und, obwohl seine Führer immer wieder mit knappen Bewegungen auf Schilder deuten, die den Weg zum ausgewählten Gasthaus weisen, verliert Mettler jede Orientierung. Endlich bleiben sie vor einer für Lamu typischen Doppeltüre mit orientalischem Schnitzwerk stehen, dem Eingang zum «Kwaheri Guesthouse».
Der Innenhof, mit Halle, Büro und Küche ist, dank des gewässerten Rasenstücks mit dem mageren Zitronenbäumchen, angenehm kühl. Mettler setzt sich erschöpft auf einen der steifen Stühle in der Halle und überlässt seinen beiden Trägern die Verhandlungen mit einem Angestellten des Gasthauses. Nur auf die Frage, wie lange er denn zu bleiben gedenke – eine, zwei oder drei Nächte? – gibt er die Antwort, dass es bestimmt eine Woche werden dürfte, worauf sich die beiden Burschen, nachdem sie einen wohlbemessenen Trägerlohn kassierten, von Mettler verabschieden. Simon, der Hausbursche nimmt Mettlers Gepäck und geht ihm durch eines der beiden Treppenhäuser voran. Sie erreichen eine Terrasse, und gelangen über eine rechtwinklig abbiegende Galerie zu den Zimmern 8 und 9.
Simon, der Mettlers Gepäck im Zimmer 9 auf eine kleine Holzpritsche stellt, erklärt, bereits wieder unter der Türe, die Vorzüge des Zimmers Nummer 9, dem einzigen, das zur Zeit noch frei sei, das Mettler aber schon in zwei Tagen gegen ein anderes eintauschen könne, denn dann werde das Zimmer Nummer 5 frei, das wesentlich grösser sei, sogar eine eigene Terrasse habe, obwohl er persönlich immer dieses kleinere Zimmer vorziehen würde, das höher gelegen sei, darum luftiger, was besonders nachts von Vorteil sei, da es dank des Windes viel weniger Moskitos habe, obwohl jedes ihrer Zimmer über einen hervorragenden Ventilator verfüge. Doch er wolle Mettlers Entscheidung nicht vorgreifen. Nummer 5 habe allerdings ein Bett mehr, nämlich drei, doch er sei ja allein, und ein zweites Bett habe auch Zimmer Nummer 9, was ihm, so schliesst Simon augenzwinkernd seine Ausführungen, jederzeit ebenfalls zur Verfügung stehe, ganz egal, ob er das Zimmer allein oder zu zweit benutze, denn alle ihre Preise seien Zimmerpreise; und das Frühstück, das sie, allerdings als einzige Tagesmahlzeit, anbieten würden, werde in jedem Fall zusätzlich verrechnet.
Mettler erklärt, dass ihm das Zimmer sehr gut gefalle, und er gleich hier bleibe, duschen und ein bisschen schlafen wolle, denn die lange Reise und das ungewohnte Klima würden ihm doch stärker zusetzen als er erwartet habe.
Das Zimmer macht Mettler einen guten Eindruck, sauber und mit dem für dieses Klima nötigsten ausgerüstet, Dusche, Ventilator und Moskitonetz. Ohne sich lange mit dem Auspacken seiner Reisetasche zu beschäftigen, zieht sich Mettler aus, stellt sich unter die kalte Dusche, schaltet den Ventilator ein und legt sich nackt und nass auf eines der beiden Lamubetten, ein knarrendes Gestell mit einem Strohgeflecht, um, trotz der erfrischenden Dusche, in einen ungesunden Halbschlaf zu verfallen, dessen fiebrige Träume sich mit den Geräuschen – dem Surren des Ventilators, dem Klagegeschrei der Esel, dem Katzengejaul und den Rufen der Muezzins – zu einem Gemisch aus Gegenwart und längst Vergangenem vermengen.
Dass ihm die Hose verrutscht, wäre nicht schlimm, aber er muss das Aktenbündel festhalten, das er sich auf den Kopf gesetzt hat und aus dem ihm der Wind, der durch den Flur des Präsidiums bläst, laufend einzelne Blätter fortreisst. Den Versuch, mit einer Hand die Hose zu halten, mit der andern die Akten, muss er schnell wieder aufgeben, weil es ihm auch schon mit beiden Händen nicht gelingt, die Akten, die immer weniger werden, zusammenzuhalten. Noch nie ist ihm der Korridor des Polizeipräsidiums so lang vorgekommen. Auch an die knarrenden Türen, die sich hinter ihm öffnen und aus denen Leute ihre Köpfe strecken, kann er sich nicht erinnern. Das Gelächter, das hinter ihm her schallt, besonders das Gewieher der Vorzimmerdamen, bezieht er auf sich und seinen Aufzug, der in der Tat immer grotesker wird, ist ihm doch die Hose mittlerweile unter die Knie gerutscht, so dass er sich nur noch in winzigen, schlurfenden Schritten fortbewegen kann.
Vollends in Verwirrung stürzt ihn die Treppe, die ohne ersichtlichen Grund auf halben Weg im Flur beginnt und scheinbar endlos in unregelmässigen Stufen in höher gelegene Stockwerke führt, sich zu winden beginnt und sich, doch wieder mehr im Zickzack, denn kreisend, in die Höhe schraubt, eine Höhe, die ihn aber eher fasziniert als ihn der Korridor ängstigt, so dass er, kurz entschlossen, das Aktenbündel fahren lässt, aus der Hose steigt und in grossen Sprüngen die Treppe hinaufhastet. Die Treppe endet auf einer Brücke hoch über der Stadt, die er zu kennen glaubt, obwohl er ihren Namen nicht weiss, und in deren Gassen er sich wiederfindet, wenn auch nur verschwommen, eine verblassende Spur verwischter Eindrücke, die sich leicht und wie von selbst verliert. Vielleicht sind aber auch die mächtigen Vögel, die ihn kreischend und flügelschlagend umkreisen, schuld, dass er die Stadt vergisst. In ihren Schnäbeln halten sie all jene Papiere, die er im Korridor verloren hat. Eine Beobachtung, die ihn verwirrt, kann er sich doch nicht erklären, wie die Papiere in die Stadt gekommen sind, die er keineswegs mit dem Flur des Polizeipräsidiums in Zusammenhang bringt. Auch nach längerem Nachdenken ist er nicht in der Lage herauszufinden, warum er sich auf dieser Brücke befindet, auf die er geflohen ist, er weiss nicht warum. Die kreischenden Vögel scheinen die Absicht zu haben, ihn von der Brücke zu stürzen, vielleicht auch nur zu verscheuchen, denn offenbar halten sie ihn für einen gefährlichen Eindringling, der entweder ihren Brutplatz gefährdet oder ihnen eine Beute streitig macht. Zu seinem Unglück erkennt er, dass die Brücke nirgends hinführt, sondern im freien Himmel plötzlich abbricht, auch schrumpft, zum schmalen Seil wird. Einer der Vögel, der im Sturzflug und laut schreiend auf ihn einstürmt, bringt ihn aus dem Gleichgewicht, so dass er ins Leere tritt und fällt.
Mettler fährt hoch, schweissgebadet und mit dröhnendem Kopf. Der Luftzug des Ventilators, der sich auf seinem Sockel hin und her dreht, bläst in seinen Aktenstoss, den er sich, mehr aus Pflichtbewusstsein, denn aus Interesse, aufs Bett gelegt hat. Irgendwo in der Stadt scheinen sich Leute zu versammeln. Eine Trommel wird geschlagen. Ein Esel schreit. Vor dem Fenster lärmen ein paar Kinder.
Als der Polizeiassistent Mwasi nach fast zwei Stunden über die Dünen an den Badestrand zurückkehrt, weiss er mehr. Das Haus Lady Gertruds fand er verschlossen, als ob die Weisse abgereist wäre, obwohl niemand etwas von einer Abreise gewusst zu haben schien. Nicht weit vom Fundort der Ertrunkenen findet er in einem Palmengebüsch ein Badetuch mit den Initialen G.H. und eine Sisaltasche, die ausser einem farbigen Baumwolltuch, einer Kanga, und einer angebrochenen Packung Zigaretten leer ist. Die Badeutensilien der Ertrunkenen?
Unten, in der Gasse, braucht Mettler nur dem rasch wachsenden Menschenstrom zu folgen, der dem Lärm entgegen drängt und ihn, der es durchaus nicht eilig hat, mit sich zieht, so dass er, viel schneller als erwartet, auf dem Plätzchen ankommt, wo sich die Leute zu einer Art Kundgebung versammeln. Bereits drängen sich über hundert Menschen, vor allem Frauen, die Mettler in ihren schwarzen Buibuis an Vögel erinnern, um einen tanzenden Kreis junger Männer, der sich in der Mitte des Platzes um einen Mann in einer Sänfte gebildet hat. Zu den Schlägen einer grossen Trommel, sich gegenseitig mit einander über die Schultern gelegten Armen haltend, stampfen die Burschen den Trommelrhythmus in den Sand. Viele Frauen rauchen, ziehen ungeschickt an offensichtlich grosszügig verteilten Gratiszigaretten oder feuern die halbnackten Tänzer zu immer wilderen und geradezu obszönen Bewegungen an.
Einige Leute strecken ein Plakat mit dem Portrait des Mannes in die Luft, der in der Sänfte sitzt, woraus Mettler schliesst, dass es sich bei der Kundgebung um eine Wahlveranstaltung handelt, oder bereits um den Wahlsieg, denn es ist offensichtlich, dass sich der Mann in der Sänfte feiern lässt. Unter den Transparenten fällt ihm die symbolische Erschiessung eines weissen Elefanten auf, der einmal im Wasser steht und, nach seinem Exitus durch eine Frau mit einem Kindergewehr, auf dem Rücken liegt. Ein Protest gegen die reichen Weissen, die sich in Lamu einquartieren? Vielleicht ist es aber auch nur die simple Bitte, die Elefanten, die durchs flache Meer auf die Nachbarinsel waten, zu vertreiben.
Mettler, der sich an eine Hauswand lehnt, schaut dem Geschehen neugierig zu. Er geniesst das Aufblitzen der Augen aus den Schlitzen der Buibuis, das ihm gilt, wenn auch nicht dem Mann, so doch dem Fremden, und das in gewisser Weise mit ein Grund dafür war, weshalb er den Lamu-Auftrag angenommen hat.
Mit Lamu, das er als Jugendlicher besuchte, damals sowohl einem Hippiekult verfallen, den er mittlerweile über Bord geworfen hat, als auch die Privilegien geniessend, die ihm seine Herkunft aus einer begüterten Familie boten, verbindet ihn nicht nur das sorglose halbe Jahr, das er hier mehr oder weniger vertrödelte, sondern auch eine erste grosse Liebe, von der er später nie wieder etwas gehört hat, an die er sich aber sehr wohl und gern erinnert.
Das Tanzen, Klatschen, Schreien, Singen nähert sich immer mehr einem ekstatischen Höhepunkt. Staub wirbelt in die Luft, eine sonnendurchflutete Glocke über den schweissglänzenden Menschen. Plötzlich, ohne dass jemand der Menge ein Zeichen gegeben hätte, beginnt sich diese, stadteinwärts zu drängen und zieht gleich einem Spuk an Mettler vorbei, der versucht, dem Druck der erhitzten Körper, den trampelnden Füssen auszuweichen, indem er sich an die Hauswand presst. Teils erheitert, teils sich vor dem stechenden Schweissgeruch ekelnd, lässt er den schwarzen Umzug der Vogelfrauen vorübergleiten, der einem nächsten Platz entgegeneilt, von wo bereits wieder das Krächzen der Trompete und der mächtige Trommelschlag herüberdringen, bis er allein auf dem Plätzchen übrigbleibt und sich verwundert seine Augen reibt.
Zu seiner Freude entdeckt er ein Gartenrestaurant mit dem etwas dümmlichen Namen «Coconut Inn». Mit seinen Palmen, Bananenstauden und Bougainvillien ohne Zweifel für Touristen gebaut, lädt es dazu ein, hier, bevor sich die Hauptgasse in der Enge der niederen Häuser verliert und das Flanieren weisser Gäste als Provokation verstanden werden könnte, einen Saft zu trinken, um nachher, in der Meinung, Lamu sei mit diesem Lokal zu Ende, wieder umzukehren.
Im Büro des Chefs der Kriminalpolizei liefert Mwasi seine Fundgegenstände ab und berichtet, was er in der kurzen Zeit herausgefunden hat:
«Bei der Toten, die ertrunken ist, handelt es sich um eine Schweizerin, eine reiche Witwe, Gertrud Hornacker, was die Initialen ...»
wichtig zieht er das Badetuch aus der Sisaltasche,
«… hier: G.H. des gefundenen Tuchs beweisen. Auch haben verschiedene Leute in der Toten eben diese Frau erkannt. Dies musste schliesslich auch eine zweite Gruppe von Männern bestätigen, die anfänglich einen Gast des Hotels ‹Rafiki› in der Toten vermutete. Ein hinfälliger Verdacht. Die betreffende Frau hat sehr lebendig auf der Terrasse des Hotels gesessen.»
Mwasis Witzchen wird mit einem Grinsen quittiert, was ihn zu einer genüsslichen Kunstpause verführt, dann fährt er fort:
«Das Haus von Lady Gertrud, wie sie in Shela allgemein genannt wird, war leer und verschlossen, so dass ich folgende Theorie aufstellte, der ich auch sofort nachging und die sich ja dann auch durch den Fund der Badeutensilien bewahrheitet hat. Lady Gertrud, über die mir erzählt wurde, dass sie es liebte, jeden Abend über die Dünen in die Bucht zu wandern, um dort zu baden, nackt, was verboten ist, allerdings immer zu einer Zeit, da der Strand von gewöhnlichen Touristen längst geräumt und verlassen ist, muss auch gestern Abend zum Strand gegangen sein. Sie wird sich im Schutz des Palmengebüschs ausgezogen haben, um von dort zum Wasser zu laufen und ins offene Meer hinauszuschwimmen. Ebenfalls eine ihrer Gewohnheiten, von der sie sich, trotz der Warnungen der Leute nicht abbringen liess. Sie muss gewusst haben, dass die Strömungen, bedingt durch die weitläufigen Meeresarme des Archipels und die grossen Unterschiede zwischen Ebbe und Flut, gefährlich sind. Immerhin liess sie sich meistens von ‹Captain Jambo›, ihrem Liebhaber, begleiten.»
Mwasi räuspert sich.
«Nicht so gestern Abend. – Ihr Freund wollte mit einer Touristengruppe mit dem Einsetzen der Ebbe, kurz vor Mitternacht, zu einem Segeltrip nach Malindi aufbrechen und war um diese Zeit schon in Lamu-Stadt. – Ich habe das überprüfen lassen und bereits mehrere Zeugen gefunden, die gestern mit ‹Jambo› zusammen gewesen sein wollen. – Was nun genau auf dem Meer geschehen ist, weiss ich nicht, es wird wohl nie in Erfahrung zu bringen sein. – Ich vermute, die Frau, die dazu neigte, sich zu überschätzen, ist ertrunken.»
Der Chef der Kriminalpolizei Tetu, seinen massigen Körper hinter seinen Schreibtisch gequetscht, als könnte er nur so das Auseinanderfliessen seines Leibes noch aufhalten, schwitzend und scheinbar ausschliesslich damit beschäftigt, einen untauglichen Tischventilator so zu regulieren, dass ein schwaches Lüftchen ihm vielleicht doch noch eine kleine Abkühlung verschafft, hört dem aufgeblähten Bericht seines Assistenten Mwasi missmutig und kommentarlos zu, denn, obwohl er auf Anhieb keine Schwachstellen in Mwasis Darstellung der Ereignisse sieht, gefällt ihm die Geschichte nicht. Die ganze Sache gefällt ihm nicht. Vor allem wenn er an den Papierkram denkt, die Schwierigkeiten, die sich kaum verhindern lassen. Die Schweizer Botschaft muss benachrichtigt werden. Angehörige werden sich einschalten. Und zu guter Letzt wird er, was er auch immer unternimmt, alles falsch gemacht haben. Wenigstens in den Augen der Weissen. Soweit er sich erinnern kann, hat er diese als Besserwisser erfahren. Lehrer, Priester, Kolonialherren, Entwicklungshelfer... Und darum sagt er auch jetzt noch nichts, nachdem Mwasi seinen Bericht abgeschlossen hat, sondern grübelt mit einem abgerissenen Streichholz den Dreck aus seinen Fingernägeln, um endlich, nach einem Blick auf die Uhr, etwas wie: «Damit lasst uns morgen weiterfahren», zu brummen, «für heute haben wir genug getan».
Natürlich gibt es kein Bier. Doch der Tamarind-Juice, ein erfrischend saurer, brauner Sud, der aus den gepressten und ausgekochten Schoten des Tamarindbaumes gewonnen wird, schmeckt Mettler besser als der Anblick der braunen Brühe vermuten liess.
Ein feines Rascheln in den Blättern der Kokospalmen kündigt das Aufkommen eines Windchens an, so dass Mettler sich zu einem Spaziergang durch die Stadt entschliesst. Mettler überlässt sich, da er ohne ein bestimmtes Ziel durch die Gassen schweift, dem Menschenstrom, in dem die wenigen Touristen, einmal von ihren weissen oder oft krebsroten Köpfen abgesehen, nicht weiter auffallen und ihn auch nicht interessieren.
Die Frauen Lamus flattern in ihren schwarzen Buibuis in die Häuser, die Gassen gehören immer mehr den Männern, die in ihren bodenlangen, weissen Kleidern, ein gesticktes Mützchen auf dem Kopf, vor den Moscheen sitzen, miteinander plaudern oder, echte Muftis, ihre Koransuren vor sich hinplappern. Andere sind mit einer Arbeit beschäftigt. Sie schieben einen Karren durch die engen Gassen, balancieren aufgetürmte Waren durch die Menge oder gehören zu einem der vielen Läden und Handwerksbetriebe, in denen, jetzt, da die Hitze das Tages nachlässt, fleissig gearbeitet wird. Geschickte Schneider fertigen aus bunten Tüchern Hosen und Blusen an, der Duft frischer Samozas vermischt sich mit dem Seifenangebot eines Krämers, Staub und Hobelspäne einer Schreinerei fliegen auf die Strasse, in der die für Lamu typischen Betten, Stühle und Truhen hergestellt werden; vis-à-vis wird Stroh zu Körben und Matten geflochten, und bevor wieder ein Stoff-Tücher-Sisaltaschengeschäft mit Spiegeln und Neonlicht in die Tiefen seiner Räume lockt, kommt vielleicht eine Teestube, ein Buchladen oder ein Kino, von dem man nicht weiss, ob es nicht doch nur ein Coiffeur ist, der mit alten Filmplakate seinen Laden ausschmückt.
Auf dem Markt rund um die ehemalige Festung durchwühlen Esel die Abfallhaufen, wo Gemüsereste, Fischköpfe, ja ganze Tierkadaver verrotten, was aber niemanden davon abhält, hier Gemüse, Früchte, Fische und Gewürze einzukaufen und sich mit Miraa oder Betel, den beliebtesten Drogen einzudecken, die trotz des staatlichen Verbotes überall und ohne Scheu gekaut werden.
Hinter dem Markt, immer weiter der Hauptgasse entlang, beginnt das Gewirr von Läden und Werkstätten, Moscheen und Teestuben erneut und endet erst kurz vor dem Elektrizitätswerk, einer schmierigen und lärmigen Generatorstation, wo sich die Hauptstrasse in viele Gässchen gleichsam ausfranst, wie überhaupt die alte Stadt von neueren, aber durchwegs ärmeren Quartieren umgeben ist.
Die Uferstrasse ist um diese Zeit mindestens so belebt wie die Hauptstrasse. Die leichte Brise und der rege Bootsverkehr locken eine Menge Schaulustiger, Müssiggänger und Touristen an, von denen wiederum all jene angezogen werden, die, für den heutigen Abend oder den morgigen Tag, ein Geschäft einzufädeln versuchen. Mettler weicht allen Gesprächen aus und antwortet auf die entsprechenden Eintrittsfloskeln wie «Woher kommst du?», «Wie gefällt dir Lamu?» stereotyp mit «Okay», was immer als Verweigerung verstanden wird, was es auch ist.
Die einzige, ziemlich wackelige Landungsbrücke, wird von zahlreichen Motorbooten angelaufen, die zum grossen Teil vom Badestrand Shelas kommen und voller Touristen sind, die in die Stadt zurückkehren.
Auf dem Landungssteg balanciert ein Mann mit einem riesigen Sombrero, einer für Lamu aussergewöhnlichen Kopfbedeckung. Mettler hält den Burschen, der die Ankommenden wie alte Bekannte begrüsst und immer wieder versucht, ihnen etwas zu verkaufen, das er in einer grossen Kühltasche aufbewahrt, für einen Eisverkäufer, der sich, seiner Meinung nach, allerdings einen denkbar ungünstigen Platz für sein Geschäft ausgesucht hat, denn wer kauft auf einem Bootssteg ein Eis, solange er damit beschäftigt ist, das Boot zu verlassen und das sichere Ufer zu erreichen? Aber ohne dass sich Mettler erklären kann warum, empfindet er so etwas wie Sympathie, vielleicht ist es auch Mitleid, für den Burschen, so dass er «Sombrero» ans Ufer winkt und ihm, da es sich tatsächlich um einen Eisverkäufer handelt, eine Plastiktüte mit gefärbtem Zuckerwassereis abkauft. Aus purer Höflichkeit und nur um den Burschen nicht zu verletzen, der ihn ein paar Schritte begleitet und in einer Weise mustert, die ihm unangenehm und peinlich ist, lutscht er das Zuckereis, wenigstens zur Hälfte, auf.
Die Polizeibeamten, die die Leiche der ertrunken Weissen quer durch die Stadt zum alten Spital brachten, werden dort nicht gern gesehen. Der Chefarzt, der von Tetu informiert wurde, versuchte, die Annahme zu verweigern. Aus Platzgründen. Schliesslich musste er aber einsehen, dass die Tote nicht irgendwo untergebracht werden kann, dass er ebenfalls dazu verpflichtet ist, die Todesursache festzustellen und den Tod der Frau zu bescheinigen. Etwas, das er unter normalen Umständen widerstandslos getan hätte, aber, wegen der herrschenden Verhältnisse, immer dazu benutzt, auf den katastrophalen Zustand des Spitals hinzuweisen, vor allem auf die Tatsache, dass der Spitalneubau, obwohl schon lange fertig, nicht bezogen werden kann. Er lässt die Beamten mit der Leiche warten,
«Tote haben Zeit, meine Kranken nicht»,
um erst kurz vor Feierabend zu schreien: «Die ertrunkene Frau Hornacker in den Operationssaal!»
ein Zynismus, der die biederen Beamten beleidigt, sie wissen nicht warum, aber trotzdem, handelt es sich doch um «ihre» Leiche, der man nicht mit der notwendigen Hochachtung begegnet. Tatsächlich trifft es aber zu, dass der Operationssaal der einzige, freie Raum ist, der, vorübergehend, als letzte Ruhestatt für eine Leiche dienen kann.
Der Eisverkäufer Ali Maiwa, von den Touristen wegen seines grossen Strohhutes «der Mexikaner» oder «Sombrero» genannt, betritt, kurz vor Dunkelheit, seine Hütte am Rand der Stadt. Er hängt seinen Hut an den dafür vorgesehenen Nagel über seiner Schlafstelle, schiebt seine Kühltasche, ohne die restlichen Eisbeutel herauszunehmen, in eine Ecke und zieht sich aus. Die aufgetauten Beutel wird er morgen in die Tiefkühltruhe eines Freundes legen und seine Tasche mit frisch gefrorenen füllen, um sie übermorgen, wenn sie wieder gefroren sind, wieder gegen aufgetaute einzutauschen. Ein Vorgehen, das nicht ausschliesst, dass immer wieder dieselben Beutel auftauen, wieder gefroren werden, auftauen, was aber dem wässrigen Inhalt kaum schaden kann. Nachdem Maiwa die wenigen Münzen und Scheine, die Tageseinnahmen, aus seinen Kleidern klaubte und, ohne sie zu zählen, in eine verbeulte Zigarrendose warf, zieht er unter seiner Matratze eine Hose und ein Hemd hervor, die ihn in einen smarten, leicht schmierigen Schönling verwandeln, dessen Eleganz an einen Aushilfskellner oder Coiffeurgesellen erinnert, ein Eindruck, der durch eine Halskette und ein Wollmützchen allerdings wieder aufgehoben wird.
Aus einem schäbigen Schränkchen, das umständlich mit einer Kette und einem Vorhängeschloss gesichert ist, nimmt Maiwa ein Päckchen Zigaretten, getrocknete Bananenschalen, ein kleines, in Aluminiumfolie geschlagenes Stück Haschisch und ein paar Betelnüsse. Er legt alles auf ein auf dem Tisch ausgebreitetes Stück einer glattgestrichenen Plastiktüte, und, nachdem er sich vergewissert hat, dass die Türe geschlossen ist, setzt er sich an den Tisch, wo er konzentriert, im schwachen Licht einer Paraffinlampe, mit einem kleinen, scharfen Messer erst einen Teil der Bananenschale in feine Streifchen schneidet, danach den Tabak zweier Zigaretten über den Bananenstreifchen zerkrümelt, ein Stückchen des gepressten Haschischs abbricht und mit dem Messerschaft zerdrückt, schliesslich eine Betelnuss zu Pulver schabt, um abschliessend die Ingredienzen seiner Rauschgifte zu mischen, zu kneten und die Masse, in die er auch mehrmals hinein gespuckt hat, zu kleinen, marmelgrossen Bällchen zu formen, die er, alle einzeln, in kleine Fetzchen Aluminiumfolie gewickelt, in den Taschen seiner Hose verschwinden lässt. Nachdem er alles, was noch auf dem Tisch liegt, wieder sorgfältig ins Schränkchen zurückgeräumt hat, das er erneut mit dem Vorhängeschloss sichert, löscht er die Lampe und verlässt seine Hütte.
Am Haus seiner Mutter vorbeischlendernd, erreicht er die abendlich belebte Hauptgasse, wo er sich unter die Leute mischt, um unauffällig nach möglichen Käufern für seine Kügelchen zu schauen. Seine Verkaufstaktik ist einfach. Nachdem er sich für einen Kunden entschieden hat, verwickelt er ihn geschickt und liebenswürdig in ein Gespräch, um ihm, hat er ihn erst einmal an der Angel, mit seinem Angebot zu überraschen, das dieser, ohne ihn zu beleidigen, kaum noch auszuschlagen wagt.
Nach ein paar missglückten Versuchen setzt sich Ali zu seinen Freunden in einer Teestube.
«Es heisst: Lady Gertrud sei ertrunken, die Sugarmama von‹Jambo›. Gestern Nacht. Der alte Kamani hat die Leiche gefunden, heute Morgen, am Strand, als er mit seinen Eseln draussen war. – Ich Maiwa, ich glaub das nicht.»
Mettler sitzt im Restaurant des Hotels «Baobab Inn» und wartet auf sein Nachtessen. Obwohl das Hotel um diese Jahreszeit nur schwach belegt ist, sind die meisten Tische im Speisesaal besetzt. Mettler, der sich in fremden Lokalen nie auf Anhieb wohl fühlt, selbst dann nicht, wenn es ihm gelingt sich einen Ecktisch zu erobern, stört sich sowohl an der kühlen, entfernt an einen Wartesaal eines Provinzbahnhofs erinnernden, Atmosphäre als auch an der Servilität der vielen Kellner, die ihn zwar nicht bedienen, das heisst, ihm weder das bestellte Essen noch das gewünschte Bier bringen, sondern ihn, der sich vorgenommen hat, ein bisschen in die Akten seines Auftrags zu schauen, belästigen, indem sie sein Gedeck verändern, die Gläser auswechseln oder umständlich eine Blumenvase gegen einen Kerzenständer austauschen.
Neben Mettler hat ein deutsches Ehepaar Platz genommen, beide um die Vierzig, schlanke Leute, die – ihr Kind zwischen sich – einander leise die Speisekarte vorlesen. Ihre Kommentare lassen Mettler vermuten, dass ihnen die fremden Gerichte nicht geheuer sind. Einerseits weil sie die phantasievollen Bezeichnungen nicht verstehen, andrerseits weil sie unter den vielen Fischgerichten kaum etwas entdecken, das ihren Essgewohnheiten, vor allem im Hinblick auf das Essen für das Kind, entspricht. In der Mitte des Raumes haben sich zwei Paare niedergelassen, die sich in Englisch, das aber nicht ihre Muttersprache zu sein scheint, erzählen, was sie bereits alles gesehen und erlebt haben, nicht nur hier in Lamu, sondern in Kenia überhaupt. Sie scheinen sich gegenseitig beweisen zu wollen, wer von ihnen das Land besser kennt. Offenbar leben sie schon ziemlich lange hier, was eine der Frauen dazu veranlasst, fast ein bisschen theatralisch, auszurufen: «Wir sind doch unerwünscht!»
Eine Bemerkung, von der Mettler nicht genau weiss, ob sie ganz allgemein zu verstehen ist, oder sich auf die lange Wartezeit bezieht. Aus einer der entfernteren Ecken schallt fröhliches Gelächter, laut und störend, offensichtlich glaubt jemand, vielleicht ein Reiseleiter, er müsste die Wartezeit für die ihm anvertrauten Touristen mit Anekdoten überbrücken. Mettler, der die Geschichten nicht versteht, den nur das salvenartige Gelächter immer wieder von seiner Lektüre aufschauen lässt, schüttelt halb verärgert, halb belustigt den Kopf: «Immer diese Italiener.»
In die gegenüberliegende Ecke gequetscht, hocken zwei Männer, ein dicker Koloss, der Mettler den Rücken zukehrt und ein blasser, schnauzbärtiger Mann, der trotz seiner grauen Haare, noch ziemlich jung aussieht und den Mettler für einen Architekten oder Entwicklungshelfer hält. Der Mann erwidert Mettlers Gesten mit einem zustimmenden Schmunzeln, was den Koloss, mit dem er in ein Gespräch vertieft ist, dazu veranlasst, sich ebenfalls nach Mettler umzudrehen und diesem, ohne zu wissen warum, freundlich zuzunicken. Mettlers Aktenbündel enthält neben der Beschreibung seines Auftrags, einem Lebenslauf der verwitweten Gertrud Hornacker, geborenen Lang, ein paar Fotografien Gertruds, einer Karte Kenias und einem halben Dutzend Quittungen und Notizen, vor allem einen leeren Schreibblock. Mehr aus Langeweile, denn aus wirklichem Interesse liest Mettler in seinen Notizen: «Unattraktive Frau zwischen fünfundzwanzig und dreissig, verheiratet, kinderlos. Auf G.H. eifersüchtig. (Warum?) Erbverzichtsvertrag, Wunsch des Vaters, nicht unterzeichnet. ... Über Tochter von G.H.»
Seinen Auftrag hat er ebenfalls auf einem Zettel festgehalten: «Gertrud Hornacker, die vor einem Monat nach Lamu reiste, allerdings nicht zum ersten Mal, nachfliegen, um die etwas über fünfzigjährige Witwe zu beobachten, die von ihren Kindern, vor allem der Tochter, verdächtigt wird, das Familienvermögen in leichtfertiger Weise zu verschleudern.»
Auf einem weiteren Papierschnitzel hat er sich den Verdacht der Tochter aufgeschrieben: «Die Mutter hat in Lamu einen Liebhaber.»
Mettler erinnert sich nur sehr ungern an das Gespräch mit der Tochter: «...und dass das klar ist, Diskretion. Diskretion. Nie darf ‹Mam› erfahren, dass wir ihr einen Privatdetektiv ... um Gottes Willen! Ein Skandal ...»
Ein Kellner führt einen weiteren Gast herein und bittet ihn, nicht ohne Mettler zu fragen, sich an dessen Tisch zu setzen. Leider zeigt es sich sehr schnell, dass der ältere Herr, der sich als Raffaele Di Polluzzi vorstellt, ein Schwätzer ist, und Schwätzern ist der wortkarge Mettler mehr oder weniger hilflos ausgeliefert.
Nachdem Di Polluzzi erst einmal sämtliche Menüs der Speisekarte laut durchgelesen hat, beginnt er das Kind am Nachbartisch zu necken. Er treibt Faxen, die die Kleine, oder ist es ein Junge, zum Lachen bringen sollen, schreit «Uhuu» und «Cucù», was das Kind verunsichert, so dass es zu weinen beginnt, ein Umstand, der den Eltern peinlich ist. Sie bemühen sich, die Grimassen Polluzzis lustig zu finden, in der Hoffnung, ihre gespielte Heiterkeit werde das Kind beruhigen, worauf das Kind laut zu schreien anfängt, bis die Mutter schliesslich entschieden aufsteht, das Kind vom Stuhl zerrt und mit ihm hinausgeht, nicht ohne eine wütende Bemerkung zu ihrem Mann zu machen, der sich immer noch darum bemüht, über Polluzzis Scherze zu lachen und sich jetzt von Polluzzi in ein stupides, halb auf Deutsch, halb in Italienisch geführtes Gespräch über Bambini verwickeln lässt, das Polluzzi aber plötzlich abbricht, weil er eine Katze entdeckt, die er nun mit Gesäusel und Geschmatze an den Tisch lockt, ein mageres, hochbeiniges Tier, über dessen Eigenart er Mettler, der verzweifelt in seine Akten starrt, einen Vortrag hält, der schliesslich Ausgangspunkt für eine Beurteilung Lamus wird, das er vor der Unabhängigkeit Kenias schon einmal besucht hat.
«Oh, was war Lamu für ein Kleinod, wie freundlich waren diese Leute. Und heute? Ein stinkendes, korruptes Nest. Schuld sind die Neger aus dem Landesinnern. Kikuyus. Überall machen sie sich breit. Nur weil Kenias erster Präsident ...», und er schlägt die Hände zusammen, «Geschichten, mein Herr! Geschichten!»
Auch während des Essens, das nun endlich serviert wird und das Mettler schmeckt, zu dem er sich ein zweites Bier bestellt, das er allerdings nie erhält, schwatzt Di Polluzzi fast pausenlos. Erst ist das Essen völlig missraten, da alle Gerichte mit Kardamom gewürzt sind.
«Was für eine Barbarenküche!»
Dann meckert er an den Kellnern herum oder belästigt Mettler mit einer abstrusen Geschichte über eine weisse Frau, die ertrunken sei, so werde erzählt, wenn er dies auch nicht glaube, denn die Frau sei eine gute Schwimmerin gewesen, viel wahrscheinlicher sei, dass die Frau mit einem der fürchterlichen Rauschgifte, die einem hier ja bald an jeder Hausecke angeboten würden, vergiftet worden sei.
«Vielleicht hat man sie auch kaltblütig ermordet. Man muss ja nur die Zeitungen lesen. Diese Brutalität. – 5o Frauen und Kinder von Viehdieben massakriert, drei Frauen mit Panga erschlagen, ... Jeden Tag. – Aber was zählt ein Mensch für diese Leute? Nichts. Ein Menschenleben? Nichts»
Als dann auch noch ein alter Mann mehrere Siwas, mit vielen Schnitzereien verzierte Holzhörner, zum Verkauf auf ihrem eh kleinen Tisch ausbreitet, um eines der Hörner an den Mund zu pressen und dem Instrument seltsame Brunstrufe zu entlocken, die er mit merkwürdigen Sprüngen begleitet, weiss sich Mettler, dem die Situation auf den Magen schlägt, nicht mehr zu helfen. Er kauft dem Alten eines seiner Krummhörner ab, bezahlt und verlässt den verdutzten Polluzzi, um, immer noch hungrig und durstig, eine Siwa unter dem Arm, was soll er damit, so schnell als möglich zurück in sein Quartier zu flüchten.
Der Eseltreiber Hamischi Kamani bindet seine Esel fest. Er schätzt die paar Minuten, die er bei seinen Eseln steht, bevor er sich zu seiner Familie legt, die um diese Zeit längst in die wenigen Betten geschlüpft ist. Er denkt über die letzten Tage nach, träumt in die Zukunft oder setzt sich noch zu einem Nachbarn, den er bei seinen Eseln im Schatten des Mangobaumes hocken sieht. Man wechselt ein paar Worte, spricht über die Arbeit, die Familie, Feste oder schweigt, schaut in den afrikanischen Sternenhimmel, lauscht den Geräuschen des nahen Wassers, das an die Kaimauer klatscht oder den Klängen eines Radios, das aus der nahen Stadt durch die Nacht plärrt.
In letzter Zeit jedoch wird er immer öfters von Fragen gequält, die sich nicht verdrängen lassen. Wie lange wohl wird er mit seinen Eseln noch ein Auskommen finden, von dem seine Familie lebt, seine Kinder zur Schule gehen, sie alle genügend Kleider und zu essen haben? Viele Leute sagen, Lamu dürfe sich nicht länger dem Fortschritt verschliessen, es müsse endlich eine Brücke zum Festland gebaut werden. Eine Autofähre! Wenigstens eine Autofähre. Eine Fähre zwischen Lamu und Mokowe. Aber sind die Autos erst einmal da, dauert es nicht lange, bis der Sand, den er und viele andere mit ihren Eseln auf die Bauplätze bringen, mit Lastwagen transportiert wird, ihm und seinen Kollegen bleibt die mühsame Arbeit des Sandschaufelns, wenn nicht auch dafür eine Maschine eingesetzt wird. Zwar wurden alle Vorschläge bis jetzt immer wieder abgewehrt, doch was rund um die Inseln wirklich geschieht, wissen sie alle nicht. Die Annahme des Entwicklungshilfeprojekts der Israelis, eine Fahrrinne für hochseetaugliche Schiffe bis zur Busstation Mokowe auszubaggern, wird letztlich ähnliche Folgen für die Insel haben.
Der Fortschritt wird seinen Einzug halten.
Die hellbeleuchteten Baggerschiffe, die Tag und Nacht zwischen den Inseln wühlen, die vielen unnötigen Lichter, aber auch die Touristen, die, jedes Jahr mehr, die Inseln besuchen, sind für Hamischi nichts anderes als Zeichen für Lamus Untergang.
Nur mit Abscheu erinnert er sich an die Zeit vor rund zwanzig Jahren, als die ersten Horden langhaariger und schmuddeliger Jugendlicher aus Europa in Lamu ankamen, die, kaum vorstellbar, die Kinder der einstigen Kolonialherren sein wollten. Überall in der Stadt rollten sie ihre Schlafsäcke aus, lagen nackt am Strand, wälzten sich im Sand, schliefen miteinander und berührten sich vor seinen Augen, dass er, der damals wie heute, mit seinen Eseln Bausand aus der Bucht in die Stadt transportierte, sich für die Weissen schämte. Die Schamlosigkeit der Fremden verdirbt Lamus Jugend, vor allem die Männer, die die weissen Frauen umschwirren wie die Fliegen den Scheissdreck. Auch sein einziger Sohn hat nichts anderes im Kopf als eine der oft älteren Damen zu erobern, von der er sich Reichtümer dafür versprechen lässt, dass er mit ihr ins Bett geht. Widerlich, ein Mann, der sich an eine Frau verkauft. Welches anständige Mädchen wird seinen Sohn noch heiraten wollen? Er wird ohne Enkel bleiben. Ein Gedanke, der Hamischi das Herz schwer macht. Die Vorstellung, nicht als Grossvater zu sterben, erschreckt ihn fast noch mehr als die Vision einer von Autolärm und Gestank erfüllten Insel.
In seinem Zimmer des «Kwaheri Guesthouse» legt sich Mettler sofort ins Bett. Es geht ihm gar nicht gut. Trotz der Hitze fällt er in einen ungesunden, dumpfen Schlaf, aus dem er mitten in der Nacht mit dem dummen Gefühl, nicht mehr zu wissen, wo er ist, hochschreckt. Sein Zustand hat sich verschlechtert und, sich mühsam aus seinem Moskitonetz schälend, schwankt er im Dunkeln auf die Toilette und erbricht sich fürchterlich.