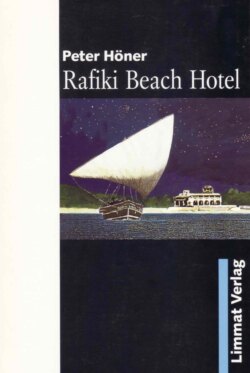Читать книгу Rafiki Beach Hotel - Peter Höner - Страница 6
Arbeitspapier I
ОглавлениеGertrud Hornacker: Hintergrund.
Gertrud Hornacker, geborene Lang. (21.7.1938), aufgewachsen in Dürnten, Zürcher Oberland. Eltern: Haushaltwarengeschäft: Geschirr, Eisenwaren, Werkzeuge. Wird heute von ihrem Bruder und dessen Frau geführt. Ausbildung als Sekretärin. Versicherungsgesellschaft in Zürich. Dort lernte sie auch den Versicherungskaufmann Rolf Hornacker kennen. Mai 1960 Heirat mit Rolf H. Brachten es zu einem bescheidenen Wohlstand:
a) Viel Arbeit.
b) Erbe der väterlichen Schreinerei (1967)
c) Erbe aus dem Vermögen von G.H.s Eltern, (Anteilmässige Auszahlung des Bruders bei Geschäftsübernahme, 1972)
1968 Bau eines Einfamilienhaus in Bassersdorf, Heimatort von Rolf. Zwei Kinder, ein Mädchen, Rita Susanna. (Mandantin), zwischen 23 und 26 Jahre alt. (geschätzt J.M.) Sohn, Hans Thomas. (Alter ?)
1984, kurz vor dem fünfzigsten Geburtstag, Tod Rolf Hornackers (Herzinfarkt).
Gertrud allein in Einfamilienhaus (Schatzacker in Bassersdorf). Zahlreiche Reisen in fremde Länder: Amerika, Kenia, Ceylon, Capri, Sizilien, Madeira, Sardinien, Korsika, ... (pflegte sich auf ihre Reisen gründlich vorzubereiten)
Frühling 1986 erste Reise nach Lamu. In der Adventszeit des gleichen Jahres zweite Reise nach Lamu.
März 1987 offizielles Reiseziel Sizilien.
August/September 1987 angeblich (Verdacht der Tochter) auf einer Kreuzfahrt.
Oktober 1987 Lamu.
November 1987 Verkauf des Hauses in Bassersdorf, Protest der Kinder, den Gertrud aber nicht berücksichtigt. Die Kinder sind finanziell unabhängig.
Januar 1988 Übersiedlung nach Lamu.
Mettler weiss, dass man ihn für einen pingeligen Bürokraten hält, aber: Saubere Papiere, Ordnung, Disziplin und gewissenhafte Recherchen, das sind die Qualitäten, die ein Detektiv braucht. Das bisschen Genie – Phantasie und Kombinationsgabe – spielt kaum eine Rolle. Vielleicht noch: Fragen muss man können.
Es ist nur Mettlers Pflichtbewusstsein zuzuschreiben, dass er sich nach dem Frühstück, trotz seines miesen Zustands – er erbrach das Tässchen Tee, kaum war er in seinem Zimmer oben – an den Strand aufmacht, um nach Frau Hornacker auszuschauen. Und weil er hofft, Gertrud vielleicht schon auf dem Weg nach Shela zu finden, sich andrerseits nicht getraut, seinen gereizten Magen dem Schaukeln eines Bootes auszusetzen, entschliesst er sich, die paar Kilometer den Strand entlang zu Fuss zu gehen.
Der Chef der Kriminalpolizei, Tetu, versucht schon das dritte Mal, die Schweizer Botschaft in Nairobi anzurufen, um sie über den Tod Gertrud Hornackers zu informieren. Aber entweder ist die Linie nach Nairobi überlastet, oder diese Schweizer sind derart beschäftigt, dass es unmöglich ist, jemanden an den Apparat zu bekommen. Doch Tetu, der sich für heute diesen Anruf vorgenommen hat, nicht mehr, aber auch nicht weniger, wählt immer wieder eine der Botschaftsnummern, immer wieder erfolglos. Schliesslich wirft er ärgerlich den Hörer in die Gabel, nimmt mit beiden Händen den ganzen Apparat und knallt ihn mehrmals auf die Tischplatte. Und, oh Wunder, der nächste Versuch: «Schweizer Botschaft, Hänslin?» stellt die Verbindung her.
In knappen Worten schildert Tetu die gestrigen Vorfälle, wohlwissend, dass die Vorzimmerdame ihn, nachdem sie ihre Neugier befriedigt hat, mit dem Konsul oder gar dem Botschafter verbinden wird, und er dort seine Geschichte noch einmal von vorne beginnen muss.
«Ertrunken, sagen Sie?»
«Ja, ertrunken.»
«Aber, wie ist das möglich? – Wissen Sie, ich kenne Lamu gut, ach es ist wunderschön, diese Ruhe und die Leute. Der Strand ist doch völlig ungefährlich, ich kann mir gar nicht vorstellen ...»
«Gertrud Hornacker heisst die Frau. Wenn Sie dann bitte die Familie der Frau informieren möchten.»
«Hohlacker, nie gehört. Sind Sie sicher, dass es sich um eine Schweizerin handelt?»
«Ja.»
«Und lebt in Lamu?»
«Ja.»
«Dann muss ich Sie mit dem Konsul verbinden, aber der ist nicht da und ...»
«Warum geben Sie die Meldung nicht einfach weiter?»
«Ja, sicher, natürlich werde ich das. Aber der Konsul wird bestimmt Fragen haben. Kann er Sie denn zurückrufen?»
Ein sinnloser Anruf, Tetu wusste es. Irgendwann heute Nachmittag, vielleicht schon früher, vielleicht aber auch erst morgen, wird sich die leicht blasierte Stimme eines Herrn der Schweizer Botschaft nach den näheren Umständen erkundigen, und er wird sich einen Vortrag anhören müssen, was jetzt alles zu machen sei. Man wird sich höflich voneinander verabschieden, höflich sind die Leute, aber ohne jede Achtung, und so werden sowohl er als auch der Konsul nichts anderes denken als: «Ein mühsamer Kerl.»
Tetu versteht die Weissen nicht. Auch nach Uhuru, der Unabhängigkeit Kenias, immer strahlen diese Leute eine Art von Überlegenheit aus, als ob sie nach wie vor die Herren hier im Lande wären. Selbst in den unmöglichsten Situationen, für die sich seine Landsleute schämen würden, schauen sie einem frech ins Gesicht und sagen die Wahrheit, ob man sich dafür interessiert oder nicht. Ungehobelte Leute, ohne jeden Anstand. Tetu geht ihnen aus dem Weg. Er kann nicht verstehen, wie sich Kollegen von den Leuten grinsend ein paar Scheine zustecken lassen, sich auf eine Kumpanei einlassen als seien sie Freunde, wo doch jedermann sehen kann, mit welcher Arroganz und Missachtung die Fremden ihr Geld an sie abgeben. Das ist nicht die Folge eines Handels, sondern Erniedrigung eines armen Habenichts, den man sich mit einer Banknote vom Leibe hält.
Sonnenöle sind Mettler ein Gräuel. Er kauft sich einen Kikoi, ein Baumwolltuch und einen Sonnenhut. Das Tuch legt er über den Kopf und presst es mit dem Hut fest, so dass es seine Arme und seinen Nacken bedeckt, ein besserer Schutz als alle Sonnenöle, Faktor zwölf, oder was auch immer angegeben wird.
Es ist kurz nach elf Uhr. Den ganzen Morgen hatte die Sonne Zeit, den Sandstrand zwischen Lamu und Shela aufzuheizen. Jetzt, kurz bevor die Flut wieder einsetzt, scheint die Natur den Atem anzuhalten. Kein Lüftchen regt sich. Über den alten, schwarzgrauen Korallenbänken, die mit Muschelschalen bedeckt sind, flimmert die Luft. Es ist an die vierzig Grad warm und feucht. Mettler keucht schweissgebadet den Strand entlang. Sein Tuch hängt irgendwo, sein Hut ist ihm in den Nacken gerutscht. Mit zusammengekniffenen Augen kämpft er sich voran. Ein mühsames Stapfen um Boote und Sträucher. Himmelarsch, ist das eine Hitze.
Der Polizeiassistent Mwasi betritt das Büro seines Chefs und reisst Tetu aus seinen Gedanken. Er bringt die ausgefüllten Papiere, mit denen Tetu ihn am frühen Morgen losschickte. Tetu muss den zuverlässigen, aber manchmal doch ein bisschen übereifrigen Beamten beschäftigen. Mwasi ist jung, will nach Oben, und darum wundert sich Tetu auch nicht, dass ihm sein Assistent eröffnet, er habe Neuigkeiten im Fall Lady Gertrud. Eine Geschichte, die er, Tetu, sich weigert, überhaupt als Fall zu betrachten.
«Gertrud Hornacker war die Geliebte von Omar Said, einem «Beachboy», der sich ‹Jambo› nennt, nicht unbedingt sehr originell, aber...»
«Das wissen wir.»
«Ja, aber, was wir nicht wissen: Das Verhältnis dauert schon über Jahre und die beiden, so hat man mir erzählt, haben sich zerstritten. Und ...» Mwasi schaut sich triumphierend um: «Ich weiss warum.»
«So?»
«Said lernte die Schweizerin vor gut zwei Jahren kennen. Er trennte sich gerade von seiner Frau. Er hat zwei Kinder, zwei Mädchen, neun und sechs Jahre alt, sie blieben beim Vater, der mit den Mädchen bei seiner Schwester wohnt, einer ebenfalls geschiedenen Frau, die mit dem Sohn des Eseltreibers Kamani verheiratet war ...»
«Dem Sohn des Eseltreibers Hamischi Kamani, der die Frau gefunden hat?»
«Genau. – Und Said und der Sohn des Eseltreibers sind Freunde ...»
«Obwohl der eine die Schwester des andern versetzt hat?»
«Wer wen versetzte, weiss ich nicht. Auf jeden Fall sind sie vorgestern Nacht zusammen mit Saids Dau nach Malindi losgefahren.»
«Ja, gut, und was beweist das?»
«So warten Sie doch. – Dieser Said war ein armer Teufel. Seine Dau lag schon über ein Jahr auf dem Trockenen, das Schiff wurde mehr oder weniger aufgegeben. Said arbeitete als zweiter Mann auf der Dau seines Exschwagers. Dort muss er, Frühling 1986, Lady Gertrud kennengelernt haben. Auf einem ihrer ersten Ausflüge. Die beiden haben sich auf Anhieb grossartig verstanden, fragen Sie nicht warum, aber ...»
«Zur Sache!»
«Auf jeden Fall sorgte Lady Gertrud, noch bevor sie nach Europa zurückkehrte, dass Saids Dau repariert wird. Nicht nur irgendwie. Heute ist das Schiff eines der schönsten. ‹Jambo Dau›. Aber das ist noch lange nicht alles. Vor gut einem halben Jahr kaufte sich Gertrud ein Haus in Shela, eines der schönsten Häuser und auf wessen Namen lauten die Papiere?»
«Jaja. Wir haben den falschen Beruf.»
«Omar Said! Er und sein Exschwager leiteten den Umbau des Hauses; er und sein Exschwager segeln zusammen nach Malindi, und ausgerechnet der Vater des einen findet, kaum sind die beiden auf und davon, eine Leiche, die immerhin den einen der beiden zu einem der reichsten Männer von Shela macht.»
«Aber das ist doch Quatsch, mein lieber Mwasi. Phantasie gut. – Was für ein Interesse sollte denn dieser ‹Jambo› haben, seine Freundin zu beseitigen?»
«Wussten Sie, dass das ‹Rafiki› verkauft wird? – Das hat mir der Hotelmanager heute Morgen erzählt.»
«Das wird doch immer verkauft. Seit ich in Lamu arbeite, wird das ‹Rafiki› verkauft.»
«Jaja, stimmt, aber wissen Sie, wer sich dafür interessiert?»
«Ja, ich weiss es, weiss es schon lange. – Deswegen liess ich auch die Leiche noch gestern Abend auf Spuren von Gewalt untersuchen, so weit so etwas überhaupt noch möglich war.»
«Und?»
«Nichts. Ertrinkungstod durch Erschöpfung.»
«Vielleicht wurde sie gehindert, an Land zu schwimmen?»
«Von ‹Jambo›? Das ergibt doch keinen Sinn?»
«Sie haben sich zerstritten. – Es heisst, sie wollte das ‹Rafiki› kaufen und er, das wird da draussen erzählt, er wollte damit nichts zu tun haben. – Warum? Ja, das konnte mir auch niemand sagen. – Aber ich weiss es, das heisst, ich vermute es: Er hatte, was er braucht, seine Dau und ein Haus. Was ihm fehlt ist eine Frau, eine Frau, die er liebt, denn die Frau, die Weisse, geht ihm auf die Nerven. – Stellen Sie sich vor: Ihre Geliebte kauft ein Hotel und Sie dürfen arbeiten, immer unter Kontrolle der älteren Dame, die Ihre Mutter sein könnte.»
Der Verdacht Mwasis, Gertrud Hornacker könnte eines nicht natürlichen Todes gestorben sein, ist Tetu gestern ebenfalls durch den Kopf gegangen, doch das Resultat der Untersuchungen des Arztes war so klar, dass er seine Theorie wieder fallen liess. Mwasis Entdeckung, dass Said und der Sohn des Eseltreibers Kamani verschwägert sind, verschiebt das Bild, das er sich über die Geschichte machte. Immerhin gibt es Leute, die am Tod der Frau ein Interesse haben. Mwasis Vermutungen allerdings hält er für ein Hirngespinst.
Shelas Badestrand beginnt hinter dem Hotel «Rafiki». Er schwingt sich um die Sanddünen, rund dreizehn Kilometer lang um die halbe Insel, ein wunderbarer, sauberer Sandstrand, dessen einziger Nachteil ist, dass er kaum Schatten bietet, es sei denn, man verkriecht sich hinter ein Palmengestrüpp in den Dünen, wo es aber um diese Jahreszeit, wenn die Winde vom Festland kommen, so heiss ist, dass man kaum in Versuchung kommt, sich dort für einen längeren Aufenthalt einzurichten. Mettler hockt sich gleich hinter dem «Rafiki» auf eine Steinbank. Der Strand besteht hier nur aus einem schmalen Sandband, und wer in die offene Bucht hinaus will, muss an der Bank vorbei.
Mettlers Zustand hat sich verschlechtert. Der kräftige Mann, in Tücher gewickelt und mit Sonnenhut, ein armer Tourist aus Europas Winter, Sonne und Hitze ausgeliefert, vom plötzlichen Klimawechsel überfordert, sieht elend aus. Die Leute, die, braungebrannt, an Mettler vorbeischlendern, können sich denn auch kaum ein mitleidiges Lächeln verkneifen, was Mettler, trotz seines miesen Zustands sehr wohl bemerkt und auf den Tod nicht leiden kann. Er ist nicht zu seinem Vergnügen da. Und schweissgebadet sitzt er frierend auf dem Posten.
Viel zu sehen gibt es nicht. Vor allem keine verliebte Gertrud Hornacker in Begleitung eines fröhlichen Schwarzen, die sich vor Mettlers Nase in den Wellen tummeln.
Vielleicht fünfzig Meter entfernt hat sich ein junges Ehepaar mit Kind niedergelassen. Mettler, der in den Leuten seine Tischnachbarn von gestern Abend zu erkennen glaubt, schaut dem Vater zu, der seine Tochter oder seinen Sohn bis zum Hals in den Sand eingräbt, was dem Kind zu gefallen scheint, wenn wahrscheinlich auch nur deshalb, weil es den Umstand geniesst, dass der Vater mit ihm spielt, wohingegen die Mutter die Aktivitäten des Vaters mit wachsender Besorgnis verfolgt. Als dann der idiotische Vater dem Kind auch noch einen, allerdings leeren, Sandeimer über den Kopf stülpt, geht das, nicht dem Kind, aber der Mutter, entschieden zu weit, und leicht hysterisch scheint sie ihren Mann anzuherrschen, mit seinem blödsinnigen Spiel aufzuhören, ein Misston, der auch das Kind verunsichert, so dass es jetzt, worauf Mettler schon lange gewartet hat, losbrüllt, den Vater ins Unrecht setzt und zur Mutter will.
Ein Pärchen kommt vom Strand zurück, eine Weisse mit ihrem schwarzen Freund, wobei nicht ganz klar ist, ob der Kenianer die Frau nicht eher belästigt. «Sombrero» mit seiner Eistasche geht an Mettler vorbei, ohne ihn zu bemerken, ein älteres Ehepaar mit einem Hund, der nach den anrollenden Wellen schnappt, sie anbellt, ein blödes Vieh, eine Gruppe Weisser, herausgeputzte Schönlinge um eine schwarze Puppe. Ein weiteres Pärchen, sie weiss, er schwarz, wieder nicht die Hornackersche aus Bassersdorf, er trägt ihre Badetasche, sie, viel Fett in einem zu knappen Badeanzug, balanciert auf einem angeschwemmten Holzstück, um sich kreischend in die Arme ihres Begleiters zu werfen. Eine Familie, alle krebsrot und mit verschwollenen Gesichtern, ein dicker Schwarzer mit Hut, «Jambo Kenia», ein Mann und vier Esel, noch ein Pärchen, zwei Weisse, eine alte Frau unter einem Regenschirm, eine Gruppe lärmiger Kinder, ein weiterer Hund ... aber keine Gertrud Hornacker.
Mettlers Zustand verschlechtert sich zusehends. Zur nicht mehr lokalisierbaren Übelkeit kommen Kopfschmerzen, seine Augen brennen, seine Zunge klebt im Hals, er friert und schwitzt. Nach gut einer Stunde entschliesst er sich, ins Wasser zu gehen. Er hofft, dass ihn ein Bad erfrische, ihn wenigstens von seinem stechenden Kopfweh erlöse, doch das Gegenteil ist der Fall. Die Abkühlung verschlimmert seinen Zustand, sein Magen dreht sich, zieht sich krampfhaft zusammen, und er kotzt einen bitteren, dünnen Saft, der ihm in Rachen, Gaumen und Mund kleben bleibt, kotzt in den Ozean, schamlos und erschöpft. Bevor er ohnmächtig wird, was er nur mit grösster Konzentration noch eine Weile einzudämmen vermag, erreicht er seine Steinbank wieder, setzt sich und überlässt sich einem alles fortreissenden Taumel, der über Mettler hinweg, durch ihn hindurch tobt, ein wildes Kreisen, ein Drehen von Oben über Unten und zu allen Seiten. Mettler beisst die Zähne zusammen, hält sich, so gut es geht, am glatten Stein der Bank. Schwer atmend und vor Anstrengung zitternd, gelingt es ihm schliesslich, die Schwindelgefühle aufzufangen.
«Hallo! Ist Ihnen nicht gut? Fehlt Ihnen etwas?»
Mettler erkennt in dem Mann, der ihn aufweckt, den Schnauzbärtigen von gestern Abend aus dem «Baobab Inn». Auch der andere steht neben ihm, der Dicke, zwei deutsche Freunde, die ihre Ferien auf Lamu verbringen, zwei Schwule, ja, so sehen sie aus, natürlich, darauf hätte er auch schon gestern Abend kommen können.
«Sie sollten nicht in der Sonne schlafen.»
«Bin ich eingeschlafen?»
«Demnächst wären Sie von der Bank gefallen.»
«Oh, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mich geweckt haben.»
«Keine Ursache, aber: ‹Die Sonne schien ihm aufs Gehirn, da nahm er seinen Sonnenschirm.› – Man sollte seinen Struwwelpeter nicht vergessen.»
Der Polizeiassistent Mwasi weiss, wann er den Eseltreiber Kamani zu Hause überraschen kann, und kurz vor drei, bevor die Stadt aus ihrem Mittagsschlaf erwacht, macht er sich auf den Weg zu Kamanis Hütte.
Er mag den Alten nicht. Er misstraut ihm. Kamani gehört zu denen, die glauben, dass ihre traditionellen Rechte berücksichtigt werden müssen, ihre Privilegien als Alte. Eitle Starrköpfe. Bremsklötze auf dem Weg in eine moderne Gesellschaft.
Die Hütte Kamanis ist verschlossen. Seine Esel wühlen, nicht weit vom Haus entfernt, in einem Abfallhaufen. Mwasi klopft an die Tür, niemand antwortet. Kamani und seine Frau, seine Mädchen – Kamani hat nur einen einzigen Sohn, aber Mädchen, wer weiss wie viele – sind nicht zu Haus.
«Merkwürdig.»
Mwasi wartet im Schatten eines Mangobaums fast eine Stunde auf die Rückkehr Kamanis und seiner Familie. Vergeblich. Die Vögel sind ausgeflogen. Mwasi notiert sich Zeit und Datum in seinem Notizblock.
Die Terrasse des Strandhotels «Rafiki» ist bereits am früheren Nachmittag bis auf den letzten Platz besetzt. Gegen vier Uhr scheinen sich hier alle Touristen zu treffen. Wer nicht Gast des «Rafiki» ist, wartet auf ein Motorboot, das ihn zurück nach Lamu bringt, man erholt sich bei Bier und Fruchtsäften von den Strapazen des Tages und geniesst es, zu den Hotelgästen des «Rafiki» zu gehören.
Mettler hat sich durch die vielen Stühle und Tische in eine Ecke der Terrasse durchgeschlagen. Er findet einen freien Stuhl, lässt sich erlöst in die federnde Plastikschale fallen, um – zu spät – festzustellen, dass er sozusagen in den Armen Di Polluzzis gelandet ist, seinem Tischnachbarn von gestern Abend, dessen Geschwätz er für seinen Zustand mitverantwortlich macht. Zu seinem Ärger erkennt ihn Di Polluzzi sofort. Er ist freudig überrascht und, ohne Gespür für Mettlers Verfassung, nimmt er den gestrigen Abend zum Vorwand, Mettler erneut mit seiner Suada zu überschütten. Er erzählt ihm, dass er seit heute Morgen Gast des «Rafiki» ist.
«Jaja, hier, im Hotel ‹Rafiki›. Eigentlich bin ich ja für diese Art Hotel ein bisschen zu alt, die vielen jungen Leute. Es ist viel Neugier, nicht wahr, sich ein bisschen ausprobieren, schwarz und weiss und weiss und schwarz. Der Hotelmanager hat mir erzählt...»
Und er senkt die Stimme, lehnt sich näher zu Mettler und gibt flüsternd ein Geheimnis preis, das er doch für sich zu behalten versprach.
«... Ja, der Manager und Direktor, ein noch sehr junger Mensch, aber gewitzt, er leitet das Hotel zusammen mit seiner Frau oder seiner Freundin. Ich habe mit ihm gesprochen. Dies und das, über Afrika, Tourismus. Schwierig. Die meisten Gäste. Alles muss wie in Europa sein, besser, schöner, nur nicht so teuer. Und so ein junger Mensch. Ich meine, die beiden machen das grossartig. Alles sauber, die Zimmer wunderbar, das Personal, nett, korrekt, das Essen ausgezeichnet, aber vielleicht wissen Sie ja, dass das ‹Rafiki›, nicht wahr, als Direktor muss er natürlich dafür sorgen, dass der gute Ruf des Hotels nicht verdorben wird...»
und Polluzzi rückt noch einmal ein Stückchen näher,
«Das ‹Rafiki› ist zum Verkauf ausgeschrieben. Stellen Sie sich das vor, so ein Zufall: Heute Morgen sagte ich zu mir: Raffaele, nun bist du bald einmal sechzig Jahre alt... – Ja in drei Jahren, aber ich fühle mich noch jung, sehr, wie sagt man, lebendig. – Und ich fragte mich: Was hast du gemacht? Aus deinem Leben? Deinem Reichtum? – Du bist in der Welt herumgereist, du hast Frauen gehabt, die schönsten Autos, in den besten Häusern gehst du ein und aus. Doch was wird bleiben? Wohin gehörst du? Quo vadis, Raffaele? – Und? Nichts. Heimatlos. Ja, das habe ich mir gesagt, heimatlos bist du. Heute Morgen. – Und nun, dieses Hotel! Meinen Sie nicht, Shela sei ein wunderbares Fleckchen Erde, endlich, eine Heimat, ein Zuhause? – Wissen Sie, ein Hotel zu besitzen, war schon immer mein Traum. – Und eines Tages eingehen in die Sanddünen der Insel, die ewige Heimat der Di Polluzzi, jaja, das sind Träume, nicht. Aber sind wir nicht auf dieser Welt, Fleisch geworden, um Träume zu verwirklichen. Die Wahrheit des Lebens: Sein, was wir träumen...»
Mettler fiebert. Di Polluzzis Geschwätz kann er nicht folgen, aber auch das Leben auf der Terrasse des «Rafiki» nimmt er kaum wahr. Bilder und Stimmen verschwimmen, mischen sich mit längst vergessen geglaubten Erinnerungen. Er erlebt seine Umwelt wie in Trance, und sein Versuch, Polluzzis Redeschwall zu stoppen, bleibt ein unverständliches Lallen, so dass Polluzzi, der Mettlers seltsames Verhalten nicht mehr übersehen kann und ihn für betrunken hält, ihm schliesslich rät, mit dem nächsten Motorboot nach Lamu zurückzufahren.
Der Chefarzt des alten Spitals hockt verbittert auf einem wackligen Stuhl im Vorraum des Operationssaals. Er hat die Nase voll, hier kann man nicht arbeiten. Das neue Spital ist seit Monaten bezugsbereit, aber ihm legt man eine Leiche in den Operationssaal, verlangt, dass er in Gegenwart einer Toten operiert, Leben rettet, oder gar, wie im Augenblick, der Frau des Eseltreibers Kamani mittels eines Kaiserschnitts zu einer erfolgreichen Entbindung verhilft.
Nein, er macht es nicht.
Vielleicht braucht es einen Todesfall, um die Distriktverwaltung auf die unhaltbaren Zustände im alten Spital aufmerksam zu machen, vielleicht hilft nur eine totale Arbeitsverweigerung, ein unmissverständlicher Protest, der die satten Herren dazu veranlasst, ihre faulen Ärsche zu heben und den Neubau endlich abzunehmen. Aber soll deswegen die Frau des Eseltreibers sterben oder das Kind in ihrem Bauch?
Die Hebamme hat ihm schon vor einer halben Stunde mitgeteilt, dass die Plazenta der Frau vor dem Gebärmutterausgang liege, dass die Möglichkeit einer Schwangerschaftstoxikose das Leben von Frau und Kind gefährde. Ein Kaiserschnitt sei unumgänglich. Die Frau liegt im Operationssaal, die Familie des Eseltreibers lagert im Schatten der grossen Mangobäume, wartet und, der Arzt weiss es, erwartet die frohe Nachricht, dass dem alten Kamani ein zweiter Sohn geboren worden ist. Er kann die Gebete des Alten und seiner Töchter hören, das Wimmern seiner Frau.
Die Operation verläuft ohne Zwischenfall und noch während der Arzt die Wunde versorgt, trägt die Hebamme das Neugeborene, ein gesundes Mädchen, zur wartenden Familie unter dem Mangobaum. Die Mädchen sind begeistert, Hamischi gerührt und enttäuscht. Seine Alte. Immer nur Mädchen. Es bräuchte doch nur so wenig, ein Zipfelchen, und das kleine Geschöpf würde alle seine Träume, seine Wünsche erfüllen. Aber Allah hat es nicht gewollt, Allah braucht Mädchen, weiss der Himmel wofür.
Die Motorboote, die am späteren Nachmittag zwischen Shela und Lamu verkehren, lassen sich mit einem Sammeltaxi auf dem Festland vergleichen. Die Boote fahren los, sobald sie voll sind. Kurz vor der Abfahrt rennt der Kapitän noch einmal auf die Terrasse des «Rafiki», schreit, dass er jetzt ablege, worauf alle diejenigen, die das Ritual der Bootsbesitzer kennen, und die ebenfalls nach Lamu wollen, hastig von ihren Freunden Abschied nehmen, um sich im letzten Moment auf das vollbesetzte Boot zu drängen.
Unter den Passagieren hockt auch Mettler. Das Schwanken des Bootes, der Gestank des Dieselmotors, die schwitzende Menge sonnengeölter Leute, der blendende Sonnenuntergang hinter der Insel Lamu verbessern Mettlers Zustand nicht. Mit geschlossenen Augen klammert er sich am Bootsrand fest und wünscht sich, «wär ich doch nur zu Hause geblieben», das Ende der Bootsfahrt herbei.
«Nur nicht kotzen, nur nicht kotzen».
In Lamu helfen ihm freundliche Hände an Land und Mettler, ohne wirklich zu wissen, welchen Weg er einzuschlagen hat, versucht, den Weg ins «Kwaheri Guesthouse» zu finden. In der Hauptgasse und sich auch in die richtige Richtung vorwärts tastend, wird er, kurz vor dem Ziel, vom Zug des Wahlsiegers überrascht, der auch diesen Abend mit Gefolge und Trara durch die Stadt zieht. Der ungebändigte Umzug drängt Mettler zurück, zwängt ihn ein und lässt ihn hin und her taumeln, schwemmt ihn mit sich fort. Im Gewoge der tanzenden und verschwitzten Leiber, wie ein Ertrinkender verzweifelt um sich greifend, spürt Mettler wie seine Kräfte nachlassen. Eine schwarze Welle wehender Buibuis rollt drohend auf ihn zu, und er stolpert, fällt in Arme, gleitet zu Boden, lässt die Woge über sich zusammenschlagen.
Wie Mettler in sein Zimmer gekommen ist, weiss er nicht. Jetzt liegt er, ausgezogen und in eine warme Decke eingewickelt, unter dem Moskitonetz in seinem Lamubett, ein kühlendes, nasses Tuch auf der Stirn. Die Sonne ist untergegangen. Auf das Tischchen zwischen den beiden Betten hat jemand etwas zu trinken hingestellt, ein paar Bananen liegen dort, aber, obwohl Mettler Appetit hat, was er mit einer gewissen Freude registriert, bleibt er liegen, rührt sich nicht, schläft sogar wieder ein und erwacht, bestimmt ein paar Stunden später – der Mond ist längst aufgegangen – weil jemand im Dunkeln unter seiner Dusche steht und duscht. Erstaunt richtet er sich auf und macht sich mit einem leisen «Hallo?» bemerkbar, das aber vom Duschenden nicht gehört wird, so dass Mettler annimmt, jemand habe das Zimmer verwechselt, oder Simon der Hausbursche habe seinen Rettern das falsche Zimmer gezeigt. Vielleicht täuscht er sich auch, die Dusche ist nicht seine, sondern die von nebenan, oder wo auch immer, irgendwo, und um den Gast unter der Dusche nicht zu erschrecken, auch von einer Hoffnung durchzuckt, die er nicht sofort wieder zerstören möchte, bleibt er einfach liegen und wartet, bis der fremde Besuch seine Dusche beendet hat und sich das Missverständnis von selbst aufklärt. Endlich wird der Duschvorhang vorsichtig zur Seite geschoben und im Mondlicht erkennt Mettler die Gestalt einer Frau, die, in ein Tuch gewickelt, mit den Füssen nach ihren Schuhen angelt.
Die nächtliche Besucherin glaubt, Mettler schlafe. Sie nähert sich ihm und setzt sich auf das freie Bett ihm gegenüber, um den Mann zu betrachten, den sie längst vergessen hat. Er scheint sich kaum verändert zu haben. Sie hatte ihn immer als grossen, schweren Mann in Erinnerung, verglichen mit den Männern der Insel ohnehin, die klein und schmächtig sind. Mettlers kurzer Haarschnitt, der sie, die Mettler nur mit langen Locken kannte, erst daran zweifeln liess, ob dieser Mann wirklich Mettler sei, gefällt ihr besser als die damalige Löwenmähne und die markanten Gesichtszüge, die sein Gesicht heute dominieren, ihm etwas Hartes geben, was sie nur natürlich dünkt, ist er doch älter geworden, imponieren ihr, strahlen die reiferen Züge doch mehr Verbindlichkeit und Verlass aus als die knabenhaften vor gut zwanzig Jahren.
Mettler schaut auf die Frau, die er im Mondschatten, eine dunkle Silhouette vor dem hellen Nachthimmel, nur erahnen kann und ergänzt die dunkle Gestalt, die voller und weiblicher ist, als das schlanke, grosse Mädchen, das er kannte, mit den Zügen seiner Erinnerung, was ihm aber nicht recht glücken will, so dass er versucht ist, Licht zu machen, eine Idee, die er aber wieder verwirft, genauso wie er es nicht wagt, die Frau anzusprechen, weil er Angst hat, er könnte sich täuschen und alles sei eben doch nur ein Traum, die Folge eines Sonnenstichs, der Bilder von Vergangenem in die Gegenwart hinüberzerrt. Im besten Fall liegt er in einem Krankenzimmer oder am Ende gar zu Hause, ist noch nicht in Lamu, sondern in einen langen, mühsamen Traum verstrickt, aus dem er, mondempfindlich wie er ist, langsam erwacht.
Er liegt da und schweigt, bemüht sich kaum, die Fäden seiner Erinnerung zu entwirren. Er schaut auf die Frau und wartet, wartet, dass sie etwas sage oder sich erhebe, vielleicht hinausgehe, was er, ohne zu wissen warum, bedauern würde, denn die Ruhe, die sich in ihm ausbreitet, schreibt er der Gegenwart dieser Frau zu, wer immer sie auch ist.
Die Frau hat den Mann nicht zurück erwartet. Sie hat sich ihr Leben längst ohne ihn eingerichtet und jetzt, nachdem ein Zufall ihr denselben Mann ein zweites Mal in die Hände spielt, weiss sie nicht, ob sie sich darüber freuen soll.
Als sie den Mann auf der Strasse erkannte, er ihr sozusagen in die Arme fiel, sie ihn mit Hilfe von ein paar Freunden in sein Gasthaus brachte, übernahm sie, ohne lange zu überlegen, seine Pflege. Aber jetzt? Sie sitzt ihm gegenüber, und während sie in seinen Zügen nach Altvertrautem forscht, überfallen sie Erinnerungen an ihre kurze Bekanntschaft, die so entscheidend für ihr weiteres Leben wurde. Und, quasi als Rechtfertigung, weshalb sie hier sitzt, zählt sie in Gedanken die Stationen ihrer Geschichte auf.
Sie sieht sich als junges Mädchen, wie sie, trotz dem Verbot der Eltern, sich mit den Fremden einlässt, sie fast täglich unter dem Vorwand, ihre Verwandten in Shela zu besuchen, mit ein paar anderen Mädchen zu den Weissen in die Dünen läuft. Sie erinnert sich an den Moment, wo sie mit ihm zum ersten Mal allein ist. An seine schüchterne Zärtlichkeit. Ihre kindischen Spiele und ernsthaften Versuche, einen gemeinsamen Weg zu finden. – Mit welcher Pedanterie bestand er darauf, dass sie seine Sprache lernt. – Und doch war alles immer wieder nur Vorwand, um sich zu berühren, anzufassen, zu drücken und an sich zu ziehen. Sie, die Ähnliches noch nie erfahren hatte, überliess sich ihm immer hemmungsloser. Ein Rausch, der sie herausriss aus ihrer Armut und in einen Gabentempel setzte, dessen paradiesischen Ausmasse ohne Ende schienen.
«Meine Alice im Wunderland» hatte er sie genannt, bis er eines morgens nicht mehr da war.
Dass sie schwanger war, konnte er nicht wissen, vermuten allerdings schon, doch da alle ihre Briefe unbeantwortet blieben, sie nichts mehr von ihm hörte, liess ihr Stolz es nicht zu, dass sie ihm die Geburt eines Sohnes mitteilte, obwohl ihre Freude damals nicht gross war, im Gegenteil, sie in Schwierigkeiten geriet, die sie kaum bewältigen konnte. Für die Männer Lamus kam sie als Ehefrau nicht mehr in Frage. Ihre Familie schämte sich. Sie und ihr Kind wurden ins Haus gesperrt und totgeschwiegen.
Sie floh nach Malindi, dem nächsten, grösseren Touristenort. Sie hoffte, Arbeit zu finden, ein Auskommen für sich und ihren Sohn, kannte eine entfernte Verwandte, die ihr vielleicht helfen würde. Dass die Frau als Tänzerin in einem Nachtclub arbeitete, wusste sie, was dies für die Frau bedeutete, nicht. Immerhin verhalfen ihr die wenigen Sprachbrocken, die er ihr beigebracht hatte, zu einer Sonderstellung unter den Mädchen, und tatsächlich genügten die wenigen Floskeln für ein Geschäft, bei dem ohnehin nicht viel gesprochen wird. Vor ein paar Jahren kehrte sie nach Lamu zurück.
Nein, sie hat keinen Grund, sich über das plötzliche Auftauchen Mettlers zu freuen.
Alice weiss nicht, wie lange sie schon dem Mann gegenüber sitzt, der sie anzuschauen scheint, ohne sie zu sehen. Entschlossen in den nächsten Minuten zu gehen, bricht sie ihr Schweigen und sagt: «Du weisst, wer ich bin?»
Mettler, den die leise Frage aus seinen Träumen reisst, antwortet nicht sofort, sondern murmelt, eher fragend und mehr für sich als an die Frau gerichtet: «Alice aus dem Wunderland?»
Alice steht auf, geht zum Stuhl, auf dem ihre Kleider liegen, lässt das Badetuch fallen und zieht ohne Hast ihre Kleider an.