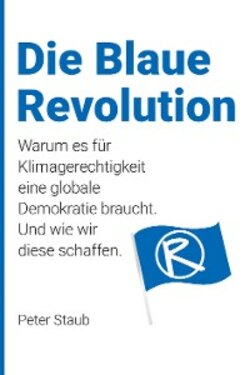Читать книгу Die Blaue Revolution - Peter Staub - Страница 5
1 Eine Nation – eine Demokratie
ОглавлениеDer Saal im ehrwürdigen «Kaufleuten» in Zürich kocht. Seit rund zwei Stunden fegt das internationale Ensemble von Incognito an einem Novemberabend 2019 über die Bühne. Das international gemischte Publikum tanzt ausgelassen zum Soul und Jazz der fast 20-köpfigen Band. Die Stimmung ist energiegeladen und entspannt zugleich. Bandleader Jean Paul «Bluey» Maunick strahlt ins Publikum und ruft zum Ende des Konzerts: «We are one nation, we are one family.» Das Publikum stampft, klatscht, jubelt.
Der in Mauritius geborene englische Musiker weiss, wovon er spricht. Schliesslich spielt er seit fast 40 Jahren rund um die Welt Konzerte. Dabei wollte «Bluey» Maunick aber nicht nur der musizierende Magier auf der Bühne sein, der die Leute zum Tanzen brachte: «Ich wollte, dass die Welt meine Band ist», sagt er. So waren bei Incognito seit Gründung der Band insgesamt über 1500 Musiker*innen und Sänger*innen dabei. «Blueys» Idee war es von Anfang an, «ein musikalisches Kollektiv» aus den unterschiedlichen Menschen aus ganz verschiedenen Ländern zu bilden.[1]
Also ist es für ihn nicht einfach eine Floskel, wenn er «We are one nation» so locker dahinsagt. Für Jean Paul «Bluey» Maunick ist es eine Lebenseinstellung. Für die meisten seiner Fans ist diese Aussage wohl eine Selbstverständlichkeit. Denn sie wissen: Wir Menschen haben alle die gleichen Wurzeln, wir alle haben das gleiche Blut in den Adern, wir alle haben grundsätzlich die gleichen Bedürfnisse und Fähigkeiten. Egal, aus welchem Schweizer Kanton sie stammen, egal, in welchem Land sie aufgewachsen sind, egal, welche Hautfarbe sie haben, egal, ob sie sich als Frau, Mann oder Transmenschen bezeichnen, egal, ob sie an einen Gott glauben oder nicht: Alle zusammen bilden die Menschheit, sind eine Nation.
Darum geht es der Blauen Revolution: Die Spezies Mensch muss in der Entwicklung endlich einen Schritt weiterkommen. Wir müssen die Erkenntnis, dass wir uns von den Inuit in Kanada über die Einheimischen der Zentralschweiz bis zu den Maori auf Neuseeland alle so ähnlich sind, dass unsere Organe problemlos ausgetauscht werden können, endlich ernst nehmen. Und diese Erkenntnis in die reale Politik umsetzen. Genauso wenig, wie es jemanden in den Sinn kommen würde, die Menschen nach ihren verschiedenen Blutgruppen in «Rassen» einzuteilen, macht es Sinn, Menschen nach dem Ort ihrer Geburt oder der Farbe ihrer Haut zu schubladisieren.
Abgesehen davon, dass «Blueys» Wort der «one nation» also grundsätzlich Sinn macht, gibt es zu Beginn des dritten Jahrtausends mehrere Gründe, aus der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass alle Menschen gleich sind, die politischen Konsequenzen zu ziehen.
Neben älteren moralischen Appellen wie «Proletarier aller Länder vereinigt euch» aus dem Manifest der Kommunistischen Partei von 1848[2] oder neueren Aufrufen wie jenem von Jean Ziegler – politisches Enfant terrible der Schweiz –, wonach «das tägliche Massaker des Hungers der absolute Skandal unserer Zeit» ist[3], ist es heute vor allem die Frage nach dem Überleben der menschlichen Zivilisation, die auf eine globale Antwort drängt. Dass durch die globale Klimaerwärmung das Überleben der zivilisierten Menschheit auf dem Spiel steht, ist heute weitgehend unbestritten. Natürlich gibt es Menschen, die das bestreiten. Mit diesen dürfen sich gerne jene auseinandersetzen, die auch mit Menschen diskutieren, die behaupten, dass die Erde eine Scheibe ist.
«Unser Planet steht in Flammen», sagte UNO-Generalsekretär António Guterres in seiner Neujahrsbotschaft Anfang Januar 2020. Er sprach damit die Klimaerwärmung an, die sich damals mit gigantischen Waldbränden in Australien manifestierte. Seine Aussage war aber auch eine vieldeutige Metapher. So sprach Guterres ebenfalls davon, dass sich die Welt in Aufruhr befinde, und dass die geopolitischen Spannungen so stark seien wie noch nie im 21. Jahrhundert. Die Menschen seien zornig und verstört. So könne es nicht weitergehen, sagte er. Sein verzweifelter Aufschrei war auch das Eingeständnis der Ohnmacht der Vereinten Nationen und damit der gesamten Staatengemeinschaft.[4]
Die Metapher des UNO-Generalsekretärs orientierte sich dabei nicht zufällig an der Botschaft der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg, die diese knapp ein Jahr zuvor am World Economic Forum (WEF) in Davos an die führende Mangager-Guilde gerichtet hatte: «Das Haus brennt».[5]
Seit dem flammenden Appell Thunbergs an die selbsternannte Wirtschaftselite sind die Monate ins Land gegangen, ohne dass sich eine funktionstüchtige Feuerwehr formierte. Thunbergs Schulstreiks fürs Klima haben zwar Millionen von jungen Menschen motiviert, regelmässig für eine politische Lösung des Klimaproblems auf die Strasse zu gehen, doch ausser der öffentlichen Erkenntnis, ein gravierendes Problem zu haben, hat sich wenig verändert.
Immerhin haben zahlreiche Städte in der Schweiz, in Europa und rund um den Globus unterdessen den Klimanotstand ausgerufen. Und selbst das EU-Parlament schloss sich Ende November 2019 diesem Trend der Symbolpolitik an und verlangte von der EU-Kommission, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird.[6]
Doch getan hat sich nichts: Trotz im Vorfeld wohlwollend formulierter Verlautbarungen ging die 25. UNO-Weltklimakonferenz in Madrid im Dezember 2019 ohne Fortschritte zu Ende. Das Plenum erinnerte die rund 200 Staaten bloss an ihre Zusage, im nächsten Jahr ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen. Aktivist*innen waren zurecht empört, dass das Pariser Abkommen von 2015 weiterhin ein Papiertiger blieb: «Diese Klimaschutzkonferenz war ein Angriff auf das Herz des Pariser Abkommens. Sie verrät all jene Menschen, die weltweit längst unter den Folgen der Klimakrise leiden und nach schnellen Fortschritten rufen», sagte Greenpeace-Deutschland-Geschäftsführer Martin Kaiser. Für den WWF war die Konferenz «ein gruseliger Fehlstart in das für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens so entscheidende Jahr 2020». Auch für die internationale Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan war das Ergebnis «völlig inakzeptabel.»[7]
Dabei aber einfach mit dem Finger auf Staaten wie die USA oder Brasilien zu zeigen, die mit ihren reaktionären Präsidenten zweifellos zu den Bremsern einer nachhaltigen Klimapolitik gehören, wäre zu billig. Selbst die reiche Schweiz, die sich gerne als Klima-Musterschülerin verkauft, ist weit davon entfernt, die eigenen, für einen wirksamen Klimaschutz immer noch ungenügenden Ziele einzuhalten. Sie rutschte 2019 im internationalen Klima-Länderrating gegenüber dem Vorjahr gar um sieben Plätze ab und belegt nur noch Rang 16. Vor der Schweiz liegen nicht nur Länder wie Schweden oder Dänemark, sondern auch Marokko und Indien. Grund dafür ist die schwache Klimapolitik der Eidgenossenschaft. Obwohl der Schweizer Bundesrat im August 2019 das Netto-Null-Ziel bis 2050 ankündigte, fehlt es an einer verbindlichen Umsetzungsstrategie. Auch das Ziel, die Inlandsemissionen bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren, war bloss eine Absichtserklärung.[8]
Nicht nur Umweltorganisationen sind besorgt. Auch das World Economic Forum (WEF) hatte die Krise auf dem Radar. Eine Woche vor dem Jahrestreffen in Davos stellte das WEF Mitte Januar 2020 die wichtigsten Risiken der Zukunft vor. Der «Global Risk Report» zeichnet vor dem Hintergrund zunehmender politischer Spannungen, drohendem wirtschaftlichem Abschwung und Umweltrisiken ein düsteres Bild. Und das war noch bevor die Coronakrise überhaupt ein Thema war. Sorgen machen sich die Entscheidungsträger*innen aus Politik und Wirtschaft insbesondere wegen extremer Wetterereignisse, dem Verlust von Biodiversität und der von Menschen verursachten Umweltkatastrophen. Der Risikoreport folgert, dass wegen des Klimawandels die Migration zunehmen wird und sich die geopolitischen Spannungen weiter verschärfen werden. Neben der Klimakrise wird auch der Verlust der Biodiversität, die so schnell schwindet wie noch nie in der Geschichte der Menschheit, als grosses Risiko für die künftige Entwicklung bezeichnet.
Für den «Global Risk Report» wurden rund 750 Personen befragt, darunter auch sogenannte «Global Shapers», Menschen ab Jahrgang 1980. Diese sorgen sich noch stärker um die Umwelt. Sie sehen im Klimawandel nicht nur langfristige Risiken, sondern gehen vielmehr davon aus, dass bereits ab 2020 Umweltkatastrophen wie extreme Hitzewellen oder unkontrollierbare Waldbrände ansteigen werden.[9] Angesichts der massiven Brände im Amazonasgebiet und in Australien im Jahr 2019 ist das keine allzu gewagte Prognose.
Zu diesen Erkenntnissen passte, dass sich kurz vor dem WEF auch der Schweizer Tennisspieler Roger Federer aus der Deckung wagte und zum Klimanotstand ein klares Statement abgab. Federer war von der Klimajugend mit dem Hashtag #rogerwakeupnow aufgefordert worden, sich gegen die Politik einer seiner wichtigsten Sponsoren auszusprechen.
Ende November 2018 hatten zwölf Aktivist*innen auf die umweltschädliche Investitionspolitik der Schweizer Grossbank Credit Suisse (CS) aufmerksam gemacht, als sie in Vorraum einer Bankfiliale als Sportler verkleidet Tennis spielten. Für diese Aktion des zivilen Ungehorsams wurden sie von der Staatsanwaltschaft wegen Hausfriedensbruchs angeklagt, Mitte Januar 2020 in erster Instanz von einem Bezirksrichter aber überraschend freigesprochen. Der bürgerliche Einzelrichter attestierte den Demonstrierenden, angesichts eines realen Notstandes gehandelt zu haben. Dafür dürfte nicht zuletzt Roger Federer mitverantwortlich gewesen sein. Denn der Richter geisselte nicht nur die ineffiziente Politik, er wies auch explizit darauf hin, dass Federer am Wochenende zuvor auf die Forderungen der Aktivist*innen reagiert hatte.[10] Dieses juristische Wunder hielt allerdings nicht lange. Mitte September hob das Waadtländer Kantonsgericht die Freisprüche auf und verurteilte die Aktivist*innen zu Bussen um 200 Franken und zur Übernahme der Gerichtskosten.[11]
Dass Weltstar Federer Stellung nahm, ist auch Greta Thunberg zu verdanken, die seine Zusammenarbeit mit der CS auf Twitter thematisierte. Federer reagierte schliesslich mit einem klaren Statement: «Ich nehme die Auswirkungen und die Bedrohung durch den Klimawandel sehr ernst, zumal meine Familie und ich inmitten der Zerstörung durch die Buschbrände in Australien ankommen», schrieb er, als er gerade zum Australian Open unterwegs war. Als Vater von vier Kindern und leidenschaftlicher Befürworter der universellen Bildung habe er grossen Respekt und Bewunderung für die Jugendklimabewegung. «Ich bin den jungen Klimaaktivisten dankbar, dass sie uns alle dazu zwingen, unser Verhalten zu überprüfen und nach innovativen Lösungen zu suchen. Wir sind es ihnen und uns selbst schuldig, zuzuhören.» Er sei sich seiner Verantwortung als Privatperson, als Athlet und als Unternehmer «sehr bewusst». Er «möchte diese privilegierte Position für den Dialog in diesen wichtigen Fragen mit meinen Sponsoren nutzen», schrieb Roger Federer.[12]
Wie ernst es um den ökologischen Zustand der Welt tatsächlich steht, wissen nicht nur Federer oder die Autor*innen des «Global Risk Report». Ein Beispiel aus Zentralafrika schildert die Geografin und Umweltaktivistin Hindou Dumarou Ibrahim im Vorwort zu Carola Racketes Buch «Handeln statt hoffen»: Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Durchschnittstemperatur im Tschad um mehr als 1,5 Grad Celsius angestiegen. Was auch für die meisten Länder Afrikas gelte. «Unsere Bäume brennen. Unsere Wasservorkommen versiegen. Unsere fruchtbaren Äcker verwandeln sich in Wüste.»
Als indigene Frau lebt und arbeitet Hindou Dumarou Ibrahim mit ihrer Gemeinschaft im Einklang mit der Natur. Die Jahreszeiten, die Sonne, den Wind und die Wolken sehen sie als Verbündete. «Inzwischen sind sie zu Feinden geworden.» Als Beispiel der verheerenden Veränderung erwähnt die Koordinatorin der Organisation «Femmes Peuples Autochones du Tchad» den Tschadsee, der früher einer der fünf grossen Süsswasserspeicher Afrikas war. «Als ich vor gut 30 Jahren geboren wurde, hatte der See eine Fläche von 10 000 Quadratkilometern. Heute sind es noch 1250.» Allein in ihrer Lebenszeit verschwanden also fast 90 Prozent des Sees.[13] Zum Vergleich: Der grösste See der Schweiz, der Bodensee, hat eine Fläche von rund 530 Quadratkilometern. Der Tschadsee schrumpfte also um eine Fläche, die 16 Mal so gross ist wie der Bodensee.
Während sich die Klimaerwärmung seit Jahren bereits deutlich manifestiert, kommt die Erkenntnis, dass wir das herrschende System grundlegend verändern müssen, erst langsam in der Mitte der Gesellschaft an. Obwohl der damalige Präsident der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, Joël Mesot, Ende 2019 nicht glaubte, «dass alles realistisch ist», was die Klima-Aktivist*innen auf der Strasse forderten, fand er Greta Thunbergs Engagement immerhin «hoch interessant». Die ETH wolle zwar Technologien anbieten, um den Klimawandel zu bekämpfen. «Aber Technologie allein genügt nicht. Es braucht auch Veränderungen in der Gesellschaft und den Willen aller Staaten, am gleichen Strick zu ziehen», sagte Mesot.[14]
In welche Richtung die Veränderungen der Gesellschaft und insbesondere das Wirtschaftssystem gehen müssen, formuliert die ehemalige Basler Ständerätin Anita Fetz. In ihrem Essay mit dem Titel «Kann die Demokratie den Kapitalismus zivilisieren?» schreibt Fetz, dass die modernen bürgerlichen Demokratien «nicht nur aus dem Prinzip des one woman one vote» bestehen, sondern «ganz entscheidend auch im Selbstverständnis, dass alle Menschen gleich viel wert sind und dass der Rechtsstaat die Minderheiten schützt». Die Sozialdemokratin windet der Schweizer Demokratie ein Kränzchen: «Kaum ein Land hat eine so weitgehende direkte Demokratie auf allen Staatsebenen verwirklicht wie die Schweiz. Wir können mitbestimmen von der Gestaltung des Dorfplatzes bis zur ökologischen und sozialen Verantwortung der Konzerne, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben.»
Fetz plädiert als fortschrittlich denkende Politikerin und Unternehmerin für eine ökosoziale Marktwirtschaft, um «das Verhältnis von Mensch und Wirtschaft wieder vom Kopf auf die Füsse» zu stellen. Die Wirtschaft sei für die Menschen da und nicht umgekehrt. Dafür brauche es nicht nur eine geschlossene Kreislaufwirtschaft, in der die Ressourcen konsequent wiederverwendet werden, sondern auch alternative Arbeitsformen und die Ausdehnung der Demokratie. Das heisst neben der verstärkten «Partizipation für die Mitarbeitenden» in den Unternehmen auch daran zu denken, dass «die nicht vermehrbare Natur wie Wasser und Boden allen gehören.» Anita Fetz fordert nicht nur deren «Vergemeinschaftung», sie blickt auch über die Grenzen: «Für eine starke Demokratie ist das Schweizer Modell der direkten Demokratie eine gute Ausgangslage.» Und mit Blick auf das weltweite Engagement der Jugend gegen den Klimawandel zeigt sie sich optimistisch. Die Jugendlichen seien einerseits «digital global vernetzt», gleichzeitig aber auch «analog vor Ort sichtbar in ihren Städten.» Fetz ist überzeugt, dass die Klimajugend die Zukunft verändert.[15]
Weil ihr die vielen Jahre als linke Politikerin in bürgerlich dominierten Parlamenten den Hang zum Träumen offenbar ausgetrieben hatten, spinnt sie den Faden nicht weiter. Sonst wäre sie zwangsläufig bei einer globalen, direkten Demokratie gelandet, deren Wirtschaftssystem sich auf eine ökosoziale Kreislaufwirtschaft stützt und als eine wesentliche Bedingung dafür den Grund und Boden sowie das Wasser vergesellschaftet hat.
Jugendliche Klima-Aktivist*innen argumentieren ähnlich wie die erfahrene Feministin Fetz. So schreibt beispielsweise Nadia Kuhn, dass der Kampf gegen den Klimawandel «Hand in Hand» gehen müsse «mit dem Kampf für mehr Demokratie und mehr Gerechtigkeit in allen Lebensbereichen.» Technokratische Scheinlösungen reichten nicht aus, um die drohende Umweltkatastrophe aufzuhalten, schreibt die Co-Präsidentin der Jungsozialist*innen des Kantons Zürich.[16] Und ihr Kollege Luzian Franzini, Co-Präsident der Jungen Grünen Schweiz, weist darauf hin, dass die Schweiz nicht nur in Sachen Demokratie etwas zu bieten hat, sondern auch eine besondere Verantwortung trägt: «Aus internationaler Perspektive ist die Schweiz als reichstes Land der Welt prädestiniert dafür, eine globale Führungsrolle im Kampf gegen die Klimakrise wahrzunehmen.» Für ihn ist klar, dass die Klimabewegung Geschichte schreibt. Der Kampf gegen die Klimaerwärmung sei die Chance, «die grundlegenden Machtstrukturen zu verändern und eine Welt zu gestalten, welche allen ein würdiges Leben garantiert – auch den künftigen Generationen.»[17]
Noch konkreter wird die Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Carola Rackete, als sie eine Regierung fordert, die «auf allen Ebenen viel mehr Demokratie zulässt. Wir brauchen echte Demokratie in der Wirtschaft, in der Politik und in der Gesellschaft.»[18] Gleichzeitig müssten wir aber ebenfalls «den Überkonsum beenden und der globalen Ungerechtigkeit und dem Verfall der Menschenrechte etwas entgegensetzen», verlangt sie. So wie sie im Juni 2019 als Kapitänin der Sea-Watch 3 nicht ewig warten konnte, bis sie die geflüchteten Menschen an Bord in Italien in Sicherheit brachte, so könne auch die Menschheit nicht darauf warten, «dass sich die Staaten selbst verpflichten.»[19]
Carola Rackete will mehr Demokratie, viel mehr Demokratie. Zu Recht. Obwohl nach dem Ende der Sowjetunion Ende der 1980er-Jahre von den Siegern des Kalten Krieges ein neues Zeitalter der Demokratie ausgerufen wurde, hat der Begriff im 21. Jahrhundert für viele Menschen den guten Ruf verloren. Zu viele wurden enttäuscht. Zu viele Zivilist*innen und Soldat*innen starben im Namen der «Demokratie» auf den Schlachtfeldern des Mittleren Ostens. Zu viele Menschen wurden in den demokratischen Staaten der EU oder in den USA wirtschaftlich abgehängt, damit deren Regierungen die Reichen noch reicher machen konnten.
Es ist insofern keine grosse Überraschung, dass Wendy Brown, Professorin für politische Theorie an der Universität Berkeley, konstatiert: «Die Demokratie, die wir einst hatten, ist tot.» Weil die Neoliberalen die Demokratie als störend empfinden, sollte sie «auf ein Kreuzchen auf einem Wahlzettel» reduziert werden, schimpft sie. Doch die linke amerikanische Intellektuelle belässt es nicht dabei, sich zu beklagen. Obwohl die Demokratie in einer globalisierten Welt nicht mehr wie früher funktionieren könne, sei das auf einer lokalen oder regionalen Ebene noch möglich. Gefragt, ob die direkte Demokratie der Schweiz «ein Rezept für die Welt» wäre, setzt die Aktivistin für Frauenrechte zu einem Loblied an: «Das wäre phänomenal», sagt sie. Die Schweiz habe eine direkte Demokratie, die «an öffentliche Interessen und das Gemeinwohl glaubt. Eine Demokratie, die die Debatten öffentlich austrägt.» Dass die Ergebnisse der Abstimmungen nicht alle glücklich machten, sei halt Demokratie. «Ja, die Welt wäre in einem guten Zustand, wenn sie verschweizern würde», sagt Wendy Brown.[20]
Damit nimmt die kalifornische Professorin den Begriff von Friedrich Dürrenmatt auf. Wendy Browns Votum wird in progressiven Kreisen in der Eidgenossenschaft nicht besonders geschätzt, leidet doch die Linke in diesem kleinen, reichen Land daran, praktisch immer in der Minderheit zu sein. Während sich Schweizer Grossbanken und multinationale Konzerne, die aus Steuergründen ihren Sitz in der Schweiz haben, mit der Unterstützung des Bürgertums am Elend der Welt bereichern.
Denn die Schweiz hat nicht nur ein ausgeklügeltes politisches System, das der erwachsenen Bevölkerung mit Schweizer Pass weitgehende Mitsprachemöglichkeiten einräumt. Die Schweiz ist auch ein Land, das von der weltweiten Ausbeutung profitiert. Natürlich ist sie damit nicht allein. Sie profitiert im Verbund mit den anderen Staaten des globalen Nordens, die der Welt die Handelsbedingungen diktieren. Der ehemalige Berner SP-Nationalrat Rudolf Strahm beschreibt die Verhältnisse so: «Die in den internationalen Handelsabkommen und der WTO (Word Trade Organization) festgeschriebene Freihandelsdoktrin hat stets soziale Fragen ignoriert, etwa Kinderarbeit und Lohndumping. Ökologische Kritik wurde beiseitegeschoben, etwa Überfischung, Gentechnologie, Klima- und Atmosphärenschutz. Der doktrinär durchgesetzte Freihandel ist sozial und ökologisch blind.»[21]
So ist es nicht verwunderlich, dass auch die sozialdemokratische Zürcher Nationalrätin Jacqueline Badran dafür kämpft, das herrschende Wirtschaftssystem «zu einer postkapitalistischen Gesellschaft, die nicht mehr den Wachstumszwang unterworfen ist», umzubauen. «Nur weil wir die Ausbeutung nicht mehr vor der eigenen Haustür haben, ist sie nicht verschwunden – wir haben sie einfach ins Ausland ausgelagert», analysiert die oppositionelle Unternehmerin. Deshalb «müssen wir jetzt die Köpfe zusammenstecken – und eine neue Geschichte entwickeln, welche die globalen Probleme angeht.»[22] Ganz ähnlich sieht das Strahm: «Die sozialen und ökologischen Schutzregeln, die in den zivilisierten westlichen Nationen über hundert Jahre hinweg schrittweise installiert worden sind, braucht es auf globaler Ebene.»[23]
Doch damit wäre es nicht getan: Es reicht nicht, bloss ökologische und arbeitsrechtliche Regeln erfolgreicher Staaten wie jene der Schweiz global umzusetzen. Unabhängig davon, dass die Gewerkschaften zu Recht darauf hinweisen, dass es etwa beim Kündigungsschutz oder bei der fehlenden Demokratie auf Betriebsebene in der Schweiz noch grosse Defizite gibt. Angesichts der sich weiter verschärfenden Klimakrise braucht es einen fundamentalen Umbau des herrschenden Wirtschaftssystems. Darauf weisen auch die jugendlichen Klima-Aktivist*innen immer wieder hin, wenn sie den «system change» fordern.
In progressiven Kreisen der USA, und seit Beginn des Jahres 2020 auch in der Kommission der Europäischen Union, ist viel von einem grünen New Deal die Rede, mit dem der Umbau der Wirtschaft vorangetrieben werden sollte, um das Leben in den reichsten Ländern der Welt CO2-neutral zu organisieren. Für viele kritische Wirtschaftsfachleute oder Aktivist*innen gehen diese Pläne allerdings zu wenig weit. Abgesehen davon, dass sie bloss auf dem Papier existieren.
Für Niko Paech beispielsweise braucht es einen Aufstand und «Gruppen von Menschen, die eine Lebensweise praktizieren, die übertragbar ist auf 7,5 Milliarden Menschen.» Für den Professor für Plurale Ökonomik an der Universität Siegen ist der von der EU-Kommission angekündigte Green Deal und der New Green Deal, wie ihn die amerikanischen Demokrat*innen propagieren, «eine Mogelpackung, die das Unmögliche verspricht: keine Wohlstandsreduktion bei gleichzeitig hinreichendem Umweltschutz.» Bestandteile einer ökologisch vertretbaren Wirtschaft sieht er etwa im Verbot «aller Urlaubsflüge, Kreuzfahrten und anderem schamlosen Luxus». Und in der Einführung einer 20-Stunden-Arbeitswoche, «um bei halbierter Produktion dennoch Vollbeschäftigung zu erreichen».[24]
Paech nennt sein Wirtschaftsmodell «Postwachstumsökonomie». Er argumentiert, dass man Wertschöpfung nicht von ökologischen Schäden entkoppeln dürfe und dass ab einem gewissen wirtschaftlichen Entwicklungsniveau «mehr Einkommen und Konsum nicht zu mehr Lebenszufriedenheit» führe. Ständiges Wachstum führe sogar zu kontraproduktiven sozialen Effekten in Bezug auf Hunger, Armut oder Verteilungsgerechtigkeit. Paech bleibt allerdings die Antwort auf die Frage schuldig, wie sich der globale Süden auf diese Weise wirtschaftlich so entwickeln könnte, dass die Menschen auch dort über genügend sauberes Wasser und gesunde Nahrung verfügen und nicht weiterhin auf ausreichende Bildung, vernünftige Transportmöglichkeiten oder eine anständige Gesundheitsversorgung verzichten müssen.[25]
Da ist sein amerikanischer Kollege Jeremy Rifkin optimistischer. In seinem Buch «The Green New Deal»[26] kommt der Ökonom und Publizist zum Schluss: «Es gibt Zeiten in der Geschichte, die zum Zusammenbruch einer Zivilisation führen, weil neue Revolutionen in den Bereichen Kommunikation, Energie, Mobilität und Logistiktechnologie nicht in Sicht sind. Glücklicherweise treibt diesmal eine neue, leistungsstarke grüne Infrastruktur-Revolution die alte Infrastruktur beiseite und schafft gleichzeitig die Möglichkeit, auf der Erde einfacher und nachhaltiger zu leben.»[27]
Für Rifkin ist der Green New Deal, wie ihn auch die US-amerikanische demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez fordert, «ein starkes Plädoyer für die jüngeren Generationen». Denn diese sei es, die Amerika umzuwälzen werde, um mit einer wichtigeren Agenda voranzukommen: «Nicht nur um die sozialen Perspektiven und das wirtschaftliche Wohlergehen aller Amerikaner*innen zu verbessern, sondern auch, um Amerika und seine Bevölkerung als Vorreiter zu positionieren, den Klimawandel zu begrenzen und das Leben auf der Erde zu retten.» Für Rifkin ist deshalb der Aufbau einer emissionsfreien Infrastruktur für die dritte industrielle Revolution «der Kern des Green New Deal.»[28]
In seinem Plädoyer für eine grüne Ökonomie legt er einen mitreissenden Optimismus an den Tag, wie man ihn auch von amerikanischen Sportler*innen gewohnt ist. Ein Optimismus, der auch den diesbezüglich zurückhaltenderen Europäer*innen guttun würde. Dieser Optimismus, dass es genüge, die Ärmel hochzukrempeln, habe die USA während mehr als zweihundert Jahren durch schwierige Prüfungen geführt. «Dies liegt in unserer kulturellen DNA», schreibt Rifkin als Nachfahre eingewanderter Europäer. Die andere Sicht der Native Americans auf die Geschichte der USA wird später in diesem Buch thematisiert.
Um aber bei Rifkins Optimismus zu bleiben: Er hofft, dass «die Graswurzelbewegung für einen Green New Deal, die sich jetzt in ganz Amerika ausbreitet», es schafft, in den Vereinigten Staaten eine grüne Infrastruktur für die dritte industrielle Revolution aufzubauen, um so den Klimawandel zu begrenzen «und eine gerechtere und humanere Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen.»[29]
Eine solche «gerechtere und humanere» Gesellschaft müsste natürlich auch jenem grossen Teil der Menschen im globalen Süden zugutekommen, die in bitterster Armut leben. Wollte man den aktuellen Lebensstandard der Mittelklasse Europas oder Nordamerikas zum Massstab eines guten Lebens für alle Erdenbürger*innen machen, bräuchten wir über den Daumen gepeilt zwei bis drei Planeten, um die Nachhaltigkeit zu garantieren. Selbst wenn der Green New Deal so umgesetzt würde, wie sich das Rifkin und Ocasio-Cortez vorstellen.
Deshalb werden wir nicht um die Einsicht der Umwelt-Aktivistin Carola Rackete herumkommen, wonach es dringend erforderlich ist, «dass wir Gesetze einführen, die den Ressourcenkonsum der Menschen in der Wohlstandsgesellschaft bremsen.»[30] Wobei dieses Limit des Ressourcenverbrauchs durchaus global gemeint ist. Und zwar beileibe nicht nur für Privatpersonen. «Unternehmen müssen daran gehindert werden, aus der Zerstörung der Natur Profit zu schlagen», fordert Rackete.
Um den Profit, wie er bisher erzielt wurde, künftig in ökologischere Bahnen zu führen, fordert der Schweizer Ökonom Ernst Fehr «eine allgemeine Klimasteuer, die alle Produkte proportional zu den verursachten Treibhausgasemissionen besteuert.»[31] Im Gegensatz zu Rackete kann der 63-jährige Professor für Mikroökonomik an der Universität Zürich kaum als Antikapitalist bezeichnet werden, schliesslich setzt er mit der Klimasteuer auf ein marktkonformes Instrument: «Mit einer Klimasteuer würde der Markt die Treibhausemissionen stark reduzieren», sagt Ernst. Dabei reiche eine CO2-Abgabe, wie sie etwa im Schweizer Parlament Ende 2019 diskutiert wurde, nicht aus. Ernst sieht die Klimasteuer breiter, nur so wäre es möglich, «die hohe Emissionen verursachende Fleischproduktion» zu verringern, «weil sich das Fleisch verteuern würde.»
Obwohl es aus ökologischen Gründen sinnvoll ist, den weltweiten Fleischkonsum zu reduzieren, würde eine «Fleischsteuer» allerdings dazu führen, dass sich die Ungleichheit weiter zuspitzte: Wer reich ist, könnte Fleisch essen, ohne sich einschränken zu müssen. Die Armen hingegen müssten sich mit Reis begnügen.
Hier würde nur eine Kontingentierung Abhilfe schaffen. Allenfalls in Kombination mit einer Fleischbörse. In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung könnte das beispielsweise über eine Art CO2-Kreditkarte laufen. Die Wissenschaft könnte berechnen, wie viel Fleisch ein Mensch im weltweiten Durchschnitt pro Woche essen darf, damit eine nachhaltige Landwirtschaft möglich wäre. Nehmen wir an, dass dieser Wert bei 100 Gramm Fleisch pro Person liegen würde. Alle die weniger verbräuchten, könnten ihr «Fleischguthaben» an die internationale «Fleischbörse» bringen, um es dort an jene zu verkaufen, die mehr als die ihnen zustehenden 100 Gramm pro Woche essen wollen. Damit wäre gewährleistet, dass jede Person so viel Fleisch essen könnte, wie ihr zusteht. Mit dem netten Begleiteffekt, dass Vegetarier*innen mit dem Verkauf ihrer Kontingente sogar noch Geld verdienen würden.
Damit sind wir mitten in der Diskussion der sozialen Frage. Wie sich von der Obrigkeit verfügte Preiserhöhungen bei Bürger*innen, die sich ihrer Demonstrationsmacht bewusst sind, aber in den Entscheid nicht einbezogen werden, auswirken können, haben die Gilet Jaunes in Frankreich gezeigt. Nach einer ökologisch begründeten Preiserhöhung des Treibstoffs legten sie Frankreich über Monate teilweise lahm. Jeremy Rifkin zitiert in «The Green New Deal» zu Recht den Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes Sharan Burrow, der davor warnt, dass der «wirtschaftliche Wandel, mit dem wir konfrontiert sind, sich in einem Ausmass und innerhalb eines Zeitrahmens vollzieht, der schneller als jeder andere in unserer Geschichte.» Burrow verlangt deshalb, dass in allen Ländern und für benachteiligte Gemeinden, Regionen und Sektoren «gerechte Übergangsfonds» eingerichtet werden, um Investitionen in Bildung und Umschulungen zu finanzieren. «Der soziale Schutz der Arbeiter*innen muss gewährleistet werden.»[32]
Auch die linken Parteien in der Schweiz arbeiten zusammen mit den Gewerkschaften darauf hin, dass nicht die Lohnabhängigen die Zeche des ökologischen Wandels bezahlen müssen. Beat Ringger, damals geschäftsführender Sekretär des linken Schweizer Thinktanks Denknetz, hat das in seinem System-Change-Klimaprogramm so formuliert: «Alle Versuche, die Kosten des Klimaschutzes auf die breite Bevölkerung abzuwälzen und gleichzeitig grosse Vermögen vor dem Zugriff zu bewahren sowie wichtige Machtzentren unangetastet zu lassen, werden scheitern – zu Recht.»[33]
Bei der Verknüpfung von ökologischen und sozialen Fragen geht es aber nicht nur darum, den alten Traum einer gerechten Gesellschaft mithilfe der neuen grünen Welle auf der Ebene der Nationalstaaten zu erreichen. Der Umbau der Wirtschaft hin zu einer weltweit nachhaltigen Ökonomie ist nur möglich, wenn er sowohl für die gewöhnlichen Menschen im globalen Norden als auch den breiten Massen im globalen Süden einen positiven Wandel verspricht. «Eine bessere Ökonomie muss sich am guten Leben für alle orientieren», schreibt Carola Rackete.[34] Um weltweit soziale Gerechtigkeit herzustellen und zeitgleich die grassierende Armut zu überwinden, müssen allgemeine Güter wie «die Atmosphäre, die Polarregionen, die Weltmeere, das All, aber auch das Internet» allen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Genauso wichtig ist allerdings, dass gleichzeitig die sozialen Güter verbessert würden: «Gesundheitsversorgung oder Bildung, bezahlbares Wohnen und öffentlicher Nahverkehr.» Ein solches Wirtschaftssystem braucht klare Regeln. Rackete plädiert deshalb für ein «Kontrollgremium, das dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten werden und die Nutzung gerecht ist.»
Damit ein solches Gremium weltweite Durchsetzungskraft hat, braucht es allerdings den entsprechenden demokratischen Unterbau. Um die menschliche Zivilisation trotz der sich verschärfenden Klimaerwärmung zu bewahren, braucht es nicht nur bei der Produktion ein anderes Wirtschaftssystem. Es braucht auch «eine markante Änderung der Lebensgestaltung und der Konsumgewohnheiten», wie Ringger postuliert.[35]
Um dahin zu kommen, müssen wir aber über den «Elefanten in unseren Wohnzimmern sprechen», wie der deutsche Soziologe und Autor Harald Welzer sagt. Denn das Problem ist nicht die Not oder die Armut, sondern der Wohlstand. Während Durchschnitts-Schweizer*innen im «Turbokapitalismus» wie Maden im Speck leben, ist das aktuelle System «darauf angewiesen, dass Menschen ohne Unterlass neue Bedürfnisse entwickeln und dass es Wirtschaftszweige gibt, die diese neu entwickelten Bedürfnisse befriedigen.» Dass dies zum Kollaps führt, wird ausgeblendet: Jedes Produkt braucht Rohstoffe und Energie und richtet so Zerstörung an. «Hinterher muss der ganze Kram noch entsorgt werden. Über diesen Elefanten in all unseren Wohnzimmern sprechen wir nicht.» Um das System umzubauen, empfiehlt Welzer kleinere «konkrete Utopien». Zusammen könnten diese das grosse Ganze nachhaltig verändern. Allerdings rechnet er mit Widerstand bei der Umsetzung dieser konkreten Utopien: «Der Prozess, da hinzukommen, verläuft über Konflikte. Denn Menschen möchten ihre Besitzstände, ihre Gewohnheiten ungern freiwillig aufgeben. Aber Modernisierung bedeutet immer Konflikt.»[36]
Die Einschätzungen Welzers decken sich mit der Erkenntnis der Wirtschaftsprofessorin Irmi Seidl, die ebenfalls dafür plädiert, von einem einseitigen Wirtschaftswachstum wegzukommen: «Doch ‹Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass›, ist unrealistisch.» Es sei die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass es beim Umbau der Wirtschaft zu keiner Massenarbeitslosigkeit komme, sagt sie. Die deutsche Ökonomin leitet die Forschungseinheit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Sie weist auf Forschungsergebnisse hin, wonach mit reduzierter Arbeitszeit eine ökologische Entlastung einhergeht. Mehr Zeit für sich und die Familie zu haben, würde den meisten Menschen nicht nur an sich guttun, wir würden auch etwas weniger produzieren und hätten weniger Umwelt- und Gesundheitskosten, sagt Seidl.[37]
Mit ihrem Wunsch nach einer signifikanten Arbeitszeitverkürzung trifft sich Seidl nicht nur mit dem Niko Paech, sondern knüpft auch an einer Forderung an, welche die Arbeiter*innenbewegung seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert begleitet. Um die umweltverträgliche Transformation der Wirtschaft durchsetzen zu können, macht also eine breite Koalition der ökologischen und sozialen Bewegungen Sinn.
Der amerikanische Historiker und Autor Thomas Frank sagte im Hinblick auf die US-Präsidentschaftswahlen 2020, dass es «eine grosse Koalition aller Arbeiter*innen, unabhängig von Hautfarbe und Ethnie» brauchte, um die Wiederwahl Trumps zu verhindern. «Das ist der Weg, den Franklin Roosevelt ging, als er die Reformen des New Deal durchsetzte.» Um diese Koalition für einen Green New Deal zu gewinnen, ist es nötig, bei den realen Lebensbedingungen der Menschen anzusetzen. Und zwar jener Menschen, die nicht im Überfluss leben. Deshalb lohnt es sich, mit Frank einen Blick in die USA zu werfen, wo die chronischen Probleme, die das Leben von Millionen von Amerikaner*innen prekär machen, trotz der bis Anfang 2020 boomenden Wirtschaft noch immer existieren. «Sie können sich keine Medikamente leisten, sie müssen sich für einen Krankenhausaufenthalt verschulden oder verzichten angesichts dieser Aussicht ganz auf die Behandlung. Sie verzweifeln an den hohen Kosten für eine Ausbildung», sagte Frank, noch bevor das Corona-Virus die amerikanische Wirtschaft lahmlegte und Hunderttausende Menschen das Leben kostete. «Wenn man durch die früheren Industrieregionen des Mittleren Westens fährt, sieht man: Das Leben ist nicht dorthin zurückgekehrt. Die Einwohner spüren jeden Tag: Ihre Gesundheitsversorgung ist schlecht. Ihre Stadt geht vor die Hunde. Und sie wissen, dass ihre Kinder nicht zu den Gewinnern gehören werden, die an die guten Colleges gehen werden.»[38]
Mit graduellen Unterschieden waren auch in den reichen Ländern Europas ähnlich prekäre Verhältnisse bereits vor der Coronakrise sichtbar, egal ob in Deutschland, Frankreich oder Grossbritannien. Es waren die Auswirkungen der neoliberalen Politik, die auf Ronald Reagan und Margaret Thatcher zurückgingen und seit gut 40 Jahren das soziale Klima bestimmten. Das wirkte sich auch in der Schweiz aus: «Das verfügbare Einkommen nach Abzug von gestiegenen Mieten, Krankenkassenprämien und anderen Abgaben ging in den meisten Regionen für die Mehrheit zurück. Das Hamsterrad in der Arbeitswelt dreht und dreht, doch die halbe Bevölkerung hat nichts davon», analysierte der ehemalige Schweizer Preisüberwacher Rudolf Strahm.[39]
Den erbärmlichen Zustand der Welt zeigt der UNO-Bericht zur Ernährungssicherheit vom Juli 2019: Jeder zehnte Mensch auf der Erde leidet an Hunger. Rund 820 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen. Damit ist die Zahl der Hungernden das dritte Jahr in Folge angestiegen. Dabei ist für Frauen die Wahrscheinlichkeit, von Hunger betroffen zu sein, auf allen Kontinenten höher als jene für Männer.
Der UN-Report stellt fest, dass in Ostafrika fast ein Drittel der Bevölkerung unterernährt ist. Zu den Ursachen gehören Klimaextreme und Konflikte sowie die schleppende wirtschaftliche Entwicklung. Mit über 500 Millionen leben die meisten unterernährten Menschen aber in Asien, vor allem in südasiatischen Ländern. Über 250 Millionen Hungernde leben in Afrika und über 40 Millionen in Lateinamerika und in der Karibik. Insgesamt haben zwei Milliarden Menschen «keinen verlässlichen Zugang zu Nahrung». Knapp 150 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind wegen chronischer Mangelernährung unterentwickelt.[40]
Dass solche beschämenden und Zahlen nicht nötig wären, weiss der ehemalige UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, der Schweizer Sozialist Jean Ziegler. Denn der Welternährungsbericht, der die oben genannten Opferzahlen aufführt, sagt gleichzeitig, «dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Phase der Entwicklung ihrer Produktionskräfte problemlos zwölf Milliarden Menschen ernähren könnte.» Also etwa 50 Prozent mehr als die Weltbevölkerung heute ausmacht. «Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es keinen objektiven Mangel mehr. Das Problem ist nicht mehr die fehlende Produktion, sondern der fehlende Zugang zu Nahrung», hält Ziegler fest. Dass dennoch alle fünf Sekunden ein Kind unter zehn Jahren an Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen stirbt, sei bei einer vernünftigen Organisation und einer gerechten Weltordnung vermeidbar. Deshalb kommt der ehemalige Schweizer Nationalrat aus Genf zum Schluss: «Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet.» Hoffnung auf eine Änderung dieser skandalösen Zustände sieht Ziegler «im Aufstand des Gewissens, im demokratischen Widerstand, im radikalen Reformwillen der Zivilgesellschaft.»[41]
Die Zustände im industrialisierten Norden sind zwar nicht so erbärmlich wie in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Aber selbst in der reichen Schweiz lebt jeder zwölfte Mensch in Armut, verglichen mit dem allgemeinen Lebensstandard im Land. Das heisst: kein Geld für Schuhe, kein Geld für Ferien, kein Geld für einen Eintritt ins Freibad. Die Armut in der Schweiz nahm in den Jahren 2014 bis 2017 um rund 20 Prozent zu. Für den Anstieg der Armut findet der Soziologe und Armutsforscher Franz Schultheis klare Worte. «Das ist ein skandalöser Tatbestand.» Vor allem alleinerziehende Mütter, die Kinderbetreuung und Arbeit vereinbaren müssen, sind von Armut betroffen. Weil in der Schweiz die externen Betreuungsangebote für Kinder oft zu teuer und zu knapp vorhanden sind, können viele dieser Frauen nur die Teilzeit arbeiten. Unter Armut leiden in der Schweiz aber auch über 70 000 Kinder: «Häufig gibt es bei armutsbetroffenen Kindern in der Schweiz eine viel höhere Krankheitsquote. Die Kindheit, die von Armut betroffen wird, ist ganz besonderen verschiedenen Risiken ausgesetzt», sagt Schultheis.[42]
Trotzdem: In der Schweiz muss im 21. Jahrhundert kein Kind Hunger leiden, niemand muss unter Brücken schlafen. Und die Gesundheitsversorgung ist auch für Arme weitgehend gewährleistet. Das sieht in den grundsätzlich ebenfalls reichen Vereinigten Staaten der USA ganz anders aus: «Obdachlosigkeit, Hunger, Scham: In den USA sind 43 Millionen Bürger davon betroffen – doppelt so viele wie vor 50 Jahren. Es kann ganz schnell gehen: Krankheit, Jobverlust, schon ist man auf der Strasse», hiess es im November 2019 in einem Dokumentarfilm. In der strukturschwachen Bergbau-Region der Appalachen war es für die Einwohner*innen fast normal geworden, mit Lebensmittelkarten einkaufen zu gehen. Und wer seine Wohnung verliert, dem bleibt oft nichts anderes übrig, als im Auto zu leben. «In Los Angeles gibt es mittlerweile so viele Obdachlose, dass Hilfsverbände damit begonnen haben, kleine Holzhütten bauen, um ihnen ein Dach über dem Kopf zu bieten. Auch die Zahl obdachloser Kinder ist dramatisch gestiegen, 1,5 Millionen sind es mittlerweile – dreimal mehr als zur Wirtschaftskrise in den 30er-Jahren, der sogenannten Grossen Depression», lautete der Befund bereits Monate vor der Coronakrise.[43]
Und dafür ist nicht nur Trump verantwortlich. Bereits im August 2014, als noch Barack Obama das Land regierte, warnte der amerikanische Milliardär Nick Hanauer: «Die Kluft zwischen Habenden und Nicht-Habenden reisst immer schneller auf.» Die Steuererleichterung der Reichen und Superreichen, seit Reagan das Dogma der Republikaner und von Demokraten wie Bill Clinton oder Obama nicht infrage gestellt, hat nur einer schmalen Elite Vorteile gebracht. Der Mittelstand fiel immer stärker zurück und verfügte über immer weniger reales Einkommen. Zur gleichen Zeit, in der Menschen wie Hanauer «jenseits der wildesten Träume aller Plutokraten der Geschichte reich» wurden, blieben 99 Prozent der Einwohner*innen des Landes immer weiter zurück. «Es gibt kein Beispiel in der Geschichte der Menschheit, bei dem ein solch immenser Reichtum angehäuft wurde, und das schliesslich nicht die Mistgabeln auftauchen liess», schrieb Hanauer, lange bevor sich Donald Trump daran machte, die amerikanische Gesellschaft noch stärker zu spalten und die Reichen mit erneuten massiven Steuererleichterungen noch reicher zu machen. Milliardär Nick Hanauer war aber nicht nur in der Analyse stark. Er wusste auch, wie das Wirtschaftssystem wieder ein wenig gerechter würde: mit der Erhöhung des Mindestlohns.[44]
Damit befand sich der amerikanische Multimilliardär mit den Schweizer Gewerkschaften in Einklang, die sich schon lange und teilweise erfolgreich für die Anhebung der Mindestlöhne engagieren. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) unterstützt darüber hinaus aber auch die jugendlichen Klima-Aktivist*innen der Fridays for Future-Bewegung.[45] Denn für die Gewerkschaften ist es ein existenzielles Anliegen, sich weltweit für griffige ökologische Massnahmen einzusetzen. Nicht nur weil auch die Schweiz von der Klimaerwärmung stark betroffen ist. Dem SGB geht es insbesondere um die sozialen Auswirkungen der Klimakrise: «Besonders betroffen von den negativen Folgen des Klimawandels werden vor allem die Schwachen, die Menschen mit niedrigen Einkommen sein – sowohl global gesehen wie auch bei uns.» Darum setzen sich die Gewerkschafter*innen dafür ein, dass die Massnahmen gegen den Klimawandel sozialverträglich sind: «Der Werkplatz und der Arbeitsmarkt Schweiz können nur mit guten Arbeitsbedingungen und einer solidarisch finanzierten Energiewende gesichert werden.» Was für die Schweiz gilt, ist auch global richtig.
Das sieht auch die internationale Klimabewegung so. Stellvertretend dafür steht in der Klimacharta der Jugendlichen, die in der Schweiz die Fridays for Future-Demos organisieren: «Wir fordern Klimagerechtigkeit.» Dabei geht es um Massnahmen, «die materiell und finanziell benachteiligte Menschen nicht zusätzlich belasten.» Das soll durch das Verursacherprinzip sichergestellt werden: Wer Treibhausgasemissionen und die Umweltverschmutzung verursacht und davon profitiert, wird zur Verantwortung gezogen. «Sie müssen Schäden vorbeugen, beziehungsweise bereits entstandene Schäden beheben.» Dieses Prinzip soll nicht nur generationenübergreifend, sondern auch global gelten.[46]
Der Berner Geografie-Professor Peter Messerli hat zusammen mit 15 Kolleg*innen im Auftrag der UNO den ersten unabhängigen Weltnachhaltigkeitsbericht verfasst. In einem Interview sagte er bereits ein halbes Jahr bevor Greta Thunberg ihren Schulstreik fürs Klima begann, dass wir alle zehn Jahre den weltweiten C02-Ausstoss halbieren müssten, um den Klimawandel zu stoppen. Einer nachhaltigen Entwicklung stehe aber noch ein zweites, riesiges Problem im Weg, die Ungleichheit in der Welt. «Sie hat vor allem innerhalb der Länder extrem zugenommen, und wir haben keine Rezepte dagegen.» Für die Entwicklung der Menschheit seien die nächsten zehn Jahre «absolut entscheidend», sagt Messerli. Da die Vernetzung und die Verbindung der Welt in den letzten Jahren exponentiell zugenommen hat, muss man die Spielregeln anpassen, weil die Menschen «nicht nur einen sicheren, sondern auch einen gerechten Platz auf der Welt» brauchen. Und dafür trägt auch die kleine Schweiz eine grosse Verantwortung: «Wer, wenn nicht die Schweiz, kann es sich leisten, den Mut zu haben und die Innovation zu entwickeln, um die Welt neu zu entwerfen?», fragt der Professor für Nachhaltige Entwicklung. Und er erinnert daran, dass fast 90 Prozent der Konsumgüter, welche die Einwohner*innen der Schweiz verbrauchen, ganz oder teilweise im Ausland produziert werden. Darin zeigt sich nicht nur die Abhängigkeit der Schweiz, sondern auch ihre internationale Verantwortung.[47] In anderen reichen Staaten des globalen Nordens sind die entsprechenden Zahlen vielleicht nicht ganz so extrem. Hoch sind sie allemal.
Doch die Schweiz trägt nicht nur politische und gesellschaftliche Mitverantwortung für die Verhältnisse in der Welt. Wie sieht es mit ihrer ökologischen Verantwortung aus? Der Klima-Fussabdruck der Schweiz ist «eigentlich doppelt so gross ist, wie der Inlandwert glauben lässt», sagt Reto Knutti, der führende Klimawissenschafter der Schweiz. Die Schweiz will zwar offiziell bis in 30 Jahren klimaneutral sein und unter dem Strich keine Treibhausgas-Emissionen mehr ausstossen und so mithelfen, die globale Klimaerwärmung auf maximal 1.5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.[48] Dennoch ist die Schweiz noch lange nicht auf Kurs, wie ETH-Professor Knutti ausführt. Denn während die Schweiz im Gebäudesektor Fortschritte erzielt hat, gingen die Verkehrsemissionen nicht zurück. «Deutlich zugenommen haben die ‹grauen› Emissionen, also Emissionen, die durch Güter und Dienstleistungen, die im Ausland für uns produziert und in der Schweiz konsumiert werden.» Die Schweiz verlagert einfach einen grossen Teil der eigenen Emissionen ins Ausland. Auch bei den in der Schweiz konsumierten Nahrungsmitteln ist «über die Hälfte des Treibhausgasausstosses auf importierte Produkte zurückzuführen». Für eine nachhaltige Klimapolitik ist die Schweiz also gewiss kein Musterland. Dafür bräuchte es klare Rahmenbedingungen sowie einen klaren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Gestaltungswillen.[49]
Wenn also im Folgenden aufgezeigt wird, welche Vorteile das politische System der Schweiz für eine globalen Demokratie bietet, geht es nicht darum, die herrschende Politik der Schweiz als Vorbild oder Massstab für künftiges Handeln zu propagieren.
Zusammengefasst:
Die ökologischen und sozialen Probleme hängen eng zusammen.
Die existentiellen globalen Probleme können nur global gelöst werden.
Die nationalen Regierungen und internationalen Organisationen sind unfähig, die Probleme zu lösen.
Das herrschende Wirtschaftssystem muss radikal umgebaut werden, wenn der Klimawandel begrenzt werden soll.
Dass ein neues System demokratisch und nachhaltig ökologisch sein muss, liegt auf der Hand. Wobei die grösste Schwierigkeit nicht darin besteht, eine globale Demokratie zu skizzieren. Die schwierigste Aufgabe wird es sein, den politischen und wirtschaftlichen Umbau so zu gestalten, dass das herrschende System nicht unkontrolliert zusammenbricht und die Welt in Schutt und Asche zerfällt. Denn die ersten Opfer eines solchen Crashs würden jene sein, deren Leben bereits heute vor allem aus Entbehrungen besteht.
Deshalb braucht es für den politischen Umbau nicht nur eine breite Basisbewegung, welche die nötigen Mehrheiten beschafft, um die politischen Umwälzungen weltweit zu erzwingen. Wir brauchen auf der anderen Seite auch hellwache und demokratisch gesinnte Persönlichkeiten, die dafür sorgen, dass der Übergang geordnet und ohne fundamentale Wirtschaftskrise oder Kriegswirren vonstattengeht. Angesichts der Figuren, die im Jahr 2020 in den USA, in Russland, Brasilien oder Australien an der Macht sind, könnte man das als unmöglich bezeichnen.
Dass aber auch scheinbar unbewegliche Machthaber grundsätzlich zu neuen Einsichten fähig sind, hat das Beispiel von Glasnost und Perestrojka in der damaligen Sowjetunion gezeigt. Als Mitte der 1980er-Jahre der neue Generalsekretär der allmächtigen Kommunistischen Partei der Sowjetunion den Umbau des überholten Sowjetsystems ankündigte, konnte sich niemand vorstellen, dass diese Atommacht nach fast 50 Jahren Kaltem Krieg in wenigen Jahren praktisch ohne Blutvergiessen einem neuen System Platz machen würde. Es geht hier nicht darum, zu werten, was das neue System den Russ*innen und ihren damaligen Verbündeten unter dem Strich gebracht hat. Wichtig ist die Erkenntnis, dass es möglich ist, auch innerhalb von wenigen Jahren ein veraltetes System umzubauen, wenn der Wille dafür vorhanden ist.
Und im Gegensatz zur Sowjetunion haben die Gesellschaften in den erwähnten demokratisch verfassten Ländern die Möglichkeit, ihren Politiker*innen Beine zu machen oder sie abzuwählen.
Dass die Klimaerwärmung helfen kann, den nächsten Schritt in der Evolution der Menschheit zu machen, hat der deutsche Historiker Philipp Blom aufgezeigt. In seiner «Geschichte der Kleinen Eiszeit» weist er nach, wie die letzte grosse Klimaveränderung im 16. Jahrhundert den Boden für die Aufklärung bereitete, ohne die wir nicht über Menschenrechte oder Demokratie sprechen würden. Im 17. Jahrhundert waren Menschenrechte noch äusserst «gefährliche und moralisch skandalöse Ideen». Dass ein Mann besser war als eine Frau oder ein Christ besser als ein Heide, wurde nicht hinterfragt. «Die Idee von der Gleichheit der Menschen hat an den moralischen Grundfesten der Gesellschaft gerüttelt», sagt Blom.
Nutzen wir also die neue Klimaerwärmung, um die heute überholten Grundsätze der Gesellschaft positiv zu verändern. Dass die Gedanken dazu als «gefährlich und moralisch skandalös» eingestuft werden können, nehmen wir gerne in Kauf.
Jean Paul «Bluey» Maunick ist Profimusiker und kein Politiker. Deshalb hat er sich nicht gefragt, ob sein Statement politisch korrekt oder gar gefährlich war. «Bluey» hat einfach gesagt, was er denkt und was er an den unzähligen Konzerten von Incognito rund um den Globus erlebt hat: «We are one nation – we are one family.»
Es ist Zeit, diese Erkenntnis politisch umzusetzen. Zeit, die Welt so zu organisieren, dass wir als Menschheit anständig zusammenleben können. Zeit, eine globale Demokratie aufzubauen. Nutzen wir die Klimakrise als Chance. Sorgen wir dafür, dass die Menschen die Angst überwinden.
Wenn es uns gelingt, die Menschen wieder zum Träumen zu bringen, schaffen wir es, eine Welt aufzubauen, in der die ganze Menschheit in Freiheit, Gleichheit und Solidarität leben kann.
Bevor solche Träume in die Tat umgesetzt werden können, gilt es, der Realität ins Auge zu blicken. Dazu dient das nächste Kapitel.
1 «Wormser Zeitung», Worms, 20. August 2016 ↵
2 www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm ↵
3 www.aargauerzeitung.ch/schweiz/jean-ziegler-spekulanten-toeten-millionen ↵
4 www.srf.ch/news/international/guterres-neujahrsbotschaft-die-welt-steht-in-flammen-die-uno-ist-ohnmaechtig ↵
5 www.bluewin.ch/de/news/schweiz/greta-thunberg-das-haus-brennt-206113.html ↵
6 www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20191121IPR67110/europaisches-parlament-ruft-klimanotstand-aus ↵
7 www.derbund.ch/ausland/europa/unoklimakonferenz-geht-in-die-verlaengerung/story/14527760 ↵
8 www.srf.ch/news/schweiz/klima-laenderrating-schweiz-faellt-um-sieben-plaetze-zurueck ↵
9 www.derbund.ch/wirtschaft/duestere-prognose-die-maechtigen-der-welt-fuerchten-sich-vor-umweltrisiken/story/18714198 ↵
10 www.derbund.ch/schweiz/standard/traenen-bei-den-klimaaktivisten-raunen-im-gerichtssaal/story/10342973 ↵
11 «Der Bund», Bern, 25. September 2020 ↵
12 www.derbund.ch/sport/tennis/federer-lobt-greta/story/17803146 ↵
13 Rackete, Carola: Handeln statt Hoffen, München, 2019, Seite 10 ↵
14 «Sonntagsblick», Zürich, 8. Dezember 2019 ↵
15 Daellenbach, Ruth (Hrsg.): Reclaim Democracy – Die Demokratie stärken und weiterentwickeln, Zürich, 2019, Seite 35 ff ↵
16 Ringger, Beat: Das Systemchange Klimaprogramm, Zürich, 2019, Seite 11 ↵
17 aao, Seite 18 ↵
18 Rackete, Carola: Handeln statt Hoffen, München, 2019, Seite 129 ↵
19 aao, Seite 42 ↵
20 «NZZ am Sonntag», Zürich, 1. Juli 2018 ↵
21 «Der Bund», Bern, 28. Dezember 2019 ↵
22 «Sonntagsblick», Zürich, 10. November 2019 ↵
23 «Der Bund», Bern, 28. Dezember 2019 ↵
24 «Blick», Zürich, 20. Januar 2020 ↵
25 www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/streitgespraech-das-wirtschaftswachstum-stoesst-an-seine-grenzen ↵
26 Rifkin, Jeremy: The Green New Deal, e-book, New York City, 2019 ↵
27 Rifkin, Jeremy, aao, Seite 59 ↵
28 Rifkin, Jeremy, aao, Seite 28 ↵
29 Rifkin, Jeremy, aao, Seite 14 ↵
30 Rackete, Carola: Handeln statt Hoffen, München, 2019, Seite 123 ↵
31 «Der Bund», Bern, 14. Januar 2019 ↵
32 Rifkin, Jeremy: The Green New Deal, e-book, New York City, 2019, Seite 52 ↵
33 Ringger, Beat: Das Systemchange Klimaprogramm, Zürich, 2019, Seite 27 ↵
34 Rackete, Carola: Handeln statt Hoffen, München, 2019, Seite 124 ↵
35 Ringger, Beat: Das Systemchange Klimaprogramm, Zürich, 2019, Seite 26 ↵
36 www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/soziologe-harald-welzer-ueber-den-elefanten-in-unseren-wohnzimmern-sprechen-wir-nicht ↵
37 «Sonntagsblick», Zürich, 22. Dezember 2019 ↵
38 «Der Bund», Bern, 6. Januar 2020 ↵
39 «Der Bund», Bern, 28. Dezember 2019 ↵
40 www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2019/un-report-jeder-neunte-mensch-hungert/196298 ↵
41 www.welthungerhilfe.de/aktuelles/gastbeitrag/hunger-ist-der-absolute-skandal-unserer-zeit ↵
42 www.srf.ch/news/schweiz/armutsquote-stark-gestiegen-jede-zwoelfte-person-in-der-schweiz-ist-arm ↵
43 www.dw.com/de/armut-in-amerika/g-17392168 ↵
44 «Der Bund», Bern, 27. August 2014 ↵
45 www.sgb.ch/themen/service-public/detail/dem-klima-und-der-klimajugend-zur-seite-stehen ↵
46 https://klimacharta.ch/charta ↵
47 «NZZ am Sonntag», Zürich, 25. Februar 2018 ↵
48 www.srf.ch/news/schweiz/bundesrat-verschaerft-klimaziel-wir-duerfen-keine-zeit-mehr-verlieren ↵
49 «NZZ am Sonntag», Zürich, 20. Oktober 2019 ↵