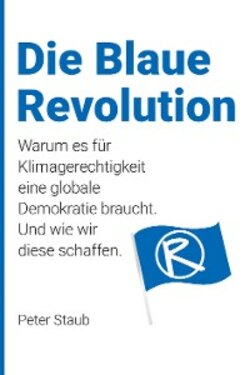Читать книгу Die Blaue Revolution - Peter Staub - Страница 7
2 Die Zeit drängt – die Klimakrise verschärft sich
ОглавлениеIn den ersten Monaten des Jahres 2020 häuften sich die Nachrichten über ungewöhnliche Wetterphänomene. Nur zwei Beispiele: Der Januar 2020 war seit Beginn der Aufzeichnungen 1981 der wärmste erste Monat des Jahres. Nicht nur in Europa, sondern weltweit.[1] Und mit 18,3 Grad wurden in der Antarktis die höchsten Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen.[2]
Dass es höchste Zeit war, zu handeln, war allen klar, die sich ernsthaft mit dem Thema Klimaerwärmung befassten. So sagte beispielsweise der Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg, der Grüne Winfried Kretschmann, der sich selbst in der politischen Mitte verortet, dass er manchmal Panikattacken habe, wenn er Berichte lese, «wie wir uns den Kipppunkten nähern, an denen der Klimawandel unumkehrbar wird.» Etwa als er eine Dokumentation über die Antarktis sah: «Es ist der grösste Eiskörper, 90 Prozent des Eises weltweit. Wenn man gesehen hat, wie dramatisch der Meeresspiegel steigt und die Erderwärmung in das filigrane Artensystem eingreift, dann denkt man schon: Schaffen wir das noch?» Der Permafrostboden taut viel schneller, als dies die Wissenschaft erwartet hat. «Wir haben noch zehn Jahre. Wenn es kippt, ist es gekippt, dann ist es unumkehrbar. So eine Situation haben wir normalerweise in der Politik nicht.»[3]
Die Dringlichkeit des Problems war mittlerweile so breit abgestützt, dass sogar das erzkapitalistische World Economic Forum in Davos im Januar 2020 die Nachhaltigkeit zum Leitthema seiner Tagung machte. Die Schweizerische Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga warnte in ihrer Eröffnungsansprache vor einer drohenden Klimakatastrophe. Sie sprach von den riesigen Feuersbrünsten, die im Vorjahr im Amazonas und in Australien Zehntausende von Quadratkilometern verbrannt hatten. Sie redete über die desaströsen Auswirkungen auf die Menschen und darüber, wie das ökologische Gleichgewicht aus den Fugen geriet.
Die Bundesrätin mit sozialdemokratischem Parteibuch sprach auch den dramatischen Verlust der Artenvielfalt weltweit an. Sie verglich die Biodiversität mit dem Pariser Eiffelturm: «Wenn man pro Tag eine Schraube aus dem Turm entfernt, geschieht erst zwar nichts. Früher oder später bricht allerdings der ganze Turm zusammen.»[4]
Einen konkreten Plan, wie die Schweiz beim Klimaschutz oder bei der Wiederherstellung einer lebendigen Biodiversität vorwärtskommen könnte, legte die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation allerdings nicht vor. Dabei wäre das dringend nötig gewesen, hinkte die Schweiz ihren eigenen Ansprüchen doch weit hinterher.
Die Schweiz erhebt zwar seit 2008 eine Lenkungsabgabe auf fossile Brennstoffe wie Heizöl oder Erdgas, die zum Heizen gebraucht werden. Davon waren die Treibstoffe für den motorisierten Verkehr ausgenommen. Dabei entfielen auf diesen motorisierten Verkehr, ohne den Flugverkehr mitzurechnen, in der Schweiz rund ein Drittel der CO2-Emissionen. Deshalb wurden hier keine Fortschritte erzielt.[5] Das im Herbst 2020 verabschiedete neue CO2-Gesetz sieht zwar einige Verschärfung vor, «trotzdem reicht das neue Gesetz alleine absolut nicht aus, um der Klimakrise wirksam zu begegnen», wie das die Grünen richtig erkannten.[6]
Am Tag nach der Schweizer Bundespräsidentin hatte auch die damals 17-jährige Greta Thunberg ihren Auftritt am WEF. Sie wies darauf hin, dass trotz der weltweiten Demonstrationen auf der politischen Ebene faktisch nichts getan wurde, um den Klimaschutz zu stärken.
Die jungen Vertreterinnen der Klimabewegung Fridays for Future kritisierten die Ergebnisse der WEF-Tagung am Ende scharf. So sagte Thunberg, dass die Forderungen der Klimajugend «komplett ignoriert» worden seien. Auch Vanessa Nakate aus Uganda oder die Schweizer Aktivistin Loukina Tille warfen dem WEF vor, in einer «geschlossenen Blase» zu leben und sich in einer falschen Sicherheit zu wiegen.[7]
Aber nicht nur die Manager*innen blieben passiv. Bei den Regierungen zeigte sich das Versagen noch viel deutlicher. Dabei hatten die meisten von ihnen das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, das verbindliche Ziele gegen die Klimaerwärmung vorsah. Und doch unternahmen sie so wenig, um diese bescheidenen Ziele zu erreichen, dass sie noch nicht einmal darüber sprechen wollten. Bis am 9. Februar 2020 hätten die Unterzeichnerstaaten des Paris-Abkommens ihre verbesserten Klimaziele einreichen sollen; nur gerade 3 von 184 Staaten hielten diese Frist ein.
Der Hintergrund: Das Pariser Abkommen sah eine regelmässige Steigerung der von den einzelnen Ländern festgelegten Klimaschutzbeiträge vor, weil die bisher zugesagten Beiträge für das Erreichen der Klimaziele nicht ausreichten. Bei der 26. Weltklimakonferenz der UNO, die ursprünglich im Herbst 2020 in Glasgow (COP26) geplant war, wegen der Corona-Krise aber verschoben wurde, sollten die Staaten detaillierter aufzeigen, was sie unternehmen wollten, um die Erderwärmung auf 1,5 bis 2 Grad zu begrenzen. Diese neuen Ziele hätten sie spätestens neun Monate vor der COP26 ankündigen müssen. Doch an diese Frist hielten sich bloss die Marshallinseln, Surinam und Norwegen. Und diese verursachten gemäss des US-amerikanischen Thinktanks World Resources Institute gerade mal einen Tausendstel der weltweiten Treibhausgasemissionen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Regierungen deren Länder, die für die restlichen 99,9 Prozent des CO2-Ausstosses verantwortlich waren, sich nicht um ihre eigenen Vereinbarungen kümmerten. Es reicht also nicht, einfach mit dem Finger auf den ökologisch unterbelichteten Präsidenten der USA zu zeigen, der das Klimaabkommen von Paris gekündigt hat. Wie etwa der Klimaökonom Reimund Schwarze vom Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung richtig erkannte, hat «das Paris-Abkommen ein riesiges Vollzugsdefizit».[8]
Dabei rennt der Welt die Zeit davon. Das sagen nicht nur Klima-Aktivist*innen, sondern auch Wissenschaftler*innen. In einer aufsehenerregenden gemeinsamen Erklärung warnten Anfang November 2019 mehr als 11 000 Forschende aus 153 Ländern vor einem weltweiten «Klima-Notfall». Ohne grundlegende Veränderung sei «unsägliches menschliches Leid» nicht mehr zu verhindern. Als Wissenschaftler*innen hätten sie die «moralische Pflicht, die Menschheit vor jeglicher katastrophalen Bedrohung zu warnen», sagte beispielsweise Co-Autor Thomas Newsome von der University of Sydney. Aus den vorliegenden Daten werde klar, dass wir einem Klima-Notfall gegenüberstehen. «Obwohl global seit 40 Jahren verhandelt wird, haben wir weitergemacht wie vorher und sind diese Krise nicht angegangen», konstatierte Ökologie-Professor William Ripple, der die Gruppe der Wissenschaftler mit seinem Kollegen Christopher Wolf von der Oregon State University in den USA anführte. Der Klimawandel beschleunige sich dabei noch schneller als viele Wissenschaftler erwartet hätten.
Die Forscher forderten in ihrem Beitrag im Fachjournal «Bioscience» Veränderungen vor allem in sechs Bereichen:
Umstieg auf erneuerbare Energien
Reduzierung des Ausstosses von Treibhausgasen wie Methan
Schutz von Ökosystemen wie Wälder und Moore
Weniger Konsum von tierischen Produkten
Nachhaltige Veränderung der Weltwirtschaft
Eindämmung des Anwachsens der Weltbevölkerung
Obwohl sich die Wissenschaftler*innen über das zunehmende Umweltbewusstsein und die Proteste der Fridays for Future-Bewegung freuten, machten sie auch klar, dass noch viel mehr passieren muss. Und sie erklärten sich bereit, «bei einem gerechten Wandel hin zu einer nachhaltigen und gleichberechtigten Zukunft zu helfen».[9] Bisher erhielten die über 11 000 Wissenschaftler von der Weltgemeinschaft allerdings keine konkreten Möglichkeiten, ihre Bereitschaft in die Tat umzusetzen.
Bereits zwei Monate vor dem weltweiten Aufschrei der Forscher*innen zeigte ein Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), des Weltklimarates der UNO, dass das Eis schneller schwand, die Meeresspiegel höher stiegen und die Ozeane stärker versauerten als vorhergesehen. Die deutsche Wissenschaftsjournalistin Alina Schadwinkel wusste schon vorher, dass die Ozeane eine wichtige Rolle spielten, um die weltweite Temperatur zu regeln. Die Dimension hingegen überraschte sie: Die Ozeane hatten rund 90 Prozent der Hitze aufgenommen, die seit 1970 durch das von Menschen produzierte CO2 verursacht worden war. Doch lange könne das die Ozeane nicht mehr durchstehen, wie der IPCC dokumentierte. Die Autor*innen des Berichts gingen von zwei Szenarien aus. Das erste Modell, das Paris-Agreement-Szenario, stellte den besten Fall dar, wonach die globale Temperatur bis ins Jahr 2100 «nur» um 1,6 Grad Celsius steigen würde. Das zweite Modell ging von der realistischeren Einschätzung aus. Im Business-as-usual-Szenario würde die globale Erwärmung bereits im Lauf des 21. Jahrhunderts die Zwei-Grad-Marke durchbrechen. Bis ins Jahr 2100 könnte die weltweite Durchschnittstemperatur um bis zu 4,3 Grad steigen.
Wie sich die Szenarien auswirken, zeigt sich am Anschaulichsten beim Anstieg des Meeresspiegels. Weil das Eis an den Polen schmilzt, stieg der Meeresspiegel seit 1993 um jährlich 3,3 Millimeter. Zuletzt erfolgte dieser Anstieg schneller als erwartet. Gemäss Schadwinkel dürfte der Anstieg künftig «noch mal höher ausfallen.» Nach dem zweiten, realistischeren Szenario des IPCC könnte das Wasser bis ins Jahr 2100 im globalen Durchschnitt um über einen Meter ansteigen. Ein halber Meter könnte es im optimistischeren Paris-Agreement-Szenario sein.
Dabei liegen die Klima-Forscher*innen bei ihren Prognosen wohl unter den tatsächlichen Veränderungen. Denn unterdessen steigt der Meeresspiegel doppelt so schnell wie am Ende des 20. Jahrhunderts, «und das wird sich weiter beschleunigen, wenn Treibhausgasemissionen nicht drastisch verringert werden», sagt der deutsche Meereswissenschaftler Hans-Otto Pörtner, der am IPCC-Sonderbericht mitgeschrieben hat. Die Rekordtemperaturen in der Antarktis vom Januar 2020 waren ein deutlicher Hinweis, welche Folgen der Rückgang des Eises in der Antarktis und in Grönland zeitigt.
Dass sich der Meeresanstieg global unterschiedlich auswirkt, ist unbestritten. «Flache Koralleninseln und flache Küstenstaaten wie Bangladesch, die nur wenige Meter über dem Meer liegen und nur wenig finanzielle und räumliche Schutzmöglichkeiten haben, werden vor allem vor den zunehmenden Wellendynamiken und Sturmintensitäten an die Grenzen ihrer Anpassungsfähigkeit und Bewohnbarkeit kommen», sagte Beate Ratter, IPCC-Autorin und Professorin für Geographie an der Universität Hamburg. Falls der Meeresspiegel um einen Meter steigt, werden rund 20 Prozent von Bangladesch überschwemmt. 30 Millionen Menschen wären unmittelbar davon betroffen.
Mumbai, Shanghai, New York, Miami, Bangkok, Tokio, Jakarta, Barcelona oder Marseille – an den Küsten der Erde leben rund 1,9 Milliarden Menschen. Rund 380 Millionen davon leben weniger als fünf Meter über dem Meeresspiegel. Wenn der Meeresspiegel auch bloss um einen halben Meter steigt, kann das allein in den 20 am meisten bedrohten Hafenstädten der Welt Kosten von rund 27 Billionen US-Dollar verursachen.[10]
Wie sehr die Ozeane das von den Menschen produzierte CO2 absorbierten, zeigte Mitte Januar 2020 eine neue Studie noch deutlicher. Ein Team von 14 Wissenschaftler*innen aus elf Instituten verschiedener Länder publizierte seine Ergebnisse im Fachjournal «Advances in Atmospheric Sciences». Darin belegten sie, dass die vergangenen zehn Jahre die höchsten Temperaturen der Meere seit Mitte des letzten Jahrhunderts brachten. Und sie wiesen auf die Folgen dieser Erwärmung hin: Wirbelstürme und heftige Niederschläge, dazu Sauerstoffarmut, Schäden für Fische und andere Lebewesen in den Meeren. Um zu zeigen, wie gigantisch die Wärme-Energie war, welche die Ozeane in den letzten 25 Jahren absorbierten, machten die Forscher*innen Vergleich: Die Menge entsprach der Energie von 3,6 Milliarden Atombomben von der Grösse der Bombe von Hiroshima.[11]
Praktisch gleichzeitig publizierte auch die amerikanische Unternehmensberatungsfirma McKinseys ein Szenario zum Klimawandel. McKinsey mit seinen weltweit rund 30 000 Mitarbeiter*innen ist kein systemkritisches Unternehmen, eine versteckte politische Agenda kann also ausgeschlossen werden. Dennoch befürchtet McKinsey Ernteausfälle, überflutete Flughäfen und ausbleibende Touristen. McKinsey sieht die Folgen der Erderwärmung für die Volkswirtschaften als verheerend an. Geschehe nichts, könne der Klimawandel «Hunderte Millionen Menschenleben, Billionen von Dollar an Wirtschaftskraft sowie das physische und das natürliche Kapital der Welt gefährden», prognostizierten die Berater von McKinsey in ihrer Studie «Climate Risk and Response». Darin analysierte das McKinsey Global Institute die Folgen des Klimawandels für 105 Staaten in den kommenden 30 Jahren. Für ihre Prognosen gingen die Autor*innen von der bisher realistischen Annahme aus, dass die CO2-Emissionen weltweit weiter steigen, da nennenswerte Massnahmen ausbleiben.
Von den volkswirtschaftlichen Folgen der Klimakrise wird besonders Indien betroffen sein, da dort ungefähr die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts unter freiem Himmel erwirtschaftet wird. Weil Hitze und Luftfeuchtigkeit zunehmen, wird diese Arbeit immer öfter unerträglich. Das könnte Indien bis 2030 bis 4,5 Prozent an Wirtschaftsleistung kosten. Doch Indien ist nicht allein, besonders betroffen sind auch Länder wie Pakistan, Bangladesch oder Nigeria. Falls die CO2-Emissionen weiter ansteigen, werden im Jahre 2030 gegen 360 Millionen Menschen in Regionen mit tödlichen Hitzewellen leben; bis 2050 könnte die Zahl bis auf 1,2 Milliarden wachsen.
Konsequenzen hat die Klimaerwärmung aber auch in anderen Regionen. Bis ins Jahr 2050 werden auch der Tourismus und die Lebensmittelproduktion am Mittelmeer leiden; das Klima in Marseille wird jenem von Algier von heute entsprechen. Die Gefahr durch Wirbelstürme und Flutwellen könnte den Wert von Immobilien im US-Staat Florida um 30 Prozent reduzieren. Die Erwärmung der Ozeane wird den Fischfang um rund acht Prozent verringern und die Lebensgrundlage von 650 bis 800 Millionen Bürgern weltweit beeinträchtigen. Und weil ein Viertel der wichtigsten 100 Flughäfen weniger als zehn Meter über dem Meeresspiegel liegen, werden diese ernsthaften Gefahren durch Flut und Sturm ausgesetzt sein, heisst es in der McKinsey-Studie.[12]
Forscher*innen und Wirtschaftsfachleute reden in ihren Untersuchungen und Studien zwar vom worst case, wenn sie davon ausgehen, dass sich kein wirksamer Klimaschutz durchzusetzt. Dabei ist der schlimmste Fall noch viel schlimmer. Und er ist die Realität.
Der worst case ist nicht, dass es beim bisherigen CO2-Ausstoss bleibt. Der schlimmste Fall ist, dass der CO2-Ausstoss weiter massiv ansteigt. Die globalen Treibhausgas-Emissionen stiegen in den letzten zehn Jahren um 1,5 Prozent jährlich. Deshalb wurde 2018 ein neuer Höchstwert erreicht. Deshalb wird die Menge Treibhausgase, die reduziert werden muss, immer grösser statt kleiner. Ende November 2019 veröffentlichte das Umweltprogramm der UNO (Unep) den «Emission Gap Reports». Das kollektive Versagen, das Klima zu schützen, «verlangt nun eine starke Reduktion der Emissionen in den nächsten Jahren», sagte die Unep-Direktorin Inger Andersen.[13]
So alt diese Forderung war, erhört wurde sie nicht. Im Gegenteil, das Wachstum des CO2-Ausstosses wird vorerst weitergehen. Es gibt keinen weltweiten Plan, den Neubau von Kohlekraftwerken zu verbieten oder die Erschliessung von neuen Öl- oder Erdgas-Feldern innerhalb nützlicher Frist zu stoppen. Dabei ist der Fall klar: Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dürfte die Menschheit gemäss Weltklimarat insgesamt maximal noch 580 Gigatonnen CO2 produzieren, um spätestens bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu werden. Doch eine Studie, die im Juli 2019 im Fachmagazin Nature veröffentlicht wurde, zeigte, dass allein die bereits existierenden Verbrennungskraftwerke – Kohle, Öl und Gas – mit 658 Gigatonnen CO2 weit mehr Kohlendioxid ausstossen werden, wenn sie wie geplant weiter betrieben werden.[14]
Und es wird noch viel schlimmer.
Obwohl die Europäische Union Mitte Januar unter Propaganda-Getöse Tausend Milliarden Euro Investitionen in einen «Green Deal» ankündigte, um die EU bis ins Jahr 2050 klimaneutral zu machen[15], stimmte das EU-Parlament einen Monat später für eine von der EU-Kommission vorgelegte Liste mit 32 Gas-Infrastrukturprojekten. Für die Grünen war dieser Entscheid «eine Schande», weil er den Green Deal der EU untergrabe und mithelfe, den Planeten weiter aufzuheizen. Auch das Climate Action Network kritisierte den Entscheid: «Diesen Gasprojekten Priorität und Geld zu geben, bedeutet, Europas Zukunft über die nächsten 40 bis 50 Jahre in Gasabhängigkeiten zu zementieren und bis zu 29 Milliarden Euro an EU-Steuergeldern in unnütze Anlagen zu verschwenden.»[16]
Weltweit sieht es nicht besser aus. Im Oktober 2018 befanden sich über 1300 neue Kohlekraftwerke in Planung. Zudem planten mehr als die Hälfte der 746 Kohlekraftwerksbetreiber weltweit, ihre Anlagen zu erweitern. In rund 60 Staaten trieben Unternehmen und Investoren den Bau von Kohlekraftwerken voran. Über 200 Unternehmen bauten ihren Kohleabbau aus. Das publizierte die Global Coal Exit List, die von einer Gruppe von 28 Nichtregierungs-Organisationen geführt wird. Dabei war nicht der Energiehunger der Industrie oder der Bevölkerung für den Bau der neuen CO2-Schleudern entscheidend. Nein, es waren grössten Teils die Kohleminenbesitzer selbst, die ihre Kohle verfeuern wollten, um daraus Profit zu schlagen.[17] Und keine Regierung war im Jahr 2020 bereit, ihnen den Riegel zu schieben. Selbst das reiche Deutschland will erst im Jahr 2038 aus der Kohle aussteigen. «Die Inbetriebnahme eines neuen Kohlekraftwerks und das weitere Abbaggern von Dörfern lässt sich weder national noch international erklären», sagte Bundestags-Fraktionschef der Grünen Anton Hofreiter zu Recht.[18]
Der Klimawandel ist unterdessen so weit fortgeschritten, dass er nicht mehr bloss in Langzeitvergleichen, sondern gar im täglichen Wetter nachweisbar ist. «Seit April 2012 hatten wir weltweit betrachtet keinen einzigen Tag mit ‹normalem› Wetter», sagte Sebastian Sippel im Januar 2020. Der Forscher am Institut für Atmosphären- und Klimaforschung der ETH Zürich war Hauptautor einer Studie, die kurz zuvor im Fachmagazin «Nature Climate Change» veröffentlicht wurde. Neue Daten öffneten eine neue Perspektive in der öffentlichen Wahrnehmung des Klimawandels. Denn der Mensch orientiert sich an einzelnen und aktuellen Wetterereignissen, wie Mitautor und ETH-Forscher Reto Knutti sagte. Die Studie zeigte, dass nicht nur die Häufung von Extremereignissen Zeichen für den Klimawandel sind, sondern dass sich die Erderwärmung global gesehen sogar an jedem einzelnen Tag bemerkbar macht.[19]
Ein anderes Beispiel, wie stark die Klimakrise bereits eingesetzt hat, sind die zunehmenden Feuersbrünste. Sie haben Stephen Pyne dazu veranlasst, vom Pyrozän, dem Zeitalter des Feuers, zu sprechen, das nun angebrochen sei. Der Forscher der Arizona State University gilt als Pionier der Feuerökologie. Seine These des Pyorzäns belegt er unter anderem dadurch, dass es im Frühsommer 2019 in Alaska und Sibirien so intensiv brannte wie noch nie. Die Forscher im des Copernicus-Programms beobachteten im gleichen Jahr mehr als hundert Brandherde, für sie eine klare Folge der heissen und trockenen Bedingungen. In Indonesien brannten Torflandschaften, im Amazonasgebiet in Brasilien und Bolivien der Regenwald und die Brände in Australien waren verheerend wie selten zuvor. In den Bundesstaaten New South Wales und Queensland brannte es gar so stark wie noch nie, seit die Brände mit Satelliten erfasst werden.[20]
Der Klimanotstand war aber allerdings schon vorher soweit anerkannt, dass sich sogar die Menschenrechtsorganisation Amnesty International damit auseinandersetzte. «Millionen von Menschen leiden bereits jetzt unter den Folgen extremer Katastrophen, die durch den Klimawandel verschärft wurden: von anhaltender Dürre in Subsahara-Afrika bis hin zu tropischen Stürmen über Südostasien, der Karibik und dem Pazifik. Da der Klimawandel nicht nur für die Natur, sondern auch für die Menschheit verheerende Folgen hat, ist er eines der drängendsten Menschenrechtsthemen unserer Zeit», heisst es auf der Webseite von Amnesty International. Und weil der Klimawandel die bestehenden Ungleichheiten vergrössert, werden Menschenrechte «durch die globale Erwärmung direkt bedroht: das Recht auf Leben, Wasser, Nahrung, Zugang zu Sanitätseinrichtungen und auf eine angemessene Unterkunft.»
Die immer extremeren Folgen der Klimaerwärmung gefährden heutige und zukünftige Generationen unmittelbar. «Beim Engagement für den Klimaschutz geht es deshalb ums Überleben,» konstatiert Amnesty International. Doch nicht nur diese Gefahren machen der Menschenrechtsorganisation zu schaffen, sondern auch dass «in verschiedenen Weltregionen Umweltaktivist*innen bedroht, manche sogar ermordet» werden. Laut Global Witness wurden allein im Jahr 2017 über 200 Umweltschützer*innen getötet, weil sie ihr Land und dessen natürlichen Ressourcen verteidigten.[21]
Carola Rackete zitiert dazu in ihrem Buch «Handeln statt Hoffen» den UNO-Bericht Climate Change and Poverty aus dem Jahr 2019, der ebenfalls darauf hinwies, dass der Klimawandel «für Menschen, die unter Armut leben, verheerende Folgen haben» wird. Selbst im besten Fall werden Hunderte Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit, erzwungener Migration, Krankheit und Tod bedroht sein. «Der Klimawandel bedroht die Zukunft der Menschenrechte und birgt das Risiko, dass die Fortschritte der letzten 50 Jahre in den Bereichen Entwicklung, globale Gesundheit und Armut zunichte gemacht werden.»[22]
Für Rackete ist es deshalb eine Frage der Klimagerechtigkeit, anzuerkennen, dass «die Menschen, die am wenigsten zu diesem Desaster beigetragen haben, es am frühesten und am heftigsten zu spüren bekommen.» Die Folgen der Klimakrise werden zunächst vor allem jene Teile der Erde betreffen, in denen die Menschen viel schlechter geschützt sind als in den Industrieländern. «Diese Menschen besitzen keine Versicherung für ihre Häuser, keine medizinische Versorgung, keine Infrastruktur für Rettungsdienste.»[23]
Der Schweizer Chemie-Nobelpreisträger Jacques Dubochet bringt es den Punkt, wenn er sagt, die Menschheit stehe vor der grössten Herausforderung, die es je gab. Sein öffentliches Engagement gegen die Klimakrise begründet er so: «Ich bin seit kurzem Grossvater. Im Jahr 2100 wird unser Enkel 81 Jahre alt sein. Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden dann die Lebensumstände wegen der Klimaerwärmung sehr schwierig sein. Es wird wahrscheinlich eine chaotische Welt sein, wenn wir die Lage nicht unter Kontrolle bringen, und zwar schnell.»[24]
Tatsächlich sprach sich Ende 2019 langsam herum, dass es allmählich höchste Zeit war, zu handeln. Der Grossteil der verantwortlichen Politiker*innen hatte es seit dem Umwelt-Gipfel der UNO in Rio von 1992 versäumt, in die Gänge zu kommen. Unterdessen ist es zwar bis weit ins bürgerliche Lager hinein Kosens, dass etwas getan werden muss. Aber Lösungen, die etwas kosten und die gezwungenermassen einen Teil des Lebensstils der satten Mehrheit in den industrialisierten Staaten infrage stellen, lassen weiterhin auf sich warten. Noch immer glauben zu viele, man müsse bloss ein paar Schräubchen am Getriebe des Systems anders einstellen.
Da braucht es neben den Naturwissenschaftler*innen auch Historiker*innen wie Philipp Blom, die Klartext sprechen: «Es geschieht alles viel zu langsam! Wenn wir erst 2050 tatsächlich carbonfrei werden, hat London die gleichen Sommertemperaturen wie Barcelona.» Blom wies Ende 2019 unmissverständlich darauf hin, dass nun «sehr schnelle radikale Handlungen notwendig wären.» Und er stellte zurecht die Fragen, ob die Fridays for Future-Bewegung stark genug sein wird, um die herrschenden Verhältnisse zu ändern, und was mit den globalen Konzernen geschehen muss, die sich bisher der demokratischen Kontrolle weitgehend entziehen.[25]
Auf diese Konzerne kam auch der Schweizer Autor Beat Ringger in seinem «System-Change-Klimaprogramm» zu sprechen: «Sechs der acht umsatzstärksten Unternehmen der Welt sind Öl- und Gaskonzerne – und auf den Plätzen 9 und 10 folgen die beiden weltweit grössten Autokonzerne. Diese Konzerne verteilen Geld, Macht, Privilegien.»[26] Und sie sind nicht bereit, ihre Macht und ihr Geld einfach so aufzugeben. Deshalb plädierte Ringger für «eine Ausweitung der Demokratie gegenüber der Macht der Konzerne.»[27]
Davon wird noch die Rede sein.
Bleiben wir kurz bei den Öl- und Autokonzernen. Dass sie sich so wichtigmachen konnten, hatte mit dem «Auto-Zeitalter» zu tun, wie es der amerikanische Wirtschaftsprofessor Jeremy Rifkin nennt: «Das Automobil war der Anker der zweiten industriellen Revolution.» Ein Grossteil des Weltbruttoprodukts war im 20. Jahrhundert auf die Produktion und den Verkauf der Abermillionen von Autos, Bussen und Lastwagen sowie auf alle Sektoren zurückzuführen, die dazu beitrugen. Dazu gehörten auch «alle Branchen und Unternehmen, die vom ‹Auto-Zeitalter› und dem Aufbau neuer Städte und Vororte profitierten, einschliesslich der Immobilienbranche, Einkaufszentren, Fast-Food-Ketten, Reisen und Tourismus, Themenparks und Technologie Parks … die Liste ist endlos.»[28]
Allerdings sieht Rifkin hier bereits eine schleichende Revolution im Gang, die sich auch in der Schweiz abzeichnet; die Veränderung des Mobilitätsverhaltens. In den grossen Städten der Schweiz, etwa in Basel oder Bern, verfügt bereits heute die Mehrheit der Haushalte über kein eigenes Auto mehr. Parallel dazu boomen Carsharing-Unternehmen wie die Genossenschaft Mobility. Rifkin analysiert die Veränderung des Verkehrssektors als «völligen Umbruch der Mobilität und Logistik auf der ganzen Welt». Dieser werde «eine Reihe gestrandeter Vermögenswerte» hinterlassen, deren Grösse noch nicht absehbar sei.[29] Denn Rifkin sieht es als weltweiten Trend, dass in städtischen Gebieten junge Menschen den Zugang zur Mobilität dem Besitz von Fahrzeugen bevorzugen. «Künftige Generationen werden in einer Ära intelligenter und automatisierter Mobilität wahrscheinlich nie mehr Fahrzeuge besitzen.»
Doch bis sich diese Entwicklung global auf die CO2-Produktion auswirkt, geht es viel zu lange. Abgesehen davon, dass in den automobiltechnisch noch unterversorgten, aufstrebenden Schwellenländern die Menschen danach gieren, auch endlich ein Auto zu besitzen. Im Jahre 2019 krochen gemäss Rifkin «1,2 Milliarden Autos, Busse und Lastwagen in dichten städtischen Gebieten auf der ganzen Welt herum.» Auch wenn Rifkin mit seiner Einschätzung richtig liegt, dass 80 Prozent dieser Fahrzeuge, «im Laufe der nächsten Generation durch die weitverbreitete Einführung von Carsharing-Diensten beseitigt werden»[30], stossen sie noch jahrelang täglich ihre CO2-Wolken aus.
Die Klimaerwärmung wird sich also weiter verschärfen. Ausser wir stoppen sie. Was nur global koordiniert möglich ist. Harald Lesch, Professor für Astrophysik in München, spricht deshalb davon, dass «eine global agierende Gesellschaft Brücken bauen sollte, statt Grenzen zu ziehen.» Der Trend sah zumindest bis zur Coronakrise ganz anders aus. Wie Lesch richtig erkannt hat, leben die Verlierer des herrschenden Systems in Afrika, in Asien und in Südamerika. «Irgendwann werden sie vor unserer Haustür stehen und ihren Anteil fordern. Da können wir nicht einfach sagen ‹Zurück mit euch!›, weil wir massgeblich für ihre Fluchtursachen verantwortlich sind.» Lesch meint, dass es solche «globale Ausgleichsströmungen» geben werde, «solange wir uns nicht solidarisch erklären mit allen anderen auf diesem Planeten.»
Die weltweite Migration wird neben dem Klimawandel das Problem der Zukunft sein: «Wir dachten immer, wir könnten unsere Abfälle in die Meere, die Atmosphäre oder den Boden entsorgen, jetzt kommt die Retourkutsche. Wir haben auf viel zu grossem Fuss gelebt und merken allmählich, dass die Party vorbei ist», sagt Lesch.[31]
Wie es um die weltweite Migration steht und warum das Thema ein jahrhundertalter Dauerbrenner ist, zeigt das nächste Kapitel.
1 www.welt.de/wissenschaft/article205617497/2020-war-der-weltweit-waermste-Januar-seit-Beginn-der-Aufzeichnungen ↵
2 www.spiegel.de/wissenschaft/antarktis-temperaturrekord-macht-forschern-sorgen-a-37c52743-6165-4e0d-be4d-20bb4e1ba504 ↵
3 «NZZ am Sonntag», Zürich, 9. Februar 2020 ↵
4 www.srf.ch/news/international/eroeffnung-des-50-wef-trump-lobt-thunberg-kritisiert-sommaruga-warnt ↵
5 www.nzz.ch/wirtschaft/die-schweiz-ist-nur-auf-den-ersten-blick-ein-umwelt-musterschueler-ld.1470064?reduced=true ↵
6 https://gruene.ch/medienmitteilungen/co2-gesetz-wichtiger-zwischenerfolg-fuer-mehr-klimaschutz ↵
7 www.srf.ch/news/schweiz/wef-bilanz-von-greta-thunberg-die-klimaforderungen-wurden-komplett-ignoriert ↵
8 www.klimareporter.de/international/paris-abkommen-die-laender-liefern-nicht ↵
9 www.srf.ch/news/international/weltweiter-klima-notfall-wissenschaftler-warnen-vor-unsaeglichem-menschlichem-leid ↵
10 www.zeit.de/wissen/umwelt/2019-09/sonderbericht-klimawandel-ipcc-report-ergebnisse-weltklimarat-klimaschutz ↵
11 www.mdr.de/wissen/weltmeere-so-warm-wie-nie-zuvor-100.html ↵
12 www.spiegel.de/wirtschaft/service/mckinsey-studie-zum-klimawandel-ergebnisse-sind-verheerend-a-0ccc0af4-6706-4a38-a4ef-38bdf570d9a6 ↵
13 «Der Bund», Bern, 27. November 2019 ↵
14 www.br.de/nachrichten/wissen/weltweite-kraftwerk-laufzeiten-sprengen-alle-klimaziele,RUxlPR9 ↵
15 www.srf.ch/news/international/klimaschutz-paket-der-eu-darum-geht-es-beim-green-deal ↵
16 www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/gruene-sauer-eu-parlament-unterstuetzt-umstrittene-energieprojekte ↵
17 www.erneuerbareenergien.de/400-von-746-kohleunternehmen-planen-eine-erweiterung-ihrer-aktivitaeten ↵
18 www.welt.de/politik/deutschland/article205191121/Gruene-fordern-Bundesregierung-zur-Nacharbeit-am-Kohleausstieg-auf ↵
19 «Der Bund», Bern, 3. Januar 2020 ↵
20 «Der Bund», Bern, 31. Dezember 2019 ↵
21 www.amnesty.ch/de/themen/klima/doc/2019/fragen-und-antworten-zu-klimagerechtigkeit-und-menschenrechte ↵
22 Rackete, Carola: Handeln statt Hoffen, München, 2019, Seite 78 ↵
23 Rackete, Carola, aao, Seite 86 ↵
24 «Der Bund», Bern, 31. Oktober 2019 ↵
25 «Der Bund», Bern, 23. Dezember 2019 ↵
26 Ringger, Beat: Das Systemchange Klimaprogramm. Zürich, 2019, Seite 33 ↵
27 Ringger, Beat, aao, Seite 34 ↵
28 Rifkin, Jeremy: The Green New Deal, e-book, New York City, 2019, Seite 60 ↵
29 aao, Seite 61 ↵
30 aao, Seite 64 ↵
31 «Der Bund», Bern, 2. Februar 2019 ↵