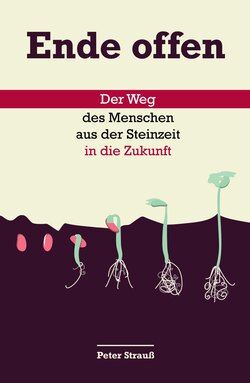Читать книгу Ende offen - Peter Strauß - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2 Woher wir wirklich kommen
Wir haben oft den Eindruck, ohne unsere technischen Errungenschaften wären wir kaum überlebensfähig. Das ist nicht richtig, denn wir wären längst ausgestorben, wenn wir nicht an unsere Umwelt angepasst wären. Wir sind nicht unzulänglich und müssen nicht dauernd verbessert werden. Wir sind für diese Welt richtig und ohne Hilfsmittel vollständig lebensfähig – allerdings nur im steinzeitlichen Zustand und unter den damaligen Umständen. Wir sind nicht an das Leben in einer Zivilisation angepasst, und unsere Zivilisation ist nicht an unsere Eigenschaften angepasst. Weiterentwicklung und Zivilisation haben die Zusammenhänge unseres Lebens verändert. Viele der biologisch alten Eigenschaften wirken jedoch heute unverändert weiter.11 Wir haben neue Regeln und Gesellschaften geschaffen und nicht beachtet, dass unser Verhalten von uralten Regeln bestimmt wird. Wir haben eine neue Zeit geschaffen, ohne uns zu fragen, ob sie zu den Regeln passt, die uns die Evolution eingeprägt hat.
Die Steinzeit ist für mich der Maßstab, an dem sich unsere Zivilisation messen lassen muss. Wir sollten es schaffen, bei unserer Entwicklung nicht hinter die damalige Qualität zurückzufallen. In den folgenden Kapiteln möchte ich auf Hintergründe eingehen, die unser Leben und unser Zusammenleben jahrtausendelang bestimmt haben und die auch heute noch gültig sind. Mich beschäftigt, woher wir kommen und warum wir uns so entwickelt haben.
Wir beschwören oft den „inneren Schweinehund“, der uns faul mache und uns daran hindere, die bei uns hoch bewertete Leistung zu erbringen. Es entsteht der Eindruck, Faulheit sei falsch, Eifer, Leistung, und permanente Anstrengung dagegen grundsätzlich gut und richtig. Doch die Evolution hat uns die Muße mitgegeben, damit wir in friedlichen Situationen, wenn ausreichend Nahrung vorhanden ist, unsere Kräfte schonen. Würden wir heute Faulheit weniger sanktionieren, wären stressbedingte Erkrankungen Vergangenheit.
Zurück in die Steinzeit?
Einer meiner Lektoren merkte an: „Willst du wirklich, dass wir in die Steinzeit zurückfallen – ständiger Kampf ums Überleben und eine Lebenserwartung von maximal dreißig Jahren?“ Doch waren unsere Vorfahren tatsächlich pausenlos auf der Suche nach Nahrung, mussten sich ununterbrochen gegen wilde Tiere verteidigen, und ereilte sie nach einem entbehrungsreichen Leben ein früher Tod?
Die ersten Menschen dürften weniger durch Fressfeinde bedroht gewesen sein, als gemeinhin angenommen. Raubtieren stand mit großen Herden von Pflanzenfressern reichlich Beute zur Verfügung. Darüber hinaus nahm die Bedrohung ab, als Waffen entwickelt wurden, also etwa vor zweieinhalb Millionen Jahren.
Die Nahrungssuche dürfte wesentlich einfacher gewesen sein, als wir im Jagen mit Pfeil und Bogen ungeübten Europäer uns das vorstellen. In der Geschichte der Evolution haben meist die Arten überlebt, die noch Zeitreserven hatten: Wer schon in guten Zeiten immer auf Nahrungssuche ist, wird beim ersten Wetterumschwung verhungern.12
Und wie steht es mit der Lebenserwartung? Die Daseinsspanne der Jäger und Sammler wird meist mit gerade einmal dreiunddreißig Jahren angegeben.13 Allerdings lag die Kindersterblichkeit bei einem Drittel bis zu einer Hälfte. Auf jedes gestorbene Kind unter zehn oder fünfzehn Jahren muss es demnach rechnerisch einen Menschen gegeben haben, der über fünfzig Jahre alt wurde. Das niedrige arithmetische Mittel schließt nicht aus, dass es auch unter den Jägern und Sammlern Achtzigjährige gab.14
Das stärkste Argument dafür, dass es auch in der Altsteinzeit Menschen höheren Alters gegeben haben muss, ist, dass die Evolution die Möglichkeit dazu in uns angelegt hat. Dass wir so alt werden können, ist mit hohem Aufwand verbunden: Die Alterung von Zellen muss verlangsamt werden, Krebszellen müssen beseitigt und beschädigte DNS muss repariert werden, langsame Vergiftungen durch Umwelteinflüsse müssen abgebaut werden können, und der Verschleiß an Knochen und Gelenken muss sich in Grenzen halten. Nicht ein einzelnes Gen entscheidet über die Möglichkeit zu altern, sondern es ist eine Vielzahl von Veränderungen erforderlich, um die Lebenserwartung anzuheben, denn sinnvollerweise altern alle unsere Körperteile und -funktionen gleichmäßig.15 Unsere Lebenserwartung ist wie alle anderen menschlichen Eigenschaften nicht zufällig entstanden, sondern das Ergebnis einer Optimierung auf bestmögliche Arterhaltung. Wenn sich die höhere Lebenserwartung nicht für uns auszahlen würde, hätte sie sich im evolutionären Prozess nie durchgesetzt.16
Die Natur als Regler
In einem technischen System dient ein Regler dazu, Einflüsse durch Störungen von außen auszugleichen und wieder einen stabilen Zustand herzustellen. Analog kann man in der Evolution eine Anpassung als die Reaktion des „natürlichen“ Reglers auf sich verändernde Umweltbedingungen betrachten. Die Veränderung der Umwelt ist die Störgröße, und die evolutionäre Anpassung ist der Regeleingriff, der zu einem neuen Gleichgewicht führt. Gibt es von einer Art zu viele oder zu wenige Exemplare, so ist die Evolution als Regler meist in der Lage, die Art durch Anpassung wieder in ein Gleichgewicht mit der Umwelt zu bringen. War die Regelung zu schwach oder die Störung zu groß, stirbt die Art aus.
Der Mensch hat durch seine Bewusstwerdung und die nachfolgende Entwicklung neue Regelungsmöglichkeiten, aber auch neue Störungen ins Spiel gebracht. Wir waren in der Lage, unsere Umwelt in ganz anderem Ausmaß zu nutzen als alle anderen Tiere, und wir konnten uns progressiv vermehren. Durch die Fähigkeit, unser Verhalten bewusst zu ändern, können wir auch viel schneller auf äußere und selbst gemachte Störungen reagieren als die Evolution mit ihren Mitteln der Mutation und Selektion.
Entscheidend ist, dass wir diese Regelung selbst vornehmen müssen. Damit haben wir die alleinige Verantwortung für unser Handeln – wir müssen selbst herausfinden, mit welchen Veränderungen wir Ungleichgewichte schaffen, die gefährlich werden können. Und wir müssen dies viel vorausschauender tun als bisher. Erst nach zweihundert Jahren CO2-Ausstoß beginnen wir, über die globalen Folgen nachzudenken. Wäre die Wissenschaft langsamer vorangeschritten und wäre weniger Geld in entsprechende Forschung investiert worden, so hätten wir den Klimawandel vielleicht erst daran erkannt, dass große Teile der landwirtschaftlichen Nutzflächen unfruchtbar geworden wären. Ein derartiges Szenario können nur wir verhindern, indem wir uns vorab Gedanken darüber machen, wie und mit welchen Folgen wir die Erde verändern.
Wir können uns der Evolution nicht entziehen
Wir denken, dass wir über der Evolution stehen, weil wir uns nicht mehr mit den Problemen herumschlagen müssen, die die meisten Tiere an der Vermehrung hindern – beschränktes Nahrungsangebot, begrenzter Lebensraum, Winter, Krankheiten und Parasiten. Was wir dabei außer Acht lassen: Gerade unsere „Überlegenheit“ hat uns unter anderem Massenvernichtungswaffen beschert. Würden wir uns selbst auslöschen, so wäre dies nichts weiter als der Beleg, dass unsere evolutionäre Entwicklung in die Sackgasse geführt hat.
Einzelne Wege der Menschheit haben bereits ihr Ende gefunden. Es scheint, als hätten die meisten Urvölker, die von uns ausgerottet wurden, den Wettbewerb verloren. Manche Indianerstämme waren beispielsweise durch ihre Vorstellung benachteiligt, dass sie ihre Gegner nicht einfach töten, sondern gefangennehmen sollten, weil dies die höhere Ehre sei, und mussten für jeden einzelnen gefangenen Eroberer viele ihrer Krieger opfern. Diese Vorstellung trug zu ihrem Verhängnis bei. Andernfalls hätte die Geschichte vielleicht eine andere Wendung genommen, da die spanischen Eroberer zwar bessere Waffen und auch Verbündete unter den Indianerstämmen hatten, aber durch ihre sehr langen Nachschubwege benachteiligt waren.
Wir stehen nicht außerhalb der Evolution, wir befinden uns nur auf einer höheren Ebene, da wir uns nicht nur genetisch, sondern auch geistig weiterentwickeln können und die einfachen Mechanismen, die die Weiterentwicklung der Tiere regulieren, außer Kraft gesetzt haben. Wolfgang Schmidbauer schreibt: „Allerdings funktioniert die menschliche Adaption ab einem bestimmten Intelligenzniveau grundsätzlich anders als die sämtlicher Tiere. Nicht mehr die Struktur des Organismus der einzelnen Exemplare der Art passt sich an die jeweils gegebene Umwelt an, sondern die Struktur der Sozietät. Sie wird in der Form bestimmter Normen dann an die einzelnen Mitglieder – die gegenwärtigen und ihre Kinder – weitergegeben.“17 Schmidbauer nennt dies den Wandel von der biologischen zur kulturellen Adaption18. Durch uns hat die Evolution eine aktive Seite bekommen. Alle Tiere haben sich bisher zufällig, d. h. passiv verändert und gewannen oder verloren dadurch Überlebensfähigkeit, und die besser Angepassten setzten sich durch. Wir sind die ersten Lebewesen, die ihren Weg aktiv beeinflussen können. Trotzdem gelten für uns nach wie vor die Regeln der Evolution. Sind wir zu aggressiv und töten uns gegenseitig, so sterben wir aus. Immerhin gehen in Europa Kriege und Aggressivität unter Einzelpersonen seit dem Zweiten Weltkrieg zurück. Unser Weg scheint also nicht zwangsläufig eine Sackgasse zu sein. Aber gilt das auch für den Rest der Welt?
Fortschritte in der Medizin, die auch „schlecht angepassten“ Menschen das Überleben ermöglichen, mindern heute den Einfluss der biologischen Selektion. Gleichzeitig bedeutet unsere geistige Entwicklung eine gigantische Beschleunigung der Evolution. Jede geistige Haltung ist ein neuer Pfad, der daraufhin geprüft wird, ob er unsere Überlebensfähigkeit erhöht.
Wir verdrängen alle anderen Lebewesen. Dies widerspricht unserer Arterhaltung kurzfristig nicht, wird sich also nicht in der Evolution unserer Gene ausdrücken. Falls wir Arten ausrotten, die wir zum Überleben brauchen, werden wir das erst bemerken, wenn es zu spät ist. Die Frage ist, ob andere Arten Mechanismen haben, ihre Ausrottung durch uns zu verhindern – was aus Sicht der Evolution sinnvoll wäre.
Wenn die Dinosaurier alle Ameisen zertreten hätten, wäre das für die Ameisen hinderlich gewesen, hätte aber den Dinosauriern nichts gebracht – keinen Lebensraum und keine zusätzliche Nahrung. Andererseits hätten die Ameisen ihr Aussterben gegen die Übermacht kaum verhindern können. Ähnlich verhält es sich bei uns Menschen. Viele Tiere wurden von uns gejagt. Wir haben in den vergangenen Jahrtausenden viele Arten ausgerottet.19 Der Nutzen für uns war vergleichsweise gering. Elefanten werden nicht wegen ihres Fleisches getötet, sondern wegen ihrer Stoßzähne. Wölfe werden überwiegend aus Angst vor ihnen getötet. Viele Tiere hat alleine der Stress aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte der Menschen dezimiert.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Tiere sich dagegen wehren könnten: Anpassung an die geänderten Bedingungen, Rückzug in andere Bereiche oder Angriff auf die Bedrohung. Bakterien beispielsweise können sich aufgrund ihrer schnellen Generationenfolge sehr leicht anpassen. Daher gibt es die Krankenhauskeime. Die früher so scheuen Füchse, Kaninchen und Wildschweine leben mittlerweile zwischen uns in unseren Städten, wehren sich also sinnvoll gegen die Verdrängung – ohne Aggression, die sie erneut gefährden würde.
Evolution ist kein Prozess, den wir durchlaufen. Sie ist ein Zustand, dem alles Leben im Universum unterliegt. Sie gilt für alles Leben ohne Ausnahme, und man kann sich ihr nicht entziehen. Sie ist vermutlich eine systemimmanente Eigenschaft des Universums. Sie würde unter reproduktionsfähigen Robotern ebenso gelten.
In den folgenden Kapiteln habe ich zusammengetragen, wie sich einige Eigenschaften auswirken, die uns die Evolution mitgegeben hat.
2.1 Der Wert von Menschen, Tieren und Umwelt
Die alten Griechen, die Römer und die Bibel gingen davon aus, dass die gesamte Welt um der Menschen und Gottes oder der Götter willen geschaffen wurde. Dieser Grundsatz, der in allen Religionen galt20, resultierte aus dem Entwicklungsstand der damaligen Menschen und erwies sich als zur Rechtfertigung geeignet, Dinge zu tun, die Tieren, Pflanzen oder der Umwelt schaden und gegen die diese sich nicht wehren können. Es bleibt die Frage offen, ob sich ein solches Verhalten rechtfertigen lässt oder ob die Machtlosigkeit der Umwelt die einzige Erklärung des Verhaltens unserer Vorfahren bleibt. Seit Charles Darwin sind wir immer weiter von diesem anthropozentrischen Weltbild abgerückt. Dennoch kann man davon ausgehen, dass das Universum auf die Hervorbringung intelligenten Lebens wie des Menschen oder vielleicht noch höherer Intelligenz hinarbeite, denn immerhin sind wir das vorläufige Endergebnis der Evolution, wobei das Leben über die Jahrmillionen zu immer mehr Komplexität, Vielfalt und Intelligenz tendiert hat.21
Wir sind heute in der Lage, unsere gesamte Umwelt unseren Zwecken zu unterwerfen. Eigentlich wissen wir, dass wir nicht jede Macht nach Belieben nutzen dürfen, nur weil wir sie haben. Das gilt gleichermaßen für die Macht von Eltern über ihre Kinder wie für Atomwaffen. Das wird uns vor allem dann deutlich, wenn wir selbst gegenüber anderen in der schwächeren Position sind: den Launen eines cholerischen Vorgesetzten oder der Willkür einer wenig verständnisvollen Sachbearbeiterin beim Jobcenter.
Jemand könnte einwerfen, das Dominanzstreben sei ein natürliches Prinzip. Tiere würden sich auch so lange vermehren, solange es ihnen möglich sei. Das stimmt nicht. Die meisten Tierarten stellen ihre Vermehrung ein, bevor sie ihren Lebensraum kahlgefressen haben. Dieser evolutionäre Mechanismus bewahrt sie vor dem Aussterben. Nehmen wir das Beispiel einer Insel, die hauptsächlich von Füchsen und Hasen bevölkert wird. Werden die Hasen durch eine Krankheit dezimiert, so fressen die Füchse sie nicht vollständig auf; weil sie damit den Fortbestand ihrer Nahrungsgrundlage gefährden würden. Stattdessen verringert sich ihre eigene Population ebenfalls, bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist.
Wer alles auffrisst, stirbt
Nur in Ausnahmefällen vermehren sich Tiere so lange, bis ihre Nahrung nicht mehr ausreicht und ein Teil von ihnen verhungert.22 Laut Jared Diamond haben das einige Tierarten23 und Menschenpopulationen schon getan. Bei den Tierarten handelt es sich jedoch um solche, die der Mensch auf Inseln aussetzte, wo ihre Mechanismen zur Regulation der Bevölkerungsdichte nicht funktionierten, weil der Lebensraum zu klein war oder Fressfeinde fehlten.
Die riesigen Steinskulpturen auf der Osterinsel zeugen von einer früheren Hochkultur, die sich selbst ausgelöscht hat. Um sie zu errichten, rodeten die Ureinwohner bis zum Jahr 1500 die gesamten Wälder. Die damit zerstörte Lebensgrundlage führte zu einem dramatischen Bevölkerungsrückgang. Die Vernichtung des eigenen Lebensraums besiegelte auch das Schicksal der Pueblo-Siedlungen im amerikanischen Südwesten bis 1200 und der antiken Stadt Petra, die von 9000 v. Chr. bis ins siebte Jahrhundert besiedelt war und im heutigen Jordanien liegt.24 Im Unterschied zu den Bewohnern der Osterinsel konnten die Bewohner ihr angestammtes Gebiet vermutlich verlassen und auf diese Weise überleben.
Allein durch den Wechsel der Jahreszeiten kann das Revier nicht immer komplett genutzt werden. Auch in einem strengen Winter muss die Nahrung ausreichen. Und selbst dann wird die Natur normalerweise nicht kahlgefressen und kann sich schnell wieder erholen. Konrad Lorenz schreibt, dass viele Tierarten ihr Revierverhalten abgelegt haben und in Herden leben, weil ihnen „Nahrung in Hülle und Fülle zur Verfügung steht“.25 Demnach müssen sie über Mechanismen verfügen, die ihre Vermehrung begrenzen, bevor diese ihre Lebensgrundlagen gefährdet.
Jetzt könnte man behaupten, dass dies durch die Raubtiere verhindert wird. Aber auch Haie, Falken, Löwen, Füchse und Wölfe fressen ihre Reviere nicht leer. Es ist für die eigene Arterhaltung von Vorteil, jeweils nur einen kleinen Teil der Population von Tieren oder der Pflanzen eines Reviers zu fressen. Das lässt sich mathematisch damit erklären, dass Wachstum (bis zum Einschwingen an einer natürlichen Grenze) exponentiell verläuft und sich somit Nahrung schneller wieder vermehrt, wenn sie vorher weniger stark dezimiert wurde.
Es gibt (außer bei Heuschreckenplagen) keinen Ort auf der Erde, über den man sagen würde: „Da hat das XY-Tier wieder alles weggefressen.“ Das hat nichts mit Macht und Möglichkeiten zu tun, denn die großen Raubtiere oder Raubfische wären in der Lage, ihren Lebensraum leerzufressen, wenn sie sich nur ausreichend vermehrten. Eine drastischere Regulierung der Bevölkerungsdichte findet bei Heuschrecken statt. Wenn ihre Anzahl in ihrem angestammten Lebensraum so weit angestiegen ist, dass hier nicht mehr genug Nahrung finden, brechen sie in Scharen in benachbarte Landstriche auf, um diese leerzufressen, bis nichts mehr übrig ist und ein großer Teil von ihnen verhungert. Die Auswanderung dient in doppeltem Sinne der Arterhaltung: Die Population im alten Revier hat weiterhin genügend Nahrung, und die abwandernden Insekten entdecken möglicherweise neue, für sie bewohnbare Regionen. Heuschreckenplagen können ganze Ernten vernichten. Für die Natur sind sie meist weniger dramatisch. Auch sind die Heuschrecken dadurch bisher nicht ausgestorben.
Auch auf molekularer Ebene ist ungehemmte Aggressivität kein geeigneter Überlebensmechanismus. Selbst das gefürchtete Ebola-Virus befällt nur eine geringe Zahl von Menschen pro Jahr, weil es die meisten seiner Wirte in kurzer Zeit tötet und sich daher schwer ausbreiten kann. Das führt in der Regel dazu, dass Epidemien schnell wieder abklingen.26 Das Grippevirus ist besser angepasst und daher viel stärker verbreitet.
Wachstum und wachstumsbremsende Mechanismen halten sich bei allen gut angepassten Arten die Waage. Die Menschheit hingegen hat die Vorteile, die sie gegenüber den anderen Tieren hat, bisher nur zur Steigerung ihres Wachstums genutzt und nicht zur Begrenzung ihrer Ausbreitung. Damit hat sie den Gleichgewichtszustand verlassen. Gefahr droht uns derzeit fast nur noch durch uns selbst. Wenn es in hunderttausend Jahren noch Menschen gibt, dann stammen sie nicht von denen ab, die sich immer weiter vermehren wollten.
Gibt uns unsere Überlegenheit das Recht, uns die Erde untertan zu machen?
Die Vorherrschaft des Menschen beruht ausschließlich auf seiner Macht. Archaische Völker haben sich die Frage nach der Begründung des eigenen Konsums nicht gestellt. Der Konsum ist zwar mit der Industrialisierung stark angewachsen, aber die dem zugrundeliegende Überzeugung, dass die Welt zu unserem Nutzen da sei und die Entscheidung darüber ausschließlich bei uns liege, ist seit Jahrtausenden unverändert. In früheren Zeiten hatten wir lediglich weniger Möglichkeiten, die Welt zu nutzen.
Wenn wir uns ausdehnen, wie wir können und wollen, so ist das unserer Natur gemäß. Doch gerade die Tatsache, dass wir nicht mehr komplett durch unsere Instinkte gesteuert werden, gibt uns die Möglichkeit, auch anders zu handeln. Die Grenzenlosigkeit unserer Expansion beinhaltet immer auch die Möglichkeit, dass wir etwas verbrauchen, das wir später nicht mehr ersetzen können.
Dass alles nach vorne strebt, unser System auf unserer Vorherrschaft aufgebaut ist, unsere Wirtschaft nicht anders funktionieren würde und wir das Geld schließlich brauchen, ist keine Rechtfertigung, sondern bestenfalls eine Erklärung. Wenn sich unsere heutige Kultur „zivilisiert“ nennt, sollte sie eine klare Antwort auf die Frage nach der Rechtfertigung unseres Handelns haben: Wie könnte eine Lebensweise und ihre moralisch plausible Begründung aussehen?
Der Wert von Mensch und Tier
Dass wir selbst der Ansicht sind, der Mensch sei mehr wert als das Tier oder die Pflanze oder ein Stein, hat wenig Bedeutung, denn auch ein Tier würde diese Frage wahrscheinlich in seinem Sinne beantworten, wenn es das könnte. Darin zeigt sich nur subjektiver Überlebenswille in Form von Egoismus oder Egozentrismus. Wenn wir uns ein Recht an der Natur oder den Tieren zusprechen wollten, so müsste dies – wie in unserer Demokratie auch – zum Beispiel von einer übergeordneten Macht zugeteilt werden, die sich dabei darum bemüht, alle Einzelinteressen zu berücksichtigen. Eine solche Instanz gibt es nicht.
Tiere sind dem Menschen demnach objektiv nicht nachgeordnet, sie sind nicht weniger wert, ebenso wie Pflanzen. Sie sind weniger intelligent, weniger durchsetzungsfähig oder weniger flexibel, aber nicht weniger wert. Der Wertbegriff kann weder auf Menschen im Vergleich noch auf Leben im Allgemeinen angewendet werden. Ein Wert ist etwas, das wir einem Produkt beimessen, und er ist subjektiv, weil er von dem bewertenden Individuum, der Gesellschaft oder einer Zielsetzung abhängt. So gilt es nach deutschem Recht als Sachbeschädigung, wenn jemand einen Hund mit dem Auto überfährt. Hundebesitzer sehen das sicher anders.
Wenn wir am vermeintlich hohen Wert des Menschen als Begründung für unsere Lebensweise festhalten – was wollten wir dann Außerirdischen erzählen, die unserer Entwicklung tausend Jahre voraus sind, uns für unterbelichtet halten, aber unser Fleisch sehr schmackhaft finden? Nach der von uns selbst geschaffenen Logik dürften sich solche Außerirdischen, wenn es sie denn gäbe, nach Herzenslust bedienen. Mit welchem Argument wollten wir uns darüber entrüsten?
Bei Tieren stehen der Erhalt des Lebens und die durch sie angerichtete Zerstörung in einem für Arterhaltung und Umwelt akzeptablen Gleichgewicht. Wir aber sind durch unsere Denkfähigkeit in der Lage, die Folgen unseres Handelns vorwegzunehmen. Damit entscheiden wir bewusst, ob wir Mitmenschen und Ressourcen schützen oder unserer Gier freien Lauf lassen. Wir sind unmittelbar für das Ergebnis unseres Tuns verantwortlich. Die Evolution kann uns nicht mehr lenken.
Von einer rechtmäßigen Vorherrschaft des Menschen kann man also nicht ausgehen. Andererseits können wir auch nicht leben, ohne dass wir und unsere Umgebung sich wechselseitig beeinflussen. Wollten wir unseren Einfluss auf unsere Umwelt auf Null reduzieren, so müssten wir uns selbst auslöschen.
Dann ab jetzt vegan?
In den Medien wird in letzter Zeit immer wieder die Forderung diskutiert, wir sollten kein Fleisch mehr essen. Dieser Lösungsansatz scheint klarer, als er ist. Es fängt damit an, dass manchen Menschen ein veganes Leben leichter fällt als anderen. Wir zertreten weiterhin Ameisen beim Wandern, wir beanspruchen Lebensraum, der vorher Tieren gehörte, wir essen Pflanzen, die dafür sterben und die anderen Lebewesen nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir belegen Lebensraum, den zuvor Tiere und Pflanzen bewohnten.
Wenn ich nach einer Mücke schlage, werden sehr pazifistische Menschen sagen, ich solle sie leben lassen, sie sei auch ein Lebewesen, und ich hätte nicht das Recht, sie zu töten. Für Fälle, in denen ich aus reiner Willkür oder Überheblichkeit handele, ist das sicherlich moralisch richtig. Jedes Lebewesen hat ein Recht auf seine Existenz, und ich sollte meine Überlegenheit nicht missbrauchen. Wenn mir das Insekt Schaden zuzufügen droht, sieht es anders aus. Auch Tiere wehren sich gegen Beeinträchtigungen durch andere Tiere. Kühe schlagen mit dem Schwanz nach Fliegen, manche Hunde zerbeißen Wespen, die sie umschwirren, und Affen lausen sich gegenseitig. Der Unterschied zu unserem Handeln ist, dass die Tiere das instinktiv tun und dazu keine bewusste Entscheidung getroffen haben. Sie sind nicht für die Folgen ihres Handelns „verantwortlich“. Dass ich die Möglichkeit zur Entscheidung und damit die Verantwortung und die Fähigkeit zur Schuld habe, nimmt mir indes nicht meine Rechte. Ich darf nach wie vor eine Mücke erschlagen, die mich stechen will. Toleranz kann man nur gegenüber Toleranten anwenden. Wer mich beeinträchtigen will, kann nicht von mir verlangen, dass ich mich stechen lasse, bloß, weil ich im Gegensatz zum Tier in der Lage bin, meinen Instinkt zu kontrollieren. Beim bewussten Handeln ergibt sich das Problem, dass man ständig beurteilen muss, ob es angemessen ist oder nicht.
Andererseits ist es nicht notwendig, andere Tiere als minderwertig einzustufen, um sie essen zu können oder zu dürfen. Ein Löwe muss sich nicht als höherwertig gegenüber der Antilope fühlen, um sie zu jagen. Er hat Hunger und tut, wofür die Natur ihn geschaffen hat. Und genauso geht es dem Bakterienstamm, der anschließend den Löwen tötet. Auch dieser ist nicht höherwertig, weil er den Löwen töten kann. Er sorgt lediglich mit seinen Mitteln für sein Überleben. Wir müssen weder ein schlechtes Gewissen haben, weil wir Tiere essen, noch sollten wir uns ihnen gegenüber wie die Herrenrasse oder gleichgültig ob ihres Leidens verhalten. Es besteht keine Notwendigkeit, sich über oder unter die Tiere oder Pflanzen zu stellen, nicht einmal neben sie, denn der Vergleich ergibt keinen Sinn. Die dafür gültiger Kriterien müssten von allen Lebensformen der Erde gemeinsam und einvernehmlich definiert werden. Wer könnte wissen, welchen Maßstab eine Schildkröte für richtig halten würde?
Die Einstellung, wir seien die wertvolleren Lebewesen, hat zu Massentierhaltung und Ausbeutung der Erde geführt – ein moralischer Irrtum, den wir korrigieren müssen.
Vielleicht hat der Sinn des Universums mit den Bewegungen von Sternen und Planeten zu tun, und das Leben auf der Erde ist nur so etwas wie Pilzbewuchs auf einem Joghurt im Kühlschrank: unerwünscht und überflüssig. Das glaube ich zwar nicht, da Bewegung, Evolution und Intelligenz27 immanente Prinzipien des Universums sind. Ich kann aber auch nicht dafür garantieren, dass es falsch ist. Auf jeden Fall sind Wertmaßstäbe denkbar, in denen der Mensch keine Rolle spielt.
Wie kann man nun zu einem moralischen und sinnvollen Handeln gelangen? Grundsätzlich halte ich alles für erlaubt, was keinem anderen Menschen, keinem, Tier, keiner Pflanze oder der Umwelt schadet, unabhängig davon, ob es heutzutage gesellschaftlich anerkannt oder geächtet ist. Da aber fast jede Handlung eines Lebewesens, vor allem aber die Ernährung, auf Kosten anderen Lebens stattfindet, ist solches Handeln eher selten. Der Lebensraum, den das eine Wesen belegt, kann ein anderes nicht nutzen. Das gilt ebenso für Pflanzen. Was dem einen Leben dient, steht anderem Leben nicht mehr zur Verfügung. Das gilt universell, außer für einige Bakterienarten, die sich am Meeresgrund von Mineralien ernähren und dabei auch keinem anderen Leben Nahrung oder Raum wegnehmen.
Da unser Wert nicht definierbar ist und damit nicht in ein Verhältnis zum ebenso nicht definierbaren Wert von Tieren gesetzt werden kann, müssen wir logischerweise Tieren dieselben Existenzrechte einräumen. Die Begründung, Tiere und Pflanzen zu essen, kann demnach nicht darin liegen, dass wir mehr wert wären, sondern dass es unsere Natur und derzeit zumindest teilweise unvermeidlich ist.28
Alle leben auf Kosten anderer
Die Lösung des Dilemmas kann darin liegen, zu akzeptieren, dass nicht nur unser Leben, sondern jedes Leben auf der Erde immer auf Kosten anderen Lebens stattfindet. Dabei sollten wir uns unserer selbst, der Tiere und allen anderen Lebens bewusst sein. Diesen Gedanken gibt es ebenfalls im Buddhismus. Essenz der Lehre des bedingten Entstehens ist: „Dieses ist, weil jenes ist“. Die Ausscheidung des Einen ist Nahrung oder Dung für den Anderen. Karma meint, dass jede Tat eine Wirkung in der Welt hat. Ziel der buddhistischen Lebensweise ist es daher, dass die eigenen Handlungen möglichst keine Spuren mehr in der Welt hinterlassen. Nur diese Haltung, die Auswirkungen des eigenen Lebens auf die Umgebung zu minimieren, berücksichtigt angemessen die Existenzrechte anderen Lebens. Wir sollten daher nichts verschwenden und achtsam mit allem Leben umgehen, Leiden vermeiden und nur nutzen, was wir wirklich brauchen, Tiere artgerecht halten, keine Lebensmittel wegwerfen, nicht sinnlos konsumieren, uns nicht beliebig weiter vermehren usw.
Heute zeigt sich die Ausbreitung dieses Denkens darin, dass immer mehr Menschen versuchen, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und dass diese Idee in den Medien erörtert wird. Sich beispielsweise beim Essen oder bei jedem anderen Konsum bewusst zu sein, dass das eigene Leben auf anderem Leben beruht, das geendet hat, ist hilfreich. Mir ist klar, dass eine solche Forderung nach Demut immer noch unpopulär ist. Sie ist das Gegenteil der heute von den meisten empfundenen Selbstverständlichkeit unserer Lebensweise, die sich in Überheblichkeit gegenüber Tieren und Pflanzen ausdrückt. Vielen fällt es schwer, den selbstverständlichen, überheblichen Umgang mit der Welt abzulegen, und es ist unbequem. Mehr Demut und mehr Vorsicht würden nicht nur unserer Umwelt, sondern auch uns und unseren Nachfahren langfristig mehr nützen als unser bisheriges, recht grobes und kurzsichtiges Verhalten.
Setzen wir diese Gedanken in die Tat um, so führt das in direkter Konsequenz zu höheren Preisen für die meisten Produkte. Daraus zu schließen, dass wir dann doch lieber so weitermachen sollten wie bisher, wäre voreilig, denn die höheren Preise kämen dadurch zustande, dass zum ersten Mal alle Umweltschäden, die durch die Produktion eintreten, in diesen Preisen berücksichtigt wären. Ein bisher ungerechtfertigt billiger Lebensunterhalt würde zum ersten Mal das angemessene Niveau erreichen. In der Vergangenheit haben wir unzulässig über unsere Verhältnisse gelebt.
Es ergibt sich das Problem, dass diese höheren Lebenshaltungskosten nicht von jedem Deutschen und noch weniger von Bewohnern ärmerer Länder aufgebracht werden können. Dieses Problem der Finanzierung muss selbstverständlich gelöst werden. In Teil 3 finden sich einige Ansätze dazu.
2.2 Menschliche Eigenschaften aus der Steinzeit und ihre heutige Wirkung
Vor der Entwicklung von Werkzeugen, Sprache, Sesshaftigkeit, Häusern, Ackerbau, Viehzucht und Zivilisation, als Menschen noch in abgegrenzten Gruppen lebten, bestand der Lebensinhalt im Wesentlichen aus gemeinsamem Jagen und Sammeln. Der Aufwand, der zum Überleben nötig war, beschränkte sich meist auf zwei Stunden „Arbeit“ pro Tag.29 Die längste Zeit des Tages war „Freizeit“. Wolfgang Schmidbauer schreibt dazu: „Genauere, unter ökologischen Gesichtspunkten durchgeführte Feldforschung hat gezeigt, daß die früheren Anthropologen stets dazu neigten, den Reichtum dieser ‚marginalen Existenz’ zu unterschätzen. Durchweg stellte sich heraus, daß die Nahrungsquellen der Jäger und Sammler in der Regel sicher und zuverlässig sind; oft sogar von erstaunlicher Fülle.“30 Im Gegensatz dazu stieg der Arbeitsaufwand für die Ernährung beim Wechsel auf Ackerbau und Viehzucht zunächst an.31
Menschen sind von Natur aus schon immer gierig und streben nach Mehr.
In Bezug auf Nahrung konnte man in der Steinzeit nicht mehr Besitz erlangen, als man sich in den Bauch stopfen konnte. Schmidbauer weiter: „Im Paläolithikum, der Altsteinzeit, die auch die Zeit der Jäger schlechthin ist, gab es keine Überschüsse an Nahrung. Man kannte kaum Methoden, Fleisch zu konservieren. Noch heute erjagen und sammeln Buschmänner und Pygmäen nicht mehr, als sie für einige Tage brauchen.“32 Der im Menschen angelegten Gier nach Mehr stand beständig das Sättigungsgefühl gegenüber, das sie aufhören ließ, nach Nahrung zu suchen, wenn es befriedigt war. In der Steinzeit galt: Wer zu gierig war und sich den Bauch zu voll stopfte, bekam Bauchweh – viel mehr Anwendungsfälle für Gier gab es nicht.
Die meiste Nahrung verdarb schnell, weshalb man sie nicht horten konnte. Darüber hinaus bestand persönlicher Besitz aus wenigen Gegenständen, vielleicht einem Fell als Kleidung und einem Knüppel oder Speer für die Jagd. Damals gab es also nur wenige Objekte, auf die sich dieses Streben beziehen konnte. Ein Mensch konnte zwar mehr Knüppel oder Felle besitzen als ein anderer, aber dies nützte ihm wenig. Solange man kein Haus besaß, gab es auch keinen Ort, an dem man Vorräte sicher hätte lagern können. Für Nomaden war Besitz nicht Vorteil, sondern Ballast.
Erst die Möglichkeit, Lebensmittel zu lagern, in Geld zu wandeln und dieses anzuhäufen, schuf die Grundlage für vielfältigen Besitz. Dieser wurde auch durch die Einführung der Erbschaft gefördert. In frühen Kulturen wurden persönliche Habseligkeiten beim Tod ihres Eigentümers verbrannt oder auf seinem Grab zerstört.33 Ohne Erbschaft bedeutet jeder Tod eines Mächtigen einen Ausgleich der Machtverhältnisse. Auf den Zusammenhang von Besitz und Macht werde ich im nächsten Kapitel detaillierter eingehen.
Heute gibt es unendlich viel mehr Objekte, auf die sich unser Besitzstreben beziehen kann. Die heutigen Konsummöglichkeiten führen zu einer ständigen Aktivierung unserer Gier, die nie vorgesehen war.
Gewalt
Vor Beginn der Zivilisation wurde die Stellung einer Person innerhalb der Gruppe durch Körperkraft, Geschicklichkeit sowie den sozialen Status bestimmt, wobei das Sozialverhalten eine maßgebliche Rolle spielte. Auch dies hat sich bis heute deutlich verändert. Zunächst bewirkte die Entwicklung von Waffen, dass die Bedeutung von Körperkraft und Kampftechnik hinter die der Waffentechnologie zurücktrat. Die Skala, auf der sich Macht bewegen kann, ist durch die Entwicklung von Waffen erheblich gewachsen. Durch diese Möglichkeit, Macht zu gewinnen, ist für den Einzelnen auch die Bedeutung des Sozialverhaltens für seine Stellung in der Gruppe zurückgegangen.
Ausgelebte Aggressivität führte vor der Zivilisation in Form einer Prügelei zu Schrammen und Beulen und nur selten zu einem gebrochenen Knochen. Das wäre je nach Situation für den Betroffenen lebensbedrohlich geworden – und damit im Sinne der Arterhaltung nachteilig.
Zur damaligen Zeit war der Entwicklungsstand aller Gruppen von Menschen und ihren Vorläufern recht ähnlich. Heute gibt es nur noch in entlegenen Regionen Stämme, die nahezu auf Steinzeitniveau leben. Ein stark unterschiedlicher Entwicklungsstand ist Voraussetzung dafür, dass sich eine Gruppe über eine andere erheben kann.
Durch die Zivilisation hat also die Bandbreite der Auswirkungen von Gier, von Macht durch Besitz oder Macht durch Waffen und damit auch von Aggressivität erheblich zugenommen. Ausbeutung oder Vernichtung anderer waren in der Steinzeit zwar ebenso möglich – eventuell wurde auf diese Weise das Schicksal der Neandertaler besiegelt. Heute sind unsere Möglichkeiten zur Ausbeutung oder Vernichtung anderer jedoch ungleich größer. Auch haben wir nun die Macht, Ressourcen zu verbrauchen und zu verschwenden. Menschen in der Steinzeit waren kaum in der Lage, etwas final zu zerstören. Jeder Schaden, der ja nur ein Schaden an der Natur sein konnte, wurde durch das Nachwachsen des Zerstörten wieder behoben. Weiterhin hat den damaligen Menschen (zumindest vor der Erfindung der ersten Waffen) die Möglichkeit gefehlt, andere Arten auszurotten.
Wir sind Rudeltiere
Von unserer Abstammung her haben wir wie Schimpansen und Bonobos, unsere engsten Verwandten, über Jahrhunderttausende in Gruppen von zwanzig bis einhundertfünfzig Individuen zusammengelebt.34 Dem Anthropologen Robin Dunbar fiel auf, dass die Größe des Neocortex’ (der Großhirnrinde) verschiedener Tierarten mit ihrer Lebensweise zusammenhing: Je größer die Gruppe, desto größer der Neocortex.35 Es scheint, als sei die Größe der Großhirnrinde dafür erforderlich, dass Menschen in solchen Gruppen leben könnten. Die Dunbar-Zahl (einhundertfünfzig) ist die maximale Zahl von Personen, mit denen wir in einer Gruppe sinnvoll zusammenleben könnten, d. h. von denen wir uns Namen und ihre Beziehungen untereinander merken können.36 Offenbar war eine solche maximale Gruppengröße optimal für die Arterhaltung, und die dafür nötigen Eigenschaften stecken noch tief in uns.
Jeder steinzeitliche Clan hatte sein eigenes Revier und überschritt dessen Grenzen nur in Ausnahmefällen. „Ein Faktum muss in diesem Zusammenhang besonders betont werden: die soziale Funktion des Territoriums im Leben der betreffenden Völker. Jede Gruppe wandert in einem bestimmten Gebiet. Ihr Weg wird in erster Linie durch die ökonomischen Erfordernisse des Sammelns und die Zufälle der Jagd diktiert, in zweiter Linie durch die Lage der Wasserstellen. […] Die Grenzen des Gebiets einer Gruppe werden strikt beachtet. Wenn sie zufällig oder absichtlich von einer anderen Gruppe verletzt werden, verteidigt die zugehörige Gruppe die Grenzen erbittert. […] Der Boden mit allem, was darauf wächst, gehört allen gemeinsam. Die Menschen kooperieren nach strengen Regeln bei der Jagd und teilen das erlegte Wild miteinander. Es gibt keine Reichen und keine Armen. Zwischen den Untergruppen eines Volkes ist Austausch an der Tagesordnung. Über die Grenzen des Territoriums hinweg kommt es zu freundschaftlichen Besuchen, werden Geschäfte abgewickelt und Ehen geschlossen.“37
Heutzutage leben wir in einer Massengesellschaft, begegnen täglich vielen fremden Menschen und treten mit einigen von ihnen in Kontakt. Trotzdem fühlen wir uns immer noch in Verbünden von der damaligen Größe am wohlsten. Schulklassen, Abteilungen in Firmen, viele Vereinsgruppen und andere Zusammenschlüsse haben eine Größe von zwanzig bis fünfzig Personen. Dies ist eine Zahl von Personen, zu denen man ein mehr oder weniger persönliches, freundschaftliches Verhältnis haben kann. Darüber und darunter wird es schwierig. Hat man über längere Zeit nur Kontakt zu wenigen Personen, so entsteht schnell Streit und Lagerkoller. Hat man auf Facebook achthundert Freunde, so wird man kaum von allen die Namen kennen.
Kontaktfreudigere Menschen hatten in den Städten in den letzten Jahrtausenden sicher größere Überlebenschancen als andere. Trotzdem gilt immer noch, dass jeder von uns gerne einen festen Freundeskreis hat und die Evolution noch nicht dorthin fortgeschritten ist, dass wir jedem Fremden genauso offen begegnen können wie guten Freunden. In diesem Sinne glaube ich, dass Menschen sich am wohlsten fühlen, wenn sie in einer Gruppe leben, die das Leben in einem Sozialverbund wie vor Entstehung der Zivilisation ermöglicht.
Unsere Mechanismen zur Entscheidungsfindung funktionieren gut in Gruppen von zwanzig bis fünfzig Personen. In größeren Gesellschaften kommen sehr leicht für Einzelne oder Teilgruppen schädliche Entscheidungen zustande, und Ignoranz und Ausnutzung nehmen zu, weshalb wir zur Regelung des Zusammenlebens zunächst Hierarchien und später demokratische Staatssysteme eingeführt haben.
Nutzen der Gemeinschaft
Heute ist es möglich, ohne allzu viele Sozialkontakte zu existieren. Steinzeitmenschen dagegen waren auf das Zusammenleben angewiesen. Eine Trennung von der Gruppe war mit größeren Risiken für den Einzelnen verbunden als heute. Damals hätte ein Verlassen der Gruppe in vielen Fällen den Tod bedeutet. Daher hatte die Gruppe bzw. das Rudel eine deutlich größere Bedeutung, und der Einzelne oder die Paarbeziehung waren wesentlich unbedeutender.38 Individualismus war noch nicht erfunden, die Gemeinschaft hatte Priorität. Das Zusammenleben in der Gruppe war von emotionalen Bindungen geprägt.39 Die „Gesellschaft“ wurde durch die sozialen Bindungen zusammengehalten und nicht durch ein Regelwerk wie heute. Der damalige Mensch gehorchte den Regeln des gemeinen Rechts der Gemeinschaft blinder noch als der moderne Mensch den Regeln des geschriebenen Rechts.40 Die Gemeinschaft war alles, der Einzelne war unbedeutend. Vorsteinzeitliche Clans hatten keine Anführer und fällten ihre Entscheidungen einstimmig.41 Aus den Clanverbänden gingen nach der Sesshaftwerdung die Dorfgemeinschaften hervor und blieben über lange Zeit das Hauptmodell der Gesellschaft.42
In den damaligen Clans gab es komplizierte Systeme, nach denen die Nahrung verteilt wurde, sodass alle versorgt waren. Die Alten, die sich nicht selbst versorgen konnten, wurden von den jüngeren Stammesmitgliedern miternährt, und sie bewahrten das Wissen und die Erfahrung der Gemeinschaft.43 In der Gruppe waren alle Altersklassen vertreten. Erfahrungen konnten leichter weitergegeben werden und gingen seltener verloren als heute. Dieser Austausch fehlt heute, wenn wir unsere alten Menschen im Altersheim unterbringen und sie dort unter sich bleiben.
Die Tradition der gegenseitigen Hilfe wurde in manchen Bereichen bis heute bewahrt: In der Landwirtschaft ist Nachbarschaftshilfe weitaus verbreiteter als in neueren Wirtschaftsbereichen.44 Auch Konrad Lorenz bestätigt die Bedeutung der Gemeinschaft für die steinzeitlichen Menschen. Er sagt, dass die Notwendigkeit, die Gemeinschaft nach außen zu verteidigen, den Zusammenhalt so gefördert habe, dass die Menschen die „zehn Gebote des Mosaischen Gesetzes“ von selbst eingehalten hätten. Sie hätten ihre Aggressionen nach außen abreagiert.45
Manche werden jetzt einwenden: Der Mensch war und ist egoistisch. Ja, das ist richtig, aber der Egoismus und das Bedürfnis nach Gemeinschaft stehen bei uns in einem Gleichgewicht. Wir sind keine Einzelgänger wie beispielsweise Eisbären oder Hamster, sondern können langfristig und überwiegend nur in Gruppen, in Kommunikation, in Zugehörigkeit und Verbindung mit anderen leben. Die Zusammenarbeit ist unsere Stärke und sie hatte damals Vorrang vor dem Wettbewerb.46 Handel, also die Idee von Leistung und Gegenleistung existierte in der Steinzeit nicht, und Freigiebigkeit war der Grundsatz des Gruppenlebens.47
Peter Kropotkin beschreibt zahllose Beispiele, wie Tiere durch Zusammenarbeit ihre Arterhaltung verbessern, und kommt zu dem Ergebnis, dass Zusammenarbeit ein stärkeres und häufiger auftretendes Prinzip der Natur ist als Konkurrenz. Kampf und Wettbewerb sind in der Tierwelt zwar vertreten, werden aber nur selten ausgelebt, zum Beispiel bei Revierkämpfen, bei Hierarchiekämpfen in einer Herde oder bei Kämpfen der Männchen um die Weibchen während der Paarungszeit. Da jeder Kampf Energie verbraucht und Risiken beinhaltet, ist es für die Arterhaltung von Vorteil, die Zahl der Kämpfe zu minimieren.
Auch Altruismus hatte früher einen anderen Stellenwert als heute. Vermutlich gab es wesentlich mehr altruistisches Handeln, denn zur Zeit des Clan-Lebens hatte man überwiegend mit Bekannten, Freunden und Verwandten aus der eigenen Gruppe zu tun, zu denen man eine mehr oder weniger enge Bindung hatte. Begegnungen mit fremden Menschen waren die Ausnahme.
Mütter trugen ihre Kinder, bis sie laufen und zumindest teilweise selbst nach Nahrung suchen konnten. Kinder wurden viel länger gestillt als heute.48 Kinder brauchten in solchen Gruppen weniger „Erziehung“. Die Eltern mussten sich nicht wie heutzutage ständig um sie kümmern, und dies vor allem nicht achtzehn Jahre lang. Die Kinder konnten sich in der Gruppe mit anderen Kindern beschäftigen und sich innerhalb der Gruppe frei bewegen, ohne dass die Aufsicht eines Elternteils benötigt wurde. Dadurch sozialisierten sie sich überwiegend gegenseitig, und es war weniger bedeutend als heute, ob die Eltern noch ein Paar waren oder sich trennten.49 Die Last der Aufsicht durch die Eltern war geringer, weil es im Rudel keine Gefahren gab und es ausreichend war, wenn sich einer oder wenige Erwachsene um alle Kinder des Rudels kümmerten. Weiterhin sind Kinder schon mit ungefähr vier Jahren ausreichend entwickelt, um sich teilweise selbst zu versorgen.50 Sie sind zwar noch nicht völlig selbständig und müssen noch das Jagen und andere Fähigkeiten erlernen. Sie sind aber nicht mehr völlig von den Eltern abhängig und in ihrer damaligen Gesellschaft selbständiger als ihre heutigen Altersgenossen.
Das Gruppenleben erleichtert die Weitergabe der Erfahrung von den Alten auf die Jungen und Heranwachsenden. Die alten Leute dienten als Speicher von Wissen und Erfahrung51 und sind es in Stammesgesellschaften noch heute. „Unter den Lebensbedingungen der Jäger und Sammler konnte der Wissensschatz einer einzigen Person von über 70 Jahren über das Überleben oder Verhungern bzw. die Niederlage des gesamten Clans entscheiden.“52
Das Leben in solchen kleinen Gruppen fördert das Gemeinschaftsdenken. Die Gemeinschaft regelt vieles automatisch, was wir in unserer heutigen Massengesellschaft in Gesetze gießen müssen, damit wir nicht über die Stränge schlagen. Die heutige Unpersönlichkeit der Verhältnisse zu den uns täglich begegnenden Personen sorgt dafür, dass unsere Hemmschwelle so weit sinkt, als seien es Mitglieder fremder, rivalisierender Clans. Die Massengesellschaft fördert unsere Rivalität, die – wie in Kapitel 2.5 näher ausgeführt – ursprünglich dazu diente, eine optimale Ausnutzung des Lebensraums zu erreichen, und sie verhindert auf diese Art Mitgefühl und verstärkt Distanz und Egoismus gegenüber unseren Mitmenschen.
Neugier, unser beständiges Streben, Gier, Neid und unser Gerechtigkeitssinn haben früher dazu gedient, möglichst viel Nahrung zu finden und diese möglichst gleichmäßig in der Gruppe zu verteilen, um das Überleben für möglichst viele zu sichern. Neid war der Motor unserer Weiterentwicklung und unseres Strebens.53 In unserer heutigen Marktwirtschaft befeuern diese Eigenschaften den Konsum und lassen uns danach streben, nicht weniger zu besitzen als unser Nachbar. Neid ist nicht nur ein negativ bewertetes Gefühl, das man sich der Volksmeinung folgend möglichst abgewöhnen sollte. Es ist auch eine Motivation für Leistung. Neid diente in archaischen Gesellschaften dazu, eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Nahrung zu erreichen.54 Andererseits hatte Neid eine natürliche Grenze: „Wenn sämtliche Rohmaterialien – Holz, Steine, Tierfelle – für die rudimentäre Technologie leicht verfügbar sind, werden Diebstähle so überflüssig wie der Versuch, andere durch den eigenen Reichtum zu übertrumpfen.“55
Die Gemeinschaft bietet einen guten Schutz vor dem Egoismus Einzelner, sodass die Auswirkungen von Neid, Gier und Egoismus im Clan-Leben begrenzt sind und in erster Linie dazu dienen, dass alle ausreichend versorgt werden: Einzelne in einer neolithischen menschlichen Gemeinschaft, die andere unterwerfen, ausbeuten oder für sich arbeiten lassen wollen, werden damit nicht weit kommen. Gegenüber einem Außenseiter sind sie vielleicht noch erfolgreich, aber auch in dieser relativ eindeutigen Situation laufen sie schon Gefahr, dass der Außenseiter von anderen Gruppenmitgliedern in Schutz genommen wird. Immerhin haben Menschen auch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, und das nicht ohne Grund.56
Konstruiert man den Fall, dass sich mehrere zusammenschließen, um sich das Leben dadurch zu erleichtern, dass sie auf Kosten anderer leben, so ist die restliche Gruppe immer noch größer, und sie verlieren mehr, als sie gewinnen. Wenn eine ganze Gruppe (vor Erfindung der Waffen) beschlossen hätte, nur noch auf Kosten anderer durch Morden und Rauben zu leben, so wäre sie auf heftigen Widerstand gestoßen. Sie wäre wahrscheinlich schnell zu der Einsicht gelangt, dass es leichter ist, selbst zu jagen und zu sammeln, als ständig andere zu berauben, da bei jedem Überfall das Risiko besteht, dass eigene Gruppenmitglieder den Tod finden. Außerdem setzt ein Raubzug voraus, dass es etwas zu holen gibt – und dies war erst mit dem Anlegen von Vorräten, also der Entstehung von Besitz nach der Sesshaftwerdung des Menschen in größerem Maße gegeben. Davor gab es bei anderen Clans kaum mehr zu rauben als das Ergebnis des täglichen Jagens und Sammelns.
Auch abtrünnige Steinzeitmenschen, die beschließen, durch Diebstahl und Raub bei anderen Clans ihre Nahrung zu beschaffen, haben ein größeres Verletzungsrisiko und haben fast nur Gegner und wenige Freunde, sodass es sich eher lohnt, den Lebensunterhalt selbst zu erarbeiten. In der damaligen Welt ergab sich aus den menschlichen Eigenschaften und der Lebensweise, dass der Versuch der Ausnutzung anderer relativ unergiebig war. Erst wenn die Waffen und die Kampftechnik der Räuber deutlich überlegen sind und es bei den potentiellen Opfern ausreichend Beute (Besitz) gibt, steigen ihre Chancen. Dies ist ein möglicher Grund, warum es Jahrtausende dauerte, bis das Rauben und das Leben auf Kosten anderer unter den Menschen zunahmen.
Kropotkin schreibt, die Dorfmark (also die Gemeinschaft) sei die stärkste Waffe im Kampf gegen die Unterdrückung durch die Listigsten oder Stärksten gewesen. Das enge Zusammenleben habe dafür gesorgt, dass der Egoismus im Zaum gehalten wurde.57 Rache war der Sanktionsmechanismus für Fehlverhalten. „Eine Gemeinschaft ohne Sanktion hätte aber irgendwann dazu geführt, dass die Egoisten die Gutwilligen ungestraft ausnützen.“58 Die Rache war also der steinzeitliche Vorläufer der heutigen Gerichtsbarkeit.
Ein weiterer Grund für die Stärke damaliger Gemeinschaften liegt aber nicht darin, dass Abtrünnige keine Chance hatten, sondern dass der Zusammenhalt so stark war, dass es kaum Abtrünnige gab. Es kam aufgrund des Verbundenheitsgefühls der Gruppenmitglieder untereinander, das damals viel stärker war als heute (siehe Kapitel 2.8), selten jemand auf die Idee, andere auszunutzen.
Die Verbreitung von Ausbeutung, Rücksichtslosigkeit, Ignoranz, Egoismus, Umweltzerstörung, von Hunger als Gegensatz zu Überfluss, Armut als Gegensatz zu Reichtum usw. ist erst möglich geworden, als wir die Gemeinschaften der Clans verlassen haben und die Individualisierung zugenommen hat. Zuvor gab es keinen Besitz und keine solchen Missstände, die heute viele wahrnehmen und anprangern. In einer Clangemeinschaft war das Verhältnis zu den anderen Clanmitgliedern zu eng, als dass es Raum für Rücksichtslosigkeit oder Besitzanhäufung gegeben hätte. Dies entsprang keiner bewussten Entscheidung oder Abwägung. Man fühlte sich den anderen viel zu verbunden, als dass man auf diese Art gegen sie hätte handeln können – genauso wie kaum jemand seine Kinder oder Eltern bestehlen, ausbeuten oder bekämpfen würde. Wer heute an der Seite der anderen gejagt hat, gestern mit ihnen zusammen gehungert hat und morgen vielleicht ihre Unterstützung braucht, wenn man plötzlich einem Wolfsrudel gegenübersteht, kommt kaum auf die Idee, sie zu bestehlen oder zu betrügen, sich auf ihre Kosten zu bereichern oder sie sonstwie zu beeinträchtigen. Auch wird es kaum Raum für Ungerechtigkeiten oder Ungleichverteilung geben. Wer so eng mit den anderen zusammenlebt, sich ihnen so verbunden fühlt und so auf sie angewiesen ist, wird sich nicht satt essen, ohne an die anderen zu denken.59 Streitigkeiten werden selten vorgekommen sein, und wenn sie einmal in Gewalt ausgeartet waren, werden die Gewalttäter sich wahrscheinlich schnell für ihr Verhalten geschämt haben, wenn sie sich wieder daran erinnerten, wie nahe ihnen die anderen standen. Kein Mitglied der Gruppe würde einem anderen Faulheit und Egoismus unterstellen, denn niemand in der Gruppe würde durch solche Eigenschaften anderen schaden, und alle fühlten das. Darauf gründete sich ihre Verbundenheit.
Wenn heutzutage einige Kinder auf einem Schulhof ein anderes hänseln oder wenn ein Manager einen Mitarbeiter entlässt, dann bleibt dieses Handeln aus zwei Gründen für die Handelnden folgenlos: Die Betroffenen können sich nur schwer dagegen wehren, und die Handelnden sind kaum auf sie oder ihre Meinung über sie angewiesen, weil sie zu den Leidtragenden in der Regel in keinem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Der Rest der Gesellschaft wird dieses Handeln selten sanktionieren, weil er in keinem persönlichen Verhältnis zu dem einen oder anderen steht. In einer steinzeitlichen Gruppe oder einem mittelalterlichen Dorf wäre so ein Verhalten unmöglich gewesen. Der enge Zusammenhalt verhinderte automatisch übergriffige Handlungen – ohne dass es den Betroffenen dazu bewusst werden musste, dass ein Fehlverhalten sich in einer Notsituation rächen kann. Der ständige Kampf gegeneinander (Wettbewerb) ist erst durch die Auflösung der Dorfgemeinschaften und die Schaffung einer großstädtischen Gesellschaft entfesselt worden. In steinzeitlichen Clans beschränkte sich Wettbewerb auf wenige Situationen, wie die Konkurrenz um Geschlechtspartner, war aber kein immer präsentes Element der Gesellschaft wie bei uns heute.
Der Beginn der Zivilisation
Die neolithische Revolution war ein wichtiger Schritt in der Menschwerdung und wird als der Beginn der Zivilisation angesehen. Der homo sapiens ist vor zweihunderttausend Jahren in Ostafrika aufgetreten und lebte bis zur neolithischen Revolution ausschließlich als Jäger und Sammler. Diese bezeichnet die Sesshaftwerdung und die Erfindung von Ackerbau und Viehzucht und begann frühestens vor ca. zwanzigtausend Jahren im Nahen Osten, und die letzten Regionen entdeckten den Ackerbau vor fünf- bis dreitausend Jahren (im Afrika südlich der Sahara und auf dem amerikanischen Kontinent). Damit ging die Bildung von Städten einher. Vor Ackerbau und Viehzucht musste die solare Energie, von der wir letztendlich leben, dezentral, also durch Jagen und Sammeln, eingefangen werden. Danach gab es die erste Überschussproduktion, sodass Menschen überhaupt in Städten leben konnten.60 Jared Diamond schreibt: „Für die meisten Menschen brachte die Landwirtschaft Infektionskrankheiten, Fehlernährung und eine verkürzte Lebenserwartung. Zu den allgemeinen Veränderungen zählte, daß sich das relative Los der Frauen verschlechterte und die Klassengesellschaft begründet wurde.“ Die Landwirtschaft verbesserte nicht den Ertrag pro Person, sondern den Ertrag pro nutzbare Flächeneinheit. Menschen mussten in der Landwirtschaft mehr Arbeit für ihre Ernährung aufwenden, aber durch die höhere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Fläche und die Möglichkeit der Lagerung beispielsweise von Getreide wurden eine höhere Bevölkerungsdichte und größere Ansiedlungen möglich. Nomaden (Jäger und Sammler) leben seither nur noch in Gegenden, in denen Landwirtschaft nicht möglich ist.61
Jean Ziegler fasst es so zusammen: „Es ist charakteristisch für die neolithische Revolution, die sich über mehrere Jahrtausende hinzog, dass es den Menschen gelang, die Natur ihren Bedürfnissen zu unterwerfen: durch die Produktion von Nahrungsmitteln mit Ackerbau und die Domestizierung von Tieren und Viehzucht; durch die Entdeckung des Metalls, was die Herstellung von Werkzeugen und die Bearbeitung der Erde (die Hacke) möglich machte, und von Töpfen zur Aufbewahrung der Erzeugnisse; durch feste Siedlungen in Dörfern, entweder im Zuge der Sesshaftigkeit oder zur Stabilisierung einer insgesamt nomadischen Lebensweise; durch die Bildung von Reserven, also Reichtum, woraus erbliche Macht und die ersten Kriege entstanden; und schließlich durch eine demografische Explosion…“62
Der Sinn des Lebens und die Suche nach dem Glück
Die Frage nach dem Sinn des Lebens wird meist als eine Frage nach dem Zweck oder Ziel des Lebens verstanden. Es gibt viele unterschiedliche Meinungen, was der Sinn des Lebens sei. Aus philosophischer oder religiöser Sicht kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn man von der Moral ausgeht, ebenfalls. All diese Ansätze gehen von einer menschlichen Perspektive aus. Es gibt aber noch eine objektivere Möglichkeit, den Sinn des Lebens zu definieren. Der Mensch hat sich durch Evolution zu dem entwickelt, was er ist. Damit ergibt sich ein möglicher Sinn aus dem, wozu wir geschaffen wurden, wofür uns die Natur optimiert hat: Das Ziel der menschlichen Evolution, der Sinn des menschlichen Lebens ist das Überleben der menschlichen Art. Sinndefinitionen, die über die Arterhaltung hinausgehen, sind erst durch die Reflexion des Menschen über sich selbst möglich geworden.
Die Evolution hat dem Menschen Mechanismen zur Steuerung mitgegeben, um die Aufgabe der Arterhaltung möglichst gut zu erfüllen. Der einfachste ist der Schmerz. Wenn etwas wehtut, meiden wir es in Zukunft. Wohlbefinden und Unwohlsein steuern uns so, dass wir Gefahren aus dem Weg gehen und nach dem streben, was uns nützt. Glück gehört ebenso dazu. Wenn wir die richtigen Dinge tun, fühlen wir uns glücklich.63 Das erklärt, warum wir vor Geschenken und Neuanschaffungen lange Vorfreude empfinden können, die Freude danach aber oft schnell nachlässt. Ein erreichter Erfolg ist somit im Moment des Eintretens uninteressant geworden, und unsere Aufmerksamkeit soll auf die nächste Optimierungsmöglichkeit gelenkt werden. Solche Gefühle steuern uns in einem natürlichen Umfeld so, dass die Arterhaltung optimiert wird. In unserer heutigen Gesellschaft treibt das leider auch sinnlosen Konsum an.
Diese Mechanismen können wir nicht umgehen. Sie sind tief in unseren Genen verankert. Die Evolution hat uns über Millionen von Generationen genetisch auf das vorbereitet, was uns erwartet – den Zustand vor etwa zehntausend Jahren, in dem Menschen lebten, bevor die Zivilisation begann. Wir kommen mit einer Erwartung an diese Zustände und an mögliche Erlebnisse auf die Welt (siehe Kapitel 2.4). Wir sind durch Evolution nicht nur in der körperlichen, sondern auch in der geistigen Struktur auf das vorbereitet, was die Generationen vor uns erlebten. Die Art, wie wir nach Glück streben, dient den Zielen der Evolution.64
Wenn wir uns in einen Zustand des Zusammenlebens begeben, der dem damaligen nahekommt, fühlen wir uns besser, als wenn wir uns von der damaligen Lebensweise entfernen.
Individualismus und unsere Entwicklung haben sich in den letzten Jahrhunderten gegenseitig angetrieben und den technischen und gesellschaftlichen Fortschritt befeuert (siehe Kapitel 2.8). In unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem wird uns ständig suggeriert, dass wir umso besser sind, je unabhängiger und individueller wir sind, dass jeder seines Glückes Schmied und dass Flexibilität (das Gegenteil von festen Beziehungen) oberstes Gebot sei. Trotzdem sind wir keine Einzelgänger und sind nicht völlig unabhängig von anderen.
Unser heutiges Wirtschaftssystem treibt uns dazu, den Sinn des Lebens oder unser Glück in der Beschleunigung des Fortschritts, in Leistung, mehr Arbeit, mehr Vermögen, Besitz und Macht zu suchen. Die Verfolgung dieser Werte führt aber auch zu den oben genannten negativen Gefühlen, sie laugt uns aus und reduziert unsere sozialen Beziehungen – sie führt also nicht eindeutig zu mehr Glück. Fortschritt und Leistung machen nicht an sich glücklich, sondern höchstens indirekt über die dadurch erzielten Erfolge. Arbeit macht nur glücklich, wenn man das Ergebnis seines Tuns genießen kann. Das setzt voraus, dass die eigene Leistung sichtbar ist und dass man die Zeit hat, sich darüber zu freuen und etwas auszuruhen. Wenn – wie bei uns üblich – nach einer Aufgabe sofort die nächste kommt, bekommt man das Gefühl, in einem Hamsterrad zu laufen, und kann den Erfolg kaum genießen.
Egoismus und Rücksichtslosigkeit
Wie bereits erwähnt, hat uns die Evolution die richtigen Mengen an Egoismus und Altruismus mitgegeben, die wir benötigten, um bis hierher zu kommen. In unserer heutigen Gesellschaftsstruktur kann sich der Egoismus viel stärker entfalten. Viele Menschen kümmern sich nur um ihr Eigentum und wenige auch um das Allgemeingut. Mietwagen, öffentliche Toiletten und Parkbänke werden ohne Hemmungen schlecht behandelt und dreckig hinterlassen, und unsere Sozialsysteme werden von vielen ausgenutzt – man nimmt halt, was man kriegen kann. Auch wenn wir mit steigendem Grad der Zivilisation mehr Selbstbeherrschung erlernen werden, so bleibt der Egoismus eine Grundeigenschaft des Menschen, die wir bei unseren Entscheidungen berücksichtigen müssen.
Es hat wenig Sinn, sich darüber zu ärgern oder zu wundern oder daran die Schlechtigkeit der Menschheit abzulesen oder mehr Disziplin zu fordern. Es käme auch niemand auf die Idee, Vögel als schlecht zu bezeichnen, weil sie beim Fressen von Körnern den größten Teil davon auf den Boden fallenlassen. Sie gehen mit den Ressourcen ebensowenig „schlecht“ um wie wir Menschen – sie tun, was ihnen die Natur mitgegeben hat, und das ist (im Ursprungszustand) ihrer Arterhaltung förderlich. Dazu gehört auch, dass ihr Lebensraum dadurch nicht bedrohlich geschädigt wird. Ein Biber, der so viele Bäume abnagt, dass aus seinem Wald eine Steppe wird, wird seine Art nicht erhalten können.
Unser negatives Urteil über derartiges menschliches Handeln hat verschiedene Gründe. Wir sind in der Lage, Verschwendung besser zu erkennen und zu verhindern als Tiere. Eine Amsel, die die Hälfte der Beeren, die sie fressen will, fallenlässt, kann dies nicht durch Erkenntnis und Beschluss unterlassen, weil ihr die Erkenntnisfähigkeit und das bewusste Handeln fehlen. Andererseits hat sie dadurch offenbar so wenig Nachteile in Bezug auf die Arterhaltung, dass sie ein leistungsfähigeres Gehirn, mit dem sie weniger Verschwendung erreichen könnte, mehr kosten als es ihr nutzen würde.
Wir nutzen unser „Revier“ stärker aus, so dass Verschwendung eine andere Bedeutung bekommt. Die Amsel hat wenig davon, wenn sie weniger Beeren fallen lässt, die dann ohnehin am Strauch verfaulen. In unserer Welt bedeutet die Verschwendung des Einen oft den Mangel des Anderen. Außerdem erzeugt eine Amsel keinen „Müll“, wenn sie angefressene Beeren fallenlässt. Erst wir haben mit Kunststoffen, Chemikalien und Giftstoffen Dinge erzeugt, die man nicht an jeder beliebigen Stelle fallenlassen kann, ohne die Umwelt zu beeinträchtigen. Und in Bezug auf Rohstoffe nutzen wir nicht nachwachsende Rohstoffe auf dieselbe Art wie nachwachsende, obwohl die Begrenztheit der ersten ein anderes Verhalten erfordert als das der Amsel.
Vielfalt, Mut und Angst
Wenn die Natur gewollt hätte, dass wir alle gleich seien, hätte sie uns so geschaffen. Dann wäre ein Mensch dem anderen so ähnlich wie für uns eine Ameise der anderen. Wenn es in einer steinzeitlichen Gruppe Menschen gibt, die sich mehr für die Jagd interessieren, andere eher ruhig sind und mehr beobachten und nachdenken, wieder andere neugierig sind und vieles sammeln, dann führt das zu einer Arbeitsteilung, bei der sich jede und jeder auf das konzentriert, was sie oder er besonders gut kann. Es wird Tätigkeiten geben, die unerlässlich sind und von jedem ausgeführt werden, und solche, die nur von wenigen beherrscht werden. Wir sind so, wie wir sind, weil dies optimal für die Arterhaltung war. Und dazu gehört, dass die Evolution uns hat unterschiedlich werden lassen, damit wir einander ergänzen können. So gesehen, hat die Natur die Arbeitsteilung erfunden, nicht der Mensch.
Gäbe es nur ausgeprägt mutige Menschen, so hätten sie sich auf den nächsten Bären gestürzt und wären tot. Wären alle Menschen ausgeprägt ängstlich, so wären sie nicht auf die Jagd gegangen und anschließend verhungert. In einem modernen Team braucht man Pessimisten und Optimisten, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ein Optimist sieht zu wenig die Gefahren, ein Pessimist zu wenig die Chancen. Wären alle in gleichem Maße ausgeprägt neugierig, gierig, schnell, so hätte das einen steinzeitlichen Clan eher aussterben lassen.
Auch wenn man uns (was manche denken) in schöne, mutige Starke gegenüber den hässlichen, ängstlichen Schwachen einteilen könnte, gäbe es uns nicht mehr. Wären alle besonders Intelligenten auch gleichzeitig besonders mutig, wären vielleicht alle Intelligenten von einem Bären getötet worden. Daher ist es von Vorteil, wenn die Fähigkeiten eher zufällig und unregelmäßig verteilt sind. Wir stammen von den Vorfahren ab, die nicht ausgestorben sind, und das waren offensichtlich die, bei denen mehr Vielfalt herrschte.
Ebenso strebt die Evolution nicht grundsätzlich nach mehr von allem, sondern nach einem optimalen Maß. Jedes Mehr bedeutet auch mehr Energieaufwand, und dies ist in einer natürlichen Umgebung ein Nachteil bezüglich der Arterhaltung. Beim Menschen ist die körperliche Kraft ein solches Beispiel. Unsere Muskeln sind deutlich schwächer als die unserer nächsten Verwandten, der Menschenaffen. Unsere Vorfahren waren wesentlich stärker, sie hatten mehr Muskelkraft bei vergleichbar großen Muskeln, so wie es bei Affen heute noch der Fall ist. Es gibt auch heute noch einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die körperlich wesentlich leistungsfähiger sind als der Durchschnitt – manche sogar bis ins hohe Alter. Trotzdem setzt sich diese Eigenschaft nicht genetisch durch. Es scheint aus Sicht der Evolution ausreichend, wenn einige wenige mehr Kraft besitzen. Die Regel vom Schulhof, dass sich der Stärkste durchsetzt, scheint nicht optimal für unsere Arterhaltung zu sein.
Jagd, Sport und Spiel
Alle Tiere und auch wir Menschen werden vom Instinkt zu bestimmten Verhaltensweisen gedrängt. Dazu gehören die Ernährung und das Vermeiden von Schmerzen, aber auch das Jagen und Sammeln.
Ein Beispiel der Autorin Jean Liedloff zeigt, wie stark diese Instinkte sein können: „Ein Kapuzineraffenweibchen, das ich von meiner ersten Expedition mitgebracht hatte, pflegte so viel von ihrer (geschälten und von mir servierten) Banane zu essen, wie sie zu ihrer Mahlzeit wollte. Dann, während sie sich deutlich den Anschein gab, nichts Besonderes zu tun, wickelte sie den Rest in eine Papierserviette, wobei sie umherblickte, als merke sie nicht, was ihre Hände taten. Anschließend umkreiste sie den Ort in der Haltung eines zufälligen Spaziergängers, entdeckte plötzlich das geheimnisvolle Päckchen und riss mit allen Zeichen steigender Erregung das Einwickelpapier von dem Schatz, den es beherbergte. Siehe da! Eine halbaufgegessene Banane! Potztausend! Aber dann erlahmte die Pantomime für gewöhnlich. Sie hatte gerade zu Mittag gegessen und brachte es nicht über sich, über diese Beute herzufallen. Sie wickelte die zerfledderte Banane wieder in die Papierfetzen und begann erneut mit ihrer Vorstellung. Sie überzeugte mich davon, dass ihr Trieb, ihr Bedürfnis, Nahrungsbehälter wie Obst- oder Nussschalen zu suchen und zu öffnen, völlig getrennt und unabhängig von ihrem Impuls nach Nahrungsaufnahme existierte. Ich hatte die Nahrungssuche und das Schälen in freundlicher Absicht aus der Abfolge herausgetrennt, die die Natur ihren entwicklungsgeschichtlichen Vorfahren seit je abverlangt hatte (und die ihre Erwartungshaltung erfüllt hätte). Ich hatte gemeint, ihr ‚Mühe zu ersparen’. Doch damals verstand ich das Kontinuum noch nicht. Sie folgte ihrem stärkeren Impuls zuerst und fraß die Nahrung. Indem der Impuls sich mit der Sättigung verringerte, kam der nächststarke zum Vorschein. Sie wollte jagen. […] Der wahre Gegenstand des Jagdverhaltens war die Befriedigung des Bedürfnisses nach der Jagderfahrung selbst“.65
Jeder, der Katzen im Haus hält, kennt dieses Verhalten: Sie wollen „jagen spielen“, um die Jagd zu trainieren und in Übung zu bleiben.66 Sie tun das, weil ihr Trieb sie dazu anhält, auch wenn sie davor gefüttert wurden – satt zu sein reicht ihnen nicht. Vermutlich bleiben solche Triebe unabhängig von ihrer Befriedigung erhalten, damit die Fähigkeit zum Jagen auch in fetten Zeiten bewahrt wird, weil wieder schlechtere Zeiten kommen können.
Ebenso verhält es sich, wenn wir wandern, spielen, Sport treiben, shoppen gehen oder verreisen. Beispielsweise ist der Hauptgrund für sportliche Betätigung nicht die rationale Erkenntnis des Zwecks der Gesunderhaltung. Wäre die Entscheidung zum Treiben von Sport rein rational, so würden sich viel mehr Menschen sportlich betätigen. Gerade der ungleich verteilte Bewegungsdrang sorgt dafür, dass manche mehr Spaß am Sport haben und ihnen die Betätigung leichter fällt. Es verhält sich nicht wie mit der jährlichen zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchung, für die wir uns bewusst entscheiden – sportliche Betätigung, Wandern, Spielen, Shoppen, Sammeln werden in den wenigsten Fällen durch eine rein rationale Entscheidung initiiert. Vergleichen Sie einmal, mit welchem Gefühl Sie zum Zahnarzt oder zum Fußball, Tennis oder Joggen gehen! Es treiben überwiegend die Menschen Sport, die von ihrem Instinkt und ihren Trieben dazu bewegt werden, und das sind überwiegend jüngere Menschen und häufiger Männer als Frauen. Und die wenigen, die sich aus einer Vernunftentscheidung heraus im Fitnessstudio anmelden, sind die liebsten Kunden der Studios, denn sie schließen meist ein Abo für ein Jahr ab und kommen dann nur zwei, drei Male. Wandern, Spielen, Sport treiben, Shoppen gehen oder Reisen befriedigen unser Bedürfnis nach Jagen, Sammeln, Revierkampf und Nomadentum. Auch wenn sie rationalen Nutzen haben, so ist die Ratio nicht der alleinige Auslöser. Allgemein könnte man sagen, dass die meisten Freizeitbeschäftigungen auch der Befriedigung von Trieben dienen, die aufgrund unserer Lebensweise zu kurz kommen.
Frauen haben meist mehr Freude am Shoppen als Männer, da ihre Rolle in unserer Frühgeschichte eher die der Sammler war – das wissen wir seit dem Theaterstück „Caveman“.67 Wenn Shoppen nur dazu diente, sich Dinge anzuschaffen, die einem nützen, würde äußerst selten jemand etwas anschaffen, was sich schon beim Auspacken zu Hause als nutzlos erweist oder uns nicht mehr gefällt. Aber wir alle kennen das Gefühl, etwas gekauft zu haben und den Kauf schon nach kurzer Zeit zu bereuen. Wie viele Dinge werden nur ein, zwei Male benutzt und nach einigen Jahren weggeworfen! Das ist ein starker Hinweis darauf, dass wir hier mehr den Trieb des Sammelns befriedigen und der tatsächliche Nutzen der gekauften Sachen höchstens eine Teilursache des Kaufs ist.68
Stress und Faulheit
Menschen hatten vor Beginn unserer Zivilisation als Jäger und Sammler sicher auch Stress, wenn sich ein Wolfsrudel in ihrer Nähe aufhielt oder wenn der Winter zu lang wurde und die Nahrung lange knapp blieb. Im Unterschied zu vielen berufstätigen Menschen heute hatten sie aber nicht tagtäglich ununterbrochen Stress. (Sonst würden wir uns bei Stress nicht so unwohl fühlen.) Etwas Ähnliches gilt für die Arbeit: Tiere müssen wie wir für ihr Auskommen „arbeiten“, aber kein Tier muss das rund um die Uhr tun. Alle Lebewesen auf der Erde können fast immer all ihre Bedürfnisse mit relativ geringem Aufwand befriedigen. Keine Katze jagt den ganzen Tag, keine Fliege fliegt von Kackhaufen zu Kackhaufen, keine Schnecke frisst rund um die Uhr Blätter. In Notsituationen wie harten Wintern, Dürreperioden und in entlegenen Winkeln der Welt oder in Ausnahmezeiten wie bei der Aufzucht der Jungen kommen einzelne Tiere an ihre Grenzen und sterben, obwohl sie ununterbrochen auf Nahrungssuche sind. Diese Phasen sind aber Ausnahmen. Arten, die ihre gesamte Zeit auf Nahrungssuche verwenden mussten, sind ausgestorben, als die erste Nahrungsknappheit eintrat. Solche Arten, die den ganzen Tag ums Überleben kämpfen müssen, sind nicht überlebensfähig, weil sie zu unflexibel sind. So sind alle Lebewesen mit überschüssiger Zeit ausgestattet. Dauerstress gefährdet die Arterhaltung, weil er mit erhöhtem Energieverbrauch verbunden ist. Müßiggang ist von der Natur eingeplant, und alle Tiere und auch wir Menschen sind daran angepasst. In der Steinzeit gab es immer lange Phasen, in denen genug zu essen zu finden war und man sich häufig ausruhen konnte. Wer sich kontinuierlich verausgaben muss, hat ein höheres Risiko, im unpassenden Moment keine Reserven mehr zu haben.
Die Evolution hat uns nicht so gestaltet, dass wir möglichst viel tun wollen, sondern dass wir das, was nötig ist, möglichst effizient tun wollen. Das Streben nach Nichtstun ist in uns angelegt, um uns ein Gegengewicht zu den Zwängen der Nahrungssuche zu geben, damit wir uns darum bemühen, dies möglichst effizient zu tun und es nicht zum Selbstzweck werden zu lassen. Zeiten der Erholung und des Nachdenkens sind wichtig für uns, und dafür wurde uns ein Streben nach Müßiggang eingepflanzt. Daher denke ich, dass wir für andauernden Stress nicht vorbereitet sind und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir darunter leiden und krank werden. Wozu hätte die Evolution uns auf Dauerstress vorbereiten sollen, wenn dieser normalerweise nicht vorkommt? Grundsätzlich ist der Mensch nicht für das ständige zielgerichtete Arbeiten und für die ständige Lösung großer Probleme geschaffen worden.
Viele Menschen arbeiten in ihren Berufen so, als sei dauernd Ausnahmezustand – manche freiwillig, manche gezwungenermaßen. Dieser immerwährende Notstand entsteht auch, weil der Wettbewerb von uns verlangt, dass wir unsere Arbeitsprozesse kontinuierlich straffen, damit Effizienz und Rendite ansteigen. Wer weniger oder langsamer arbeitet, gehört zu den Verlierern. Derzeit ist diese hohe Schlagzahl vielleicht von einem Teil der Menschen gewünscht, weil sie uns Vorteile wie den technischen Fortschritt bringt. Ich denke, die Mehrheit wünscht sich etwas anderes oder hat sich noch nie Gedanken darüber gemacht, ob auch ein Leben ohne diese dauerhafte Überanstrengung möglich sei. Der Wettbewerb in der Berufswelt führt leider dazu, dass derjenige die Latte für alle anderen höher legt, der bei den gefragten Eigenschaften am leistungsfähigsten ist. Dass alle über einen Kamm geschoren werden, wird der oben beschriebenen Unterschiedlichkeit nicht gerecht, lässt viele von uns im Berufsleben übermäßig verschleißen und verschwendet Potentiale, die unter anderen Bedingungen besser genutzt werden könnten. Unsere Arbeitswelt müsste nicht so sein, und wir könnten eine andere Lebensweise wählen, wenn wir das wollten, denn für die westliche Welt gilt, dass wir wesentlich mehr produzieren, als wir benötigen. Was wir wirklich zum Leben bräuchten, wenn wir uns auf Nahrungsbeschaffung und den Komfort des Mittelalters beschränken würden, könnten wir heutzutage in wenigen Minuten pro Tag erwirtschaften, und es wäre genug für die gesamte Menschheit da. Ein großer Teil unserer Anstrengung dient der Schaffung von Wohlstand und Fortschritt, der Befriedigung von Wünschen, dem Machtstreben, dem Geltungsdrang oder dem Besitzstreben.
Tiere zeigen ein solch unnatürlich hohes Maß an Anstrengung nur in Ausnahmesituationen, wir zeigen es ununterbrochen. Die große Zahl an Zielen, nach denen wir streben, von denen die meisten unnötig sind oder Zirkelschlüsse – „Ich arbeite mehr, damit ich mehr verdiene, damit ich mich von der Arbeit erholen kann oder mir etwas leisten kann, das mir das Leben erleichtert.“ – zeigen, dass wir nicht im inneren Gleichgewicht sind und auch gefühlsmäßig in einer ständigen Notsituation leben. Wenn die Natur von uns diese hohe Ausnutzung der Zeit gewünscht hätte, dann würden auch viele andere Tiere sich so verhalten, und auch wir hätten schon immer so gehandelt, weil es ja für die Arterhaltung sinnvoll wäre.
Ähnliches gilt für unsere Flexibilität, die in der heutigen Zeit stark beansprucht wird. Neolithische Menschen mussten sich nicht in kurzen Abständen immer wieder auf Neues einstellen. Ihr Leben lief über lange Zeiträume in bekannten Bahnen. Heute müssen sich viele Berufstätige vor allem aufgrund der technologischen Entwicklung, aber auch wegen eines Wechsels ihres Arbeitsplatzes oder Aufgabengebiets ständig an neue Bedingungen, Gruppen und Lebensräume anpassen. Dieses hohe Maß an geforderter Flexibilität laugt uns aus, weil uns die Evolution nicht dafür geschaffen hat. Im Leben früherer Generationen vor der Zivilisation gab es auch Phasen der Anpassung, aber meist nicht über mehrere Generationen hinweg, sondern zeitlich eng begrenzt und vor allem viel seltener.
Sexualität und außerehelicher Geschlechtsverkehr
Auch bei der Sexualität bringen wir aus unserer Geschichte Eigenschaften mit, deren Auswirkungen wir bei der Ausgestaltung unserer Gesellschaft nicht berücksichtigt haben. Die Lust ist unter den Menschen sehr ungleich verteilt – es gibt Monogame und Polygame, manche wünschen sich Sex mit vielen verschiedenen Menschen, andere wünschen sich mehrere Beziehungen, und ich schätze, ungefähr die Hälfte aller Menschen ist tatsächlich lebenslang monogam. Jedenfalls ist der Wunsch nach Sex und nach Häufigkeit, Dauer und Intensität ungleich verteilt. Es ist statistisch belegt, dass zwischen fünf und dreißig Prozent der Babys in den USA und Großbritannien Kuckuckskinder sind.69 Fremdgehen gehört zur Menschheit, selbst wenn dauerhafte Treue für die Mehrheit kein Problem darstellt.
Dass man sich zwischen Freiheit und Geborgenheit entscheiden muss, dass der, der viele wechselnde Bekanntschaften hat, weniger Geborgenheit bekommt, und dass der, der eine feste Beziehung hat, einen Teil seiner Freiheit einbüßt, ist vielen klar. Manche bemerken, dass sie auch in einer Beziehung den Wunsch nach Sex mit anderen haben, und ganz wenige gestehen sich das zu. Wieder andere haben diesen Wunsch gar nicht. Dass es nicht einen richtigen Weg gibt, dass die Vielfalt auch in der Sexualität ein Prinzip der Arterhaltung der Menschheit ist und dass unterschiedliche Menschen im Sinne der Evolution in Bezug auf die Sexualität unterschiedliche Rollen in der menschlichen Gesellschaft haben, ist meines Erachtens den wenigsten von unbewusst.
Aus Sicht der Spieltheorie gibt es zwei Prinzipien: Die Frau möchte sich mit dem Besten paaren, also sollte sie bei Gelegenheit mit einem attraktiveren fremdgehen, wenn sie sich der Unterstützung ihres Partners sicher sein kann. Der Mann möchte, dass seine Gene weitergegeben werden. Daher sollte der Mann sich mit weiteren Frauen paaren, und damit seine Chancen erhöhen, seine Gene weiterzugeben. Fremdgehen ist ein natürliches Programm zur Effizienzsteigerung.
Es erscheint mir, dass es für das Überleben einer steinzeitlichen Gruppe wichtig war, dass manche viel Lust auf andere hatten und die Gene sich durchmischten. Promiskuität führt dazu, dass der Genpool aufgefrischt wird. Dies kann gerade vor der neolithischen Revolution wichtig gewesen sein, denn die damaligen Clans hatten untereinander wenig Kontakt und konkurrierten um ihre Reviere, sodass die Gefahr bestand, dass die genetische Vielfalt innerhalb einer Gruppe für die Arterhaltung zu gering war. Es war ebenso wichtig, dass es feste Beziehungen gab, die Ruhe und Konstanz in die Gruppe brachten, denn zu viel Promiskuität kann dazu führen, dass der Zusammenhalt der Gruppe zu gering wird und sie zerfällt. Daher ist Monogamie ebenso wichtig. Sich für das eine oder das andere zu entscheiden oder jedem gleich viel von beiden Eigenschaften mitzugeben, ist für Menschen offenbar schlechter, als die beiden Eigenschaften ungleich auf die Menschen zu verteilen – so werden beide Funktionen erfüllt. So entwickelten sich verschiedene Charaktere, von denen weder der eine noch der andere „besser“ ist, sondern die gleichermaßen wichtig für die Arterhaltung sind.
Jean Ziegler schreibt: „Bevor der Mensch liebt, liebt er das Land, auf dem er lebt. Der Mensch im Paläolithikum definierte […] höchstwahrscheinlich ein bestimmtes Territorium als sein eigenes, stellte sich die Welt als Funktion des Territoriums vor, sprach ihm feste Grenzen zu, verteidigte sie mit seinem Leben, verließ seine Frau und sein Kind und kehrte auf sein Territorium zurück, sobald er auf dem Nachbarterritorium den Zeugungsakt vollzogen und sich seiner Wirksamkeit (der Geburt eines Kindes) überzeugt hatte.“70 Ähnliches findet sich auch bei Peter Kropotkin: Bei den primitiven Menschen habe es Frauentausch gegeben, lockere eheliche Bande, Aufhebung der Ehebeschränkungen bei Festlichkeiten oder an jedem fünften, sechsten, siebten Tag, sowie Ehen, bei denen mehrere Männer eine Frau heirateten.71
Wenn wir heute eheliche Treue als Ideal definieren und diese von allen Menschen fordern, stellt das für einen Teil der Männer wie der Frauen eine Überforderung dar – sie könnten diese Erwartung nicht erfüllen, selbst wenn sie wollten. Also hat eine solche Erwartung wenig Sinn. Es wäre sinnvoller, wenn wir das Fremdgehen als Eigenschaft aus unserer Herkunft anerkennen würden, beispielsweise indem es sich etablieren würde, dass sich Paare, die sich gerade kennengelernt haben, darüber austauschen, welche Vorstellungen sie von Treue in einer Beziehung haben und ob sie in dieser Hinsicht harmonieren, statt nach Jahren in heftigsten Streit auszubrechen, wenn der zuvor totgeschwiegene Unterschied offensichtlich wird.
Werbung und Propaganda
Dass Menschen auf Einflussnahme anderer reagieren, ist natürlich. Es hat sicherlich auch in einer frühzeitlichen Gruppe zum Prozess der Meinungsbildung gehört, dass Menschen bereit waren, sich der Meinung anderer anzuschließen, wenn ihnen diese schlüssig präsentiert wurde. Im Allgemeinen wird es so sein, dass ein einleuchtender Gedanke auch zu einem guten Ergebnis führt. So gesehen hat auch die Evolution „Verkaufstalent“ in gewissen Grenzen gefördert, und es gehört zum menschlichen Sozialverhalten. Die unerwünschten Ausnahmen sind die Fälle, in denen ein gut verkaufter, aber unschlüssiger Gedanke sich gegen einen schlecht präsentierten, vernünftigeren durchsetzen kann.
Verkaufstalent wirkte früher anders als in der heutigen Zeit: In einer kleinen Gruppe von Menschen, wie einer Schulklasse, einer Abteilung in einer Firma oder einem Verein kennen sich alle untereinander. Kurze Zeit nach der Gründung einer solchen Gruppe haben alle die Eigenarten der anderen Gruppenmitglieder kennengelernt. Wenn einer eine „große Klappe hat, aber wenig dahinter“, so wissen das die anderen und werden auf seine vermeintlich sinnvolle Rede weniger hören. Das kennt wahrscheinlich jeder aus seiner Schulzeit. Umgekehrt ist in einer Gruppe auch schnell klar, wenn ein Gruppenmitglied gute Ideen hat, aber sich kaum traut, diese durchzusetzen. Die anderen werden die Schüchternheit dieses einen meist dadurch ausgleichen, dass sie bei ihm genauer hinhören oder ihn nach seiner Meinung fragen. Die Gruppe ist also in der Lage, Unterschiede in der Persönlichkeit zum maximalen Nutzen aller zu kompensieren.
In unserer heutigen Massengesellschaft führen dieselben menschlichen Eigenschaften zu einem anderen Ergebnis: Da nicht mehr jeder jeden kennen kann und der Empfänger der Botschaft die Eigenarten und die Persönlichkeit des Senders der Botschaft meist nicht feststellen kann, versagt die Methode, die Botschaft mit Hilfe der Kenntnis der Persönlichkeit des Senders zu korrigieren. Unter solchen Umständen wird es schwierig. Der Empfänger der Botschaft muss sich entscheiden, ohne die Kenntnis der Persönlichkeiten der einzelnen Sender zwecks Orientierung zur Hand zu haben. Zum Beispiel muss er einen Politiker oder eine Partei wählen, ohne dass er die Ernsthaftigkeit der Wahlversprechen beurteilen kann. Ebenso verhält es sich bei Produktwerbung, deren Aussagekraft wir auch erst dann erkennen, wenn der betreffende Artikel von uns gekauft und benutzt wurde. Erst dann wissen wir, wer um wie viel beschönigt hat, wer oder was wirklich eine gute Wahl war und wer oder was nur besonders geschickt vermarktet wurde. In einer unpersönlichen Umgebung kann nicht mehr die beste Entscheidung getroffen werden.
Das ist eines unserer Probleme: Rhetorik und gute Werbung werden dadurch höher bewertet als gute Lösungen. Selbst langfristig führt das oft nicht zu besseren Ergebnissen. Politiker stehen nach vier Jahren, nach denen man sich vielleicht eine etwas genauere Meinung bilden konnte, nicht mehr zur Wahl. Unternehmen, die sich mit hochwertigen Produkten einen Namen gemacht haben, entscheiden sich, ihren Herstellungsaufwand auf Kosten der Qualität zu reduzieren usw. Da sich alle in einem System oft gleich verhalten (alle Politiker machen falsche Wahlversprechen, alle Handyhersteller preisen Funktionen an, die nur eingeschränkt zur Verfügung stehen), hat der Einzelne nur die Wahl zwischen gleichen Übeln. Außerdem stehen Rhetorik, Propaganda und Werbung so stark im Vordergrund, dass über die dahinter liegende Wahrheit ohne langwierige Untersuchungen kaum etwas herauszubekommen ist. Das ist der Grund, warum zum Beispiel die Pharmaindustrie ein Vielfaches von dem in Werbung investiert, was sie für Forschung ausgibt. Da der Kunde die Wahrheit kaum erkennen kann und ihm keine echte Wahl bleibt, ist Werbung oft renditeträchtiger als wirkliche Qualität. Das im Kleinen sinnvolle Phänomen, auf eine gute Präsentation zu reagieren, wird in der Anonymität der Masse ins Gegenteil verkehrt. Was im Kleinen sinnvoll war, wird im Großen kontraproduktiv.
Grenzen der Evolution
Die Natur (die Evolution) wertet nicht moralisch. Sie hat uns zu dem gemacht, was wir sind, mit allen vermeintlichen Stärken und Schwächen und mit allen vermeintlich moralischen und unmoralischen Eigenschaften. Die Evolution hat dazu geführt, dass wir unsere Kinder lieben. Sie hat uns die Aggression gegeben, die zur optimalen Ausnutzung unserer Reviere führte (siehe Kapitel 2.5). Und sie will es oder duldet es, dass steinzeitliche Menschen in bestimmten Situationen ihren eigenen Nachwuchs töteten oder dass es Kannibalismus gab. Letzteres erscheint uns zu Recht sehr brutal. Im Sinne der Evolution war das Töten von Kindern vermutlich besser, als den ganzen Stamm aufgrund von Hunger aussterben zu lassen. Kannibalismus war höchstwahrscheinlich ein Irrtum der Evolution, blieb aber unbedeutend und wurde von der Evolution geduldet, solange er nicht Ausmaße annahm, die die Existenz des Stammes gefährdete. Falls dies vorkam, so stammen wir nicht von dieser Linie ab. Entscheidend aber ist: Heute haben wir bessere Möglichkeiten, unser Zusammenleben in dieser Hinsicht zu regulieren. Heute können wir mit Hilfe unseres freien Willens solche Probleme im Sinne selbst gewählter Moralvorstellungen lösen. Bei weniger offensichtlichen Belangen sollte dabei mit Bedacht vorgegangen werden, denn der Sinn vieler Mechanismen der Natur erschließt sich nicht automatisch. Grundsätzlich besteht aber die Möglichkeit, die Evolution zu „optimieren“.
Es ist sinnlos, ein von Aggressionen befreites Leben anzustreben. Das können Menschen nicht leisten, denn Aggression ist unauslöschlich in uns angelegt. Es bestünde aber die Möglichkeit, sich zu überlegen, wie Aggressionen umgeleitet oder gedämpft werden können, sodass sie keinen Schaden anrichten, sondern konstruktiv genutzt werden.
Es tut uns gut, wenn wir unser Leben so gestalten, wie es unsere Vorfahren in der Steinzeit taten. Jetzt werden sicherlich einige Leser widersprechen und sagen: nein, so wollen sie nicht mehr leben. Genau das tun wir aber derzeit schon in einigen grundlegenden Fragen: Sport und Spiel sind die Überbleibsel der Jagd und des dazu nötigen Trainings. Wir reisen gerne, was meines Erachtens den archaischen Trieb befriedigt, der unsere Vorfahren durch ihr Revier ziehen ließ oder sie als Nomaden leben ließ. Auch in Bezug auf die Faulheit verhalten wir uns zumindest teilweise wie unsere Vorfahren: Wir arbeiten nicht pausenlos (wie Ameisen), sondern gönnen uns Ruhezeiten – Feierabend und Wochenende sind uns heilig. Unter rein wirtschaftlicher Betrachtung könnten und müssten wir alle diese Verhaltensweisen unterlassen, weil wir dann viel produktiver sein könnten und den technischen Fortschritt erheblich beschleunigen könnten. Dass wir das nicht tun, zeigt, wie stark das Erbe unserer Vorfahren noch in uns wirkt.
2.3 Gier, Macht und Hierarchie
Wie erwähnt, ist Gier ein Antrieb, der zur optimalen Versorgung und damit zur optimalen Arterhaltung beitragen soll. Solange es keine Sesshaftigkeit, keinen umfassenden Besitz, kein Eigentum und Vermögen gab, hatte Gier wenige Ziele: Nahrung und vielleicht den Besitz eines Fells, Speers oder Faustkeils. Gier sorgte dafür, dass sich jeder darum bemühte, nicht zu kurz zu kommen. Neben dieser Form des durch menschliche Gier ausgelösten Wettbewerbs um Nahrung gibt es unter Menschen zahlreiche gegenläufig wirkende Mechanismen: Wer geschickt oder schlau ist, kann sich – trotz der größeren Kraft eines anderen – Nahrung beschaffen. Außerdem haben wir Menschen einen starken Wunsch nach Gemeinschaft und Freundschaft, was zu gegenseitiger Hilfe führt. Nahrung wurde in der Steinzeit nicht nur gehortet, sondern auch mit anderen geteilt. Wettbewerb ist nicht der einzige Mechanismus der Evolution. Er wurde durch andere Mechanismen in seiner Wirkung abgeschwächt.
Besitz schafft Ungleichheit
Aus zwei Gründen gab es in einer steinzeitlichen Gruppe keine ausgeprägten Hierarchien.72
Ein Mensch, mit einer überdurchschnittlichen Körperkraft konnte daraus wenige Vorteile gewinnen, solange Nahrung im Überfluss vorhanden war. Nur in Notzeiten hätte er seine Stärke ausspielen und mehr Nahrung für sich beanspruchen können.
Jägern und Sammlern war das Anhäufen von Besitz unbekannt. Er hätte beständig mitgenommen werden müssen und damit eine Last dargestellt. Persönliches Eigentum war daher auf das Nötigste beschränkt.73
In der Folge der neolithischen Revolution wurden Überschüsse erwirtschaftet, die die Voraussetzung für Ungleichheit darstellen.74 Jean Ziegler nennt die Einführung des Privateigentums den „Gründungsakt der gesellschaftlichen Ungleichheit“ und zitiert Rousseau: „…ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Erde niemandem.“75 Gier führt in einer Welt des Besitzes zu Macht, wenn sie ihr Ziel erreicht und Besitz und Vermögen anhäuft. Wie diese Macht dann genutzt wird, hängt von den Präferenzen des Einzelnen ab. Meist wird Macht aber eher zum persönlichen als zum allgemeinen Nutzen eingesetzt.
Vor Beginn der Zivilisation dienten Gier und Strebsamkeit des Menschen im Wesentlichen drei Zwecken:
1. der schon erwähnten optimalen Versorgung aller aufgrund eines starken eigenen Bemühens um die Versorgung;
2. einer Förderung der Stärkeren, sodass sich zumindest nicht der Schwächere durchsetzen konnte,
3. dem Streben nach Macht, sodass sich in einer kritischen Situation jemand findet, der die Macht übernehmen will und die Rolle des Anführers einnimmt und die Gruppe aus der Krise führt.
Vor der Zivilisation bezog ein Anführer seine Legitimation aus der Aufgabe. In einer Notsituation konnte ein Alpha-Männchen die Gruppe führen. War diese überwunden und ging es allen wieder gut, so hatte der Anführer deutlich weniger zu sagen. Nur solange der Anführer durch die Qualität der Ergebnisse überzeugen kann, wird er diese Rolle behalten. Wieso sollte sich eine Gruppe mit vollem Bauch in der Sonne liegender Steinzeitmenschen von irgendwem kommandieren lassen? Das korreliert mit der Erkenntnis, dass in Krisenzeiten eine Einzelperson als Anführer schlagkräftiger ist, in friedlichen Zeiten aber ein demokratisches Vorgehen unter Einbeziehung aller Meinungen zu besseren Ergebnissen führt. Es gab damals keine permanente Autorität, sondern nur eine solche, die sich am Bedarf der Gruppe und der Befähigung der Autoritätsperson orientierte und ebenso wieder verschwand, wenn eine dieser beiden Voraussetzungen nicht mehr gegeben war.76
In einer Jugendgruppe, der ich lange Zeit angehörte, gab es jemanden mit einer Begabung für Führung und Koordination. Häufig fanden die Vorschläge, die er machte, große Zustimmung. Gleichermaßen regte sich aber Widerstand, wenn viele das Gefühl hatten, dass sie gegen ihren Willen irgendwohin gelenkt werden sollten. Im Nachhinein denke ich, dass unsere Art, Entscheidungen zu treffen, fast der Lebensweise von Menschen in der Steinzeit und der echten Anarchie entsprach: Wir hatten eine Führungsperson, doch die Akzeptanz für deren Führung beruhte ausschließlich auf Notwendigkeit und Kompetenz. Immerhin funktionierte diese Form des sozialen Aushandlungsprozesses über zehn Jahre lang stabil.77
Vor der Zivilisation musste der Einzelne sich nach Kräften gegen Übergriffe anderer verteidigen, aber es gab keine Machtkonzentrationen. Die Evolution begünstigt offenbar ein ständiges Vorwärtsstreben des Einzelnen, nicht aber eine zu große Überlegenheit Einzelner. Ein gewisses Maß an Ungleichheit darf im Sinne der Arterhaltung nicht überschritten werden. Einige Jahrtausende der Zivilisation später hatten sich Strukturen ausgebildet, die Monarchen Macht über ein Volk gaben. Heute soll der Staat durch Gesetzgebung und Gewaltmonopol dafür sorgen, dass die Möglichkeiten zur Ausbeutung eines Menschen durch einen anderen begrenzt sind.
Unsere geistigen Fähigkeiten sind nicht an unsere Macht angepasst
Die wahre Ursache für die negativen Folgen von Macht sehe ich in einem Umstand, den Konrad Lorenz in Bezug auf Waffen und Aggressivität beschrieben hat. Die Aggressivität stand vor der neolithischen Revolution in einem sinnvollen Verhältnis zu ihren möglichen Folgen. Die Evolution hat die Kräfteverhältnisse so wachsen lassen, dass der optimale Nutzen für die Gemeinschaft entsteht, denn das Überleben der Gemeinschaft ist wichtiger als das des Einzelnen. Dies ist die Stärke aller Herden- und Rudeltiere. Daher ist die geistige Entwicklung des Menschen in Bezug auf den Umgang mit seiner Aggressivität an seine Zerstörungsmöglichkeiten angepasst. Menschen werden sehr schnell sehr aggressiv, können anderen aber mit bloßen Händen meist nur unbedeutende Verletzungen zufügen. Wenn man im Zustand aggressiver Erregung hingegen eine Schusswaffe in der Hand hält, oder am Steuer eines Autos sitzt, so kann das katastrophale Folgen haben, weil der Affekt (Wut) dem Ausdrucksmittel (Waffe) nicht angemessen ist. Die Selbstkontrolle des Menschen hat sich durch die Evolution an seine körpereigene Bewaffnung angepasst, nicht aber an die Waffen, die wir in den letzten Jahrhunderten entwickelt haben.
So wie Aggression aufgrund unserer schwachen natürlichen Bewaffnung nicht viel Schaden anrichten konnte, so hatte Gier damals zu wenige Zielobjekte, um zu Machthäufungen zu führen und in der Folge der Gemeinschaft zu schaden. Erst das Erwirtschaften von Überschüssen und der daraus resultierende Besitz führten zu größeren Machtunterschieden. Dauerhaft gefestigt wurden diese zudem durch das Erbrecht. In unserem „Urzustand“ vor der Entstehung von Besitz gab es keine Weitergabe von Macht in Form von Erbschaften.
Wird also jemand Herrscher über eine größere Anzahl von Menschen, sei es als König oder als Diktator oder als gewählter Präsident, so ist er von Natur aus nicht dafür gewappnet, mit dieser Machtfülle umzugehen. Es erfordert ein hohes Maß an charakterlicher Entwicklung, nicht egoistisch, überheblich, leichtsinnig, übermütig, selbstgefällig und unachtsam zu werden. Die Geschichte kennt hier zahlreiche Negativbeispiele: Ludwig XIV, Stalin, Hitler, Silvio Berlusconi, Josef Ackermann, Kim Jong Un oder Donald Trump. Dies gilt nicht nur für die Macht der Regierenden, sondern auch für die Macht, die Unternehmenslenker in Händen halten. Die Evolution hatte bisher wenig Möglichkeit, uns daran anzupassen. Das bedeutet, dass unser derzeitiges Verhalten der Machtanhäufung nicht optimal für die Arterhaltung und die Gemeinschaft ist.
Stärken des Menschen sind sein ständiges Streben nach Verbesserung und seine Neugier. Diese Eigenschaften sind Voraussetzungen, um in unserer heutigen Gesellschaft eine Machtpositionen zu erreichen. In einer nahezu besitzlosen Gruppe von Nomaden hingegen führt Strebsamkeit zu Unterschieden in Bezug auf individuelles Wissen und Erfahrung. Erfahrung verschafft zwar Macht, aber ohne Besitz bleibt die Macht begrenzt. Diese begrenzte Macht ermöglicht keinem die in späteren Zeiten aufgekommene völlige Herrschaft über andere. Es kann in einer solchen Gruppe nie zu einem Ungleichgewicht kommen, das Einzelnen die Ausbeutung der Masse erlaubt und damit die Gemeinschaft schädigt.
Vergleich Waffen – Vermögen
Wer eine Waffe hat, kann in Situationen seine Meinung durchsetzen, in denen er sonst nachgeben oder einen Kompromiss aushandeln müsste. Dadurch kann er sich Vorteile verschaffen. Haben alle vergleichbare Waffen, so hat keiner mehr einen Vorteil. Das Gleichgewicht stellt sich nur auf einem höheren Gewaltniveau ein – zum Nachteil für alle. Am Steuer eines SUV sitzt man höher, kann über die Vorausfahrenden hinwegsehen und hat mehr Überblick. Fahren alle SUVs, hat keiner mehr einen Vorteil, aber alle haben den Mehrverbrauch und die Umweltschäden zu tragen. Dasselbe gilt für Geld: Wer mehr Geld hat, hat mehr Macht und kann sich Vorteile erkaufen, auf die andere keinen Zugriff haben. Hätten alle gleichmäßig mehr Vermögen – was bisher noch nicht eingetreten ist –, so ginge dies mit erhöhtem Konsum, Ressourcenverbrauch und den entsprechenden Folgen einher – wieder zum Nachteil für alle.
Bei Waffen entscheiden wir uns (im Gegensatz zu den USA) ganz klar dafür, dass der Bürger sie nicht besitzen sollte, denn wir haben dem Staat das Gewaltmonopol übertragen. Für alle Bürger gilt Gleichbehandlung: Sie sollen ihre Konflikte auf Augenhöhe austragen. In Bezug auf Vermögen tolerieren wir aber eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: den Normalbürger und wenige Reiche, die sich trotz rechtlicher Gleichstellung faktisch von vielem freikaufen können. Warum?
Die Grenzen der Evolution
Ich bin der festen Ansicht, dass es „das Böse“ nicht gibt. Wenn wir unseren destruktiven Trieben freien Lauf lassen und Menschen oder Tiere quälen, so gibt es dafür zwei Gründe. Zum einen hat die Evolution der Gewalt keinen Riegel vorschieben können, wenn sie aus der Situation heraus nicht sanktionierbar ist. Das heißt, ich kann Ameisen zertreten, so lange ich will. Da diese so viel kleiner sind, wird die Evolution mein Verhalten nicht unterbinden können.78 Es hat keinen negativen Einfluss auf die Arterhaltung, wenn ich es tue, und keinen positiven, wenn ich es lasse. Zum anderen setzt eine bewusste zerstörerische Handlung voraus, dass ich Wut in mir trage. In diesem Zusammenhang ist es für den Zusammenhalt der Gemeinschaft oft von Vorteil, wenn ich die Wut irgendwo außerhalb der Gruppe abreagieren kann, also an wehrlosen Tieren oder wehrlosen anderen Menschen. Daher hat uns die Evolution wahrscheinlich diese Möglichkeit gelassen – wir können uns an anderen abreagieren, wenn es keinen negativen Einfluss auf unser Überleben hat, und daher hindert uns sehr wenig in unserem Empfinden daran, solange der andere uns nur fremd genug und eindeutig unterlegen ist: Arterhaltung ist nicht immer freundlich, und biologische Evolution ist gröber und brutaler als geistige Evolution.
Eine zu große Ungleichheit unter Menschen kann also für die Schwächeren schnell zur Gefahr werden (siehe auch Kapitel 3.8): Vor Wesen, die uns nur ein wenig unterlegen sind, haben wir schon nahezu keinen Respekt. Wir essen Tiere, halten sie auf unmenschliche Weise, töten oder quälen sie teilweise ohne Notwendigkeit. Was uns deutlicher unterlegen ist, nehmen wir gar nicht mehr wahr: Ameisen sind für uns so unbedeutend wie Steine. Wenn wir darauf treten, fällt es uns nicht einmal auf, obwohl es sich um Leben handelt. Selbst uns dümmer erscheinende Menschen behandeln wir oft respektlos. Sitzen mehrere Menschen zusammen und diskutieren, so schließen die, die sich für intelligenter halten, den, den sie für dümmer halten, häufig aus und beachten ihn nicht. Schon solche kleinen Unterschiede reichen aus, diejenigen zu übergehen, die weniger können oder weniger Macht haben. Viele Wohlhabende sehen ihren Erfolg als Resultat ihres Könnens an und halten die Ärmeren für weniger bedeutend. Wie groß dürfen Unterschiede im Wohlstand unter diesen Umständen werden?
Die Gegenkräfte werden weniger
Es gab aber immer auch Gegenkräfte zur beständigen Konzentration von Macht. Ich stelle mir vor, wie vor Beginn der Industrialisierung der Zusammenhalt in Dörfern gewesen sein könnte: Es gab wie überall reichere und ärmere Menschen. Wenn ein Ärmerer in Not geriet, fragte er vielleicht bei seinem reichen Nachbarn, ob dieser ihn unterstützen würde. Und sicherlich gab es Reichere, die auf ihrem Geld saßen. Aber es wird auch andere gegeben haben, die ihrem armen Nachbarn halfen, weil sie auf dem Markt regelmäßig bei ihm eingekauft hatten oder weil ihre Kinder zusammen spielten oder weil die Frau des einen die Cousine des anderen war. Das enge Zusammenleben in der Gemeinschaft eines Dorfes oder einer Kleinstadt brachte neben dem Streben nach Besitz oder Macht auch Verflechtungen mit sich, die die möglichen Auswirkungen der Macht begrenzten. Seit Beginn der Industrialisierung hat sich das egoistische Prinzip stärker durchsetzen können. In einer heutigen Großstadt kommt keiner auf die Idee, seine Nachbarn nach Geld oder Essen zu fragen, und könnte umgekehrt wenig Unterstützung erwarten. Der Kontakt ist meist nicht eng genug. Solche Hilfe ist seit der Industrialisierung und besonders seit dem Neoliberalismus seltener geworden. Der Reiche bekommt meist zu wenig vom Leben des Armen mit, als dass sein Mitgefühl stark genug werden würde, um etwas abzugeben. Die Idee, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied sei und sein Leben selbständig und eigenverantwortlich zu führen habe, ist stärker geworden.
Besitz führt zu Macht
Der Mensch entwickelte sein Zusammenleben von einer Gemeinschaft mit geringen Ungleichheiten über die Jahrtausende zu mächtigen Staaten mit Königen. Aus Beratern, deren Stellung ursprünglich nur wenig über der anderer Menschen lag, wurden irgendwann Anführer, denen ihr Besitz bei der Festigung und dem Ausbau ihrer Macht half.79 In der Folge sind aus ihnen Lehnsherren und (Raub-)Ritter geworden, noch später Fürsten und Könige.
Besitz wird in vielen Quellen als eine wesentliche Ursache von Macht und Ungleichheit angesehen: Die Sesshaftwerdung ermöglichte das Erwirtschaften von Überschüssen. Diese Vorräte sollten von Verwaltern gerecht verteilt werden. Diese Verwalter seien dadurch zu Einfluss und Autorität gelangt. Es sei also nicht die direkte Bereicherung, sondern – indirekt – die Stellung gewesen, die die Ungleichheit befördert habe.80 Durch Ausbau und Verfestigung der Strukturen hätten sich die Verwalter dann zu Häuptlingen bzw. Herrschern gewandelt. Dazu sei ein enges Zusammenleben vieler erforderlich gewesen.81
Jared Diamond schreibt: „Neben Fehlernährung, Hunger und Krankheitsepidemien brachte die Landwirtschaft noch einen weiteren Fluch über die Menschheit – die Entstehung sozialer Klassen. Jäger und Sammler besitzen nur wenige oder gar keine konzentrierten Nahrungsquellen wie Obstplantagen oder Viehherden. Sie leben vielmehr von dem, was sie täglich sammeln oder erbeuten. Außer Kleinkindern, Kranken und Alten sind alle an der Nahrungssuche beteiligt. Deshalb gibt es bei ihnen keine Könige und Individuen, die einen spezialisierten Beruf ausüben, keine Klasse sozialer Schmarotzer, die sich auf Kosten anderer Fett anfressen.“82
Die Entstehung von Besitz und von Rollen wie Berater, Verwalter, Anführer, Rechtssprecher und vielleicht auch das Aufkommen von Familien innerhalb der Gruppe haben also die Entstehung von Macht ermöglicht. Über lange Zeit konnten Machtkonzentrationen und große Ungleichheit entstehen.
Im Mittelalter war Leibeigenschaft weit verbreitet. Auch heute tendieren wir mit unserer eng reglementierten und stressigen Berufswelt wieder zu etwas Ähnlichem, wenn auch im modernen Kleid. Die Leibeigenschaft im Mittelalter ist zwischen Sklaverei und Hörigkeit einzuordnen.83 Heutige Arbeitsverhältnisse kann man in vielen Fällen ebenso als Hörigkeit bezeichnen.
Auch unser persönliches Einkommen ist ein Symbol der Macht. Je mehr Einkommen jemand hat, desto mächtiger ist er, und umgekehrt ermöglicht Macht die Erlangung zusätzlichen Vermögens.
Macht hat in unserer Demokratie nur derjenige, dem wir, der Souverän, die Gemeinschaft der Bürger, sie zugestehen.
Hierarchie ist nicht mehr zeitgemäß
Im neunzehnten Jahrhundert setzte sich die Gesellschaft überwiegend aus gebildeten Vermögenden und ungebildeten Armen zusammen. Gute Schulbildung war eher den Wohlhabenden vorbehalten. Kinder aus ärmeren Familien mussten oft früh die Schule verlassen, damit sie zum Lebensunterhalt der Familie beitragen konnten.84 Einer solchen Gesellschaft kommt es entgegen, wenn es einige Positionen mit höheren Anforderungen und viele Arbeitsstellen in der Produktion zu besetzen gibt – so wie es damals der Fall war.
Strenge Regeln, klare Hierarchien und wenig Flexibilität sind in dieser Gesellschaft aus ungebildeten, kindhaften Persönlichkeiten die Grundlage für ein harmonisches Zusammenleben. Die überwiegende Zahl der Menschen damals war triebhafter, weil sie nie gelernt hatte, sich selbst zu regulieren, und benötigte daher mehr Kontrolle von außen. Der Soziologe Georg Oesterdiekhoff schreibt: „In Schamkulturen werden Menschen über Augenkontrolle reguliert, in Schuldkulturen über das eigene Gewissen. Menschen in Schamkulturen fühlen sich nur dann schuldig, wenn sie infolge sozialen Tadels einen Ehrverlust erleiden. Solange sie bei ihren Untaten nicht erwischt werden, leiden sie keine innere Not […]. Daher sind Schamkulturen autoritär, Schuldkulturen liberal. Jene müssen autoritär sein, diese können liberal sein. Das meinte Rousseau […], als er sagte, ein noch unreifes Volk brauche Zucht, eine Demokratie würde es moralisch ruinieren.“85 Und weiter: „Man achte auf den Umgang solcher Menschen mit Abfällen, dem anderen Geschlecht, öffentlichem Eigentum – wenn ihnen keiner über den Rücken schaut.“86
Peinlichkeits- und Schamempfinden korrelieren mit dem Bewusstsein. Erst die Möglichkeit, dass das Ich sich seiner selbst bewusst sein kann, erzeugt Scham. Tiere empfinden (fast) keine Scham. Der erste Schritt zum Selbst-Bewusstsein war der „Sündenfall“ (siehe Kapitel 4.1), der zweite die Aufklärung. Das erklärt, dass die Schamschwelle primitiver Völker deutlich höher liegt, denn ihr Bewusstsein ist noch weniger stark. Je empfindsamer ein Mensch ist und je mehr er sich seiner selbst bewusst ist, desto empfänglicher ist er für Schamgefühle.
Scham ist von einer äußeren Instanz ausgelöst, Schuld von einer inneren. Schuld kann durch Buße, Einsicht und Verzeihen abgetragen werden, Scham dagegen nicht. In allen Kulturen gibt es beide Gefühle, aber sie werden unterschiedlich gewichtet. Es scheint, als sei die Schamkultur älter und hat sich durch Weiterentwicklung langsam zur Schuldkultur gewandelt. In meinen Augen hängen Scham- und Schuldkultur auch mit dem Wandel gesellschaftlicher Normen zusammen: Am Anfang unserer Geschichte stand die Gemeinschaft, in der der Einzelne kaum zählte, und daraus resultierte die Schamkultur. Die Regulierung über die Scham bedeutet, dass die Gemeinschaft immer Priorität vor dem Einzelnen hat. Daher ist eine Verfehlung (ein Gesichtsverlust) in der Schamkultur endgültig. Erst die Schuldkultur stellt den Einzelnen in den Vordergrund; er selbst kann (als Ich) für sein Handeln verantwortlich sein und seine Schuld abtragen.
Auch unsere heutige Welt besteht aus Hierarchien. Die Strukturen der Macht sind meist nicht mehr so offensichtlich wie in früheren Zeiten. Aber der Druck ist für die meisten als Stress bei der Arbeit spürbar. Unsere ganze Berufswelt ist von Hierarchien durchzogen. Stimmt nicht, sagen Sie, weil Ihr Chef Ihnen kaum Anweisungen gibt? Doch, sage ich, dies drückt die Entwicklung von der Scham- zur Schuldkultur aus: Wir haben die Spielregeln so verinnerlicht, dass man sie nicht mehr aussprechen muss. In vielen Berufen wird mittlerweile erwartet, dass wir schon im vorauseilenden Gehorsam tun, was die Firma von uns erwartet. Das unterscheidet uns von Arbeitern früherer Generationen, die faul wurden, wenn ihnen keiner zusah, und die nur auf Anweisung arbeiteten. Wir sind heute in der Lage, uns selbst zu regulieren. Einerseits ist dies wichtig und nützlich. Andererseits sollten wir uns immer überlegen, in wessen Dienst wir diese Fähigkeit stellen und sie nicht unkontrolliert auf jede Anforderung anwenden, mit der wir konfrontiert werden.
Hierarchie, Befehl und Gehorsam sind das Gegenteil von Verantwortlichkeit. Schon daraus wird ersichtlich, dass ein Herrschaftsverhältnis nicht das Optimale für den hinreichend gebildeten und entwickelten Menschen und zur Erreichung gesellschaftsübergreifender Ziele ist. Die Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung auf den unteren Ebenen wird dadurch nicht genutzt, und dieses Potential geht verloren. Der Gehorchende führt aus, ohne dass er den Befehl zu hinterfragen hat. Er soll als intelligente Maschine agieren. Von einer Maschine erwarten wir, dass sie das Leben ihres Eigentümers verbessert. Das zeigt das Verhältnis von Befehlendem zu Gehorchendem. Ein Befehl ist das Gegenteil von Freiheit, weil er die persönliche Freiheit des Empfängers negiert. Es geht nicht um die Bedürfnisse des Gehorchenden, sondern um die des Befehlenden. Wird dieses Prinzip in Unternehmen angewendet, so geschieht dies meist nicht so eindeutig – es gibt Kompromisse, aber die Tendenz ist offensichtlich. Es geht bei Befehlen immer darum, dass das Gehorchen dem Befehlenden oder seinen Zielen mehr nützt als dem Gehorchenden. Will man Ziele erreichen, die der Gesamtheit der Menschen oder der Welt nützen, so benötigt man das Gegenteil: Keine Befehlenden und Gehorchenden, sondern eigenverantwortlich handelnde Menschen.
Jede hierarchische Struktur bedeutet, dass höhere Positionen mit mehr Macht ausgestattet sind als niedere. Macht verzerrt jedoch die Entscheidungsfindung. Die Entscheidung wird durch den „Entscheider“ dominiert in der Annahme, dass dieser mehr Erfahrung, Wissen oder Entscheidungsqualität liefert als die Gemeinschaft. Dies hat sicher im neunzehnten Jahrhundert für einen gebildeten Chef gegenüber seinen ungelernten Arbeitern gegolten, aber es gilt heute erheblich weniger, seit wir eine flächendeckende Bildung und eine höhere durchschnittliche Reife erreicht haben. Fähigkeiten heutiger Menschen wie selbständiges Handeln und eigenverantwortliches Denken waren für die Arbeiter in einer hierarchischen Welt wie im neunzehnten Jahrhundert unnütz, solange sie nur monotone körperliche Tätigkeiten verrichten mussten. Trotzdem stellt die damalige hierarchische Struktur eine große Ungleichheit auch der Chancen dar. Sie fördert Ausbeutung und stellt langfristig nicht die optimale Konstellation zur Erreichung von Fortschritt dar. Vielleicht musste die Menschheit diese Zwischenstufe durchlaufen, und vielleicht konnten wir uns als Menschheit nicht mit weniger Verlusten entwickeln. Aus heutiger Sicht ist dies eine Vergangenheit, die nie wiederkehren muss und sollte. Menschen als mechanische Arbeitskräfte sind heute nur noch in sehr wenigen Bereichen unersetzbar, seit Maschinen viele unserer Tätigkeiten übernehmen können. Je schneller wir eine flächendeckende Bildung aller Menschen erreichen, desto leichter und erfolgreicher werden wir uns weiterentwickeln.
Wir sind auf dem Weg von einer auf Befehlen aufgebauten Arbeitswelt hin zu eigenverantwortlichem Arbeiten. Voraussetzung dafür ist die Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstregulation und zum verantwortungsvollen Handeln im Sinne der Allgemeinheit, was eine entsprechend verinnerlichte Erkenntnis der Notwendigkeit von solchem Verhalten voraussetzt. Denkt man die bisherige Entwicklung von der Schamkultur zur Schuldkultur weiter, so liegt die Zukunft in der Erkenntnis: Wenn wir uns aufgrund unserer Erkenntnis und des daraus resultierenden Wollens selbst regulieren, benötigen wird weder Scham noch Schuldgefühle zur Kontrolle unseres Zusammenlebens. Andere nennen das Anarchie – in der richtigen Bedeutung des Wortes: als ein Zusammenleben, das keine Führung benötigt.
Macht tendiert zu Machtausweitung
Meist versuchen Mächtige, noch mehr Macht anzuhäufen. Geschichten von Unternehmern, Investoren oder Politikern, die freiwillig an einem bestimmten Punkt aufhörten und sich zurückzogen, sind selten. Allein die Zahl der Millionäre und Milliardäre in Deutschland (1,2 Millionen) und der Welt zeigt das. Viele, die einmal damit angefangen haben, Vermögen und Macht anzuhäufen, hören nicht mehr damit auf. Wären sie nur durch den Wunsch nach materieller Sicherheit oder beispielsweise einer Yacht motiviert, so würden sie nach Erfüllung dieser Wünsche ihr Bemühen einstellen oder reduzieren, anstatt weiteres Vermögen anzuhäufen
Wer Macht hat, hat oft nicht nur den Wunsch, sie auszubauen, sondern fast immer auch die Möglichkeit dazu. Alle „Großen“ sind in der Lage, die „Kleinen“ zu dominieren und sich finanzielle Vorteile zu verschaffen – egal ob es sich um Firmen, „Investoren“ oder Länder handelt. Das zeigt sich an der Macht von Staaten (USA, China, Russland, demnächst möglicherweise Indien), Staatenbündnissen (EU, NATO, OPEC), Konzernen (Goldman Sachs, die „Investment“-Banken, Facebook, Google, Ebay, Amazon, Apple, Ikea, Nestlé, Unilever usw.), Superreichen (Ölscheichs, Familien-„Investoren“, Milliardäre). Seit dem Zweiten Weltkrieg sind die Anhäufungen von Macht in den einigermaßen stabilen Regionen der Welt beständig gewachsen und verfolgen überwiegend ihre eigenen Ziele.
Viele große Firmen transferieren ihre Gewinne in Steueroasen – unabhängig von der Qualität ihrer Produkte oder ihrer Haltung in moralischen Fragen. Der Grund dafür ist, dass es in ihrer Macht liegt – während der Normalbürger nicht über die Macht verfügt, Geld steuerfrei zu verdienen, obwohl wir das alle gern tun würden. Die Einteilung in „gute“ und „schlechte“ Firmen ist hierbei nicht mehr sinnvoll. Viele Unternehmen verfolgen zum Teil wünschenswerte Ziele und handeln an anderen Stellen unmoralisch.
Google, Facebook, Amazon und NSA
Die Möglichkeit der nahezu unlimitierten Datensammlung und Datenverwertung („Big Data“) hat ein neues Potential zur Machtkonzentration geschaffen: Dass wir zu gläsernen Menschen werden, macht uns wirtschaftlich verwertbar und auch erpressbar.
Juli Zeh schreibt in einem in der der Zeit abgedruckten offenen Brief an Angela Merkel:87 „Was NSA und Internetkonzerne wie Google oder Facebook betreiben, ist kein Datensammeln aus Spaß an der Freud. Auch hat es wenig mit dem zu tun, was Sie oder ich unter nationaler Sicherheit verstehen. Ziel des Spiels ist das Erreichen von Vorhersehbarkeit und damit Steuerbarkeit von menschlichem Verhalten im Ganzen. Das funktioniert heute schon erschreckend gut. Wer genügend Informationen über die Lebensführung eines Einzelnen miteinander verbindet und auswertet, kann mit erstaunlicher Trefferquote voraussehen, was die betreffende Person als Nächstes tun wird…“ Solange die Internetkonzerne Milliarden durch das Sammeln und Verkaufen von Daten verdienen, kann die Auswirkung nicht unbedeutend sein – sonst wäre das ihren Kunden aus der (Werbe-)Industrie nicht so viel Geld wert. Die Konzerne Amazon und Google sind an der Börse mit achthundert und sechshundert Milliarden Dollar bewertet, Tendenz steigend. Facebook kommt auf vierhundert Milliarden, und es läuft der interne Wettbewerb, wer als erster die Billion knackt.
Google, Facebook, Amazon und andere sammeln alle Informationen, derer sie habhaft werden können, und ermitteln aus dieser Datenfülle Zusammenhänge jeglicher Art. Wer beispielsweise ausschließlich bei Internetversendern bestellt, kein Auto besitzt und niemals Urlaubsreisen bucht, ist mit größerer Wahrscheinlichkeit gehbehindert. Googles Vorteil auf dem Werbemarkt beruht darauf, dass es den Verkäufern nicht nur Unmengen von Adressen liefern kann, sondern insbesondere die potentiellen Kunden aus der Masse extrahieren kann. Viele denken: „Was wollen denn Ebay, Facebook, Google oder Amazon mit meinen Daten anfangen? Und wenn sie etwas davon haben, so nützt es doch auch mir, wenn mir Dinge beworben oder angeboten werden, nach denen ich suche.“ Aber erstens haben diese Konzerne mehr bekommen, als sie gegeben haben – wesentlich mehr, sonst wären sie nicht innerhalb eines Jahrzehnts von Null auf die heutigen, gigantischen Bewertungen an der Börse gesprungen. Und zweitens kann man das leicht widerlegen. Beispielsweise könnte eine Versicherung, die von Google Informationen oder Beratung einkauft, Lebensversicherungen nur noch an Kerngesunde und Unfallversicherungen nur noch an sehr besonnene Menschen verkaufen, da Google dieses Wissen aus unseren Daten herausfiltern kann. Andere Menschen würden aus unerklärlichen Gründen von den Versicherungen abgelehnt oder müssten Wucherpreise bezahlen, weil Google aus deren Verhalten im Internet ermittelt hätte, dass sie ein statistisch erhöhtes Risiko aufweisen, in einen Unfall verwickelt zu werden oder sich eine schwere Krankheit zuzuziehen. Damit wäre die Idee der Versicherung ad absurdum geführt und das Geldverdienen optimiert. Und von alledem bekämen wir Kunden nichts mit.
Was, wenn Amazon durch Analyse der Daten seiner Nutzer herausfindet, dass achtzig Prozent der Menschen, die innerhalb von wenigen Monaten mehrfach in einem Weinversand bestellen, Alkoholiker sind? Und vielleicht wundern Sie sich, warum Ihnen beim Hausbau niemand einen Kredit geben will, dessen Zinssatz nicht zwei Prozent über dem marktüblichen Wert liegt. Ihnen wird niemand sagen, dass die Banken Ihre Daten über die Schufa mit Amazon abgeglichen haben und Ihnen nun niemand mehr zutraut, die nächsten zwanzig Jahre im Job zu überstehen. Oder Sie haben schon einmal als alleinstehender Mann in einem Spielzeugversand bestellt, und Google hat durch automatisierte Datenanalyse herausgefunden, dass alle bekannten alleinstehenden deutschen Pädophilen ebenfalls in einem Spielzeugversand eingekauft haben. Wenn Sie bei der nächsten Einreise in die USA stundenlang gefilzt werden, halten Sie das vielleicht für Zufall. Und niemand wird Ihnen sagen, dass Sie zur Intensivkontrolle ausgewählt wurden, weil die NSA Zugriff auf die Google-Daten hatte. Es lassen sich unzählige weitere solcher Fälle konstruieren.
Bei den großen Internetkonzernen „handelt [es] sich um Privatgelände, das Konzernen gehört, Öffentlichkeit und Transparenz werden nur simuliert. Wie in einem Shoppingparadies werden Waren und Werbung strategisch platziert und unerwünschte Personen und fragwürdiges Verhalten strukturell und aktiv ausgeschlossen.“88
Die Macht, die Google, Facebook, Amazon und andere aktuell durch Datensammeln anhäufen, ist undemokratisch, weil sie durch Gewinnabsicht motiviert ist. Dasselbe gilt für staatliche Massenüberwachung und für Freihandelsabkommen: Abkommen wie TTIP, TISA oder CETA dienen dazu, Macht zu festigen oder auszubauen, ebenso die Überwachung der Welt durch die NSA. Dass all dies im Geheimen vorangetrieben wurde, zeigt, dass die Akteure befürchten, ihre Ziele im Falle einer Veröffentlichung zu verfehlen.
Kann man es ignorieren, dass alle alles über einen wissen? Nur wenn alle Menschen wohlwollend miteinander umgehen würden – aber dieses Ziel haben wir noch nicht erreicht. Dadurch, dass andere Informationen über uns haben, verlieren wir an Freiheit. Personenbezogene Informationen werden kommerziell verwertet, um uns zu manipulieren, und sie schaffen die Möglichkeit, uns zu erpressen. Diese Datenbasis kann zum Aufbau einer Diktatur genutzt werden.89 Die Gefahr einer Diktatur steigt, wenn man das Datensammeln in diesem Ausmaß duldet. Wann die kritische Masse erreicht und die Grenze überschritten wurde, wird die Zukunft zeigen. Dieser Missbrauch der Macht ist nur noch nicht eingetreten.90 Es dauert immer seine Zeit, bis die Möglichkeiten der Ausbeutung erkannt und genutzt werden. Man denke an Rationalisierung, Globalisierung, Korruption, Ausbeutung von Ressourcen und die Freigabe der Geldschöpfung durch die Banken (dazu mehr in Kapitel 3.6). Die Phase, in der die neuen Möglichkeiten aufkommen und noch nicht missbraucht werden, taugt also kaum als Beweis, dass dies nicht geschehen wird. Aber heute wird oft angenommen, die Datensammelei sei nicht gefährlich, weil ja bisher nichts passiert sei. Die Verfügungshoheit über die eigenen Daten ist daher keine Freiheit, auf die man verzichten kann, nur weil sie noch nicht missbraucht wurde.
Es ist Ziel der allumfassenden Datensammlung der NSA, den USA die weltweit größte Macht zu verschaffen und zu sichern.91 Möglicherweise ist die Entscheidung, alles und jeden zu überwachen, der Versuch, die Macht zu erhalten oder auszubauen, da dies mit reinen militärischen Mitteln nicht mehr über lange Zeit gelingen könnte. Datensammeln ist die einfachere Art, die eigene Macht zu festigen, weil sie schwerer aufzudecken ist.
Überwachung schürt Angst und treibt die Bürger auseinander. Das ist die Methode von Diktatoren. Das stärkste Argument gegen Überwachung und Datensammeln ist, dass keiner der Befürworter sie bei sich zulassen würde – egal ob es um die CEOs von Ebay, Facebook, Google oder Amazon oder um Regierungsvertreter geht: Wer dieser Menschen würde sein Privatleben, seinen Aufenthaltsort, seine Gespräche und Gesprächspartner freiwillig veröffentlichen?92
Gern wird argumentiert: „Wer sich nichts zuschulden kommen lässt, hat auch nichts zu befürchten“. Diese scheinbare Logik lässt folgendes außer Acht93: Freiheit ist immer die des Andersdenkenden. Jede Diktatur überwacht nur ihre Gegner. Die Mitläufer und Befürworter haben selbstverständlich ein leichtes Leben. Ein System, das die Mehrheit nur deshalb nicht überwacht, weil deren Meinung mit der Systemvorgabe übereinstimmt, ist nicht frei.
Ein Mensch, der sich beobachtet fühlt, verhält sich anders, als wenn er unbeobachtet ist. Wenn wir dauernde Beobachtung hinnehmen, gewöhnen wir uns an eine Unfreiheit des Denkens, deren Auswirkungen wir noch nicht kennen.
Mit dem Anhäufen von Daten ist es wie mit dem Anhäufen von Macht: Es wird nicht erst gefährlich, wenn die Daten oder Macht missbraucht werden, sondern die Gefahr liegt schon in ihrer Anhäufung.
Das gilt auch für Staaten: Für die Gleichberechtigung auf der Welt wäre es ein Fortschritt, wenn es keine Großmächte mehr gäbe, sondern nur noch Kleinstaaten. So wie ein Rudel aus vielen Individuen besteht, von denen keines stark genug ist, alle anderen zu dominieren, würde auch ein Konstrukt vieler Kleinstaaten als Weltgemeinschaft verhindern, dass ein Staat sich über die anderen erheben kann.94 Eine EU bestehend aus vielen autonomen Kleinstaaten würde den Einzelinteressen beispielsweise von Bayern eher gerecht, denn jeder Kleinstaat könnte seine regionalen Befindlichkeiten berücksichtigen.95 Weiterhin würde sich niemand mehr beschweren, dass Deutschland die EU dominiere.
Wissen ist Macht
Wissen über andere ist Macht über andere. Wer exklusives Wissen über andere Menschen besitzt, kann diese damit erpressen. So wenig ich mir das wünsche, dass alle Informationen über mich öffentlich sein sollen, so wäre ich doch nach einer wirksamen Veröffentlichung nicht mehr erpressbar. Ich kann mir vorstellen, dass wir als Einzelpersonen in fünfhundert Jahren keine Geheimnisse mehr haben werden, weil jedem klar ist, dass Menschen selbstverständlich unterschiedlich sind und dass persönliche Eigenarten akzeptiert werden müssen. Erpressbarkeit beruht darauf, dass jemand etwas über eine Person weiß, das dieser bei Bekanntwerden zwischenmenschliche Komplikationen, Rufschädigung oder juristische Verfolgung bescheren würde. Das setzt die Idee voraus, dass Verhalten in Richtig und Falsch eingeteilt wird. Wenn man dabei Verstöße gegen Strafrecht ausklammert, beruht dies in erster Linie auf Intoleranz: Man kann jemanden mit Nacktfotos aus seiner Jugend erpressen, obwohl dies wenig mit Beeinträchtigung anderer Menschen zu tun hat, sondern in erster Linie mit der Vorstellung, es gebe objektiv richtige und falsche Verhaltensweisen. Je freier wir werden, desto weniger Bedeutung werden solche Informationen haben.
Technisches Wissen ist Macht
Exklusive Nutzungsrechte von Wissen (Patente, Urheberrechte) sind exklusive Nutzungsrechte in Bezug auf Macht. Diese Macht wäre dahin, wenn alles Wissen öffentlich wäre. Patente sind ursprünglich dafür gedacht, eine Vergütungsmöglichkeit für den Aufwand neuer Entwicklungen zu schaffen. Wer sein hart erarbeitetes Wissen nicht verkaufen kann, hat weniger Anreiz, etwas zu entwickeln, weil er am Ende möglicherweise auf den Kosten sitzenbleibt. Auf der anderen Seite werden Patente zunehmend dazu verwendet, Veränderung zu verhindern. Viele Firmen besitzen Patente über neue, innovative Technologien nur noch zur Festigung ihrer Marktmacht. Das hat mit dem ursprünglichen Gedanken wenig zu tun. Sie können damit andere vom Markt auszuschließen, ihre alten Anlagen weiter betreiben und sind nicht zur Anwendung einer neuen Technologie (mit hohem Kostenaufwand) gezwungen. Beispielsweise hat die Erdölindustrie ein großes Interesse daran, dass sich alternative Methoden zur Energieerzeugung nicht zu schnell verbreiten, damit sie ihre Milliarden Euro teuren Raffinerien weiter betreiben können, solange sie rentabel arbeiten. Dass im ursprünglichen Sinne Patente gehandelt werden und ein Unternehmen die Lizenz von einem anderen erwirbt, um das patentierte Produkt zu produzieren, wird mittlerweile zur Ausnahme.
Derzeit werden viele Erkenntnisse von konkurrierenden Personen oder Unternehmen parallel entwickelt. Der Nachteil des mehrfachen Aufwandes wird in Kauf genommen, weil angenommen wird, dass die Entwicklung zum Erliegen kommt, wenn keine Konkurrenz mehr herrscht. Ich kann mir hingegen auch vorstellen, dass Unternehmen in fünfhundert Jahren auf neue Art zusammenarbeiten werden, weil es sinnlos und verschwenderisch ist, wenn jede neue Technologie von mehreren konkurrierenden Unternehmen parallel entwickelt wird. Der Wissensaustausch ist eine Grundlage unserer schnellen Entwicklung seit der neolithischen Revolution. Wenn die Verteilung von Wissen und die darüber erfolgende Verbreitung von Qualifikation so entscheidend sind, bedeutet jede unterlassene Weitergabe von Wissen einen Verlust für die Entwicklung der Menschheit. Das gilt auch für jede Geheimhaltung von Wissen – unabhängig davon, welche Gründe es für die Geheimhaltung gibt. Was geheimgehalten wird, verzögert die Weiterentwicklung der Menschheit. In diesem Sinne trägt jedes Horten von Know-how zur Stabilisierung von Ungleichheiten bei, und die Weitergabe von Wissen trägt zu einer besseren Welt bei.
Macht wird langfristig immer missbraucht
Wenn ein Mensch Macht anhäuft, besteht ein hohes Risiko, dass er diese zum Nachteil der anderen nutzt. Die Risiken für den Machtmissbrauch sind folgende:
− Konrad Lorenz zufolge ist der Mensch mit einer hohen Aggressivität ausgestattet, die noch in einem akzeptablen Verhältnis zu seinen Körperwaffen (Fingernägeln, Zähnen usw.) und Kräften steht. Wer zu viel Macht hat, verletzt das Kräftegleichgewicht.
− Wer mehr Macht hat, trägt ein Risiko, Schaden an der Menschheit anzurichten. Seine Handlungen haben eine größere Tragweite als die anderer. Das bedeutet, dass er früher oder später aus Unachtsamkeit oder Unwissenheit Schaden anrichten wird. Nur wer trotz des Potentials zur Verbesserung der eigenen Lage altruistisch handelt, hat eine Chance, die Macht nicht zu missbrauchen. Im besten Fall wird also nur jemand, der die Macht nicht anstrebt, damit verantwortungsvoll umgehen, weil er am ehesten altruistisch handeln kann. Aber auch dieser Mensch ist nicht vor Irrtümern sicher.
− Je mehr Macht jemand hat, umso mehr kann er sie zu seinem persönlichen Vorteil nutzen. Wer mehr Macht besitzt, braucht bei Missbrauch derselben weniger Sanktionen zu fürchten.
− Der Mensch ist als ein in Gruppen lebendes, soziales Wesen nicht dafür gemacht, Macht zu haben. Die Vorteile der gemeinsamen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung, die in letzter Zeit häufig erwähnte „Schwarmintelligenz“ wird durch Macht und Herrschaft verhindert.
− Am Beispiel der Rolle des Verfassungsschutzes im NSU-Prozess wurde klar: Macht einerseits und Kontrolle bzw. Vernetzung andererseits stellen zwei Gegenpole dar. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist unter anderem, rechtsextreme Entwicklungen aufzudecken. Um verdeckt ermitteln zu können, dürfen sich V-Männer im rechtlichen Grenzgebiet bewegen, solange sie nicht direkt an Straftaten beteiligt sind und nicht dazu anstiften. Der Verfassungsschutz agiert dabei relativ unabhängig. Im Fall des NSU („Nationalsozialistischer Untergrund“) führte das zu derartigen Verstrickungen zwischen Verfassungsschützern und Rechtsextremen, dass jetzt der Vorwurf im Raum steht, der Verfassungsschutz habe die rechtsextrem motivierte Mordserie erst ermöglicht. Selbst nach der Enttarnung des NSU wurde bei verschiedenen Behörden eine große Zahl von Akten vernichtet, die möglicherweise unzulässige Aktivitäten des Verfassungsschutzes hätten belegen können. Ob Macht missbraucht wird, wird dadurch beeinflusst, wie stark diejenigen, die sie besitzen, mit der Gesellschaft vernetzt sind und wie sehr sie einer (staatlichen) Kontrolle unterworfen sind. Sind Vernetzung und Kontrolle zu gering, so entsteht Wildwuchs, und das System wird zum Selbstläufer, der unkontrolliert marodieren kann.
Rousseau sagte: „Nun ist in der Beziehung zwischen Mensch und Mensch das Schlimmste, was dem einen widerfahren kann, sich dem Belieben des anderen ausgesetzt zu sehen.“97 Je größer das Machtgefälle, desto wahrscheinlicher wird der Machtmissbrauch, weil die möglichen Sanktionen für den Inhaber der Macht geringer werden und gleichzeitig sein möglicher Vorteil auf Kosten anderer größer wird. Von Jean-Jacques Rousseau stammt auch der Satz: „Zwischen dem Schwachen und dem Starken ist es die Freiheit, die unterdrückt, und das Gesetz, das befreit.’“98
Normalerweise sind wir zu Mitgefühl mit anderen fähig, zu denen wir eine persönliche Beziehung haben oder die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie wir. Je größer aber die Unterschiede in Stellung, Vermögen oder Lebensweise werden, desto mehr schwindet diese Fähigkeit. Ganz gleich, ob die Macht des einen über den anderen durch physische, psychische oder finanzielle Überlegenheit zustande kommt – ist das Gefälle groß genug, so geht das Mitgefühl des Stärkeren für den Schwächeren verloren. Wie viel Mitgefühl haben wir gegenüber nervenden Fliegen oder Ameisen? Wie respektvoll begegnen wir einem uns intellektuell deutlich unterlegenen Menschen? Wir empfinden Dummheit meist als abstoßend, obwohl sie in den wenigsten Fällen selbstverschuldet ist.
Die kritische Masse für den Machtmissbrauch ist erreicht, wenn ein Staat, ein Unternehmen oder eine Einzelperson die Interessen anderer verletzen kann, ohne Gegenwehr fürchten zu müssen.99 Das gilt für die Macht eines Vergewaltigers über sein Opfer, von Metzgern über die zu schlachtenden Tiere, von Soldaten im Krieg gegenüber Besiegten und der Schulhofgang gegenüber dem Außenseiter. Und auch heute noch werden viele Kinder von ihren Eltern geschlagen – trotz eines mittlerweile gesetzlich verankerten Prügelverbots.
Heute werden Empfänger von Sozialleistungen und Flüchtlinge in die Rolle des Unterlegenen gedrängt: Sie haben wenig Macht, keine Fürsprecher und gelten gemeinhin als Versager. So erschafft man Sündenböcke und die Ohnmacht, die die Grundlage jeder Ausbeutung ist. Dasselbe gilt für die Häftlinge in Guantanamo und anderen nicht demokratisch kontrollierten Gefangenenlagern. Auch Näherinnen in Bangladesch, Arbeiter in Minen in Afrika und Südamerika und viele weitere Gruppen sind den europäischen Unternehmen, denen sie zuarbeiten, so stark unterlegen, dass sie sich nicht gegen Ausbeutung zur Wehr setzen können.
Jeder Händler kennt sie – Kunden, die es darauf anlegen, jeden noch so ungerechtfertigten Preisnachlass zu erhalten, wenn sie eine Chance wittern. Auch ich erlebe in meinem Beruf immer wieder Verhandlungspartner, die ihre Machtposition missbrauchen und über die Stränge schlagen. Sie fordern Zugeständnisse, von denen sie wissen, dass sie völlig unrealistisch sind. Das wird gelegentlich ganz unverblümt zugegeben – zumal sich der Lieferant oder Dienstleister nicht dagegen wehren kann. Das ungerechte Verhalten muss den Beteiligten aber nicht zwangsläufig bewusst sein – es reicht aus, wenn man einander nicht auf Augenhöhe begegnet.
Wenn wir eindeutig überlegen sind und mit dem Angriff kein Risiko eingehen, greifen wir früher oder später immer zu Gewalt.100 Leopold Kohr hat in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, dass zu der Möglichkeit noch die Motivation gehört, sonst müsste ich den ganzen Tag Ameisen zertretend durch die Stadt laufen. Ein gewisses Aggressionspotential, der Wunsch, sich abzureagieren, oder der Wunsch, sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, begünstigen Machtmissbrauch. Ohne Handlungsmotivation führt Macht höchstens zu Schäden aus Unachtsamkeit. Allerdings tragen viele Menschen der heutigen Zeit eine innere Leere in sich (siehe Kapitel 2.4), die sie nach persönlichen Vorteilen streben lässt, und haben genügend aufgestaute Wut in sich, was eine starke Motivation zum Streben nach Macht und zu ihrer Ausübung darstellt.
Hohe Bevölkerungsdichte und viele Begegnungen mit Fremden erhöhen unsere Aggressivität und führen dadurch zu Veränderungen – aber auf verschleißträchtige Weise: durch Wettbewerb, Selektion von Unternehmen und Mitarbeitern, unter Stress, im ständigen Kampf um die vordersten Plätze – eben so, wie es die Verfechter unseres Wirtschaftssystems häufig propagieren. Die in vielen Firmenleitbildern beschriebene offene Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit werden meist nur auf den untersten Ebenen gelebt. Auf der Stufe der Abteilungsleiter und darüber besteht ein großer Teil des Handelns in den meisten Unternehmen aus Intrigen, Machtspielen und „politischen Entscheidungen“. Die Medien sprechen von den Leitungsebenen großer Unternehmen als „Haifischbecken“. Führungskräfte sind meist davon überzeugt, die wahren Leistungsträger zu sein, ohne die nichts läuft. Sie verwenden einen Teil ihrer Arbeitszeit auf Ränkespiele und Strategien für ihren weiteren Aufstieg. Von ihnen geht ein hohes Maß an Aggressivität sowie sozialer und wirtschaftlicher Zerstörung aus.
Nicht alle Menschen streben nach Macht. Unsere Manager und Politiker rekrutieren sich aus dem kleinen Teil der Bevölkerung, der nach oben will. Wer wirklich Macht will, sucht sein Leben lang nach Mitteln und Wegen, sie zu erlangen. Und er wird dabei entdecken, dass Vernetzung mit anderen nach Macht strebenden Menschen von Vorteil ist, dass die Botschaft wichtiger ist als die Handlung und dass man besser nichts tut, als Fehler zu machen. Normalbürger entdecken das ebenso, aber sie richten ihr Handeln nicht danach aus, weil es für sie nicht bedeutend genug ist oder weil ihr Streben auf ein anderes Ziel gerichtet ist. Es gibt eine große Zahl von Menschen, die beobachtet haben, dass man z. B. mit Seilschaften und Intrigen nach oben kommen kann. Sie nutzen diese Möglichkeiten aber nicht, weil sie einfach kein Interesse am Aufstieg haben, weil ihnen ein solches Verhalten zu unmoralisch ist, weil sie sich andere Ziele gesetzt haben oder Ihnen andere notwendige Eigenschaften für eine Karriere fehlen. Es benötigt eine bestimmte Haltung, um nach oben zu kommen. Emotionslosigkeit, Ignoranz, Kaltschnäuzigkeit, Moralfreiheit und ein Hang zu Intrigen sind vorteilhaft für eine Karriere.
Das Problem besteht nicht darin, dass Leute nach oben streben, weil sie denken, dass sie dort am besten ihre Fähigkeiten einbringen können. Viele wollen deshalb in hohe Positionen, weil sie einen starken Geltungsdrang haben. Dies sollte uns suspekt sein, da sie dabei sehr persönliche Motive verfolgen und der mögliche Nutzen für den Arbeitgeber oder die Allgemeinheit fragwürdig ist. Man sollte solche Eigenschaften wie den Willen zur Macht bei der Besetzung einer hohen Position negativ bewerten, nicht positiv. Wir würden nie bewusst Terroristen mit Sprengstoff versorgen und Menschen ohne Fluglizenz Linienflugzeuge fliegen lassen. Aber in Unternehmen und Politik lassen wir auch Menschen an die Schaltstellen der Macht, die die nötige moralische Eignung nicht nachgewiesen haben.
Ich denke, jeder Mensch kann in Überheblichkeit oder Depression verfallen. Läuft es gerade gut und einem gelingt alles, stellt sich manchmal ein Moment ein, in dem man denkt: Eigentlich kann ich doch alles, was ich können muss. So liegt mir die Welt zu Füßen. Was sollte ich sonst noch brauchen? Und in besonders schlechten Momenten ist man am Boden zerstört, weil nichts gelingt, keine Hoffnung besteht und man an seinen Fähigkeiten zweifelt. Jeder Mensch bewegt sich irgendwo zwischen diesen Zuständen. Und beide Zustände sind schädlich, wenn man zu tief oder zu lange hineinrutscht – der „negative“ nur für den Einzelnen, der „positive“ auch für die Umgebung. Wenn Menschen in einer natürlichen Gruppe zusammenlebten, wird das Gemeinschaftsgefühl immer seinen Teil dazu beigetragen haben, dass der Einzelne nicht in solchen Gefühlen versank. Aber in unserer heutigen Gesellschaft gibt es Situationen, in denen Einzelne lange Zeit in dem Gefühl der Selbstherrlichkeit baden können, zum Beispiel wenn sie Firmenlenker, Hollywoodstars, Musiker oder finanziell erfolgreich sind. Dann bekommt die Neigung zur Selbstherrlichkeit über lange Zeit Futter, und die Wahrscheinlichkeit wächst, dass diese zerstörerisch wirkt. Wir alle kennen Geschichten von berühmten Persönlichkeiten, die im Umgang mit anderen Menschen unerträglich waren.
Interessant finde ich die Beispiele aus Romanen, in denen die Autoren ihre Protagonisten entsprechend dieser Erkenntnis der Bedeutung und Folgen von Macht handeln lassen: J. R. R. Tolkien behauptet indirekt in Der Herr der Ringe, Macht an sich sei schlecht, denn es gibt in dieser Geschichte keinen guten Zauberring. Das erklärte Ziel der Handlung ist es, die Macht des obersten Ringes und damit aller Ringe zu vernichten, um die diktatorische Herrschaft einzelner über den Rest zu beenden. Auch Harry Potter zerbricht am Ende des letzten Filmes der Reihe den mächtigsten Zauberstab, den Elderstab, obwohl er mit diesem Zauberstab unbesiegbar wäre. Die letzte Szene des Films zeigt eine friedliche Zukunft der Protagonisten.
Die vorgenannten Zusammenhänge stellen in meinen Augen klar, dass es viele Mechanismen gibt die dafür sorgen, dass Machtanhäufung auch zu Machtmissbrauch führt. Die wenigen Gegenkräfte sind unterlegen. Eine Gegenkraft ist die Beziehung zwischen Menschen, die Mitgefühl und wechselseitiges Verständnis mit sich bringt. Genau diese persönlichen Beziehungen sind seit der neolithischen Revolution weniger geworden, als wir eine Gesellschaft erschufen und das Leben in Kleingruppen seltener wurde, und in einem zweiten Schritt mit der Industrialisierung, die die Massengesellschaft mit sich brachte.
Der „Will to Power“ passt einfach nicht mehr in unsere Zeit. In früheren Zeiten waren wir nicht hoch genug entwickelt, um Machtanhäufungen zu vermeiden, und vielleicht gab es auch Situationen, in denen die Führung von Ungebildeten durch einen Gebildeten sinnvoll war – vor allem, als es noch eine größere Zahl von Menschen gab, die überwiegend ihren Eingebungen und Trieben folgten und ihr Handeln kaum bewusst kontrollieren konnten. In der heutigen Zeit brauchen wir jedoch altruistische, kommunikative Menschen, die unseren Entwicklungsprozess gemeinsam und auf Augenhöhe vorantreiben.
Es wird Zeit, dass wir dies erkennen und den Machtgeilen diese Jobs verweigern, so wie wir auch in anderen Bereichen durch demokratische Prozesse die für die jeweiligen Tätigkeiten Ungeeigneten zum Schutz aller davon ausschließen. Wer mehrmals betrunken Auto gefahren ist und dabei erwischt wurde, muss den Führerschein abgeben. Wer mehrfach Firmen ausgebeutet hat oder in den Konkurs geführt hat, darf einfach weitermachen, obwohl der Schaden ungleich größer sein kann und die Gegenwart zeigt, dass der Markt dies nicht von selbst regelt. Auch für diese Fälle könnten auf demokratischem Weg Gesetze erlassen werden, die den Entscheidern mehr Verantwortung für ihr Handeln auferlegen.
Je größer das Machtgefälle, desto tragischer die Auswirkungen
Beispiele für die Folgen großer Machtungleichheit sind Vergewaltigungen in Kriegen, die Folterungen an KZ-Insassen im Dritten Reich, gezielte Quälereien von Tieren in Schlachthöfen101 oder, wenn Kinder Frösche aufblasen.