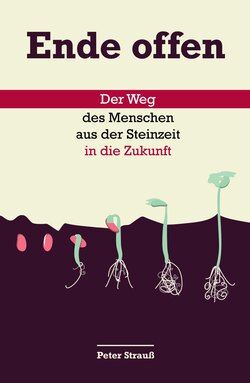Читать книгу Ende offen - Peter Strauß - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEs gibt viele Berichte über Folterungen von KZ-Insassen, die z. B. mit medizinischen Experimenten begründet wurden, und es gibt Berichte über willkürliche Quälereien aus dem Affekt heraus. Menschen wurden psychisch und körperlich gequält und zu unnützen Arbeiten gezwungen. Die große Machtdifferenz zwischen Insassen und Aufsehern in den KZs beinhaltete, dass Quälereien nicht mehr durch Sanktionen bedroht waren – ein Fehlverhalten der Aufseher gegenüber den Insassen im Sinne der Gesetzgebung war nicht mehr möglich. Das schuf die Möglichkeit, alle moralischen Grenzen zu überschreiten.
In Irland gab es bis zum Ende des zwanzigsten Jahrhunderts „Magdalenen-Heime“, in denen Mädchen und Frauen wegen Prostitution, aber auch für zum Teil kleinste moralische Verfehlungen zur „Besserung“ gefangen gehalten wurden, manche nur, weil sie zu hübsch waren.102 Diese Inhaftierung war nur möglich, weil die Eltern und Verwandten sie wegen „moralischer Verfehlungen“ verstoßen hatten und der Rest der Welt glaubte, sie seien zu Recht dort, weil sie unzüchtig, verdorben und entehrt seien und es verdient hätten. Man konnte so mit ihnen umspringen, weil sie weder Unterstützer hatten noch irgendeine Form von Zuflucht oder die Möglichkeit zur Gegenwehr.
Für alle Menschen- und Tierkinder gilt, dass die Eltern eine unangreifbare Übermacht darstellen. Die Natur hat uns die Liebe zu unserem Nachwuchs mitgegeben, damit wir ihm gegenüber geduldiger, wohlwollender, fürsorglicher sind, als wir es bei Erwachsenen wären.103 Wenn ein Erwachsener durch mangelnde Erfahrung etwas kaputt macht, sich ungeschickt anstellt, hilflos ist, Pflege oder Unterstützung braucht, haben wir wesentlich weniger Geduld als gegenüber unseren Kindern. Und dies ist für das Überleben der Art dringend erforderlich, um zu verhindern, dass in einer vorzivilisatorischen Gruppe die Übermacht der Eltern gegenüber den Kindern zu instinktiven Gewalthandlungen führt, gegen die sich diese nicht wehren könnten.
In vielen Bereichen verwenden wir unsere Übermacht gegenüber dem größten Teil der Natur zu unserem Nutzen: Kein Leben eines Schweins wird geschont, wenn ein paar Cent zu verdienen sind. Wenn eine Entscheidung zwischen Gewaltfreiheit und Kostenreduktion gefällt werden muss, fällt die Entscheidung im Kapitalismus fast immer zugunsten des Gewinns, vor allem, wenn es keine Restriktionen gibt oder keine Gefahr besteht, dass die Handlung öffentlich bekannt wird. Und wir alle schauen selten hin. Denn die meisten von uns haben schon von Quälerei bei Tierhaltung und Schlachtung gehört, beschäftigen sich aber kaum mit dem Thema, wollen weiter gut und billig essen und hoffen, dass alles mit rechten Dingen zugehe und die Fleischhersteller oder der Gesetzgeber verantwortlich handeln. Menschen, die in Schlachthöfen arbeiten, haben die Gelegenheit, Tiere ungestraft zu quälen – mit der Begründung: „Die Tiere sterben ja sowieso“. Ein im Internet zu findender Film über die Schlachtung einer Kuh104 hinterlässt beim Anschauen dasselbe schaurige Gefühl wie Dokumentationen über die Grausamkeiten in Konzentrationslagern.
Unternehmen wie Nestlé, Unilever oder große Automobilhersteller können aufgrund ihrer Position ihre Lieferanten gegeneinander ausspielen, um niedrigere Preise durchzusetzen. Andere wie Maxdome, Ebay, Paypal können durch den Aufwand nicht zu rechtfertigende Gebühren für ihre Dienstleistungen verlangen, weil sie wenig oder keine Konkurrenz in ihrem Marktsegment haben. In Form von Banken, Hedgefonds und sonstigen „Investoren“ wurden große Machthäufungen zugelassen, die es jenen erlauben, die Preise von Grundnahrungsmitteln durch Spekulation so sehr hochzutreiben, dass die Ärmsten der Erde dadurch verhungern.
Große Machtunterschiede geben dem Unterlegenen wenige Möglichkeiten zur Gegenwehr und damit zur Sanktionierung der Machtausübung. Es braucht nicht viel Böswilligkeit, damit der Überlegene den Unterlegenen schlecht behandelt. Ein „Täter“ kann durchaus ohne böse Absicht, sondern in Unwissenheit über die Auswirkungen handeln, weil sich die Betroffenen in ihrer Notlage kein Gehör verschaffen können.
Warum gibt es keine Superhelden?
In der Phantasie würden sich viele wünschen, Superheld zu sein, und diese modernen Film-Märchen vermitteln den Eindruck, das sei gut für alle, denn die Superhelden retten immer wieder die Welt vor Gefahren, die mit der Kraft eines normalen Menschen nicht zu bewältigen sind.105 Abgesehen von den Grenzen, die die Physik setzt, wäre es problematisch für die Arterhaltung, wenn es Einzelpersonen mit übermenschlichen Kräften gäbe. Diese Einzelnen könnten nicht nur wie im Film eine starke Hilfe sein, sondern sie könnten auch mit dem Rest machen, was sie wollen.
Grundsätzlich bringt auch jede Erfindung die Gefahr mit sich, dass ein neues Machtmittel geschaffen wird, dem die Menschen moralisch nicht gewachsen sind. Drastischstes Beispiel hierfür ist die Entdeckung der Kernkraft, die uns die Fähigkeit zum Mord an der gesamten Menschheit eröffnet hat. Wir können es uns als Menschheit nicht mehr leisten, bei ständig zunehmender Macht nur aus unseren Fehlern zu lernen, sonst wird es irgendwann den Fehler geben, aus dem wir nicht mehr lernen können.
Der Glaube an Macht erschafft und legitimiert Macht
Viele Menschen streben heute nach Ansehen, Geltung und Beachtung, und viele Menschen sind bereit, diesen Drang bei anderen anzuerkennen oder dazu beizutragen. Einem Star- und Personenkult liegen ähnliche Verhaltensmodelle zugrunde wie Machtstrukturen und Hierarchien. Eine Veränderung, die keinen Personenkult mehr schafft, wäre der Weg zu mehr Gemeinschaft. Miteinander ist das Gegenteil einer Struktur mit „Oben“ und „Unten“. Es wäre ein Abschied von Hierarchien, die durch Ansehen verstärkt werden. Ohne Personenkult und Ehrfurcht vor hohen Positionen verlieren Hierarchien an Bedeutung, und das Miteinander tritt in den Vordergrund.
Der Anfang ist gemacht. Die Bedeutung von Stellungen und Rollen ist rückläufig, und der Trend geht zur Gleichheit im Status. Heutzutage gibt es immer mehr Vorgesetzte, die ihre Position gar nicht oder viel weniger als früher ausnutzen, die sich genauso verhalten wie vor ihrem Aufstieg und sich von ihren Untergebenen nur noch durch ihre Aufgaben, nicht durch ihr Verhalten oder Erscheinungsbild unterscheiden. In den Siebziger und Achtziger Jahren hätte ein Mitarbeiter, der eine Entscheidung eines Vorgesetzten hinterfragte, eine Abmahnung oder Kündigung riskiert. Heute dagegen ist es vielerorts üblich, dass Entscheidungen offen vom Vorgesetzen mit dem Team diskutiert werden.
Schon im neunzehnten Jahrhundert hat der Prozess der Rückbildung der Hierarchien mit dem Bedeutungsverlust der Monarchien begonnen, und es setzte sich damit fort, dass sich Menschen in unterschiedlichen Positionen immer weniger durch ihre Kleidung unterschieden. Klar, auch heute müssen die höchsten Führungskräfte „ordentlich“ gekleidet sein, und sie definieren sich über bestimmte Kleidung. Aber es gibt nicht mehr den Prunk wie im Mittelalter und die Unterschiede verschwimmen immer mehr. In manchen jungen Branchen, zum Beispiel der IT-Branche, kann oder muss der Geschäftsführer genauso gekleidet sein wie der Sachbearbeiter. Die Anerkennung irgendwelcher Positionen wird mit weiterer Reifung des Menschen zurückgehen. Wir werden weder Stars oder Anführer anbeten wollen, noch selbst welche werden wollen.
Wie entstehen Machtanhäufungen? Als Einzelne wollen wir vorwärts kommen durch die Sammlung von Wissen, Vermögen, Macht, Erfahrung, Geld usw. Das ist zumindest teilweise (außer in Bezug auf Vermögen und Geld) richtig, denn es ist der Motor unserer Entwicklung – auch der unserer Kultur – und wurde uns von der Evolution mitgegeben. Aber daraus abzuleiten, dass auch beliebig große Ansammlungen von Macht erstrebenswert seien, ist ein Fehlschluss, denn die Möglichkeit zur Machtanhäufung ist erst durch unsere Kultur (Besitz) entstanden und war von der Evolution nicht eingeplant.
Die Annahme, dass Machthäufungen erstrebenswert seien, vertreten wir unbewusst, indem wir die Macht von Diktatoren, großen Konzernen, Medien und anderen als selbstverständlich hinnehmen und nicht in Frage stellen. Wenn zu viele Menschen an Helden und starke Anführer glauben, so werden sie diese auch bekommen. So entsteht die Umgebung, die eine Machthäufung toleriert.
− Wir empfinden Machthäufungen als zulässig und richtig und liefern so die Legitimation auch der Macht, die uns schaden will.
− Der Glaube an die Macht befördert Einzelne in Machtpositionen, weil viele danach streben und bei manchen Menschen dieses Streben von Erfolg gekrönt ist.
− In der Bevölkerung gibt es immer wieder den Gedanken an eine wohlwollende Diktatur. Diese soll „mit harter Hand“ notwendige Entscheidungen treffen und etwas zum Besseren wenden, was der Demokratie nicht gelingt. Darin drückt sich auch der Wunsch aus, die Entwicklung der Menschheit zu beschleunigen. Es ist anstrengend, zusehen zu müssen, wie andere Fehler machen, die man selbst vielleicht schon hinter sich gelassen hat. Andererseits hatte man selbst auch die Freiheit, diese Fehler zu machen, bis man sie als solche erkannte und sein Verhalten änderte. Was wäre, wenn man als wohlwollender Diktator anderen Vorschriften machen könnte und man später herausfände, dass die anderen doch recht hatten? Wer könnte dafür wirklich die Verantwortung tragen? Jeder Versuch, der darüber hinausgeht, andere zu überzeugen oder ihnen Vorbild zu sein, ist der erste Schritt in Richtung Diktatur. Weiterhin besteht immer die Gefahr, dass der wohlwollende Diktator sein Wohlwollen ablegt oder dass er durch einen Putsch aus seinem Amt entfernt wird und ein anderer die vorhandenen diktatorischen Strukturen für egoistische Zwecke missbraucht.106
Man kann darüber streiten, ob eine Diktatur deshalb entsteht, weil das Volk noch nicht reif für die Demokratie ist, im Sinne von: „Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient“. Man kann auch behaupten, das Volk könne sich einem Diktator, der über die nötige Machtstruktur verfügt, nicht widersetzen – genau das ist ja das Ziel jedes Diktators. Ich denke, für bestehende Diktaturen gilt meist beides, aber das ist nicht relevant, denn die Umkehrung ist aufschlussreich: Ein Volk, das nicht an Macht und Machtstrukturen glaubt, kann von keinem Diktator, der sich aus den eigenen Reihen erheben will, unterworfen werden, denn es wird sich ein Umfeld ohne Machtstrukturen schaffen.
Unsere Gesellschaft versucht auf der einen Seite, die negativen Auswirkungen von Macht zu begrenzen. Fälle von Machtmissbrauch werden häufig zu Skandalen in den Medien, und wir sind bestrebt, Machtmissbrauch zu ächten, indem wir Gesetze dagegen erlassen. Dies wird jedoch nie vollständig gelingen, weil jeder Machtmissbraucher, der aus seiner Position entfernt wurde, früher oder später durch einen anderen ersetzt wird, solange die Strukturen dafür existieren und solange Menschen nach Geld, Macht, Vermögen und Bedeutung streben. Die Fälle, die aufgedeckt werden, haben sicherlich eine abschreckende Wirkung, doch wird immer nur ein Teil der Fälle von Machtmissbrauch publik, und ein Teil bleibt unentdeckt. Auf eine gesamtgesellschaftliche Erkenntnis eines Fehlverhaltens kommen zahllose individuelle Versuche, sich persönlich zu bereichern. Während ein Fehlverhalten durch die Aufdeckung eines Skandals geächtet wird, sucht weltweit die Mehrzahl aller Entscheider in Unternehmen und Politik nach legalen und zum kleineren Teil auch nach illegalen Möglichkeiten der Machtanhäufung. Sie lernen dabei aus den „Fehlern“ ihrer Vorgänger und versuchen, negative Publicity zu vermeiden.
Es ist unsinnig, dass wir auf der einen Seite als Einzelpersonen ein Streben nach Macht und persönlichem Fortkommen gutheißen und auf der anderen Seite als Gesellschaft Maßnahmen gegen Machtmissbrauch ergreifen. Erst wenn die Menschheit mehrheitlich nicht mehr glaubt, dass Macht etwas Erstrebenswertes sei, wird das Problem des Machtmissbrauchs wirklich gelöst.
Machtstrukturen und geistige Entwicklung
Kinder in den ersten sechs bis sieben Lebensjahren haben ebenso wie Völker, die als Ganzes den entsprechenden Entwicklungsschritt noch nicht vollzogen haben, eine größere Regelgläubigkeit als heutige westliche Menschen (siehe auch Kapitel 2.8). Der Glaube an Regeln macht es Herrschern leichter, ihre Macht zu festigen. Sind die Regeln einmal aufgestellt, werden sie weniger in Frage gestellt. Das ist der Entwicklungsstand, der bis zum Ende des Mittelalters überall herrschte und der Demokratie verhinderte: „Hätte die Menschheit schon immer Demokratie und Rechtsstaat ‚gewollt’ und ‚gekonnt’, dann hätte es die ‚déclaration des droits’ schon im Altertum und in außereuropäischen Kulturen gegeben. […] Vormoderne Bevölkerungen wählen König, Führer, Imam, Ayatollah und Diktator aus freien Stücken, weil sie mit Demokratie Chaos verbinden. […] Das ist aber […] die Vorstellung des Kindes mit Blick auf die Eltern. Die vormodernen Völker offenbaren damit, wie es zahlreiche Autoren und Kommentatoren gesagt haben, dass sie zur Demokratie noch gar nicht reif sind […].“107
„Demzufolge ist der Gegensatz von antidemokratischem und repressivem Machtapparat einerseits und demokratischen Bevölkerungsanteilen letztlich auf die Schwäche des demokratischen Bewusstseins des ganzen Volkes zurückzuführen. Diese Betrachtung wird dadurch ergänzt, dass der Riss zwischen Revolutionären und Konterrevolutionären durch das ganze Volk verläuft und nicht nur zwischen Apparat und Volk. […] Das ägyptische Volk hat 5.000 Jahre lang unter der Knute von Pharaonen und Autokraten gestanden, aber nie daran gedacht, Demokratie und Rechtsstaat aufzubauen. Es hat in der pharaonischen Zeit niemals eine Revolution gewagt, nicht einmal gedacht, mit dem Ziel, Demokratie und Rechtsstaat aufzubauen. Armut und Unterdrückung waren damals schlimmer als unter Mubarak, aber niemand dachte an eine Revolution.“108
Unser heutiger westlicher Entwicklungsstand erschwert Diktaturen und große Machtungleichgewichte. So gesehen haben wir in der westlichen Welt schon einen großen Fortschritt erreicht und einen Schritt in Richtung Freiheit getan.
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass dies nicht für alle Menschen auf der Welt gilt. Die, die in archaischeren Verhältnissen leben, können nicht so leicht von – nach unserem Verständnis – falschen Machtverhältnissen befreit werden, denn ihre Regelgläubigkeit lässt sie diese Verhältnisse mittragen: „Menschen autoritärer Gesellschaften fehlt jedes Vertrauen in die Fähigkeit des Menschen, aus freien Stücken, ohne Kontrolle und Gewalt, Disziplin, Moral und Gesetz zu befolgen.“109 Wenn wir diese Unterschiede in den Denkweisen bei unseren Entscheidungen nicht berücksichtigen und die Haltung der betreffenden Menschen nicht respektieren, werden wir dadurch Kriege vom Zaun brechen.
Wenn beispielsweise westliche Campaigning-Plattformen in Europa Stimmen für die Gleichstellung von Schwulen und Lesben in der arabischen Welt sammeln, wird das von den meisten der dort lebenden strenggläubigen Moslems höchstwahrscheinlich als Angriff von Ungläubigen und als westliche Überheblichkeit ausgelegt. Und daran haben die Unterzeichner der Petitionen Mitverantwortung, denn Menschen, die einen wirklich ernsthaften Glauben bis weit ins Erwachsenenleben beibehalten haben, können diesen kaum mehr ablegen – unabhängig davon, ob sie es selbst wollen oder nicht.
Macht ist der falsche Wert
Es hält sich der Irrglaube, dass Machtwille normal sei und zu Führungspositionen führen solle. Ein optimales System ist in einem für alle Menschen nützlichen Zustand selbststabilisierend. Systeme, die darauf beruhen, nur durch guten Willen und ausgeprägte Erkenntnisfähigkeit des Menschen human zu werden, sind anfällig für Missbrauch und Missstände. Unsere Gesellschaft schafft mit der Möglichkeit zur Machtanhäufung eine kontinuierliche Kraft, die die Ungleichverteilung fördert.
Man hält es für unvermeidlich, dass auch die Träger der Macht Fehler haben und nimmt diese hin. Je größer die Macht, über die ein Mensch verfügt, desto größer wird auch die mögliche Zerstörung, die er anrichten kann. Die Konsequenz daraus kann aber nicht sein, dass wir die Macht besonders ausgewählten, geschulten oder moralischen Menschen geben sollten, denn auch diese können durch die Macht korrumpiert werden und werden früher oder später ihre Macht missbrauchen.
Der dem Klischee entsprechende Machtmensch glaubt üblicherweise an die Ellenbogengesellschaft als ein Ideal und hat es aufgrund dieses Denkens und seines Machtstrebens nach oben geschafft. Auf der Grundlage dieser Überzeugung kämpft er sich nach oben.110 Andere, die zwar selbst nicht nach oben streben, aber den gleichen Glauben teilen, erleichtern ihm den Aufstieg, indem sie ihn gewähren lassen oder ihn fördern. In Hierarchien in Firmen fällt ein solcher Mensch nach oben, und niemand achtet darauf, dass der Aufstieg mit einer Zunahme der persönlichen Verantwortung einhergeht. Er wird, da die Entwicklung seiner Empathie nicht zwangsweise mit seinem Machtzuwachs Schritt gehalten hat, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mehr Schaden als Nutzen erzeugen.
Nicht Machtmissbrauch ist das Problem, sondern die Existenz von Machtstrukturen an sich. Es ist nicht nur so, dass Macht korrumpieren kann – Macht korrumpiert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn nur genügend Zeit vergeht.
Niemand möchte von unbarmherzigen Selbstoptimierern regiert werden. Also sollten wir unsere Werte überdenken. Es sind die falschen Werte in unseren Köpfen, die zum falschen Ergebnis führen. Macht ist gesamtgesellschaftlich kontraproduktiv. Daher sollten alle Anreize zur Machtanhäufung vermieden werden. Die Lösung des Machtproblems liegt aber erst im gesamtgesellschaftlichen Verzicht auf das Streben nach Macht. Und dieser Konsens kann sich nur dadurch einstellen, dass alle Menschen die negativen Folgen von Machthäufungen erkennen, so wie wir vor Jahrhunderten erkannt haben, dass mittelalterliche Folter menschenverachtend ist und sie daraufhin unterlassen haben.
Macht braucht Begrenzung
Wir haben gesehen: Das beständige Anhäufen von Macht muss wirksam begrenzt werden. Daher sollten wir bei der Veränderung unserer Gesellschaft danach streben, mit möglichst wenig Hierarchien und Machtpositionen auszukommen.
Die direkte und extremste Maßnahme wäre der Verzicht auf persönlichen Besitz. Dies wird erst in ferner Zukunft möglich werden, denn mit unserer heutigen Persönlichkeits- und Gesellschaftsstruktur ist die Realisierung dieser Utopie der Sozialisten leider noch unmöglich.
Mit der Abschaffung des persönlichen Besitzes meine ich keineswegs die dogmatische Forderung des Kommunismus, sondern den Verzicht auf Besitz aus der Erkenntnis heraus, dass Besitzstandsmehrung ein eher fragwürdiges Ziel ist. Der Weg dahin kann ausschließlich über die Förderung dieser Erkenntnis führen – Zwang hat keinen Sinn, denn Zwang überzeugt nicht. Eine entsprechende Veränderung der Gesellschaft ist schon zu beobachten: Unter vielen jüngeren Menschen haben Macht, Geld und Besitz weniger Statuswert als früher. Sie setzen Freiheit (auch von Verpflichtungen gegenüber ihrem Eigentum) und Flexibilität über Status, Besitz und Macht.111 In den Medien wurde z. B. mehrfach darüber berichtet, dass junge Erwachsene im Mittel das Auto weniger als ein Statussymbol sehen – statt auf Status und Besitz legen sie eher Wert auf den Sachnutzen.
Da auch die Anhäufung von Vermögen und die Entwicklung großer Konzerne eine Machtanhäufung beinhalten, sollte auch bei Vermögen und Firmen ein ungebremstes Wachsen verhindert werden. Kein einzelner Bürger und auch kein Konzern sollte so viel Macht besitzen, dass er eine Großbank ruinieren, ein Staatssystem gefährden oder eine Finanzkrise auslösen kann. Macht in dieser Größenordnung sollte immer einer demokratischen Kontrolle unterliegen. Am Ende betreffen die Folgen das Volk (beispielsweise wenn systemrelevante Banken gerettet werden müssen) und deshalb sollte die Entscheidungsgewalt darüber auch beim Volk liegen.
Am Anfang des Kapitels hatte ich beschrieben, dass es vor der Entwicklung von Besitz und Sesshaftigkeit keine Möglichkeiten zu Vermögensbildung und Machtanhäufung gab. Die begrenzten Möglichkeiten verhinderten, dass unser beständiges Vorwärtsstreben negative Auswüchse zeitigen konnte. In unserer heutigen Gesellschaftsstruktur brauchen wir Menschen Begrenzungen, die unserem Streben nach Mehr entgegenwirken, um zerstörerische Machtanhäufungen zu verhindern. Ein solcher Mechanismus ist die Besteuerung von institutionellen und privaten Vermögen.
In Bezug auf Unternehmen muss das differenziert betrachtet werden: Die Arbeit mancher Großunternehmen kann nicht sinnvoll durch kleinere Betriebe übernommen werden. Beispielsweise ist es unsinnig, mehrere parallele Postunternehmen oder Eisenbahnnetze zu betreiben, weil eine redundante Infrastruktur hohe Kosten erzeugt. Optimal für den globalen Nutzen wäre hingegen ein weltweites Verkehrskonzept, denn jede Schnittstelle frisst einen Teil des Nutzens des Transports wieder auf. Ebenso frage ich mich in Bezug auf die gesetzliche Krankenversicherung, worin der Vorteil liegen soll, dass es mehrere Kassen gibt, die um die Kunden konkurrieren. Weiterhin müssen manche Firmen eine gewisse Größe haben, um sinnvoll arbeiten zu können, z. B. Firmen, die komplexe Produkte wie Flugzeuge entwickeln. Unternehmen wie Google, Ebay oder Facebook werden für ihre Kunden erst durch ihre Größe nützlich. „Der Nutzen eines Netzwerks steigt mit der Anzahl der User überproportional an, und das Netzwerk mit den meisten Usern setzt sich durch. Digitalen Plattformen ist die Tendenz zum Monopol inhärent, diese führt zu schneller Konzentration.“112 Es hat keinen Sinn, mehrere konkurrierende Suchdienste, Online-Auktionshäuser, oder soziale Netzwerke zu schaffen, um Monopole zu verhindern. Ebenso hat es wenig Sinn, sie in länderbezogene Niederlassungen zu zerlegen. Diese Unternehmen erhalten ihren Nutzen für die Bürger daraus, dass alle Menschen Kunden bei einem einzigen Unternehmen sind. „Diese Oligarchen der Netzwerkökonomie übernehmen die Funktion öffentlicher Institutionen, gewährleisten die Grundversorgung mit Information und Kommunikation und agieren doch als gewinnorientierte private Unternehmen.“113 Eine Kontrolle dieser Unternehmen wird infolge ihrer Marktmacht mit zunehmender Größe und Internationalität immer schwieriger. Es ist nötig, sie unter staatliche Kontrolle zu stellen, um den Missbrauch für Einzelinteressen zu verhindern, und es ist berechtigt, da es sich dabei um Infrastruktur handelt. Wieso sollte man damit nicht so verfahren wie mit Autobahnnetzen, Post- oder Eisenbahnunternehmen? Wir können nicht Konzerne mit der Begründung durch ihre Nützlichkeit nach der Weltherrschaft streben lassen. Der Schutz der Bürger hat Vorrang vor einem möglichen Nutzen und eine staatliche Kontrolle würde den derzeitigen Nutzen nicht zwangsläufig schmälern. Die Frage, wie man die Bediensteten der Staatskonzerne dazu bewegen kann, stärker im Kundeninteresse zu denken und zu handeln, ist damit noch nicht beantwortet.
Für die Macht von Staaten und Staatenbündnissen gibt es keinen vergleichbaren Mechanismus zur Machtbegrenzung wie eine Vermögensbesteuerung. Die Macht von Regierenden kann nur durch Widerstand des Volkes begrenzt werden.
Auch Mechanismen, die Machtanhäufungen begünstigen, müssen abgeschafft werden. Daraus ergibt sich direkt die Forderung nach einer scharfen und vollständigen Trennung von Politik und Wirtschaft, dem vollständigen Verbot von Parteispenden und von Lobbyarbeit im Parlament sowie der Verhinderung von Korruption, denn dadurch können die Machtinhaber ihren Einfluss ohne Nutzen für die Allgemeinheit ausbauen. Macht zieht Korruption an. Mächtige Personen sind für eine Bestechung interessanter als weniger mächtige. Daher könnte man Macht in vielen Fällen auch auf mehrere Personen verteilen. Das reduziert ebenfalls negative Folgen, denn wer nach Macht strebt, hat sie gerne für sich alleine. Wenn die Struktur das Gegenteil erzwingt, wird dieser Posten für die Machthungrigen weniger interessant.
Wir sollten als Menschheit nach Möglichkeit auf Macht und Einfluss verzichten, denn es fällt uns schwer, damit verantwortungsvoll umzugehen. Allgemein formuliert, ergibt sich, dass wir unsere Gesellschaftsstrukturen an die Veränderungen unseres Zusammenlebens seit der Steinzeit anpassen müssen. Dies könnte kurzfristig durch bewusste, demokratisch beschlossene Veränderungen bewirkt werden, wenn wir unser System so korrigieren, dass weniger Machthäufungen entstehen können und deren Auswirkungen durch entsprechende Gegenkräfte abgemildert werden. Da sich heutige Machtanhäufungen immer in finanziellem Vermögen darstellen, ist der wesentliche Punkt die Reduzierung der weltweiten finanziellen Ungleichheit. Darauf gehe ich in Kapitel 3.8 detaillierter ein.
Wir Menschen sind es, die durch das Tolerieren der Strukturen die Möglichkeit schaffen, von genau denen regiert zu werden, denen wir am wenigsten vertrauen. Je weniger wir an Macht glauben, desto weniger wird es Machtstrukturen geben. Je weniger Hierarchien eine Gesellschaft hat, desto weniger Ungleichverteilung und Ausbeutung wird es geben. Wenn wir die Gesellschaftsstrukturen nicht entsprechend korrigieren, wird die Evolution das Problem langfristig ohnehin lösen – aber dies kann unser Aussterben zur Folge haben.
Das Online-Rollenspiel World of Warcraft als Beispiel
Das Multiplayer-Online-Rollenspiel World of Warcraft ist eine große abgeschlossene Welt. Es weist einige Parallelen zu unserer Welt auf – interessant sind aber die Unterschiede. Obwohl das Spiel seit über zehn Jahren existiert, gibt es dort kein Äquivalent zu den Superreichen und Diktatoren unserer Welt. Wäre das nicht so, so würde das Spiel nicht nur für die schwächeren Spieler langweilig, sondern auch für die Überlegenen, denn ein Spiel lebt ja davon, dass es Herausforderungen gibt.
Wie haben die Spieleentwickler das erreicht?
1. Im Spiel muss man seinen Charakter ausbilden und trainieren („leveln“), damit man auch die spannenderen und komplexeren Abenteuer durchspielen kann. Dies ist am Anfang relativ leicht und wird nach oben hin schwieriger. Weiterhin gibt es einen Maximallevel für die Grundfähigkeiten. Darüber hinaus kann man nur noch seine Ausrüstung verbessern und muss sich das hart erkämpfen. Das hält die Spieler auf einem mittleren Niveau zusammen.
2. Ab einem gewissen Niveau kommt man nur dann weiter, wenn man sich mit anderen zusammenschließt.
3. Dass die Herausforderungen über die Jahre mit jedem neuen Update wachsen, hat einen ausgleichenden Effekt, denn jeder ist unabhängig von seiner Erfahrung und Ausrüstung in der neuen Umgebung neu und muss neue Erfahrungen machen. Auch wer vorher einen guten Stand hatte, muss hier wieder teilweise von vorne beginnen.
4. Es gibt keine Form von Erbschaften. Zwar kann man anderen Spielern Waffen und Materialien verkaufen oder übertragen, aber die Erfahrung ist das Wichtigste im Spiel, und die ist nicht übertragbar.
5. Es gibt Zeitschriften, die Spielzüge erläutern und Hilfestellung geben. Es gibt also sogar ein Bildungssystem, das den weniger Findigen hilft, voranzukommen.
Zu 1.: In unserer Welt ist es genau umgekehrt: Aus den Slums der Welt kommt man besonders schwer heraus, und ab einem gewissen Vermögen vermehrt sich das Geld beinahe von selbst, weil man es mittels Konsum kaum noch dezimieren kann und gleichzeitig auf große Vermögen höhere Zinssätze zu bekommen sind.
Zu 2.: Die Qualität von Zusammenarbeit ist bei uns noch wenig positiv betont. Dies wird aber stärker werden, wenn mit zunehmender Komplexität der Technik diese immer weniger durch Einzelleistung realisiert werden kann und ohne wohlwollende Zusammenarbeit viele Erfolge nicht mehr möglich sind.
Zu 3.: Solche ausgleichenden Effekte fehlen in der realen Welt. Die Besteuerung der Einkommen ist weltweit so gestaltet, dass Reich und Arm auseinanderdriften – dazu mehr in Kapitel 3.8.
Zu 4.: Erbschaften sind in der realen Welt ein Hauptgrund für Vermögensanhäufungen, und es fehlt eine ausreichend starke Gegenkraft, die ausgleichend wirkt. Auch dies erörtere ich in Kapitel 3.8.
Zu 5.: Sogar in der Bildung driftet Deutschland auseinander, in Richtung einer Zweiklassengesellschaft, und weltweit betrachtet werden die Bildungschancen schlechter, je ärmer ein Land ist. Außerdem ist unser Bildungssystem sehr träge – es dauert Jahrzehnte, bis neue wissenschaftliche Erkenntnisse in seine Strukturen und Inhalte einfließen.
Mein Fazit aus diesen Beobachtungen ist: Es geht! Es ist möglich, eine solche Welt zu schaffen. Bei World of Warcraft gibt es derzeit ca. fünf Millionen Spieler114, die mit den Umständen zufrieden sind. Unsere Welt ist nicht alternativlos, und die nötigen Randbedingungen einer Veränderung sind leicht zu formulieren.
Für die Spieleentwickler ist es eine einfache Frage, die sie sich wahrscheinlich (belegt durch ihren Erfolg) regelmäßig stellen: Wie sorgen wir dafür, dass das Spiel interessant bleibt? Das führt zur nächsten Frage, wie man große Ungleichheit verhindert und damit zu den obigen Ergebnissen kommt. Dafür, dass unsere Regierenden diese Erkenntnisse nicht genauso direkt umsetzen, gibt es nur eine mögliche Erklärung: Es gibt kein Interesse daran, dafür zu sorgen, oder es gibt große Gegenkräfte, die das verhindern. Dazu gehört neben Lobbyismus, Korruption, Opportunismus und Populismus auch die fehlende Verbreitung der obigen Erkenntnisse.
Nebenbei beobachtet: Es gibt innerhalb des Spieles so gut wie keine Hierarchien!
2.4 Das Gefühl des Richtig-Seins
In diesem Kapitel möchte ich beschreiben, wie sich unsere psychologische Historie auf unser heutiges Leben auswirkt: Die US-amerikanische Autorin und Psychotherapeutin Jean Liedloff hat in der Mitte des letzten Jahrhunderts mehrere Expeditionen zu einem Indianerstamm im brasilianischen Regenwald unternommen. Ihr 1975 erschienenes Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Glück beschreibt, wie deren Ausgeglichenheit, Friedfertigkeit und Integrität mit dem Aufwachsen ihrer Kinder zusammenhängt: „Bei den Yequana werden Kindern praktisch das ganze erste Lebensjahr auf dem Arm oder am Körper getragen und nach Bedarf gestillt. Die Kinder schlafen gemeinsam mit den Eltern, bis sie selbst aus dem Familienbett ausziehen, meist zwischen dem dritten und dem fünften Lebensjahr. Ermahnungen oder Tadel, wie sie Bestandteil der westlichen Erziehung sind, finden Liedloffs Beobachtungen zufolge nicht statt. Die Kinder wachsen zu ungewöhnlich freundlichen, friedlichen und selbstbewussten Menschen heran.“115 Die Geborgenheit der Kinder in den ersten Lebensjahren scheint also zu Eigenschaften im Erwachsenenleben zu führen, nach denen wir ebenso streben.
Liedloff geht davon aus, dass wir eine Erwartung an das Leben, das Kontinuum haben, wie man als Säugling mit uns umgehen solle. Diese Erwartung entsteht durch die Prägung, die die vielen Generationen vor uns erfahren haben. Wir erwarten nach der Geburt, dass die Welt so ist, wie sie unsere Vorfahren erlebten, denn wir sind durch die Evolution genau daran und an nichts anderes angepasst. Liedloff stellt heraus, dass ein Kind ein Aufwachsen in Liebe, Freiheit und Geborgenheit erwartet und nicht ein Aufwachsen in Kontrolle, Zucht, Ordnung und Gefühlskälte, was lange Zeit Standard in der „Erziehung“ war und heute als „Schwarze Pädagogik“ bezeichnet wird. Ihr zufolge haben Eltern von der Natur alle nötigen Fähigkeiten mitbekommen, die sie für den Umgang mit ihren Kindern benötigen: „Es steht z. B. nicht dem Verstand zu, darüber zu entscheiden, wie man ein Baby behandeln muss. Lange ehe wir einen Entwicklungsstand erreichten, der dem des homo sapiens ähnelte, verfügten wir über hervorragende Instinkte, die über jede Einzelheit der Kinderaufzucht Bescheid wussten.“116 Die wenigen Generationen unserer Zivilisation und des bewussten Handelns hätten daran nichts Wesentliches verändert.117
Sie schließt aus ihrer Beobachtung der Ureinwohner, für ein Baby sei es natürlich, den ganzen Tag von der Mutter getragen zu werden, und dies ist direkt nachvollziehbar, wenn man sich vorzivilisatorische Menschen vorstellt. Eine steinzeitliche Mutter hatte keine andere Wahl, als ihr Kind den ganzen Tag mit sich zu tragen. Dies war also unser aller „Urzustand“, der nicht ohne Wirkung bleibt: Ein Baby, das sein erstes Lebensjahr im Körperkontakt mit der Mutter verbringt, bekomme dadurch ein Gefühl des Richtig-Seins in der Welt, der Sicherheit und Geborgenheit, das den meisten heutigen Menschen fehle: „Richtigkeit ist das den Einzelwesen unserer Gattung angemessene grundlegende Gefühl von sich selbst. Verhalten, das nicht durch das Gefühl eigener Richtigkeit bedingt wurde, ist nie das Verhalten, zu dem die Evolution uns führen wollte; es vergeudet daher nicht nur Jahrmillionen der Vervollkommnung, sondern kann auch keiner unserer Beziehungen dienen, weder in uns selbst noch nach außen. Ohne dieses Gefühl des Richtigseins hat man kein Gespür dafür, wie viel an Wohlgefühl, Sicherheit, Hilfe, Gesellschaft, Liebe, Freundschaft, Gegenständen, Lust oder Freude man beanspruchen kann. Einem Menschen, dem dieses Gefühl mangelt, kommt es oft so vor, als sei ein leerer Fleck, wo er selbst sein sollte.“118
Den meisten von uns fehlt das Selbstverständlichste
Die meisten älteren Menschen und ein erheblicher Teil der Jüngeren wurden als Babys den längsten Teil des Tages alleine in ein Bettchen gelegt und hatten nur für kurze Zeit Körperkontakt mit ihrer Mutter. Mit etwas Glück wurden sie gestillt; hatten sie Pech, wurden sie mit der Flasche großgezogen. Dies ist das genaue Gegenteil der „Kontinuumserwartung“ des Babys an die Welt. Ein Baby fühlt sich im Vergleich zu einem Erwachsenen ungleich stärker einsam und verlassen, wenn es alleine ist. Es ist hilflos, kennt diesen Zustand nicht, erwartet ihn nicht und kann damit nicht umgehen: „Nicht vorbereitet ist es hingegen auf irgendeinen noch größeren Sprung – geschweige denn auf einen Sprung ins Nichts, in Nicht-Leben, in einen Korb mit Stoff ausgeschlagen oder in ein Plastikkästchen, das sich nicht bewegt, keinen Ton von sich gibt, das weder den Geruch noch das Gefühl von Leben aufweist.“119
Längeres Alleinlassen eines Babys vermittelt diesem unendliche ununterbrochene Todesangst, Einsamkeit, Verlorensein, Verlassensein, Ausgeliefertsein – ganz einfach deshalb, weil kein vorzivilisatorisches Baby, das auf diese Art allein gelassen wurde, überlebt hat. Instinktiv hätte damals eine Mutter ihr Kind nie länger außer Sicht oder alleine gelassen, weil die Gefahr zu groß gewesen wäre, dass es von einem Raubtier gefressen wird. Das ist auch der Grund, warum ein Baby auf diesen Zustand nicht vorbereitet sein kann: „Wenn er [der Säugling] verlassen ist, aus seinem Kontinuum der richtigen Erfahrung geworfen, ist nichts annehmbar, und nichts wird akzeptiert. Es gibt nur noch ungestilltes Verlangen, es gibt nichts, was sich nutzen ließe, woran man wachsen könnte, nichts, was sein Bedürfnis nach Erfahrung erfüllte; denn die Erfahrungen müssen die erwarteten sein, und nichts in der Erfahrung seiner entwicklungsgeschichtlichen Vorfahren hat ihn darauf vorbereitet, allein gelassen zu werden, ob im Schlaf oder im Wachen, geschweige denn weinend ohne die Antwort eines seiner Artgenossen.“120Jan Philipp Reemtsma bestätigt diese Beobachtung: „Jedes Kind […] ist sich instinktiv seiner Verletzlichkeit gewiss, es weiß vorbewusst von seiner Abhängigkeit, präziser seinem Ausgeliefertsein an die Umwelt und jene Menschen, in deren Verfügungsgewalt es sich weiß. Vernachlässigung, gleichgültiges, gar Abneigung signalisierendes Abwenden bedeuten Todesgefahr, auch das bestbehütete Kind, dem doch solches dennoch immer wieder widerfährt, kann darauf panisch reagieren. Zurückweisung, Verachtung im Alltagsleben des Erwachsenen kann an solche Ängste rühren – muss sie nicht aktualisieren, es hängt von der Lebensgeschichte, der Situation, von vielem ab, was geschieht, aber die besondere Verstörung, die solche Zurückweisung bei manchen Erwachsenen hinterlässt, verweist auf frühes Erleben.“121
Ein Baby kann solche Einsamkeit nicht wie ein Erwachsener aushalten, weil es nicht abschätzen kann, wann diese endet: „Der Mangel an Gespür für das Vergehen der Zeit ist für ein Kind im Mutterleib oder während der Phase des Getragenwerdens kein Nachteil: Es fühlt sich einfach richtig. Für einen nicht auf dem Arm getragenen Säugling jedoch ist die Unfähigkeit, sein Leiden durch Hoffen (was ein Zeitgefühl voraussetzt) wenigstens teilweise zu mildern, wohl der grausamste Aspekt seiner Qual. Daher kann sein Weinen nicht einmal Hoffnung enthalten, obwohl es als Signal wirkt, Erleichterung herbeizurufen. […] Der Mangel an vorausgegangener Erfahrung lässt die Zeit für ein Baby im Zustand unerfüllten Sehnens unerträglich lang erscheinen.“122 Liedloff weiter: „Zu diesem frühen Zeitpunkt ist das Erforderliche genau festgelegt. Wie wir gesehen haben, kann er [der Säugling], wenn er sich jetzt nicht wohl fühlt, nicht hoffen, dass er sich später wohl fühlen wird. Er kann nicht fühlen, dass ‚Mutter gleich wieder da sein wird’, wenn sie ihn verlässt; die Welt ist plötzlich falsch geworden, die Umstände sind unerträglich.“123
Ein Säugling hat keinerlei Möglichkeiten, die Situation auszuhalten, ihr auszuweichen oder sie zu verändern, denn er ist fast vollständig auf andere angewiesen – auch was sein Fühlen betrifft. Solche Erlebnisse prägen den heranwachsenden Menschen meist für das gesamte Leben. Er hatte ein Gefühl des vollständigen Alleinseins und empfand sich vollständig dem Schicksal ausgeliefert – für eine gefühlt endlos lange Zeit hat er dies ertragen müssen, und dies hat ihn geprägt. Er hat zwischen den kurzen Momenten, die ihn seine Mutter auf dem Arm hielt, beständig in der Erwartung gelebt, dass ihn zu einem beliebigen Zeitpunkt das nächste Raubtier verspeisen wird – so wie es einem steinzeitlichen Baby in dieser Situation widerfahren wäre: „Das Ausmaß, in dem die beiden Erwartungsfolgen sich unterscheiden, bestimmt die Entfernung, die ihn später von seinem angeborenen Potential, sich wohlzufühlen, trennt.“124 Diese frühen Erfahrungen bestimmen die Gefühle des Menschen meist ein Leben lang: „Stimmen seine späteren Erfahrungen ihrem Wesen nach nicht mit denen überein, die ihn geprägt haben, neigt es dazu, sie auf Biegen und Brechen dahingehend zu beeinflussen, dass sie dieses Wesen annehmen. Ist es an Alleinsein gewöhnt, wird es unbewußt sein Leben so einrichten, dass ihm ein ähnliches Maß von Alleinsein beschert wird. Möglichen Versuchen seinerseits bzw. durch die äußeren Umstände, es weitaus einsamer bzw. weit weniger einsam zu machen, als es gewohnt ist, wird sein Bestreben nach Stabilität Widerstand leisten.“125
Schwarze Pädagogik
Bis über die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts hinaus erfuhr die Mehrheit der Babys das in den vorigen Absätzen Beschriebene. Sie wurden die längste Zeit des Tages in ihren Bettchen allein gelassen und hatten nur selten Körperkontakt mit der Mutter. Es war lange Zeit ein erklärtes Ziel der „Schwarzen Pädagogik“, das Kind nicht durch Zärtlichkeit „zu verwöhnen“, es dadurch gefügig zu machen und zur Selbständigkeit zu erziehen: „Weinen muß ignoriert werden, um dem Baby zu zeigen, wer der Herr ist; und eine Grundvoraussetzung der Beziehung ist, dass jede Anstrengung unternommen werden muß, um das Baby zur Anpassung an die Wünsche der Mutter zu zwingen.“126 Diese für die Babys fürchterlichen Thesen wurden u. a. Ende des neunzehnten Jahrhunderts von Moritz Schreber und später in der NS-Zeit und bis in die Sechziger Jahre von Johanna Haarer verbreitet. Beide gingen davon aus, dass ein neugeborener Mensch geformt werden müsse.127 Der einflussreiche Naturwissenschaftler Thomas Henry Huxley128 vertrat im neunzehnten Jahrhundert diese Ansicht.129 Für Freud war der Mensch von Natur aus grundsätzlich asozial.130 Diese Ideen sind aber deutlich älter. Schon "Luther nimmt an, daß der Mensch von Natur aus verderbt ist und daß dies seinen Willen zum Bösen hinlenke, so daß es ihm unmöglich ist, eine gute Tat allein aufgrund seiner Natur zu vollbringen."131
„Die früher sehr verbreiteten Vorstellungen von der ‚bösen Kindsnatur’ oder der notwendigen ‚Abrichtung’ zeugen von Aberglauben und dem Wunsch, Menschen auf ähnliche Weise formen zu können, wie man es damals als Dressur mit Tieren praktizierte. […] ’Diese ersten Jahre haben unter anderem auch den Vorteil, dass man da Gewalt und Zwang brauchen kann. Die Kinder vergessen mit den Jahren alles, was ihnen in der ersten Kindheit begegnet ist. Kann man da den Kindern den Willen nehmen, so erinnern sie sich hiernach niemals mehr, dass sie einen Willen gehabt haben.’ – Johann Georg Sulzer: Versuch von der ‚Erziehung’ und Unterweisung der Kinder, 1748“132
Jean Liedloff beschreibt die dramatischen Umstände, unter denen ein Neugeborenes bis über die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts hinaus seine ersten Stunden, Tage oder Monate verbrachte: „In diesem Stadium wäre eine Wölfin, die sich dem Wolfskontinuum gemäß verhält, einem menschlichen Baby eine bessere Mutter als seine biologische Mutter, die einen Meter entfernt im Bett liegt. Die Wolfsmutter wäre greifbar; die menschliche Mutter könnte ebenso gut auf dem Mars liegen. […] In den Entbindungsstationen der westlichen Welt besteht kaum Aussicht, von Wölfinnen getröstet zu werden. Das Neugeborene, dessen Haut nach der uralten Berührung durch einen weichen, wärmeausstrahlenden, lebendigen Körper schreit, wird in ein trockenes, lebloses Tuch gewickelt. Es wird, sosehr es auch schreien mag, in einen Behälter gelegt und dort einer qualvollen Leere ausgeliefert, in der keinerlei Bewegung ist (zum erstenmal in seiner gesamten Körpererfahrung, während der Jahrmillionen seiner Evolution oder seiner Ewigkeit im Uterus). Das einzige Geräusch, das es hören kann, ist das Geschrei anderer Opfer, die die gleiche unaussprechliche Höllenqual leiden. Das Geräusch kann ihm nichts bedeuten. Es schreit und schreit; seine an Luft nicht gewöhnten Lungen werden von der Verzweiflung in seinem Herzen überanstrengt. [Wenn hier ein Reflex greift, also etwas aus dem Kontinuum, dann der, so laut wie möglich zu schreien, um damit die Überlebenswahrscheinlichkeit zu erhöhen, weil einen die Mutter dann vielleicht wiederfindet.] Keiner kommt. Da es seiner Natur gemäß in die Richtigkeit des Lebens vertraut, tut es das einzige, was es kann: Es schreit immer weiter. Schließlich schläft es erschöpft ein – ein zeitloses Leben lang später.“133 Und: „Beim Aufwachen befindet es sich in der Hölle.“134
Bei dem Schriftsteller Andreas Altmann findet sich eine ähnlich dramatische Beschreibung: „Kein Kind wird je fassen, dass es sich ohne Liebe zurechtfinden muss. Es kommt mit der unbedingten Gewissheit auf die Welt, geliebt zu werden. So wie Luft zum Atmen bereitsteht, so die Liebe. Dachte es, nein, fühlte es. Im Laufe der Jahre wird dem Mensch jedoch bewusst, dass jenes Grundnahrungsmittel nicht vorrätig war. Nicht für ihn. Und natürlich versteht er nicht, wie es dazu kommen konnte: dass die einen geliebt wurden und die anderen nicht.“135
Jean Liedloff beschreibt die damals übliche Behandlung aus der Perspektive des Babys: „Auf einer vorbewußten Ebene, die alle seine weiteren Eindrücke bestimmen wird, […] kennt es das Leben als unaussprechlich einsam, ohne Reaktion auf die von ihm ausgesandten Signale und voller Schmerz. […] Die Stunden, in denen der Säugling wach ist, verbringt er in Sehnsucht, Verlangen und in unablässigem Warten darauf, dass ‚Richtigkeit’ im Sinne des Kontinuums die geräuschlose Leere ersetzen möge.“136 Die Mutter hat ihr Baby in seinem Zimmer in sein Bettchen gelegt: „Durch die Türe hört sie Töne, als würde jemand gefoltert. […] Es ist genauso ernst, wie es sich anhört. […] [Sie ist] sicher, daß ihm in Wirklichkeit nichts fehlt; und sie lässt ihn weinen bis er erschöpft ist. […] Die Schreie des Säuglings gehen in ein zitterndes Wimmern über. Da niemand antwortet, verliert sich die Antriebskraft seiner Signale in der Verwirrung lebloser Leere, wo schon lange Erleichterung hätte eintreten müssen. Er blickt um sich. Jenseits der Stäbe seines Gitterbettchens gibt es eine Wand. Er sieht nur die Gitterstäbe, unbeweglich, und die Wand. Aus einer fremden Welt hört er sinnlose Geräusche. In seiner Nähe ist alles still. Er sieht auf die Wand, bis ihm die Augen zufallen. Wenn sie sich später wieder öffnen, sind die Gitterstäbe und Wand genau wie vorher, doch das Licht darüber ist noch trüber.“137 Diese Ruhe ist das Gegenteil dessen, was ein Baby braucht: „So, wie die Bedingungen sind, unter denen seine Gattung sich entwickelte, wirken nur völlige Stille oder ein längerdauernder Mangel an Veränderung in den Sinnesreizen beunruhigend.“138 Entsprechend besteht „seine wirkliche Erfahrung […] hauptsächlich aus unerfülltem Verlangen.“139
Die Natur hat es so angelegt, dass das Baby dies nach außen nicht zeigt, weil es von seiner Mutter abhängig ist: „Seine Mutter ist überzeugt, die geschätzte Mutter eines glücklichen Babys zu sein, weil es lächelt, wann immer sie zu ihm kommt. Die bittere Qual, aus der die ganze übrige Zeit seines Wachseins besteht, ruft bei ihm keinerlei negative Gefühle ihr gegenüber hervor; vielmehr strebt es dadurch nur umso verzweifelter danach, bei ihr zu sein.“140 Der Überlebenstrieb des Babys muss zwangsweise eine negative Reaktion gegenüber der Mutter verhindern, die ein Erwachsener gezeigt hätte. Es hat nicht die Freiheit wie ein Erwachsener, einen anderen Menschen anzunehmen oder abzulehnen; es muss seine Mutter annehmen und lieben, weil alles andere in einer natürlichen Umgebung, also der Kontinuumserwartung entsprechend, sein Leben gefährden könnte.
Wer sich über diesen immensen Unterschied im Verhalten von Säuglingen und Erwachsenen wundert, dem möchte ich eine Parallele aus dem Tierreich beschreiben: Auf meinem Balkon nistete vor einigen Jahren ein Ringeltaubenpärchen und zog dort zwei Junge auf. Die Taubeneltern waren so scheu, dass sie sofort davonflogen, wenn ich nur das dahinter liegende Zimmer betrat und sie mich schemenhaft durch die Scheibe erspähen konnten. Als ich den Taubenküken einmal in Abwesenheit der Eltern etwas zu Fressen geben wollte, hackte eines der Küken nach meiner Hand und wollte mich vom Nest verscheuchen – völlig ignorierend, dass in etwa das Tausendfache des Kükens wog. Ich war über seine Aggressivität erstaunt, aber dies war die einzige Handlung, die diesem Tier überhaupt noch etwas nützen konnte. Auch solche extremen Wandlungen der Angstempfindungen zwischen Kindern und Eltern sind möglich, sofern sie der Arterhaltung dienen. Ausgezogen sind die beiden Küken übrigens dann, als sie etwas größer waren und ein Nachbar eine Decke aus dem Fenster schüttelte – zu diesem Zeitpunkt konnten sie sicherlich Angst vor größeren Tieren erleben.
Die Überwindung der Einsamkeit
Der Umgang mit Babys änderte sich mit der 68er-Generation, der zunehmenden Beschäftigung mit Psychologie und der zurückgehenden Zahl der Kriegstraumatisierten. Seinen juristischen Niederschlag fand dieser Wandel des Denkens allerdings erst im Jahre 2000 mit dem Verbot der Prügelstrafe.
Die frühere dauerhafte und flächendeckend falsche wie grausame Behandlung von Babys kann nicht ohne Einfluss auf die Gesellschaft und ihre Ansichten bleiben. Das Gefühl des Richtig-Seins kann nur entstehen, wenn ein Baby Körperkontakt, Geborgenheit, Gestilltwerden und liebevollen Umgang erfährt. Jean Liedloff zitiert die Aussage der Verhaltensforscherin Jane Goodall über deren Kind, das nie schreiend in seinem Bettchen allein gelassen wurde, sondern von seinen Eltern überallhin mitgenommen wurde. Es sei in auffälliger Weise „’außerordentlich gehorsam, aufgeweckt und lebendig […], verhältnismäßig angstfrei und anderen gegenüber rücksichtsvoll’“ und vor allem unabhängig.141
Der Unterschied in der erlebten Geborgenheit und dem daraus folgenden Gefühl der Richtigkeit im eigenen Körper und im Leben wird sich unabhängig davon einstellen, ob er der betreffenden Person bekannt und bewusst ist: „Fühlt es [das Baby] sich sicher, erwünscht und ‚daheim’ als Mittelpunkt der Aktivität, noch ehe es denken kann, so wird sich seine Sichtweise späterer Erfahrungen qualitativ sehr von jener eines Kindes unterscheiden, das sich unwillkommen und aufgrund von fehlender Erfahrung nicht angeregt fühlt und das sich an einen Zustand unerfüllten Verlangens gewöhnt hat, obwohl die späteren Erfahrungen beider Kinder identisch sein können.“142 Sie beschreibt am Beispiel der Yequana, dass Menschen, die als Baby ohne diese Leidensgeschichte aufwuchsen, im Erwachsenenleben zu mehr Vertrauen fähig sind, sich weniger unsicher fühlen, mehr Integrität und Selbstbewusstsein besitzen, mehr Geborgenheit statt Einsamkeit empfinden und kaum die Entfremdung kennen, die viele von uns in der Gesellschaft erleben und die Erich Fromm in seinem Buch Der moderne Mensch und seine Zukunft eingehend analysiert hat.
Die Vorstellung dieses Ausmaßes der „Richtigkeit“ muss Menschen schwerfallen, die solche Geborgenheit nur ansatzweise oder gar nicht erlebt haben. Leider habe ich auch eine solche Vorgeschichte, und mir geht es ebenso – das Gefühl der Einsamkeit ist mir geläufiger als das der Geborgenheit.
Anhand des Kontrastes zwischen den Beschreibungen wird jedem klar werden, wie groß der Unterschied zwischen den unterschiedlichen Behandlungsweisen von Babys ist – egal ob die persönliche Erfahrung die richtige oder die grausame war. Wer nie über längere Zeit Todesangst und stattdessen Geborgenheit erfahren hat, wird wesentlich mehr im Leben ruhen, sich auf sich selbst verlassen, seltener Angst vor Versagen oder Katastrophen haben, leichter an das Gute glauben können und vor allem weniger Stress empfinden – weil diese Nervenbahnen bei ihm seltener aktiviert wurden und daher nicht so stark ausgebildet sind. Ausreichende Geborgenheit im Kleinkindalter hat einen Einfluss auf das Zusammenleben der Menschen: „Es gibt keinen Wettbewerb, keinen Streit, keine Gewalt unter den Kindern der Yequana.14
Von Natur aus schlecht?
Laut Liedloff haben wir alle Eigenschaften, die wir benötigen. Wir sind nicht von Natur aus unzureichend oder schlecht. Zu demselben Schluss kommt A. S. Neill, der Gründer der Schule in Summerhill: „Wenn wir einen Säugling betrachten, wissen wir, dass an ihm keine Schlechtigkeit ist – ebensowenig wie an einem Kohlkopf oder Tiger. Das Neugeborene bringt eine Lebenskraft mit, seinen Willen, seinen unbewußten Drang zu leben.“144
Obwohl dies mittlerweile auch von anderen Autoren beschrieben wurde, hält sich in unserer Gesellschaft hartnäckig die Phantasie von der Notwendigkeit einer aktiven „Erziehung“. Schon Rousseau hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Seit Bücher über „Erziehung“ geschrieben werden, existiert die Idee, Kinder seien von Natur aus egoistische und unzulängliche Wesen, die erst geformt werden müssten, bevor sie gesellschaftsfähig sind. Kindern wurden keine Bedürfnisse zugestanden. Ein Kind, das keine Geborgenheit bekam, mag für seine Eltern deshalb quengelig und „ungezogen“ gewesen sein. Der Mangel an Liebe hat in ihm den Glauben erzeugt, es sei unzureichend, und entsprechend verhielt es sich.
Mit der Industrialisierung adaptierten auch Unternehmen den Gedanken, Menschen seien von Natur aus unzureichend: Sie entdeckten, dass man im Menschen Bedürfnisse wecken kann, indem man ihm vermittelt, ohne das von ihnen angebotene Produkt fehle ihm etwas Wichtiges. So brauchen wir heute rückfettende Shampoos, Vitaminpräparate, Spezialbekleidung, und wir achten sehr darauf, dass unser Essen als gesund deklariert ist. Uns wird gesagt, dass wir ohne die tausend kleinen Helferlein nicht gesund sein und nicht alt werden können oder ohne sie nicht lebensfähig sind. Wären wir tatsächlich so empfindlich, gäbe es uns schon lange nicht mehr. Sicherlich ist im Winter eine federleichte, winddichte Jacke bequemer als ein Bärenfell. Aber auch in einem Bärenfell wird man nicht sofort sterben. Und ohne ein rückfettendes Shampoo wird man sicherlich genauso alt wie mit einem solchen. Haben Sie schon einmal wirklich gespürt, dass Sie der Stressfrei-Badezusatz mehr entspannt hat als ein herkömmlicher? Oder war es doch eher die Hoffnung auf etwas Schönes, die Sie das entsprechende Produkt wählen ließ? Die Werbung signalisiert uns nicht nur, dass mit dem jeweiligen Produkt unsere Welt besser wäre, sondern auch, dass wir ohne es unvollständig sind. Damit wird genau das Gefühl angesprochen, das wir schon aus unserer Kindheit mitbringen. Die Suche nach Kompensation dieses Unvollständigseins lässt uns zu Drogen greifen und uns nach Macht, Anerkennung, Bewunderung, Sex, Konsum oder Geld streben, uns esssüchtig, bulimisch oder magersüchtig werden. Sie fördert unser Leistungsbewusstsein, unsere Gier sowie unseren Drang nach Geltung und Bestätigung.145 Erich Fromm schreibt über den Zusammenhang zwischen innerer Leere und Gier: "Selbstsucht ist nicht dasselbe wie Selbstliebe, sondern deren genaues Gegenteil. Selbstsucht ist eine Art Gier. Wie jede Gier ist sie unersättlich und daher nie wirklich zu befriedigen. Die Gier ist ein Fass ohne Boden. Der Gierige erschöpft sich in der nie endenden Anstrengung, seine Bedürfnisse zu befriedigen, ohne daß ihm dies je gelingt. Genaue Beobachtung zeigt, daß der Selbstsüchtige zwar stets eifrig darauf bedacht ist, auf seine Kosten zu kommen, daß er aber nie befriedigt ist und niemals Ruhe findet, weil ihm stets die Angst im Nacken sitzt, er könnte nicht genug bekommen, es könnte ihm etwas entgehen und er könnte etwas entbehren müssen."146
Bekommt ein Kleinkind nicht Muttermilch, Liebe, Geborgenheit und Körperkontakt – was lernt es daraus? Dass es sehr darauf achten muss, dass es alles bekommt, was es braucht. Natürlich lernt es das nicht in Worten, aber es wird Defizite bei seinen Bedürfnissen sehr viel stärker spüren, als es sein sollte, und es wird entsprechend empfindlich darauf reagieren. Und wenn es älter wird, ist dies die ideale Grundlage für ein Leben in ständigem Streben und Sucht nach Konsum. (Eine weitere Ursache unseres Konsums, den Sammeltrieb, habe ich ab Seite 46 erörtert.) Die meisten von uns haben Kinder wohlhabender Menschen erlebt, die in dieser Hinsicht besonders auffällig waren, die scheinbar alles hatten, was man sich wünschen konnte, und trotzdem nie zufrieden waren.
Wir streben und streben…
In unserer Phantasie wären wir gerne schnell wie das Licht, stark wie Hulk, schlau wie Einstein, erfolgreich wie Steve Jobs oder cool wie James Dean und ein Frauenschwarm wie George Clooney. Doch was wir eigentlich wollen, ohne es zu merken, ist, uns endlich richtig zu fühlen. Zum Teil ist dieses Streben ganz natürlich, und gerade das macht es so schwer, den unnatürlichen Teil unseres Strebens als solchen zu erkennen. Wenn in unserer Kindheit alles richtig lief, sollte man sich in seinen ersten Lebensjahren vollkommen geborgen und versorgt und als Mittelpunkt fühlen können, bis man genügend innere Stärke entwickelt hat, um in die Welt hinauszuziehen. Hat man dies nicht erlebt, so sucht man höchstwahrscheinlich in seinem späteren Leben instinktiv danach. Es ist dieses Gefühl, das viele im Star-Dasein suchen, und es ist der unnatürliche, weil zivilisations- bzw. „erziehungs“-bedingte Teil unseres ständigen Strebens.
Ebenso gut wie bei der Erfüllung solcher Wünsche fühlen wir uns, wenn es uns gelingt, das Fahrrad eines Freundes reparieren, oder wenn wir aus Erfahrung schon vorher wissen, welches Fettnäpfchen wir in einer bestimmten Situation besser meiden sollten, oder wenn bei der Arbeit, beim Kochen oder Musikmachen einfach jeder Handgriff sitzt und wir mit traumwandlerischer Sicherheit das Richtige tun – und uns richtig fühlen. Oft aber suchen wir dieses Gefühl in einem Streben nach mehr von irgendetwas.
Wie oft kommt es vor, dass wir etwas tun, nicht nur weil uns sonst langweilig wäre, sondern weil wir uns auch eine Verbesserung unseres Lebens davon erhoffen – und das obwohl wir genügend zu essen, ein Dach über dem Kopf, Kleidung und Gesundheit haben und uns äußerlich nichts fehlt. Aber innerlich spüren wir Leere und suchen Linderung. Das Streben nach Beseitigung der inneren Leere macht mit Sicherheit keinen Menschen langfristig glücklich. Jede derartige Befriedigung dieses Strebens ist immer nur vorläufig. Ich bin mir sicher, dass man einem Menschen, der in sich ruht, weniger Medikamente, Artikel zur Körperpflege, Versicherungen und Altersvorsorge-Verträge verkaufen kann. Wer genügend Geborgenheit erfahren hat, kennt nicht das Gefühl, unzureichend und dadurch gefährdet zu sein, und es treibt ihn keine innere Leere an.
Wer vom Falschen ausgeht, kommt zu falschen Schlüssen. So führt die Annahme, dass der Mensch ohne seine ganzen Hilfsmittel nicht überlebensfähig wäre, zu dem Schluss, dass wir unser Streben fortsetzen müssen. Wir stellen unseren Konsum und unser Streben nicht in Frage. Und dies behindert die Erkenntnis, dass uns beides nicht glücklich macht und dass wir nach etwas anderem suchen, nämlich nach dem natürlichen Zustand, in dem wir uns vollständig fühlen. Dass dies oft nicht bewusst wird, behindert wiederum die Erkenntnis, dass vielen von uns zu Anfang des Lebens ein großes Stück Geborgenheit gefehlt hat, die in uns die Gewissheit des Richtigseins verankert hätte.
Wir können uns an Erlebnisse vor dem dritten Lebensjahr nicht bildhaft erinnern, weil die Entwicklung des Gehirns zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist. Daher fehlt uns die konkrete Erinnerung an die Einsamkeit in unserer frühesten Kindheit. Dennoch haben die Erlebnisse in der Zeit davor deutliche Spuren in unserer seelischen Struktur hinterlassen. Man muss nicht um die seelische Verletzung wissen, um verletzt zu sein. Es ist so schwer, das Defizit im Getragenwerden und der Mutterliebe zu erkennen, weil nur unser Gefühl uns dahin leiten kann und keine bewusste Erinnerung.
Auffällig ist, dass viele Menschen beim Älterwerden Erfahrungen machen, die in die richtige Richtung zielen. Der eine schränkt sein berufliches Engagement ein, weil er spürt, dass Arbeit nicht alles ist. Der andere hat es zu Vermögen gebracht, spürt, dass ihn das Geld alleine nicht glücklich macht, und sucht sich neue Hobbys, statt weiter sein Geld zu vermehren. Viele legen ihre Süchte im Alter ab – weil sie nach Jahrzehnten spüren, dass die Befriedigung der Sucht sie nicht glücklicher, dafür aber schneller alt werden lässt.
So geht es immer weiter
Ein erwachsener Mensch, dem als Kind Geborgenheit fehlte und der noch als Erwachsener das Gefühl des Richtigseins kaum kennt, wird wesentlich leichter auf die Idee kommen, dass auch seine Kinder unzureichend seien und deshalb „erzogen“ werden müssten. Das bestätigt in der Folge dann auch sein Kind in seinem Gefühl des Falschseins. Zuerst fehlte ihm die Geborgenheit, die es von Natur aus erwartete, und danach signalisiert man ihm, es müsse angeleitet werden, woraus es schließen muss, dass es unvollständig sei: „Ganz ähnlich wird sie [die Mutter] ihm [dem Baby], wenn sie es unablässig behandelt, als sei es zerbrechlich, das Gefühl vermitteln, zerbrechlich zu sein. Handhabt sie es jedoch auf rauhe und lockere Weise, wird es sich stark und anpassungsfähig und in einer unendlichen Vielfalt von Umständen beheimatet fühlen. Sich als zerbrechlich zu betrachten ist nicht nur unerfreulich, sondern beeinträchtigt auch die Leistungsfähigkeit des heranwachsenden Kindes und später die des Erwachsenen.“147 Ähnliche Beobachtungen hat auch der Familientherapeut Jesper Juul beschrieben. Auf diese Art und Weise pflanzt sich das Defizit in unserem Gefühlsleben von Generation zu Generation fort.
„Wird es [das Baby oder Kleinkind] hingegen ständig beobachtet und dahin gesteuert, wo es nach Auffassung seiner Mutter hingehen sollte, hält sie es an und rennt hinter ihm her, wenn es aus eigenem Antrieb handelt, so lernt es bald, nicht mehr für sich verantwortlich zu sein, da sie ihm ja zeigt, was sie von ihm erwartet.“148 Das ist das Problem aller Kinder, die von wohlmeinenden, überforderten Eltern in der Absicht intellektueller Förderung groß-gezogen wurden, anstatt mit Gleichaltrigen in Freiheit zu spielen und ihren eigenen Weg zu entwickeln. Sie sind an Unselbständigkeit und Anweisungen einer „Obrigkeit“ gewöhnt und haben Schwierigkeiten, eigenverantwortlich zu handeln.
Kinder nehmen von sich aus an der jeweiligen Kultur teil. „Ein Kind, das noch nicht sprechen kann, ist sehr gut in der Lage, seine Bedürfnisse klarzumachen, und es ist sinnlos, ihm etwas anzubieten, was es nicht braucht; schließlich ist das Ziel der kindlichen Aktivitäten die Entwicklung von Selbstvertrauen. Bietet man ihm entweder mehr oder weniger Unterstützung, als es wirklich braucht, so wird dieses Ziel leicht vereitelt. […] Weder gibt es den Begriff des ‚unartigen Kindes’ [bei den Yequana], noch wird umgekehrt irgendeine Unterscheidung hinsichtlich ‚braver Kinder’ getroffen.“149 Es gibt bei den Yequana ebenso wie bei uns unerwünschte Handlungen, aber ein Kind ist immer geliebt.150
Erziehung und Eigenverantwortlichkeit
Entgegen der landläufigen Vorstellung sind Lob und Tadel nicht das Kernstück einer sinnvollen „Erziehung“, denn sie zerstören das Zugehörigkeitsgefühl und das Gefühl des Richtigseins des Kindes.151 Es fühlt sich unzureichend, weil verbesserungswürdig. Wer korrigiert werden muss, kann nicht „richtig“ sein. Ebenso verhält es sich, wenn Eltern sich den ganzen Tag um ihr Kind sorgen. Jesper Juul schreibt: „Besorgnis ist mit das Schlimmste fürs Selbstgefühl, denn Besorgnis sagt die ganze Zeit: ‚Ich rechne nicht damit, dass du zurechtkommst.’“152 Übertreiben Eltern damit, erklären ihrem Kind beständig die Welt und fordern entsprechendes Verhalten ein, so wird das im Kind zwei Reaktionen auslösen: Es fühlt sich gegängelt, und es fühlt sich unzureichend. Das kann zu aggressiven Gegenreaktionen führen. Diese Reaktionen sind geeignet, die Eltern in ihrer Annahme zu bestätigen, dass man dem Kind alles erklären müsse. Lange Zeit war das, was in Wahrheit eine sich selbst erfüllende Prophezeiung darstellt, Konsens in unserer Gesellschaft und hat vielen Menschen viel Leid eingebracht und viel Lebensfreude genommen. Juul: „Jedesmal, wenn wir Tommy belehren, wie seine Lokomotive funktioniert, nehmen wir ihm die Freude am Leben, die Freude des Entdeckens, die Freude, ein Hindernis zu überwinden. Schlimmer. Wir geben ihm ein Minderwertigkeitsgefühl und lassen ihn glauben, auf Hilfe angewiesen zu sein!“153
Besonders tragisch ist, dass sich in der Geschichte der Kinder-„Erziehung“ unausweichlich diese Annahme entwickeln musste, man müsse Kindern Moral „beibringen“. Im vorletzten Jahrhundert begann man, sich über „Erziehung“ Gedanken zu machen. Ein maßgeblicher Teil der Bevölkerung besaß eine wesentlich geringere geistige Reife als heutzutage. Die Menschen hatten überwiegend die Vorstellung, dass Rechtsgrundsätze nicht verhandelbar sind und dogmatisch befolgt werden müssen. Diesen Erwachsenen müssen die Einstellungen ihrer Kinder als gesellschaftszersetzend erschienen sein, beispielsweise, dass Kinder beständig „Warum…?“ fragen, Grenzen austesten und Regeln brechen wollen. Das mag in ihnen in Ermangelung des wirklichen Verständnisses der Zusammenhänge die Vorstellung ausgelöst haben, man müsse Kinder durch „Erziehung“ formen, weil sie sonst zu Barbaren würden. Im Angesicht des heutigen psychologischen und soziologischen Wissensstandes stellt sich das anders dar. Auch dies ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, zu wissen, was mit einem geschieht, wenn man sich weiterentwickelt, und wie dramatisch es werden kann, wenn man von der Entwicklung überholt wird (siehe auch S. 457).
A. S. Neill schrieb in den 1960er Jahren: „Die meisten Eltern glauben ihr Kind zu vernachlässigen, wenn sie ihm keine moralischen Werte beibringen, wenn sie es nicht ständig auf den Unterschied zwischen Gut und Böse hinweisen. Praktisch alle Eltern sehen es, abgesehen von der Sorge für die körperlichen Bedürfnisse des Kindes, als ihre wichtigste Pflicht, dem Kind Moral einzupauken. Für sie würde ein Kind ohne moralische Belehrung als Wilder aufwachsen, zügellos im Verhalten und ohne Rücksicht auf andere. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft akzeptieren eben, zumindest passiv, dass der Mensch sündig von Geburt und schlecht von Natur sei und dass er raubgierig, grausam und mordlüstern werde, wenn man ihn nicht zum Gutsein erziehe.“154 Bei den Yequana lernen Kinder überwiegend durch den Nachahmungsdrang und das Spiel mit Gleichaltrigen, aber nicht durch Lob und Tadel, durch Überwachung oder Anleitung: „Dem Kind ein Beispiel oder Vorbild zu bieten, geschieht im Idealfall nicht ausdrücklich, um es zu beeinflussen, sondern heißt lediglich, sich normal zu verhalten: dem Kind keine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, sondern eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich vor allem um die eigenen Angelegenheiten kümmert; von dem Kind nimmt man dabei nur Notiz, wenn es dies braucht, und auch dann nicht mehr als notwendig. Ein Kind, welches das Getragenwerden vollständig erfahren hat, wird es nicht nötig haben, über seine körperlichen Bedürfnisse hinaus um Aufmerksamkeit zu betteln; denn es wird nicht, wie die Kinder, die wir unter zivilisierten Umständen kennen, irgendwelche Bestätigung benötigen, um sich seines Daseins oder seiner Beliebtheit zu versichern.“155
Neill: „Wenn man Kinder in Freiheit erzieht, werden sie ihrer selbst immer stärker bewusst, weil die Freiheit einen immer größeren Teil des Unbewußten bewusst werden lässt.“156 Diese Idee findet sich in ähnlicher Form schon bei Rousseau: „Der Geist der hier aufgestellten Vorschriften geht darauf aus, den Kindern mehr wahre Freiheit und weniger Herrschaft zu gestatten, sie mehr an Selbständigkeit zu gewöhnen und von dem Verlangen nach fremder Hilfe zu entwöhnen. Indem sie sich auf diese Weise schon frühzeitig gewöhnen, ihre Wünsche mit ihren Kräften in Einklang zu bringen, werden sie die Entbehrung dessen, was zu erlangen nicht in ihrer Macht steht, nur wenig empfinden.“157 Das Gegenteil davon, die „Erziehung“ zur Unterordnung unter Autoritäten, führt demnach zu Wünschen, die nicht mit der Realität in Einklang gebracht wurden. Dazu gehört das Streben nach Vermögen, Macht und Geltung.
Lob und Tadel bedeuten immer eine Bevormundung und etablieren eine Hierarchie. Sie legen den Grundstein für Anpassung und Obrigkeitshörigkeit und reduzieren die empfundene Freiheit. Die in der Kindheit meist erzwungene Unterordnung unter die Autorität der Eltern führt im Erwachsenenleben zu übermäßiger Akzeptanz existierender Herrschaftsverhältnisse. Es ist eine große Errungenschaft, dass in der westlichen Welt Obrigkeitshörigkeit nicht mehr – wie bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts – als Ideal gilt. Dies bietet das Potential, die „Erziehung“ so zu verändern, dass der Kontinuumserwartung der Kinder Genüge getan wird und sie in Zukunft in mehr Freiheit aufwachsen können. Lesenswert ist in diesem Zusammenhang Christian Felbers Aufsatz Charakterskizze des autoritär erzogenen Österreichers.158 Ähnliche Gedanken finden sich bei Alice Miller.159 Wird ein Kind nicht durch Lob und Tadel verunsichert und konditioniert und lässt man es seine eigenen Erfahrungen machen, so hat es die Möglichkeit, mehr Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln.
Viele Erwachsenen versuchen, ihre Kinder nicht nur ohne physische, sondern auch ohne psychische Gewalt zu erziehen, indem sie ihnen oft eine Wahl lassen oder ihnen ihre Entscheidungen erklären. Wenn es allerdings hart auf hart kommt, zeigt sich, dass sie sie doch als in der Hierarchie unter sich stehend empfinden. „Ich hab’s Dir jetzt drei Mal erklärt, Du musst einfach auch mal auf mich hören.“ Und dann wird doch mit Macht durchgesetzt, was der Erwachsene will. Kaum ein Mensch käme auf die Idee, so mit anderen Erwachsenen zu reden. Es wird damit entschuldigt, dies seien Ausnahmesituationen, aber sie zeigen den wahren Charakter, und das spürt das Kind auch und lernt Unterwerfung. Wenn die tiefste Wahrheit, die Rückfalllösung immer noch die Struktur der Hierarchie ist, ist nur wenig gewonnen. Es hat keinen Sinn, das als Ausnahme zu entschuldigen, wenn es die Ultima ratio ist, wenn also die Gewalt als Mittel immer dann eingesetzt wird, wenn das Thema besondere Tragweite hat.
Es geht im Leben weniger darum, das Richtige zu tun. Die reine Ausführung einer Anordnung hat eine untergeordnete Bedeutung. Es geht darum, das Richtige zu wollen, weil nur dies bedeutet, dass der Einzelne an der Entwicklung der Gesellschaft teilhat, wodurch „die Weisheit der Vielen“ ermöglicht wird. Das Richtige zu wollen, können wir nur lernen, wenn wir uns frei entscheiden können. Nur dann lernen wir, Verantwortung zu übernehmen. Man muss als Kind die Freiheit haben, sich zu entscheiden160, sonst können daraus keine Erfahrung und keine Verantwortlichkeit entstehen. Als Erwachsene ärgern wir uns, wenn andere sich in unsere Entscheidungen einmischen und wir dadurch daran gehindert werden, aus unseren Fehlern zu lernen. Das gilt ebenso für Kinder.
Verantwortung kann man nur für das eigene Handeln übernehmen und eingeschränkt für Vorgänge, die im eigenen Einflussbereich liegen. Niemand kann jedoch für andere so gründlich wachsam sein wie für sich selbst.161 Eltern sind schnell gestresst und überfordert, wenn sie versuchen, die ganze Zeit für ihr Kind mitzudenken. Und sie tun ihm damit keinen Gefallen, denn ein überbehütetes Kind hat gar keinen Anlass, ein Gefahrenbewusstsein zu entwickeln. Deutlich weniger aufwändig und dabei nachhaltiger ist es, wenn das Kind zum eigenverantwortlichen Handeln befähigt wird.162 Ich halte Regeln, die uns Verantwortung abnehmen, nur insofern für sinnvoll, wenn sie uns vor etwas schützen, vor dem wir uns nicht selbst schützen können.163
Grenzen, die Kinder brauchen
Es heißt immer wieder, Kinder bräuchten Regeln, man müsse ihnen Grenzen setzen, und sie müssten gehorchen, weil sie von sich aus nichts könnten. Als Begründung wird oft angeführt, dass sie sonst vor Autos liefen. Das ist jedoch eine unzulässige Verallgemeinerung. Dass sie von Natur aus mit Autos nicht umgehen können, liegt daran, dass sie in den Jahrhunderttausenden der Evolution vor unserer Zivilisation nicht mit Autos in Kontakt kamen und sich nicht daran anpassen konnten. Gleiches gilt auch für elektrischen Strom.164 Als Radfahrer in einer Großstadt erlebe ich oft Erwachsene, die nach Gehör über die Straße und einem direkt vor die Lenkstange laufen. In Zeiten zunehmender Elektromobilität wird das lebensgefährlich. Die Evolution hat uns keinen Instinkt zur Orientierung im Straßenverkehr mitgegeben.
Vom Lernen durch Ausprobieren sind nur die Dinge ausgenommen, die im Erwartungshorizont des Kindes nicht vorkommen oder die kein Lernen erlauben, weil sie hochgefährlich sind. In früheren Zeiten gab es keine menschengemachten Gefahren wie Straßenverkehr, und Menschen lebten üblicherweise nicht dort, wo ein kleines Fehlverhalten lebensbedrohliche Auswirkungen hatte. Die Kontinuumserwartung gebietet Kindern einen instinktiven Respekt vor Höhe, spitzen Gegenständen und anderen gefährlichen Dingen. Darauf hat uns die Evolution vorbereitet.
Jean Liedloff hat festgestellt: „Ein Baby hat keine selbstmörderischen Neigungen“.165 Kinder können intuitiv mit Gefahren umgehen, die in ihrer Kontinuumserwartung vorkommen. Es geht nicht darum, alle gefährlichen Situationen zu vermeiden, sondern solche, die in der Natur nicht vorkommen oder die unverhältnismäßige Schäden erzeugen. Unsere frühen Vorfahren werden nicht in der Nachbarschaft von Bären gelebt haben, und sie haben wohl kaum zugelassen, dass ihre Kinder an Bären den Umgang mit Gefahr lernen. Aber wenn ihre Kinder auf Bäume geklettert sind, sind sie nicht sofort hinterhergerannt wie viele heutige Eltern.
Es ist schon tragisch genug für Kinder, dass wir sie in Situationen wie dem Straßenverkehr nicht selbständig lernen lassen können und sie bevormunden müssen. Wir sollten uns überlegen, wie wir die Häufigkeit solcher Erlebnisse für Kinder reduzieren können, indem wir die möglichen Kontakte mit solchen menschengemachten Gefahrenquellen reduzieren, um ihnen mehr Freiheit zu ermöglichen.
Dass Kinder an der Supermarktkasse etwas Süßes oder ein kleines Spielzeug wollen, ist kein Beweis dafür, dass man ihnen Grenzen setzen muss. Ebenso ist es kein Beweis dafür, dass Kinder schlecht sind, wenn sie zuerst zu Papi gehen, wenn sie etwas wollen, und danach zu Mami, wenn Papi es ihnen nicht gibt. Beide Verhaltensweisen hatten in der Steinzeit ihren Nutzen. Dass sie nach Süßem verlangen, ist die Folge ihres Lebenserhaltungstriebes und in der Steinzeit hätten sie sich also um süßes Obst bemüht – das weniger gesunde Essen haben wir erst in der Zivilisation erfunden. Ihre ausgeprägte Gier diente ihrer Lebenserhaltung. Dass sie Spielsachen wünschen, ist eine Folge ihrer Neugier und ihres Spieltriebes, die ihr Lernen und damit ihre spätere Selbständigkeit fördern. Und wenn sie es erst bei Papi und später bei Mami probieren, ist das kein perfider Charakterzug, sondern Teil ihres Überlebensprogramms aus der Steinzeit: Versorgt sie ein Elternteil nicht ausreichend, suchen sie nach einer Lösung – nur können sie in der heutigen Welt den echten Bedarf nicht von den zahllosen „Luxus“-Gütern unterscheiden. In einer steinzeitlichen Welt sind solche Verhaltensweisen ausschließlich nützlich.
Kinder bringen von Natur aus ein Interesse an der Welt mit, sie ahmen ihre Eltern in allen Tätigkeiten nach, sind neugierig und bereit, in einem sozialen Umfeld zu leben. Sie lernen von selbst, ohne dass man sie dazu drängen müsste. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, bringt es alle Fähigkeiten mit, um in einer Menschengruppe sozial aufzuwachsen. Es ist nicht nötig, es beständig zu formen und anzuleiten, weil es nicht wisse, was richtig sei. Das einzige, worauf die Natur es nicht vorbereitet hat, sind die Errungenschaften der letzten zehntausend Jahre unserer Zivilisation. Es ist nicht vorbereitet auf Einsamkeit, Massenveranstaltungen, Straßenverkehr, Bahngleise, elektrischen Strom, Süßwarenregale vor Supermarktkassen und unsere gegenüber damals veränderte Gesellschaftsform.
Wenn Eltern ihr Kind den ganzen Tag Dinge lehren wollen, erreichen sie damit eher das Gegenteil. Wenn Eltern ihrem Kind gelegentlich ungefragt Dinge erklären, wird das Kind sie vielleicht übernehmen. Erfolgt das Lernen hingegen nicht durch „Eintrichtern“ und Zwang, sondern aus freiem Willen, so geschieht es ungleich einfacher, selbstverständlicher und nachhaltiger: „Die Welt durch Assoziieren kennenzulernen heißt, dass es [das Kleinkind] als Ganzes in sich aufnimmt, was es nie zuvor gekannt hat, ohne dass es irgend etwas daran ‚bemerkt’.“166 Ein Kind, dem man nicht die Funktion der Welt „beizubringen“ versucht, wird von sich aus nachahmen und Fragen stellen und nicht mit Ablehnung auf die Eltern reagieren. Es wird den Eltern zeigen, dass es unnötig ist, es etwas zu „lehren“.
In den letzten Jahrhunderten ging dieses Konzept deshalb nicht auf, weil es voraussetzt, dass ein Kind ungeschädigt ist. Babys, die schreiend allein gelassen wurden, zeigen später weniger Neugier und mehr destruktive Neigungen. Das lieferte in früheren Generationen den Verfechtern der Schwarzen Pädagogik die vermeintliche Rechtfertigung, diese Kinder durch Lehren, „Erziehung“ und Prügel zu formen.
Jean Liedloff: „Es scheint fast, als hätten wir in dieser gewaltig langen Zeitspanne, die Hunderte von Jahrmillionen umfasst, ehe unsere Vorfahren einen Intellekt entwickelten, der über solch schwierige Dinge wie Sterblichkeit und Sinn nachdenken konnte, tatsächlich auf die einzige glückselige Weise gelebt: vollkommen in der Gegenwart.“ Derselbe Gedanke findet sich auch in anderen Quellen. Das Dasein im Jetzt beispielsweise ist Ziel der buddhistischen Lebensweise: Der Mensch soll sich darum bemühen, jedes Denken an Vergangenheit und Zukunft, was Hadern und Streben bedeutet, abzulegen.
Die Qual der Wahl
Liedloff weiter: „Wie jedes andere Tier erfreuten wir uns des großen Segens, unfähig zu sein, uns Sorgen zu machen. Es gab selbst im Stadium der wilden Tiere Unbequemlichkeiten, Hungersnöte, Verletzungen, Ängste und Mangel zu ertragen, jedoch wäre der Sündenfall, ausnahmslos bezeichnet als eine verkehrt getroffene Wahl, unmöglich für Geschöpfe ohne ausreichenden Verstand, überhaupt eine Wahl zu treffen. Erst mit der Ausbildung der Fähigkeit des Wählens wird der Sündenfall möglich. Und erst mit dem Wählen schwindet das vollkommene Glück der Unschuld (die Unfähigkeit, verkehrt zu wählen). Nicht die Tatsache, dass man eine verkehrte Wahl getroffen hat, sondern die Fähigkeit des Wählens überhaupt beseitigt die Unschuld. Es lässt sich unschwer vorstellen, dass sich jene Jahrmillionen der Unschuld tief genug in unsere ältesten Erwartungen eingekerbt haben, um ein Gefühl zu hinterlassen, der mit der Unschuld einhergehende Glückszustand sei irgendwie erreichbar.“167 Ich finde es leicht nachvollziehbar, dass die Qual der Wahl uns Unschuld und Glück geraubt hat. Die zunehmende Erkenntnis hat vor Jahrtausenden zur Entwicklung des Selbst-Bewusstseins und damit auch zur Möglichkeit der Entscheidung geführt. (Darauf gehe ich in Kapitel 4.1 näher ein.) Seit damals bedeutet die Wahlmöglichkeit immerwährende Verantwortung und den unwiederbringlichen Verlust der Unschuld. Regeln sind uns daher so wichtig, da sie uns Orientierung und damit Sicherheit geben und uns zumindest teilweise von der Last des Wählens befreien.168
Ebenso hat uns die Entwicklung der Sprache von unserem Ursprungszustand entfernt und kann uns ein Gefühl der Unvollständigkeit geben: „Das Kind findet Eingang in eine größere Kulturgemeinschaft, aber mit dem Risiko, die Kraft und Ganzheit des ursprünglichen Erlebens einzubüßen.“169 Der Bruch entsteht durch den Spracherwerb, da die Sprache viele Erfahrungen unzulässig vereinfacht, verzerrt oder schlicht falsch darstellt. Die Sprache schafft eine zweite Wirklichkeitsebene, deren Realitätsbezug vom Sprecher und Hörer hergestellt werden muss, aber nicht immanent ist.
Damit einhergehend, stellen die Entwicklung des Bewusstseins (der „Sündenfall“) sowie die Veränderung der Denkstrukturen seit der Aufklärung (siehe Kapitel 2.8) zwei große Brüche in unseren Denkmustern dar, auf die uns die Evolution nicht vorbereiten konnte. Ich halte es für mehr als wahrscheinlich, dass manche Gefühle von Leere, Unzureichend-Sein und Sehnsucht durch diese Entwurzelung und die Entfernung vom Kontinuum zustande kommen, da unsere Gehirne zum ersten Mal eine solche Tätigkeit verrichten und dies eine grundlegende Umstrukturierung der Denkprozesse darstellt.170 Das bringt uns in unserer Entwicklung weiter, und gleichzeitig quält es uns mit Ungewohntem – wir fühlen uns von uns selbst entfernt. Erich Fromm fasst es so: „Selbst die vollkommenste Befriedigung seiner instinktiven Bedürfnisse löst sein menschliches Problem nicht; denn seine heißesten Leidenschaften und Bedürfnisse sind nicht die aus seiner Körperkonstitution stammenden, sondern diejenigen, die in der Eigenart seiner menschlichen Existenz verwurzelt sind.“171 Die genannten Zusammenhänge tragen zu unserer Umtriebigkeit bei, die sich auch in Machtstreben, Kaufrausch, Süchten und Geldgier äußert. Uns fehlt etwas, und wir fühlen nicht, was es ist. Wir wollen das Loch stopfen, und dazu ist uns manchmal jedes sich bietende Mittel recht. Wenn wir lernen würden, mit unserer inneren Leere zurechtzukommen, anstatt sie durch Geltungsdrang, Aktionismus und Konsum zu verdrängen, bräuchten wir viel weniger zum Leben.
Die Entwicklung geistiger Stärke
In einem Vorstellungsgespräch oder, wenn wir vor vielen Menschen sprechen oder, wenn wir auf Fremde zugehen sollen, sind wir oft unsicher und schüchtern. All das sind Situationen, in denen sicheres Auftreten – Selbstbewusstsein – gefragt ist. Dazu gehört das Grundgefühl, richtig zu sein, sich selbst nicht in Frage zu stellen und sich mögliche Fehler zu gestatten. Am deutlichsten wird das, wenn wir einen anderen Menschen begehren. Viele Männer und Frauen scheuen davor zurück, jemanden anzusprechen, der ihnen gefällt. Dabei könnte dies ein schönes Spiel sein. Warum sollte man nicht häufiger Wildfremde, die einen interessieren, ansprechen – nur um herauszufinden, ob sie das Gefühl, das man hatte, bestätigen? Es gibt kaum etwas, das vordergründig dagegenspricht, und trotzdem ist es in der westlichen Gesellschaft immer noch unüblich und eher den notorischen Schwerenötern vorbehalten. Wir verhalten uns meist so, als müssten wir unter allen Umständen jegliche Niederlage in dieser Hinsicht vermeiden, weil sie eine nicht wiedergutzumachende Demütigung darstelle. Und so fühlt es sich für viele auch an: Selbst wenn man von anderen für die Niederlage nicht gehänselt wird, ist sie schwer zu ertragen und hängt einem oft lange nach.
Warum ist das so? Zunächst sollten, von außen betrachtet, unsere Neugier und Experimentierfreude der Versagensangst gegenüberstehen, und die Frage, warum wir uns häufig gegen eine Kontaktaufnahme entscheiden, ist berechtigt. Die Erklärung könnte sein, dass unsere Angst vor der Niederlage viel größer ist als der in Aussicht stehende Gewinn. Was gibt uns das Gefühl, dass eine solche Niederlage so groß und unerträglich sei? Bei diesen Situationen stehen wir als Person im Mittelpunkt und können uns nicht hinter einem Auftrag, einer anderen Person, einem Sachzwang oder ähnlichem verstecken.172 Am deutlichsten wird es immer dann, wenn wir einen anderen Menschen begehren. Das können wir nur selbst tun, und es gelingt auch nur, wenn wir für uns selbst sprechen. Verstecken wir unser Begehren hinter einem belanglosen Vorwand zur Kontaktaufnahme, so wandert das Gespräch auf die Sachebene, und der Zauber ist verflogen. Ich habe es erlebt, dass eine Frau erst neugierig auf mich war, als ich sie ansprach, und dass ihr Interesse verlorenging, als mir kein persönliches Gesprächsthema mehr einfiel und ich über etwas Belangloses wie das Wetter sprach.
Auffällig finde ich, dass viele aus Krisenregionen kommende Afrikaner mit solchen Situationen viel sorgloser umgehen, obwohl sie in ihrer Kindheit und Jugend in der Regel viel weniger behütet und häufiger gequält und mit den Schattenseiten der Welt vertraut gemacht wurden. Dies ist ein Indiz dafür, dass es neben den Erfahrungen, die uns im bewussten Teil unserer Kindheit und Jugend zuteilwerden, noch einen weiteren großen Einflussfaktor auf die Stabilität unserer Selbstempfindung geben muss. Anders ist meiner Ansicht nach die tiefe Selbstsicherheit vieler Afrikaner nicht zu erklären, da unsere Kindheit von weniger Beeinträchtigungen und Brutalität geprägt ist als das Aufwachsen in Hunger- und Krisenregionen. Den oben erwähnten Körperkontakt als Baby dürften die meisten Afrikaner, die in ärmeren Verhältnissen aufwuchsen, eher erhalten haben – meist einfach aus Ermangelung von Kinderwagen und der Möglichkeit, das Baby in ein Bettchen im Nebenzimmer zu legen. Bei uns tragen die wenigsten Mütter ihre Babys den ganzen Tag am Körper, obwohl dies der Urzustand ist, in dem wir aufwachsen sollten. Vor Beginn der Zivilisation war das Getragenwerden für Babys die Regel. Erst unsere Kultur änderte dies.173
In Europa gehen wir aber meist noch weiter. Während in ursprünglichen Regionen Kinder oft sehr lange gestillt werden, müssen europäische Babys häufig schon mit sechs oder zwölf Monaten mit der Flasche auskommen. In industrialisierten Ländern steht künstliche Babynahrung zur Verfügung, und Eltern setzen andere Prioritäten. Mütter haben in größerem Maß als früher das Bedürfnis, wieder ins Berufsleben zurückzukehren, und sind weniger bereit, für ihr Kind Abstriche zu machen. Der brillante Psychoanalytiker Daniel Stern stellt fest: Während der längsten Zeit der Menschheitsgeschichte seien Säuglinge sehr häufig auf das kleinste Signal hin gestillt worden – bis zu zwei Mal pro Stunde. Die Mutter habe den Säugling zumeist am Körper mit sich herumgetragen, weshalb häufiges Stillen möglich war. Heutzutage lassen wir den Hunger der Babys lange anwachsen, was mit hoher Stimulierung verbunden sei, ebenso wie bei der darauffolgenden Sättigung. Stern bezeichnet die heutige Säuglingsernährung als Drama.174
In Deutschland wurden im Jahr 2005 etwa achtzig Prozent aller Babys zumindest zeitweilig über sechs bis acht Monate gestillt, aber nur ein kleiner Teil länger als ein Jahr.175 In vorzivilisatorischer Zeit war es nicht ungewöhnlich, dass Kinder über mehrere Jahre gestillt wurden. Somit erleben auch heute noch viele Babys eine der selbstverständlichsten Erfahrungen von Glück und Geborgenheit nicht oder in unnatürlich geringem Umfang. Auffällig ist, dass unter den Ländern, in denen weniger als neunzig Prozent aller Kinder überhaupt gestillt werden, nur Länder der westlichen Welt sind und keine aus ärmeren, südlichen Regionen.
Fazit: Liebe, Körperkontakt und emotionale Geborgenheit in der frühesten Kindheit sowie Bewahrung der Integrität, Förderung und Angenommen-Sein in der späteren (bewussten) Kindheit und Jugend haben großen Einfluss auf das spätere Selbstbewusstsein eines Menschen.
Manch einer wird dem entgegnen, Getragenwerden sei weniger bedeutend für das optimale Aufwachsen des Kindes als ausreichende Nahrung und Schutz. Doch die Natur tut wenig Unnützes; alle Triebe und Gewohnheiten leisten ihren Beitrag zur Arterhaltung. Getragenwerden gibt dem Baby ein beständiges Gefühl von Sicherheit, das es zu übernehmen und zu verinnerlichen lernt, während das Liegen im Kinderwagen eine beständige Erfahrung von Alleinsein bedeutet. Praktisch ist diese Situation ähnlich der von Gefängnisinsassen: Sie wissen auch die Menschen und die Gesellschaft in ihrer Nähe, können sie aber genauso wenig aus eigener Kraft erreichen wie ein Baby, das im Kinderwagen liegt. Damit lernt das Baby beständig, dass es in seinem Wunsch nach Nähe der Gnade seiner Umwelt ausgeliefert ist und dass es selten genug Liebe erhält und dass das Aushalten und Ertragen von Leid ein wichtiger Anteil des Lebens ist.
Das durch solches Aufwachsen entstandene Lebensgefühl vieler Menschen macht sich unser Wirtschaftssystem zunutze. Viele Menschen nehmen ungünstige Arbeitsbedingungen bereitwillig hin, weil sie sie aus ihrem Lebensgefühl heraus für unabwendbar halten: längere Arbeitszeiten, niedrigere Löhne, mehr Flexibilität der Mitarbeiter und vieles mehr.
Bis wir unsere grausamen Kindheiten in gesellschaftlicher Breite verdaut haben, werden noch Jahrzehnte vergehen. Heutige Kinder wachsen zwar meist mit mehr Geborgenheit, mehr Liebe, weniger Schlägen und weniger Quälerei auf als die Kinder der vorherigen Generationen, aber erstens ist das Ziel noch nicht erreicht und zweitens fand der Übergang lautlos statt. Genauso lautlos wie die Gesetzesänderung, die seit dem Jahr 2000 Eltern das Schlagen ihrer Kinder verbietet. Eine öffentliche Diskussion über die frühere Prügelstrafe und die psychischen Folgen, die sie bei vielen Betroffenen hinterließ, steht noch aus. Da Gewalt in der „Erziehung“ ein sehr verbreiteter Missstand in den Familien war, ist eine öffentliche Diskussion darüber besonders wichtig und eine weitere Verdrängung des Themas hätte schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft.
2.5 Aggressivität und Liebesfähigkeit
In seinem Buch Das sogenannte Böse erläutert Konrad Lorenz den Ursprung der Aggressivität aller Lebewesen, wozu sie dient und welche Folgen sie hat – auch in Bezug auf die menschliche Gesellschaft. Er führt aus, dass der Aggressionstrieb nicht pathologisch ist und seine Ursache nicht in einem Kulturverfall zu suchen ist. Die Frage, wieso Aggression bei Tierarten, die eng zusammenleben, nicht einfach abgebaut wurde, beantwortet er damit, dass ihre Funktionen eben nicht entbehrt werden können.176 Dies gilt in Bezug auf den Menschen mindestens für die Zeit vor unserer Selbst-Bewusstwerdung und der neolithischen Revolution. Für mich lautet das Fazit: Das Böse gibt es nicht.
Konrad Lorenz ist für seine Nähe zum Naziregime kritisiert worden. Seine Forschung zur Aggressivität ist über fünfzig Jahre alt. Trotzdem kann ich seine diesbezüglichen Aussagen nachvollziehen und halte seine Thesen für richtig. Im Folgenden werde ich die wichtigsten Gedanken des Buches zusammenfassen, da sie erklären, welche Bedeutung Triebe und Instinkte für unsere Gesellschaft haben und welche Schlüsse man daraus ziehen sollte.
Innerartliche Aggression und Revierverhalten
Aggression ist bei Lorenz der auf den Artgenossen gerichtete Kampftrieb von Mensch und Tier. Bei Beobachtungen an einem Korallenriff in Florida stellte er fest, dass Schwarmfische eher unauffällig aussehen, und im Gegensatz dazu allein oder als Paar lebende Fische, die ortsansässig sind und ein Revier verteidigen, „schreiend bunt“ sind. Letztere seien nur ihresgleichen gegenüber angriffslustig, nicht jedoch Fischen anderer Arten gegenüber.177 Der Überlebenskampf in der Natur ist also keinesfalls ein Kampf aller gegen alle. Die innerartliche Aggression dient vor allem der optimalen Aufteilung des zur Verfügung stehenden Reviers und dazu, dass sich sinnvolle Mutationen innerhalb der Art durchsetzen.178 Es besteht hauptsächlich Konkurrenz zwischen Lebewesen einer Art – sei es beim Revierkampf oder beim Kampf um die Fortpflanzung. Kämpfe zwischen nicht artverwandten Wesen sind selten und fast ausnahmslos nicht-tödlich.179 Aggression dient nicht der Zerstörung, wie man gemeinhin vermutet. Sie hat einen stark arterhaltenden Nutzen.
„Die Gefahr, dass in einem Teil des zur Verfügung stehenden Biotops eine allzu dichte Bevölkerung einer Tierart alle Nahrungsquellen erschöpft und Hunger leidet, während ein anderer Teil ungenutzt bleibt, wird am einfachsten dadurch gebannt, dass die Tiere einer Art sich abstoßen. Dies ist in dürren Worten, die wichtigste arterhaltende Leistung der intraspezifischen Aggression.“180
Darüber hinaus kann die innerartliche Aggression einen weiteren Nutzen haben. Die Anzahl der innerartlichen Kämpfe steigt, wenn die Bevölkerungsdichte so zunimmt, dass die Nahrung knapp wird. Erinnern Sie sich an das Beispiel der Füchse und Hasen auf einer Insel aus Kapitel 2.1? Hintergrund dieser Selbstregulierung könnte sein, dass das abnehmende Nahrungsangebot für die Füchse zu Revierkämpfen und Stress führt und deren Vermehrungsfähigkeit aufgrund des hohen Stresspegels zurückgeht, oder sie verhungern zum Teil, oder hungernde Füchse töten ihre eigenen Jungen häufiger.181 Aggressivität ist lebenserhaltend: Wenn Beutetiere durch Krankheit dezimiert werden, ist es besser, die Jäger töteten sich zum großen Teil gegenseitig, als dass sie alle Beutetiere auffressen und dann gemeinsam mit diesen aussterben.182 Für die einzelnen gestorbenen Füchse ist das zwar tragisch, aber weniger Füchse benötigen weniger Hasen als Futter, so dass sich deren Population wieder erholen kann. Auf diese Weise überleben beide Arten.
Nie rotten Jäger ihre Beute aus, sondern es stellt sich zwischen dem Raubtier und seiner Beute immer ein Gleichgewicht her, das für beide Arten erträglich ist. Im natürlichen Umfeld ist es nie der Fressfeind, der die Arterhaltung einer Tierart gefährdet, sondern der besser an die Umgebung angepasste Konkurrent.183 Exemplare einer Spezies, die sich besser angepasst haben, setzen sich bei der Vermehrung durch und verdrängen langfristig die Artgenossen, die diese Mutation nicht aufweisen. Der Mechanismus dazu sind innerartliche Kämpfe um die Fortpflanzung.
Konrad Lorenz liefert mit den von ihm beschriebenen Zusammenhängen eine allgemein gehaltene Erklärung der Aggressivität. Es bleibt unberücksichtigt, dass das individuelle Niveau der Aggressivität stark von dem erfahrenen Maß an Geborgenheit in der frühesten Kindheit und durch die Menge der Gewalterfahrungen während des Aufwachsens bestimmt wird, wie bereits in Kapitel 2.4 und weiter unten in Kapitel 2.7 beschrieben. Dass manche geschlagenen Kinder sich weniger gewalttätig verhalten und andere aggressiver werden, spricht nicht gegen diese Theorie. Nicht jeder hat die gleichen Fähigkeiten, Gewalterfahrungen zu verarbeiten, weil wir Menschen unterschiedlich sind.
Ersatz für aggressive Handlungen
Aus den oben genannten Gründen – Revieraufteilung, Auswahl bei der Fortpflanzung, Verteidigung gegen Fressfeinde – dienen Kämpfe der Arterhaltung. Andererseits verbraucht jeder Kampf Kräfte und bedeutet ein Verletzungsrisiko. Die Natur hat einige Mechanismen erfunden, die Verletzungen oder den direkten Kampf vermeiden: Viele Tiere haben relativ stumpfe, kampfungeeignete Waffen wie beispielsweise nach hinten statt nach vorne gebogene Hörner. Auch eine definierte Rangordnung in einer Herde verhindert Kämpfe. Bei vielen Tieren hängt die Rangstufe mit der Größe von Muskeln und Körper oder mit dem Alter zusammen. So wurde wohl die Hierarchie erfunden, wobei sich diese vor der Sesshaftwerdung lediglich darauf erstreckte, wer bei der Paarung und beim Fressen Vorrang hatte, wer bei der Verteidigung gegen Feinde in der ersten Reihe stand und wer den Weg der Gruppe festlegte – was nicht immer ein eindeutiger Vorteil ist. Zwecks Gewaltvermeidung gibt es weiterhin Ersatzhandlungen wie Imponiergehabe und Drohgebärden, die helfen, Revierkämpfe und Kämpfe um die Rangordnung abzumildern. In der heutigen Zeit gehört auch das Fahren eines Sportwagens dazu. Statt mit jedem Fremden Krieg auf der Straße anzuzetteln, gibt man mit einem „potenten“ Auto an. Dicke Muskeln und eine verspiegelte Sonnenbrille sind einfachere Machtdemonstrationen, ein Maßanzug gepaart mit jovialen Gesten die kulturell höherstehenden – beide erfüllen den Zweck, einen Statusanspruch zu äußern, ohne dass es einer „klärenden“ Konfrontation bedarf.
Ebenso stellt jede Form von Höflichkeit eine Beschwichtigungsgeste dar, die aggressives Verhalten bei einer Begegnung verhindert. Beobachten Sie sich einmal selbst, wie Sie sich fühlen, wenn jemand Sie nicht freundlich grüßt, nicht „Bitte“ und „Danke“ sagt usw. Wir gehen selbstverständlich davon aus, das gehöre sich so, alles andere sei unverschämt. Aber was ist der Zweck dieser Gesten? Sie verhindern, dass unsere hohe Aggressionsbereitschaft automatisch zu ausgeprägtem Revierverhalten innerhalb der eigenen Gruppe führt. Beschwichtigungsgesten gibt es im Tierreich ebenso wie beim Menschen. Unterlässt eine andere Person einen Gruß oder eine Geste, die man aus Höflichkeit erwarten würde, ist man schnell irritiert. Dieselbe Reserviertheit und latente Kampfbereitschaft zeigen wir unwillkürlich gegenüber Fremden, wenn wir nicht wissen, wie wir diese einschätzen sollen.184 Schon ein plötzliches Lächeln eines Fremden, der auf uns zukommt, entspannt die Situation.
Liebesfähigkeit
Beschwichtigungsgesten sind essentiell für alle Herdentiere, die begrenzte Reviere bewohnen. Noch wichtiger sind sie für die Fortpflanzung. Die Evolution war gezwungen, dem hohen Maß an Aggressivität innerhalb der eigenen Art etwas entgegenzustellen. Balzrituale signalisieren dem „Gegner“, dass es sich nicht um einen Angriff handelt, der die Reviergrenzen klären soll, sondern um einen Annäherungsversuch, der keineswegs feindlich gemeint ist.185
Die nächsthöhere Stufe der Unterdrückung von Aggressivität zwecks Paarung ist die Ehe. Bei weniger hoch entwickelten Tieren gibt es die Ortsehe, d. h, die Partner sind über das gemeinsame Revier verbunden. Storchenpaare beispielsweise erkennen sich weit entfernt vom Nest nicht wieder, sind also nur über den Nistplatz miteinander verbunden. Bei höher entwickelten Tieren gibt es die mit starken Emotionen verbundene Ehe, die aggressionshemmend wirkt. Wie stark diese Wirkung ist, kann man sich ausmalen, wenn man sich vorstellt, man müsste dieselbe Intensität der Beziehung statt mit dem geliebten Partner mit jemand Wildfremden erleben oder mit jemandem, den man abstoßend findet.186 Liebe ist die schönste Ersatzreaktion und Ausweichhandlung zur Vermeidung von Aggressivität. Gleichzeitig ist sie eng an Aggressivität gebunden, weil sie ohne diese gar nicht benötigt würde. „Es gibt sehr wohl intraspezifische Aggression ohne ihren Gegenspieler, die Liebe, aber es gibt umgekehrt keine Liebe ohne Aggression.“187
Auch gegenüber den eigenen Kindern müssen alle Tiere Mechanismen zur Hemmung aggressiver Impulse haben, die ja gerade während der Kinderaufzucht gegenüber anderen Tieren verstärkt sind, um die Jungen zu schützen.188 Bei (höher entwickelten) Säugetieren ist dies ebenfalls eine Form der Liebe.
Aggressivität und Jagd
Aggression ist gegen Artgenossen gerichtet. Wenn ein Löwe eine Gazelle jagt, stellt dies keine Aggression des Jägers gegen seine Beute dar – auch wenn dies in nahezu allen Spielfilmen anders dargestellt wird. Der Jagdinstinkt ist ein gänzlich anderes Gefühl als die Aggression, es ist eine freudige Erwartung und wird lustvoll erlebt.189 Spielen und Sport sind das Üben von Jagd, und beides geht mit denselben positiven Gefühlen einher. Wenn wir als Kinder fangen spielten und einem anderen Kind hinterherliefen, hatten wir dasselbe Gefühl, das Raubtiere beim Jagen empfinden. Interessanterweise bedeutet das englische Wort game im Deutschen gleichermaßen „Wild“ und „Spiel“.
Jagd und innerartliche Kämpfe sind beide mit Gewaltbereitschaft verbunden. Die Jagd ist mit Lustgefühlen verknüpft, aber am Ende steht die Tötung und Zerlegung der Jagdbeute, was mit Gewalt verbunden ist. Dass Jagen der Nahrungsbeschaffung vieler Tiere und auch der Menschen dient, hat dazu beigetragen, dass solche Gewalt in unserem Denken und Empfinden etabliert ist. Dieselbe Gewalt wie bei der Jagd wendet man – kombiniert mit Aggressivität – im Kampf gegen Rivalen bei der Paarung oder im Revierkampf an. Ich denke, diese Parallele hat auch zu der irrigen Ansicht geführt, dass Jagd mit Aggressivität verbunden sei.
Wenn wir Sport treiben, ist das eine Ersatzhandlung für Revierkampf und Jagdtrieb, da die wenigsten von uns noch wirklich zur Jagd gehen und sich mit den Nachbarn um ihr Revier prügeln. Uns geht es ebenso wie der erwähnten Hauskatze, die ihren Jagdtrieb im Spiel befriedigt, selbst wenn sie sattgefressen ist. Diese Triebe wollen unabhängig von ihrem Zweck ausgelebt werden. Dies dient dem Üben von Bewegungsabläufen. Daher tun das alle Tierkinder und auch die Menschenkinder gerne, und es ist keineswegs Zeitverschwendung.
Sackgassen der Evolution und menschliche Aggressivität
Wenn der Anreiz zur natürlichen Auslese nicht von außen kommt, kann die Evolution in Sackgassen geraten. Ein Anreiz von außen wäre beispielsweise, dass bessere Sinnesorgane nützlich bei der Nahrungssuche und dem Erkennen von sich anschleichenden Raubtieren sind. Wer schärfere Sinne hat, hat einen Vorteil bezüglich der Arterhaltung. Einen Anreiz zur Auslese von innen, eine „innerartliche Zuchtwahl“, wie Lorenz es nannte, gibt es beispielsweise bei Paradiesvögeln und Argusfasanen.190 Das Merkmal, dessen Ausprägung sie bei der Fortpflanzung begünstigt, erfüllt keinen äußeren Nutzen. Aus irgendeinem Grund oder aus Zufall hat es sich ergeben, dass Weibchen buntere Männchen mit größeren Flügeln bevorzugen. Vielleicht bedeuteten zu Beginn die größeren, bunten Flügel auch eine Verbesserung der Überlebensfähigkeit. Das buntere Männchen gewinnt das Weibchen beim Balzen. Dieses Merkmal hat sich im Wettstreit um die Weibchen durch Zuchtwahl nun immer stärker ausgeprägt. So wurden die Männchen immer farbenprächtiger und entwickelten immer größere Flügel, bis sie kaum noch flugfähig waren. Werden ihnen die aufwändigen Federn zum Verhängnis, weil sie häufiger gefressen werden als ihre unauffälligeren Artgenossen, so ist das zunächst unbedeutend, sofern ihnen vor dem Gefressenwerden die Vermehrung gelingt und ihre Eigenart weitergetragen und verstärkt wird. Es ist möglich, dass die Art durch dieses Wirkprinzip ausstirbt oder dass sie nur deshalb weiter existiert, weil die Beeinträchtigung gerade noch tragbar ist. Da jedoch die Männchen nicht miteinander kämpfen, sondern die Weibchen die Partnerwahl treffen, kann sich diese Eigenart kaum mehr vollständig zurückbilden.
Bei uns Menschen trat vor der neolithischen Revolution ein dramatischer Bevölkerungsrückgang auf. Über Jahrhunderttausende lebten nur einige Zehntausend Menschen.191 Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass uns damals unser evolutionsbedingtes Aggressivitätsniveau in Kombination mit der Erfindung von Waffen beinahe die Existenz gekostet hätten.192 Denn mit dem menschlichen Aggressionstrieb verhält es sich wie mit den Merkmalen des Argusfasans: „Vor allem aber ist es mehr als wahrscheinlich, daß das verderbliche Maß an Aggressionstrieb, das uns Menschen heute noch als böses Erbe in den Knochen sitzt, durch einen Vorgang der intraspezifischen Selektion verursacht wurde, der durch mehrere Jahrzehntausende, nämlich durch die ganze Frühsteinzeit, auf unsere Ahnen eingewirkt hat. […] Der nunmehr Auslese treibende Faktor war der Krieg, den die feindlichen benachbarten Menschenhorden gegeneinander führten. Er muß eine extreme Herauszüchtung aller sogenannten kriegerischen Tugenden bewirkt haben, die leider noch heute vielen Menschen als erstrebenswerte Ideale erscheinen“.193
Charles Darwin zitiert die Beobachtung des Südseeforschers John Byron unter Eingeborenen der Inselgruppe Feuerland. Weil ein kleiner Junge einen Korb mit Möweneiern fallengelassen hatte, wurde er von seinem Vater gegen einen Felsen geschlagen und getötet. Bei einer solch geringen Aggressionshemmung ist ein Bevölkerungswachstum kaum möglich.194
Was Konrad Lorenz nicht erwähnt hat: Die mit Aggressivität einhergehende Rastlosigkeit sorgt dafür, dass die Aggressiven häufiger sterben – früher durch Stammeskriege, bei denen sie sicher weiter vorne standen als die Ängstlichen, heute durch Auto- und Motorradunfälle, Schießereien, Kriege, Raubbau am eigenen Körper und anderes. Dies regelt das Aggressivitätsniveau der Gesellschaft auf natürliche Art. Völker, die übertrieben starke Aggressionsneigungen haben, werden sich durch Kriege dezimieren. Allerdings funktioniert diese Selbstregulierung nur, wenn Ebenbürtige aufeinandertreffen. Unter Ungleichen setzt sich nicht nur der höher Entwickelte gegen den geringer Entwickelten und der Stärkere gegen den Schwächeren, sondern auch der Aggressivere gegen den Friedlicheren durch. So erging es vielen friedliebenden Urvölkern.
Ich denke, die innerartliche Auslese wirkt nicht ganz so dramatisch, wie Lorenz befürchtete, denn Paradiesvogel und Argusfasan gibt es nach wie vor. Was er herausgearbeitet hat, ist, dass dieser Mechanismus dem Ziel der Arterhaltung teilweise entgegengerichtet ist, obwohl er denselben evolutionären Mechanismen gehorcht. Die natürliche Auslese greift in solchen Fällen möglicherweise zu spät, wenn die Arterhaltung bereits akut gefährdet ist. Die innerartliche Auslese ist ein Nachteil in der Arterhaltung, den bewusst denkende und handelnde Menschen zu vermeiden suchen sollten.
Waffen
Die Erfindung von Waffen ist artgefährdend, da der Mensch kein besonders gefährliches Raubtier ist: „In Wirklichkeit ist es tief beklagenswert, dass der Mensch eben gerade keine ‚Raubtiernatur’ hat. Ein Großteil der Gefahren, die ihn bedrohen, kommen daher, dass er von Natur aus ein relativ harmloser Allesfresser ist, dem natürliche, am Körper gewachsene Waffen fehlen, mit denen er große Tiere töten könnte, denn eben deshalb fehlen ihm ja auch jene stammesgeschichtlich entstandenen Sicherheitsmechanismen, die alle ‚berufsmäßigen’ Raubtiere daran hindern, ihre Fähigkeiten zum Töten großer Tiere gegen Artgenossen zu missbrauchen.“195 Aufgrund unserer Intelligenz konnten wir unsere Waffen schneller weiterentwickeln, als die Mechanismen zur Aggressionshemmung mitwachsen konnten. Die Anpassungsfähigkeit unserer Instinkte ist an der schnellen Entwicklung gescheitert.196 Offenbar können wir unsere Aggressivität im Affekt nicht besonders gut kontrollieren. Einen Beleg dafür, dass mit der Verfügbarkeit von Waffen nicht automatisch ein verantwortungsvoller Umgang mit ihnen einhergeht, liefert ein Vergleich: In den USA sterben jährlich circa dreißigtausend Menschen durch Schusswaffengebrauch, in Deutschland ungefähr siebzig.
Die Erfindung von Waffen hat also in vielerlei Hinsicht unser Zerstörungspotential erhöht: erstens direkt durch die höhere Schlagkraft und zweitens durch die Herauszüchtung der Aggressivität. Der dritte Grund: Das Besitzen von Macht begünstigt die Ausübung von Gewalt und erhöht damit die möglichen Folgen von Aggression. Macht im heutigen Ausmaß gab es in der Steinzeit nicht. Dass wir bisher nicht durch die Folgen unserer eigenen Erfindungen ausgestorben sind, beruht auf unserer Fähigkeit zur Reflexion und zur Korrektur als falsch erkannter Handlungsweisen.197
Aggressivität lässt sich nicht einfach unterdrücken
Konrad Lorenz ging davon aus, dass die aggressivsten Menschen sich durch natürliche Auslese bei der Vermehrung durchsetzten. Wenn das stimmt, hat die menschliche Aggressivität kontinuierlich zugenommen. Und er kommt zu dem Schluss, dass Kriege nicht der Auslöser, sondern das Ergebnis der Aggressivität sind. Er schreibt unter dem Eindruck der Weltkriege und des Kalten Krieges: „Wir sind dazu erzogen, uns der sogenannten politischen Klugheit der für die Staatsführung Verantwortlichen zu unterwerfen, und wir sind an alle hier in Rede stehenden Phänomene so gewöhnt, dass die meisten von uns sich daraus nicht klar darüber werden, wie ungemein dumm und menschheitsschädlich das historische Verhalten der Völker ist.“198 Man darf nicht Ursache und Wirkung durcheinander bringen. Die Menschheit ist „nicht kampfbereit und aggressiv, weil sie in Parteien zerfällt, die sich feindlich gegenüberstehen, sondern sie ist eben in dieser Weise strukturiert, weil dies die Reizsituation darstellt, die für das Abreagieren sozialer Aggression erforderlich ist.“199
Man kann der Aggressivität auch nicht mit äußerlichen Maßnahmen Herr werden: „Zwei naheliegende Versuche, die Aggression zu steuern, sind nach allem, was wir über Instinkte im allgemeinen und die Aggression im besonderen wissen, völlig hoffnungslos. Man kann sie erstens ganz sicher nicht dadurch ausschalten, dass man auslösende Reizsituationen vom Menschen fernhält, und man kann sie zweitens nicht dadurch meistern, dass man ein moralisch motiviertes Verbot über sie verhängt. Beides wäre ebenso gute Strategie, als wollte man dem Ansteigen des Dampfdruckes in einem dauernd geheizten Kessel dadurch begegnen, daß man am Sicherheitsventil die Verschlußfeder fester schraubt.“200
Wir müssen uns also mit einer gewissen Grundaggressivität abfinden und uns damit so einrichten, dass sie unser Leben nicht beeinträchtigt. Ich denke, dass die beschriebene Herauszüchtung nur eine von mehreren Ursachen unserer Aggressivität ist. Dennoch sollten wir die beschriebenen Zusammenhänge bei der Gestaltung unserer Gesellschaft berücksichtigen, wenn wir eine bessere Welt anstreben.
Konsequenzen für die Zukunft
Nach den obigen Ausführungen ist es also nicht so, dass Liebe gut und richtig und Aggressivität böse und falsch sei. In Religionen, Märchen und auch in vielen älteren und modernen Geschichten und Filmen kämpfen die Protagonisten gegen „das Böse“. Das kann jedoch in der Realität nicht funktionieren: Es gibt die Aggressivität, die für das Überleben der Art notwendig ist, und es gibt die Liebe, die für das Überleben genauso notwendig ist. Wer also nach der Abschaffung des „Bösen“ strebt, will etwas ausrotten, das es so gar nicht gibt und dessen wahre Natur einen Zweck hat.
Womöglich werden Sie mir jetzt entgegenhalten, was es denn anderes als das Böse sei, wenn Menschen „aus heiterem Himmel“ zu Terroristen werden, andere vergewaltigen oder wenn ein Junge in einer Schule seine Mitschüler erschießt. Ein solches Verhalten hat nichts mit dem beschriebenen Revierverhalten und den Ersatzhandlungen zu tun. Es ist Wut, die sich lange angestaut hat und sich in einer Überreaktion Bahn bricht. Keine menschliche Handlung kommt aus heiterem Himmel, wie uns die Medien gerne erklären wollen. In diesen Fällen ist häufig durch den Täter selbst erlebte Gewalt oder Entwurzelung die Ursache, die auf dem Nährboden unseres hohen Aggressionsniveaus gedeiht. Viel scheinbar unmotivierte Aggressivität geht auf Verletzungen der Integrität in der frühen Kindheit zurück. Ergibt sich eine Situation der Überlegenheit gegenüber anderen, so schafft dies die Möglichkeit zum Abreagieren der Aggression.
Aufgrund unserer geringen körpereigenen Bewaffnung konnten wir viel Aggressivität entwickeln, durch innerartliche Auslese verstärkte sich diese noch, und die Waffen, die wir entwickelten, verstärkten unser Zerstörungspotential. Damit müssen wir heute leben und zurechtkommen. Eine Art, die das Überleben aus Sicht der Evolution verdient hat, muss dazu in der Lage sein, ihre Hitlers und Stalins ebenso wie gewaltsame „Kindererziehung“ (Schwarze Pädagogik), die die Aggressivität in der Gesellschaft erhöht, abzuschaffen. Zu viel Aggressivität wird von der Evolution nicht geduldet und kann zum Aussterben führen. Das Aggressionsniveau lässt sich nicht durch Willenskraft, sondern nur durch Ersatzhandlungen wie Sport und Spiel absenken. Was wir jedoch tun können, ist, unsere Gesellschaft so umzugestalten, dass unser Überleben nicht mehr durch Aggressivität gefährdet wird.
Im steinzeitlichen Gruppenleben gab es die Freundschaft und Liebe zur Familie und Gruppe sowie die Liebe zum Partner, die ein Gegengewicht zur Aggressivität darstellen. In unserer Gesellschaft und zwischen Nationen, Staaten und Völkern fehlt bisher eine Entsprechung – auch wenn vor hundert Jahren die Liebe zum eigenen Volk oder die Bruderschaft von Nationen in politischen Reden oft beschworen wurden – vielleicht gerade weil sie fehlte. Wenn wir ein solches Empfinden entwickeln können, wird das der Aggressivität zwischen Nationen vorbeugen. So gesehen kann man sich einen intensiven Austausch zwischen allen Nationen nur wünschen.
2.6 Minderheiten und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
Mit einer gewissen Regelmäßigkeit blüht der Rechtsradikalismus in Deutschland auf. In den Neunzigern waren es die Republikaner, dann kam die Schill-Partei, und derzeit hat die Alternative für Deutschland (AfD) viel Zulauf und die größten Erfolgschancen einer rechten Partei seit dem Zweiten Weltkrieg. Und jedes Mal scheint keiner zu wissen, woher das kommt. Die Äußerungen von Politikern und Medien offenbaren meist Unkenntnis der Hintergründe und klingen hilflos.
Beispiel Landtagswahlen 2016: In jedem Bundesland hat die AfD dazugewonnen, und viele fragen sich, wie sie dem Rechtsruck und der Flüchtlingsfeindlichkeit begegnen können. Als Maßnahme wird vorgeschlagen, die CDU müsse die Angst vor Überfremdung ernstnehmen und entsprechend handeln. Bei der Bundestagswahl 2017 bestätigt sich der Trend nach rechts, woraufhin CDU und CSU darüber nachdenken, selbst mehr rechte Inhalte anzubieten. Bisher kommen Gegenkonzepte kaum darüber hinaus, uns zum Kampf gegen Rechts und zu Gegendemonstrationen aufzurufen. Die Ursachen des Rechtsradikalismus bleiben unklar.
Gegendemonstrationen, das Willkommenheißen der Flüchtlinge sowie Hilfeleistungen bewirken lediglich, dass die Bildung der öffentlichen Meinung nicht komplett den Rechten überlassen wird. Rechtsradikale werden ihre Ansichten indes nicht ändern, sondern sich durch den „Gegenwind“ eher noch bestätigt fühlen.201
Die Heitmeyer-Studie
In den Jahren 2002 bis 2012 wurde unter der Leitung des Bielefelder Soziologen Professor Wilhelm Heitmeyer eine groß angelegte Langzeitstudie202 zu einem Phänomen durchgeführt, das er als „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ bezeichnet. Hieran waren zahlreiche Wissenschaftler beteiligt. Über einen Zeitraum von zehn Jahren wurden dieselben Personen in regelmäßigen Abständen befragt.203 Man wollte herausfinden, wie sich Fremdenfeindlichkeit, Hass auf Schwule und Lesben, Diskriminierung von Juden, Ausgrenzung oder Herabwürdigung von Frauen, Behinderten, Obdachlosen usw. verändern und mit welchen äußeren Faktoren dies korreliert.
In der Studie wurde nachgewiesen, dass abnehmende Zukunftschancen zu einer Zunahme gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit204, stärkerer Abgrenzung und einer Zunahme konservativer Einstellungen führen. Relevant sind dabei nicht die messbaren Verhältnisse, sondern die empfundene Chancenlosigkeit, Machtlosigkeit und Existenzgefährdung.205 Besonders stark trägt zu diesem Empfinden ein Rückgang der Lebenschancen der Jugend bei. Zurückgehende Zukunftschancen führen zur Abgrenzung durch das Aburteilen anderer.206 Dies stellt genau die Kernaussage der meisten rechtsradikalen Gruppierungen dar: „Ausländer, Linke, Flüchtlinge und andere Schmarotzer sind daran schuld, dass es uns schlechter geht. Wir müssen uns dagegen wehren.“ In der letzten Zeit richtet sich diese Menschenfeindlichkeit vorwiegend gegen Flüchtlinge.207
Viele Soziologen verstehen die Abgrenzung gegen andere als eine Maßnahme zur Stärkung der eigenen Gruppe.208 Die Aggressivität nach außen soll den Zusammenhalt nach innen festigen. Für die Arterhaltung ist es von Vorteil, wenn die stärkste Gruppe mehr Raum einnimmt. Doch die Prinzipien des biologischen Überlebenskampfes gelten nicht mehr für unsere heutige Zeit. Wo würde er langfristig hinführen? Wollen wir, dass die stärkste Nation, Firma, Ethnie irgendwann die Weltherrschaft übernimmt, den Rest unterwirft und die gesamte Bevölkerung stellt? Oder wollen wir als Menschheit in Vielfalt weiterleben?
Geht es uns schlechter, schotten wir uns ab
Mit zunehmender Prekarisierung und den damit verbundenen Ängsten und Ohnmachtsgefühlen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich viele Menschen nach rechts orientieren.209 Man kann davon ausgehen, dass die Hartz-IV-Gesetze und andere Maßnahmen der Agenda 2010 sowie die Folgen des Neoliberalismus durch die Verschlechterung der Chancen der Betroffenen zu einem Rechtsruck geführt haben. Das ist auch eine Erklärung dafür, warum der Osten Deutschlands fremdenfeindlicher ist – hier gibt es seit der Wende immer noch weniger Arbeitsplätze und mehr Abwanderung als im Westen. In vielen ländlichen Regionen des Ostens leben überwiegend ältere Menschen, was nicht gerade für Aufbruchstimmung sorgt.210
In einer homogenen Gesellschaft, in der es allen gleichermaßen gut geht, wird sich kaum ein Rechtsruck ergeben. In den letzten fünfzig Jahren kam die Welt auch ohne ein solches Phänomen aus. Eine derartige Bewegung benötigt nicht nur die Möglichkeit in Form einer neu gegründeten Partei, sondern auch einen hinreichenden Grund dazu – keine Wirkung ohne Ursache. Warum sollte sich eine starke Bewegung bilden, wenn es allen unverändert gut geht? Eine Polarisierung, die der fast weltweit zu beobachtende Rechtsruck darstellt, muss also auf einer Spaltung der Gesellschaft beruhen. Als Hauptursache des Rechtsrucks meine ich die weltweit zunehmende Ungleichverteilung (siehe Kapitel 3.8) ausgemacht zu haben.
In Deutschland haben wir durch die Agenda 2010 die Leistungsgesellschaft über die Solidargemeinschaft gestellt, nach dem Prinzip: „Erst das Geld, dann der Mensch, denn der Mensch muss ja vom Geld leben.“ Eine wesentliche Ursache für die sich entladende Wut und die Wende nach rechts und hin zum Reaktionären ist, dass es vielen jetzt schlechter geht: Jugendliche finden keinen unbefristeten Job, Erwachsene haben nur Aussicht auf ein Überleben durch staatliche Almosen, aber kein Leben, das dem der Mitte der Gesellschaft ebenbürtig ist, und alte Menschen müssen ihre Rente mit Hartz IV aufstocken. In den letzten zehn Jahren sind die Einkommen der Geringverdiener im Mittel gesunken, während die Lebenshaltungskosten anstiegen. Während man vor einigen Jahrzehnten auch in „einfachen“ Berufen ein ordentliches Auskommen hatte, reicht es heute nur noch zum Überleben, aber nicht mehr für Wohlstand – als Geringverdiener ist man vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Ein immer größerer Teil geht für die Wohnung, für gestiegene Nebenkosten, Strom, Telefon, Miete oder Kleinkredite weg. Wer heute als Dienstleister beispielsweise in den Bereichen Einzelhandel, Krankenpflege oder Frisörhandwerk arbeitet und ein Gehalt in der Nähe des Existenzminimums bekommt, hat keine Chance, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Sein Gehalt geht komplett für den Lebensunterhalt drauf, und er hat keine Möglichkeiten, etwas zu sparen oder zur Altersvorsorge zurückzulegen. Somit hat er auch keine Chance, der Geldentwertung und den steigenden Kosten zu entkommen. Jetzt müssen wir als Gesellschaft mit der Wut der Betroffenen als Folge dieser Maßnahmen zur Effizienzsteigerung leben. Es ist also falsch, dass die Politik kaum etwas gegen den neuen Rechtsextremismus tun könne und für ihn auch nicht verantwortlich sei – Neoliberalismus und Sparprogramme haben ihn mit befördert.211
Schlimmer noch sieht es nach der Finanzkrise in Südeuropa aus. Die Zeit schreibt, dass die Arbeitslosigkeit der unter 25jährigen im Jahre 2014 in Spanien 55,5 %, in Griechenland 57,2 %, in Italien 40,9 % und in Frankreich 24,8 % betrug.212 Weiter: „Die Einkommen der Generation, die in diesen Ländern nach 1970 geboren wurden, sind sogar um 25 bis 30 Prozent niedriger als die Einkommen, die nötig wären, damit später geborene Generationen (…) vom selben Einkommenstrend wie ihre Vorgängergenerationen profitieren“.213 Das sind nach Heitmeyer Faktoren, die die gesamtgesellschaftlich gefühlte Perspektivlosigkeit erheblich verstärken. Hierin liegt ein großes Potential für künftige Krisen.
Wie aber lassen sich die Wutbürger und Rechten erklären, die nicht unter Armut und Chancenlosigkeit leiden und das auch nicht in ihrem Umfeld erleben, also Leute, die nicht durch die Agenda 2010 und die Umverteilung von Arm nach Reich beeinträchtigt werden? Was die Studie von Heitmeyer nicht erfasst hat, sind individuelle biografische Unterschiede. Wie in den vorherigen Kapiteln ausgeführt, hängt das persönliche Aggressionsniveau damit zusammen, wie viel Gewalt bzw. Liebe und Geborgenheit jemand in seiner Kindheit erfahren hat. Dementsprechend wird auch die persönliche Tendenz zur Abgrenzung gegenüber anderen dadurch bestimmt. Jemand, dem in der Kindheit so wichtige Dinge wie Freiheit, Selbstbestimmtheit, spielerisches Entdecken der Umwelt verweigert wurden und der daher das Gefühl entwickelt hat, dass ihm Perspektiven genommen wurden, derjenige wird auch stärker von Ängsten bestimmt werden. Er ist sicherlich anfälliger für die Entwicklung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Einen Teil wird auch dazu beitragen, dass viele den Rückgang der Aufstiegschancen innerhalb der Gesellschaft wahrnehmen – auch wenn sie selbst nicht davon betroffen sind.
Schon die Nazis machten sich die weitverbreitete Unzufriedenheit zunutze, indem sie eine „jüdische Weltverschwörung“ als Urheber der demütigenden Reparationszahlungen an die Siegermächte des Ersten Weltkrieges und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Not in Deutschland ausmachten. Damit lenkten sie die Wut der Menschen gezielt auf diese Minderheit. Floriert heute möglicherweise der Rechtsradikalismus in ganz Europa, weil die Bürger instinktiv spüren, dass große Teile des von ihnen Erarbeiteten bei den Superreichen und Konzernen verbleiben? Ein weiterer Faktor ist die schnelle ("disruptive") Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten Jahren. Sie ist dominiert von ökonomischer Liberalisierung und technologischem Fortschritt, schert sich aber nicht um die Sehnsucht der Menschen nach Verlässlichkeit und Orientierung.
Der Zusammenhang zu Aggressivität und Revierverhalten
Dass Konservativismus, Rechtsorientierung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zunehmen, wenn es den Bürgern und vor allem der Jugend schlechter geht, deckt sich mit den Erkenntnissen von Konrad Lorenz: Wie immer, wenn die Überlebenschancen zurückgehen, werden Menschen aggressiver und fangen an, nach anderen zu hacken und sich Sündenböcke zu suchen. Das ist durch die Evolution so beabsichtigt und dient der Arterhaltung. In bedrohlichen Zeiten sollen vor allem diejenigen überleben, die die Aggressivität ihrer Umwelt am besten aushalten, weil sie größere Widerstandskräfte haben als ihre Artgenossen.
Wie bei den erwähnten Füchsen und Hasen auf der Insel ist es für jede Spezies notwendig, dass sie Mechanismen hat, mit einem zurückgehenden Angebot an benötigten Ressourcen umzugehen – und zu dieser Regulierung dient bei uns die Aggressivität. Wenn unsere Lebensgrundlagen gefährdet sind, werden wir untereinander aggressiver – um nicht auszusterben. Dieses menschliche Verhalten zu verteufeln, verleugnet dessen biologische Sinnhaftigkeit. Erst wenn man diese Tatsache akzeptiert hat, lässt sich über Auswege und Ersatzstrategien nachdenken.
In Krisenzeiten wie in entspannten Zeiten wird Kreativität benötigt. Aber in Krisenzeiten ist es wichtiger, drängende Probleme in Bezug auf die Existenz pragmatisch zu bewältigen, und in Friedenszeiten ist es möglich, neue Ideen zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. In Friedenszeiten braucht man ausgefallenere Menschen, die sich außerhalb des Mittelmaßes bewegen und daher neue Ansätze in die Gemeinschaft einbringen, in Krisenzeiten braucht man diese weniger. Dies wird ein weiterer Grund dafür sein, weshalb uns die Evolution dazu gebracht hat, dass wir alle von der Norm Abweichenden in Krisenzeiten ausgrenzen wollen.
„Schmarotzer“
Wer sich über Minderheiten empört und sie ausgrenzen will, wirft ihnen häufig vor, sie lebten auf Kosten der Allgemeinheit. Missbrauch der Sozialsysteme kommt in jeder Gesellschaft vor. Die Frage ist allerdings, wodurch die Empörung darüber tatsächlich entsteht. Dass die Forderung nach Abweisung von Flüchtlingen mit der Begründung, man befürchte andernfalls Einschnitte beim eigenen Wohlstand, nicht auf logischen Überlegungen beruht, sondern auf reflexhaften Äußerungen, zeigt sich u. a. daran, dass in dieser Diskussion nie gefordert wurde, Reichtum stärker zu besteuern oder einen ähnlichen Betrag zur Unterstützung der Ärmsten zur Verfügung zu stellen, wie er zur Rettung der Banken in der Finanzkrise aufgebracht wurde. Also wird auch die Ausweisung von Flüchtlingen das Problem nicht lösen, da die Flüchtlinge nicht die Ursache sind, sondern die noch nicht bewusst gewordene und ins richtige Verhältnis gesetzte Verschlechterung der eigenen Lebensumstände und Chancen.
Auswege
Anonymität erleichtert Fremdenfeindlichkeit. Persönliche Bekanntschaft wirkt aggressionshemmend. Es fällt einem schwer, auch nur unhöflich gegenüber Fremden zu sein, wenn man ihnen Auge in Auge gegenübersteht – selbst wenn man zuvor über die betreffende Gruppe geschimpft hat.214 Der Demagoge trachtet danach, den Kontakt zwischen verfeindeten Gruppen zu verhindern. Daraus ergibt sich eine Möglichkeit, wie man gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit jeder Art entgegentreten kann. Integration entsteht: wenn die Angehörigen unterschiedlicher Kulturen ein gemeinsames Ziel anstreben, dabei zusammenarbeiten und das Ganze unter Leitung und Aufsicht geschieht.215 Daher geschieht Integration in Deutschland überwiegend im Berufsleben und in Sportvereinen, ist aber im Privaten nach wie vor die Ausnahme.
Aus den Ausführungen dieses Kapitels ergibt sich, dass der Extremismus unter anderem aus den zurückgehenden Lebens- und Berufschancen der jetzigen prekär Beschäftigten und vor allem der Jugend gespeist wird. Die Agenda 2010 und der ausufernde Neoliberalismus haben hier weitreichende Schäden angerichtet.216
Allein die Erkenntnis der zugrunde liegenden Zusammenhänge kann schon einen Rückgang von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Aggressivität bewirken. Wenn uns bewusst wird, dass eine impulsive Wut auf Fremde aus unserem biologischen Erbe stammt und heute keine sinnvolle Funktion mehr hat, können wir sie leichter beherrschen. In unserer Geschichte gibt es zahllose Beispiele dafür. Wir haben in den letzten Jahrhunderten viele Formen von Gewalt abgeschafft, weil wir sie nicht mehr für angemessen hielten und unser Mitgefühl für die Betroffenen wuchs. Vergewaltigung, Rachemorde und Folter waren im Mittelalter nicht ungewöhnlich und sind für uns heute ein absolutes Tabu – allein durch Erkenntnis.
2.7 Gewalt im Kleinen und im Großen, Krieg und Langzeitfolgen
Hören wir in den Nachrichten, dass irgendwo ein Krieg beendet wurde, so atmen wir innerlich auf bei dem Gedanken: Es ist vorbei. Das Gegenteil ist der Fall: Es fängt gerade erst an.
Im Krieg verlieren Menschen Angehörige und Freunde, ihnen werden Verstümmelungen zugefügt, Menschen werden vergewaltigt und müssen Leid und Gewalt mitansehen. All das tragen sie ihr ganzes Leben lang mit sich herum. Die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern, dass bis in die Achtziger Jahre viel mehr Menschen mit fehlenden Gliedmaßen im Straßenbild zu sehen waren. Die Folgen eines Krieges wirken sehr lange nach, bestimmen die Entwicklung der Gesellschaft eines Landes und haben in Zeiten der Globalisierung Einfluss auf die gesamte Welt.
Jan Philipp Reemtsma zitiert Theodor W. Adorno in seinem Buch Vertrauen und Gewalt: „Nichts aber ist vielleicht verhängnisvoller für die Zukunft, als dass im wörtlichen Sinn bald keiner mehr wird daran denken können, denn jedes Trauma, jeder unbewältigte Schock der Zurückkehrenden ist ein Ferment kommender Destruktion.“ Jedes Trauma ist, auch wenn es durch Verdrängung der Erinnerung und damit der Möglichkeit zur Verarbeitung entzogen wurde, weiterhin im Menschen aktiv.
Menschen, die einen Krieg erlebt haben, zeigen Verhaltensweisen, die in Friedenszeiten absurd erscheinen, wie beispielsweise eine panische Angst vor Flugzeugen oder Feuerwerk oder eine übertriebene Vorratshaltung. Manche werden in Anbetracht des erlebten Grauens mehr oder weniger sprachlos. Andere haben das Verständnis für die Feinheiten des Lebens verloren, können nur extreme, lebensbedrohliche Zusammenhänge ernstnehmen und tun normale Empfindungen als unbedeutend ab. Manche werden von Alpträumen geplagt, andere können aufgrund ihrer Erlebnisse nicht mehr offen und freundlich sein, sondern reagieren schon bei kleinen Anlässen mit Gewalt. Manche richten sich selbst mit Alkohol zugrunde. Andere können keinen Kontakt mehr zu ihren Mitmenschen aufrechterhalten.
Wer einen Krieg erlebt hat, ist fast zwangsläufig mit extremer Gewalt in Kontakt gekommen und vergisst das nicht mehr. Häufig geben Eltern ihre eigenen unverarbeiteten Verletzungen an ihre Kinder weiter, indem sie wenig Raum für deren Nöte und Befindlichkeiten lassen. Viele Traumatisierungen werden so von einer Generation an die nächste weitergereicht.
Vergessenes Leid
In den Schlachten zweier Weltkriege und in den KZs des Dritten Reiches sind Millionen Menschen gestorben und Millionen auf irgendeine Art verletzt worden. Die, die es am schlimmsten traf, sind tot. Wer Glück hatte, überlebte. Damit ist die Erinnerung an die Kriege in der Gesellschaft erheblich zu positiv. Es werden die Geschichten von den Menschen erzählt, die dem Tod knapp entronnen sind. Diejenigen, die das nicht schafften, haben ihre Geschichte mit ins Grab genommen. Für alle Kriege gilt gleichermaßen: Die Geschichte schreiben die Überlebenden.217 Somit stellt alle Überlieferung des Geschehenen aus den Erzählungen der Augenzeugen eine Beschönigung dar.
Heutige Kriege sind mehr oder weniger weit weg von uns. Vielen Menschen ist zwar klar, dass Krieg nach Möglichkeit vermieden werden sollte; weil aber unsere heutige Gesellschaft nur den Frieden kennt, haben wir kaum eine realistische Vorstellung von den Kriegsfolgen.
Die heute in Europa Regierenden haben keinen Krieg erlebt und kennen Kriegserzählungen nur von ihren Eltern oder Großeltern – sofern diese etwas erzählten, denn die meisten Zeugen des Zweiten Weltkrieges taten das nicht.
Das Aggressionsniveau wird von Eltern an Kinder weitergegeben
Die in Kapitel 2.4 beschriebenen Yequana-Indianer leben auf einem deutlich niedrigeren Niveau von Aggressivität. Aggressive Handlungen kommen innerhalb eines Stammes so gut wie nicht vor. Trotz ihrer friedlichen Gesinnung halten sie sich bis heute im venezolanischen Regenwald. Offensichtlich hat die Natur nichts gegen friedliche Menschen. Wenn aber Friedliche und Aggressive aufeinandertreffen, stehen die Chancen für die Friedlichen schlecht.218
Konrad Lorenz und die Heitmeyer-Studie haben aus zwei unterschiedlichen Perspektiven gezeigt, dass Menschen aggressiver werden, wenn sich ihre Lebensbedingungen verschlechtern oder ihr Lebensraum zu klein wird. Dann ist es mit der Friedfertigkeit vorbei, und die Aggressiveren setzen sich durch. Die Natur hat nichts gegen ein friedliches Leben – solange genügend Raum für alle da ist. Unsere Vermehrung in den letzten zehntausend Jahren hat in diesem Sinne den Auslöser für einen Anstieg der Aggressivität geliefert, da wir nun erheblich häufiger fremden Menschen begegnen und viel weniger Platz haben. In der Steinzeit konnte ein menschliches Rudel viele Quadratkilometer für sich allein beanspruchen. Vor allem die Veränderungen der letzten fünfhundert Jahre – Landflucht, zunehmende Individualisierung, Bevölkerungswachstum – haben dazu geführt, dass wir weniger in überschaubaren Gemeinschaften leben, sondern mehr mit uns nicht persönlich bekannten Menschen zu tun zu haben.
Seit Jahrhunderten ist das Aggressionsniveau der Europäer sehr hoch, und erst in den letzten fünfzig Jahren ist es langsam abgeklungen. Über Jahrhunderte war es für jeden männlichen Jugendlichen klar, dass die Zeit bis zum Erwachsensein mit Rivalitäten und Prügeleien verbunden sein würde. Über lange Zeit war klar, dass in jeder Gruppe Schwächere und Außenseiter gehänselt und ausgegrenzt werden. Ja, all das gibt es auch heute noch. Aber ich bin der Ansicht, es ist seltener als noch zu meiner Schulzeit. Verletzungen bei Prügeleien auf Schulhöfen sind rückläufig.219 Gewaltkriminalität durch Jugendliche war in den letzten Jahren – entgegen der Einschätzung der Teilnehmer einer Befragung – rückläufig.220 Hass auf Randgruppen und Kriegsbegeisterung sowie gewalttätige Auseinandersetzungen, beispielsweise bei Demonstrationen, waren noch vor hundert Jahren wesentlich weiter verbreitet – Demonstrationen wurden immer wieder mit Waffengewalt unterdrückt. Solche Vorkommnisse sind in Deutschland seither seltener geworden.
Die oben aufgezählten äußeren Auslöser haben unsere Bereitschaft zur Aggressivität in den letzten Jahrhunderten gesteigert, aber auch mangelnde Geborgenheit in der frühesten Kindheit und gewalttätige Erziehung haben ihren Teil dazu beigetragen. Der wesentliche Punkt dabei ist: Die ausgesäte Gewalt setzte sich von Generation zu Generation fort. Erfahren Kleinkinder wenig Liebe und stattdessen Gewalt, so werden daraus aggressivere Erwachsene. Darüber hinaus bewirkt die Grobheit, die man als Kind selbst erfahren hat, dass man dies später als normal empfindet und tendenziell weniger zu Mitgefühl fähig ist. Die Verletzung der Integrität wirkt also doppelt: Man hat mehr Wut in sich, die nach Gelegenheiten zum Ausbruch sucht, und man neigt dazu, die gewalttätigen Umstände, unter denen man aufwuchs, für richtig zu halten. Jesper Juul fasst zusammen: „Physische Gewalt bedeutet für alle Menschen eine Verletzung ihrer Integrität, auch für Kinder. Das gilt, selbst wenn wir das etwas anders bezeichnen: ‚der letzte Ausweg’, ‚der verdiente Klaps hintendrauf’, ‚das Züchtigungsrecht’. Allein die Zahl der Euphemismen, die wir gebildet haben, um es nicht einfach Gewalt zu nennen, spricht dafür, dass wir gut wissen, dass etwas nicht stimmt.“221
Mein Aufwachsen in den Siebziger und Achtziger Jahren hat mir sehr deutlich gezeigt, wie Aggressivität von einer Generation zur nächsten übergeben wird: Sind Eltern durch Kriegserlebnisse oder aufgrund einer von Gewalterfahrungen geprägten Kindheit traumatisiert, so fehlt ihnen häufig Mitgefühl, und sie sind nicht in der Lage, ihren Kindern die nötige Geborgenheit zu geben. Viele Eltern konnten es nicht aushalten, dass es ihre Kinder im Leben leichter hatten und sorgloser, neugieriger, ohne Vorbelastung ins Leben gingen. Um sie auf den „Ernst des Lebens“ vorzubereiten, wurden viele präventiv von den Eltern unterworfen und gedemütigt, damit sie es „später leichter hätten“.222 Beispielsweise konnten es meine Eltern nicht ertragen, wenn ich als Kind ausgelassen oder übermütig spielte. Sie empfanden impulsive und laut geäußerte Lebensfreude als Störung der Ruhe und Ordnung und ermahnten und zwangen mich immer wieder dazu, leise zu sein oder stillzusitzen.
Juul weiter: „Die andere [Erklärung für das Streben vieler Eltern, die Kinder zu regulieren] ergibt sich daraus, wie wir Menschen, wenn wir in unseren Beziehungen zu anderen erleben, dass wir nicht so wertvoll sind, wie wir gern wären, unmittelbar reagieren: nämlich aggressiv. Wir sind gereizt, frustriert, wütend und gewalttätig.“223 Ganz allgemein greifen Eltern, deren Integrität durch Gewalt in ihrer eigenen Kindheit oder durch Kriegserfahrungen beschädigt wurde, auch ihren Kindern gegenüber schneller zu Gewalt und halten das eher für richtig als unbeeinträchtigte Eltern. Aggressivität ist durch „Erziehung“ vererbbar. Wie A. S. Neill feststellt, hat noch nie ein glücklicher Mensch Krieg gepredigt, an seinen Kindern herumgenörgelt, seine Angestellten terrorisiert oder einen Mord oder Diebstahl begangen. Wer Gewalt erlebt hat, neigt selbst zu Gewalt und toleriert sie eher.224
Die Verletzung der Integrität ist es, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, und dies bedingt sich wechselweise mit einem höheren Niveau von Aggressivität in der Gesellschaft. Dies mag einen Sinn haben, denn aus Sicht der Evolution ist es nützlich, in Notzeiten die Aggressivität hoch zu halten, um die Revierausnutzung zu verbessern und die Bereitschaft zu Veränderungen anzuheben. Es scheint dem Überleben einer Art zu dienen, ein einmal benötigtes, besonders hohes Aggressionsniveau über Jahrzehnte bzw. mehrere Generationen aufrechtzuerhalten. Dieser Gedanke mag spekulativ sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dieser Mechanismus nicht zufällig entstanden ist, sondern aus evolutionärer Sicht einen Zweck erfüllt. Selbst die Möglichkeit, dass er zufällig entstanden ist und lediglich nicht störend wirkt, ist unwahrscheinlich. Brächte dieses Wirkprinzip tatsächlich einen Nachteil für die Arterhaltung, würde es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zurückbilden.225 Daher nehme ich an, dass der langsame, über Generationen laufende Rückgang der Aggressivität einen Zweck erfüllt.
Ähnliche Mechanismen finden an vielen Stellen Anwendung: Stolpere ich auf einem Weg, gehe ich unwillkürlich mit erhöhter Aufmerksamkeit weiter, denn vielleicht bin ich von einem befestigten auf einen unbefestigten Weg gelangt. Trete ich in eine Pfütze, lohnt es sich weiter, auf Pfützen zu achten, denn vielleicht erwarten mich noch mehr davon. Nach diesen Prinzipien funktionieren auch adaptive Fahrwerke und andere Software in den Steuergeräten heutiger Fahrzeuge. Wir können zwar die Zukunft nicht vorhersagen. Tritt jedoch ein auffälliges Ereignis ein, hat es sich bewährt, zunächst davon auszugehen, dass es sich wiederholen kann. Ein solcher Generalisierungsmechanismus steuert offenbar auch die Aggressivität der Menschen, indem er dafür sorgt, dass ein einmal hohes Niveau nach dem Verschwinden der Bedrohung nicht sofort wieder abklingt.
Beispielsweise wird dieser Mechanismus in einem steinzeitlichen Umfeld dazu führen, dass Menschen bei Verschlechterungen ihrer Lebensbedingungen (z. B. durch klimatische Veränderungen) für einen langen Zeitraum aggressiver und aktiver werden und sich neue Lebensräume suchen. Dabei werden sie wahrscheinlich auch Nachbarn in gemäßigteren Regionen zurückdrängen, sodass es am Ende wieder im Sinne von Konrad Lorenz zu einer weitgehend gleichmäßigen Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Lebensraums kommt. Auf jeden Fall wird der Wettbewerb untereinander härter, und nur die Stärksten kommen durch. Vielleicht stellt die parallel zu den unwirtlicheren Umweltbedingungen ansteigende menschliche Aggressivität den Regelungsmechanismus dar, den auch die Füchse (das Beispiel von S. 28) nutzen, um ihre Population in schlechten Zeiten zu reduzieren, statt ihr Revier leerzufressen.
Möglicherweise gehört auch dazu, dass im Urzustand der Menschheit die Aggressivität nur langsam abklingen konnte, weil andernfalls die ältere, aggressivere Generation die jüngere, allzu friedliche verdrängt hätte. Die Aggressivität kann in der nächsten Generation offenbar nur so weit absinken, dass sie ausreicht, der älteren Generation Widerstand zu leisten.
Eltern mit den oben beschriebenen „Erziehungs“-Methoden waren in den Nachkriegsjahrzehnten der Normalfall. Die erste Generation, die sich dagegen wehrte, waren die Achtundsechziger, die den „Mief der Fünfziger Jahre“ beseitigen und ein anderes Leben führen wollten. Seitdem ist Gewalt in unserem Zusammenleben und speziell in unserer Kinder-„Erziehung“ kontinuierlich zurückgegangen. Da es in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg wenige neue Kriegstraumatisierungen gibt, „Erziehung“ immer weniger gewalttätig ist und Kinder mit jeder Generation tendenziell mehr Liebe und Geborgenheit und weniger Beeinträchtigungen erfahren, geht die Aggressivität bei uns zurück. Im Westen hat sicherlich auch das Wirtschaftswunder mit den beständig steigenden Konsummöglichkeiten zur Entspannung der Situation beigetragen.
Dennoch wird es noch Jahrzehnte dauern, bis wir einen allgemein offenen, friedlichen und toleranten Umgang miteinander haben und wir gelernt haben, auf Aggressivität und Abgrenzung zu verzichten. In vielen Bereichen der Berufswelt ist derzeit eine offene Begegnung von Menschen noch nicht möglich, und es überwiegen Hierarchie, Ängste und Grobheiten. Wie lange wird es dauern, bis die Folgen des Kriegsleids verdaut und verarbeitet sind?
Aggressivität ist ein Mittel zum Überleben, aber auch zur Entwicklung
Betrachtet man die Auswirkungen von Aggressivität und Friedfertigkeit bei zwei benachbarten steinzeitlichen menschlichen Clans, so stellt man fest, dass Aggressivität automatisch zu Expansion, Entdeckungen, Erfindungen und Weiterentwicklung führt. Der aggressivere Clan wird den friedfertigeren zurückdrängen und sich so Lebensraum aneignen. Einerseits fördert die Rastlosigkeit, die untrennbar zur Aggressivität gehört, neue Handlungsweisen, andererseits birgt sie aber auch die Gefahr des Scheiterns. Für die Arterhaltung ist sie daher nur in Krisensituationen angebracht.
Friedfertigkeit ist von der Evolution gewünscht, solange die Lebensbedingungen für die Mehrheit ausreichend gut sind. Wird der Lebensraum knapp, so setzen sich im Sinne der Arterhaltung die Aggressiveren durch. Darüber hinaus scheint Aggressivität ganz allgemein der Motor zu sein, der angeworfen wird, wenn Veränderung benötigt wird – nicht nur, um den verfügbaren Platz optimal auszunutzen, sondern auch, um weitere Veränderungen anzustoßen. Aggressivität ist stärker mit Innovation verbunden als Friedfertigkeit. Wohlstand und Friedfertigkeit führen zu Zufriedenheit und machen träge. Unzufriedenheit und Leidensdruck machen aggressiv und drängen zur Tat. Man kann zwar auch aus Neugier kreativ und innovativ werden, aber Unzufriedenheit ist der stärkere, weil kontinuierlichere Antrieb. Wut hat den Sinn, Kräfte zu mobilisieren. Wenn ich wütend bin, bin ich entschlossener, geradliniger, verfolge mein Ziel ernsthafter und lasse mich weniger leicht vom Weg abbringen.
In bestimmten Situationen stellt die Evolution offenbar den Nutzen der Aggressivität zur Arterhaltung über die negativen Folgen für Einzelne. In unserer Gesellschaft wie auch in archaischen Umgebungen führt aggressive Konkurrenz zu Lösungen, die sonst nicht gefunden würden. Dieser recht grobe Mechanismus der Lösungsfindung lässt Schwächere auf der Strecke und geht zu Lasten der eigenen Gesundheit und Lebensqualität.
Aggressivität und Friedfertigkeit – Schimpansen und Bonobos
Nördlich des Kongo-Flusses leben Schimpansen, südlich davon leben Zwergschimpansen, sogenannte Bonobos. Beide können den Fluss nicht überwinden. Sie waren früher eine Art und haben sich erst nach der Abspaltung vom Menschen auseinander entwickelt. Schimpansen sind aggressiver, reizbarer und gewalttätiger, Bonobos sind friedfertiger. Wissenschaftler sehen die Ursache hierfür in unterschiedlichen Lebensbedingungen. Die Heimat der Bonobos südlich des Kongoflusses bietet mehr Nahrung.
Bonobos haben kein Patriarchat entwickelt. Sie sind geselliger, Männchen knüpfen im Gegensatz zu Schimpansen engere Beziehungen zu ihren Weibchen.226 „Der Urwald im Süden des Kongobeckens ist reichhaltiger, sodass die Bonobos nicht um jeden Bissen kämpfen müssen. Sie leben in größeren, stabilen Gemeinschaften, was die Bildung von Frauengruppen begünstige. ‚Weniger aggressive Männchen könnten gegenüber aggressiven Artgenossen einen Vorteil gehabt haben’, sagt Hare [Brian Hare ist Professor für evolutionäre Anthropologie an der Duke University in North Carolina], zum Beispiel indem sie Beziehungen zu hochrangigen Müttern pflegten und dadurch Zugang zu den Weibchen bekamen.’“227 Bonobos sind freigiebiger und teilen ihr Futter oft mit anderen, völlig fremden Tieren.
Am auffälligsten finde ich, dass Bonobos ihre Sexualität – Geschlechtsverkehr und Selbstbefriedigung – nicht ausschließlich zur Vermehrung nutzen, sondern auch zur Verbesserung der persönlichen und allgemeinen Stimmung. Bei den Menschen scheint es ähnlich zu sein. Eine große Zahl onaniert mehr oder weniger regelmäßig, und viele tun dies auch in einer festen Beziehung. Vermehrung kann also nicht der einzige Zweck unseres Sexualtriebes sein. In dem Wort „Befriedigung“ steckt „Frieden“ – wenn ich bekommen kann, was ich mir wünsche, bin ich friedlicher, wenn nicht, bin ich aggressiver. Sexualität ist auch bei Menschen ein Mittel zur Beruhigung, zum Aggressionsabbau und zur Festigung des sozialen Friedens.
Weder vor dem Sex noch danach neigen Menschen zu Aggression und Konkurrenzverhalten. Den meisten Menschen ist das nicht bewusst, weil sie ihn nicht in Anwesenheit Dritter praktizieren. Wer erlebt, wenn eine Frau mit mehreren Männern Sex haben will, kann beobachten, dass Aggressionen dann sehr kontraproduktiv sind. Ganz intuitiv sind dann alle Männer um diese Frau bemüht. Es ist kein Platz für Rangkämpfe. Dasselbe Verhalten wurde bei Bonobos beobachtet: Im Angesicht eines paarungsbereiten Weibchens gleichen sich die Testosteronspiegel der Männchen aneinander an.228
Das Potential der Sexualität, das die Bonobos zur Stabilisierung ihrer Gesellschaft nutzen, bleibt bei uns Menschen spätestens seit dem „Sündenfall“, der Entwicklung der Selbsterkenntnis, weitgehend ungenutzt. „Und sie erkannten, dass sie nackt waren.“ Seit wir uns unseres Handelns bewusst geworden sind, können wir Nacktheit und Sexualität nicht mehr unbefangen betrachten, und deshalb wurde beides mit einer Menge Regeln und Tabus belegt. Egal, ob man das gut oder schlecht findet: Es ist davon auszugehen, dass unser Sexualver halten zuvor stärker dem der Bonobos geähnelt hat als heute. Das heißt, dass wir seitdem eine weitere Möglichkeit zum Abbau von Aggressionen verloren haben.
Die sexuelle Revolution der Sechziger und Siebziger Jahre hat zwar einige Freiheiten erkämpft – man muss heute nicht heiraten, um Sex haben zu können, und Frauen wird mehr Initiative und Autonomie zugestanden. Aber solange man mit nackten Frauenkörpern Werbung machen kann, haben wir noch keinen entspannten Umgang mit dem Thema. Könnte jede und jeder Einzelne wirklich ihre oder seine Art von Sexualität ausleben, so würde dies auch unserer Gesellschaft nützen, so wie es die Gemeinschaft der Bonobos befriedet.
Der Unterschied zwischen Bonobos und Schimpansen legt nahe, dass erschwerte Lebensbedingungen, Aggressivität und Patriarchat zusammenhängen. Ist das Leben einfach, so kann es auch friedlich sein, und es entwickelt sich nicht zwangsläufig eine männlich dominierte Führungsstruktur. Wir Menschen haben Eigenschaften von Bonobos und Schimpansen. Wir haben einen relativ hohen Aggressionspegel, wir kennen aber auch den Zusammenhalt der Bonobos, wir leben Konkurrenz genauso wie Kooperation.
Sehr interessant finde ich, dass wir uns seit dem Zweiten Weltkrieg von der Aggressivität und dem patriarchalen System der Schimpansen mit seiner Sexualität, die auf Dominanz und auch Vergewaltigung basiert, hin zu dem System der Bonobos entwickeln, denn Frauen bestimmen zunehmend die Partnerwahl. Nicht mehr Aggressivität qualifiziert den Betreffenden für einen hohen Platz in der Gesellschaft, sondern eher die Fähigkeit zu Kommunikation und Kooperation. Vor hundert Jahren war es noch fast ausschließlich der Mann, der die Frau erwählte. Nach meiner Erfahrung entscheidet sich heute eher die Frau für den Mann, der durch sein Bemühen sein Interesse an ihr zeigt.
Die Existenz eines Matriarchats wurde bei Menschen bisher nicht nachgewiesen. Was es aber gab und gibt, sind matrifokale und matrilineare Strukturen.229 Hier definierte die weibliche Linie die Verwandtschaftsbeziehungen und die Erbfolge, und der Ehemann zog in das Haus seiner Frau. Das erinnert an die Lebensweise der Bonobos.
Der Führungsstil in vielen Unternehmen hat sich deutlich gewandelt. Früher waren Chefs dominant und autoritär, heute werden von ihnen vor allem Überzeugungskraft und Talent bei der Moderation erwartet. Ich beobachte auch, dass der gesellschaftliche Konsens, wie das Leben zu gestalten und zu strukturieren sei, sich weg von gewaltbasierten Hierarchien hin zu Kommunikation und Kooperation entwickelt. Chefentscheidungen, Durchsetzung des Stärkeren, „Konfliktlösung“ durch körperliche, geistige, finanzielle oder sonstige Machtausübung haben in der Familie, auf Schulhöfen, im Berufsleben und der Geschäftswelt seit dem Zweiten Weltkrieg an gesellschaftlicher Akzeptanz verloren – auch wenn all das in einzelnen Bereichen oder Gruppen immer noch vorkommt.
Der Aggressivere setzt sich durch
Träfen Bonobos und Schimpansen aufeinander, so würden höchstwahrscheinlich die Schimpansen nach kurzer Zeit das gesamte Territorium beherrschen, so wie wir während der Kolonialzeit so ziemliche alle Eingeborenenstämme unterworfen haben – durch unsere technologische Überlegenheit, unsere höhere Aggressivität und unseren Expansionsdrang. Um sich gegen Eindringlinge zur Wehr zu setzen, reicht technologische Ebenbürtigkeit allein nicht aus. Ein friedfertiger Stamm muss, wenn er angegriffen wird, in der Lage sein, „das Kriegsbeil auszugraben“. Toleranz kann man nur gegenüber Toleranten leben, Toleranz gegenüber Intoleranten führt in den Untergang. Ebenso kann eine Welt ohne Hierarchie nur von Nichthierarchiegläubigen gelebt werden. Ein gieriger Mensch kann eine Gruppe altruistischer Menschen ausbeuten, wenn diese sich nicht gegen ihn wehren. Ein Wütender bringt Wut in eine Gruppe Friedlicher, und ein Gewalttäter kann die Gewaltfreiheit anderer untergraben. Karl Popper schrieb: „Wenn wir der Intoleranz den Rechtsanspruch zugestehen, toleriert zu werden, dann zerstören wir die Toleranz und den Rechtsstaat.“230
„Toleranz mit abweichenden Meinungen ist auch nur dann möglich, wenn diese nicht zu extremistisch und menschenverachtend sind. Die Toleranz konnte sich in den Demokratien nur ausbilden, weil die extremistischen Positionen weitgehend verschwunden sind. […] Toleranz und Demokratie setzen also eine Zivilisierung der Gesinnungen in doppelter Hinsicht voraus: Menschen müssen auf antihumane Extremismen und Handlungsweisen verzichten, damit Toleranz überhaupt möglich ist; ferner müssen sie wirklich toleranter werden, um andere Positionen zu ertragen. Man kann ja nicht Toleranz mit Menschengruppen praktizieren, die Andersgläubige massakrieren wollen, eine Diktatur errichten wollen oder Sklaverei praktizieren wollen. Toleranz ist also nur mit toleranten Menschen möglich. Man zerstört die Grundlagen einer toleranten Gesellschaft, wenn man mit intoleranten Menschengruppen tolerant umgeht. Toleranz setzt daher voraus, dass man Menschen vertrauen kann.“231
Mahatma Gandhi, der Dalai-Lama und andere traten und treten für völlige Gewaltfreiheit ein. Kann man durch eine solche Haltung, durch reine Friedfertigkeit bestehen, ohne Gewalt anzuwenden? Ich denke, das ist nur möglich, solange beim Gegenüber ein Mindestmaß an Erkenntnis, Mitgefühl und Toleranz vorhanden ist.232 Ist das Gegenüber von Vernichtungswillen getrieben und Argumenten nicht zugänglich, bleiben als Alternativen nur Gegenwehr oder Abwanderung übrig. Wer sich einem Angriff nicht durch Abwanderung entziehen kann, muss für sein Überleben in der Lage sein, auf dem Niveau der Angreifer zu antworten. Das gilt auch für eine Gesellschaft, die sich kulturelle Entwicklung und Friedfertigkeit als Ziele gesetzt hat. Leider scheint es ein Prinzip des Lebens zu sein, dass die Aggressiveren den anderen das Spiel diktieren können. Das lernen wir gerade durch die in Syrien und im Irak agierende Terrororganisation Islamischer Staat.