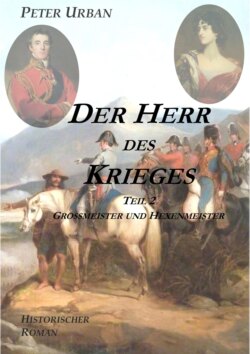Читать книгу Der Herr des Krieges Teil 2 - Peter Urban - Страница 4
Kapitel 2 Winter in den Bergen
ОглавлениеIn der Nacht vom 26. auf den 27. September 1811 ergab sich ein kurioses Mißverständnis zwischen den beiden Kontrahenten Marmont und Wellington. Der Marschall von Frankreich war felsenfest davon überzeugt, bei Fuenteguinaldo Sir Arthurs Hauptarmee vor sich zu haben und noch dazu einen angriffslustigen alliierten Oberkommandierenden. Unterdessen konnte der irische General sich einfach nicht vorstellen, daß der Chef der Adler naiv genug war, seine kleine Scharade nicht zu durchschauen. Er erwartete einen Angriff im Morgengrauen. Jeder hatte solche Angst vor dem anderen, daß Marmot in Richtung Ciudad Rodrigo weglief und Wellington, so schnell er konnte auf eine neue Stellung hinter dem Coa zueilte – Aldea de Ponte. Am nächsten Morgen mußten dann sowohl der Herzog von Ragusa als auch der Sepoy-General konstatieren, daß sie keinen Gegner mehr hatten.
Arthur war in einer teuflischen Laune. Da hatte er nun eine Stellung, die genau so gut war wie Bussaco, aber um die Hälfte kürzer. Er konnte seine ganzen 45.000 Mann an die Front führen, die alliierte Armee war vollständig konzentriert und Marmont versetzte ihn einfach. Knurrig, wenn auch nicht böse, saß er an einem provisorischen Frühstückstisch in einem kleinen Bauernhaus im Dorf Aldea und hielt sich an einer großen Kaffeetasse fest. Sir Thomas Graham, Sir Thomas Picton und Sir Robert Craufurd akzeptierten die Lage mit größerer Gemütsruhe als ihr irischer Vorgesetzter:
Picton, dessen Aktion bei El Bodon so spektakulär und erfolgreich verlaufen war, unterhielt seine Kollegen mit der Anekdote über die Verkleidungskomödie bei Fuenteguinaldo. Lebhaft schilderte er die Szene. Black Bob warf ihm strafende Blicke zu. Die Tatsache, daß Picton sich plötzlich mit Kavallerie an der rechten Flanke vorfand, gründete auf seiner fast unverzeihlichen Verspätung. Graham versuchte den Schotten zu provozieren: „Sollte die Leichte Division verweichlicht sein! Ihr macht keine Nachtmärsche mehr und braucht für zehn Meilen fast 20 Stunden. Das schafft mein Vater ja auch noch, und der ist 92 Jahre alt ...”
„Ich befürchte, die langen Monate, die ihr in Fuentes de Onoro und Fort Concepçion verbracht habt, haben euch beeinflußt! Wie sagen die Spanier so schön: ‚Manaña‘ – Morgen ist auch noch Zeit!’“ Wellington brauchte ein Opfer für seine Laune. Craufurd zu ärgern, ersetzte zwar nicht eine saubere Schlacht mit Marmont und seinen Adlern, aber mangels anderer Gegner mußte eben der Kommandeur der Leichten Division herhalten.
„Warum bist du plötzlich so angriffslustig, Arthur?” Black Bob nahm die Frotzelei seines Freundes mit Humor. Wellington hatte zwar vor Fuenteguinaldo eine Heidenangst und eine ungedeckte, rechte Flanke gehabt, aber er hatte schließlich doch akzeptiert, daß der Schotte auf einem Nachtmarsch durch die Berge seinen ganzen Troß und Proviant verloren hätte. Ein solcher Zwischenfall in einer unwirtlichen Gegend, wie der Beira war fatal. Er hatte eingesehen, daß Craufurd nicht ungehorsam oder faul gehandelt hatte, sondern nur übervorsichtig.
„Bob, der Mann ist unhöflich! Ich habe eine wunderbare Position hier! Wir haben mit Herrn Marmont ein Treffen vereinbart und er kommt nicht zum Rendezvous! Wo kämen wir denn hin, wenn sich keiner mehr an die Spielregeln hält? Heute steht Krieg mit Bonny auf dem Arbeitsplan ... Zuerst sitzt sein sogenannter Schwertarm drei Stunden vor meiner Nase, trinkt Rotwein literweise und schlägt sich den Wanst voll und dann verschläft er meinen Rückzug auf Aldea de Ponte und verfolgt uns nicht. Es ist sträflich, sich als erwachsener Marschall von Frankreich so aufzuführen ... Bonny ist kein Gentleman!” Wellington hatte ordentlich gefrühstückt, ausreichend Kaffee bekommen und sogar drei Stunden geschlafen. Dieser Luxus wirkte sich positiv auf ihn aus. Und er wußte, daß er seinen noblen Gegner mühelos und ohne große Verluste in die Schranken gewiesen hätte, wenn er aufgetaucht wäre. Eigentlich war er ja sogar ein bißchen stolz auf sich: Nach vier Jahren und sieben Waffengängen mit den Adlern, genügten die bloße Erwähnung seines Namens und ein paar Rotröcke auf einem Hügel, um den Feind einzuschüchtern. Napoleon Bonapartes Anwesenheit auf einem Schlachtfeld ersetzte 40.000 Mann. Seine scheinbar auch! Er stand energisch vom Tisch auf, griff nach Schwert und Feldjacke und verschwand durch die Tür. Picton rief ihm noch nach: „Was machen wir jetzt?” Der Ire blieb in der Tür stehen: „Zwei Tage abwarten, und wenn sich dann immer noch nichts tut, bis zum nächsten Frühjahr ins Winterlager ziehen, uns ausruhen und darüber nachdenken, wie wir die Adler ärgern könnten. Ich will den arroganten Herren aus Paris endlich Ciudad Rodrigo wegnehmen!”
Bis zum 2. Oktober blieben die Alliierten in ihren Stellungen bei Aldea de Ponte. Als sie sicher wußten, daß der Herzog von Ragusa aufgegeben hatte, schickte der Oberkommandierende alle Männer in ein langes, geruhsames Winterlager. Er war in allerbester Stimmung. Hill hatte ihm eine Depesche aus Elvas geschickt, aus der hervorging, daß Soult keinen Versuch unternahm, gegen die portugiesische Grenze zu ziehen. Burgersh, der sich, als spanischer Händler verkleidet, in Sevilla herumtrieb, erzählte, daß der Marschall, nachdem er die Stadt von der latenten Bedrohung durch den spanischen General Blake und dessen Armee befreit hatte, ein friedliches Leben führte. Meist vergnügte er sich hoch zu Roß in der Donaña, dem ehemaligen Jagdrevier der Herzöge von Medina Sidonia, in dem es vor Wild, Wasservögeln und Luchsen nur so wimmelte. Er residierte, wie ein König, in den prächtigen Reales Alcazares, die im Jahre 1364 für Pedro I. im maurischen Stil erbaut worden war. Seine Abende waren ausgefüllt mit Theater- und Opernbesuchen, bombastischen Ess- und Trinkgelagen und anderen Lustbarkeiten. Burgersh hatte seine Sache besonders gut machen wollen. Ausführlich schilderte er in einem Bericht alle Gewohnheiten von Lord Wellingtons berühmtestem Gegner.
In seinem eigenen spartanischen Hauptquartier in Freneida, einem winzigen Nest, drei Meilen westlich von Fuentes de Onoro und Villa Fermosa, saßen der alliierte Oberkommandierende, sein Chefspion Dr. Jack Robertson und Lady Lennox mit großen Augen und hängenden Kinnladen über dem fünfzehnseitigen Papier, das ein Guerillero, versteckt in einem Hirtenstab, zu ihnen geschmuggelt hatte: „Fritura de Pescado, Habas a la Rondena, Ternera con Alcachofas, Serrano-Schinken und hinterher Tocino de Cielo! Ich finde Burgersh übertreibt! Muß er den unbedingt die Speisekarte dieses verdammten Adlers herunterbeten, wie das Vaterunser? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen!” Der dicke Benediktiner sah vom Bericht seines diensteifrigen Spions kurz auf. Sein verzweifelter Blick schweifte über einen halbleeren Teller mit ein paar verlorenen Stückchen geräucherter Wurst und einer einsamen Kruste Schwarzbrot. Die Beira war ein karges, armes Land und die Diät, der man ihn gerade unterzog, erinnerte ihn irgendwie an die barbarischen Foltermethoden der Heiligen Inquisition. Lady Lennox, die eine Schwäche für Süßigkeiten und Kuchen hatte, schien ebensoneidisch auf das leichte Leben von Soult und Burgersh in der ehemaligen, spanischen Königsstadt. Leise und verträumt murmelte sie „Tocino de cielo” vor sich hin. Ihr Blick war in die unendlichen Weiten des ehemaligen Schweinestalls gerichtet, der Lord Wellington nun als großes Besprechungszimmer diente. Trotz der sorgfältigen Säuberung durch Sergeant Dunn und die Waschfrauen des 33. Regiments, hing der fatale Geruch immer noch in allen Ritzen und Winkeln. Nur der Ire schien alles mit stoischer Gelassenheit hinzunehmen. Zufrieden schnappte er sich die letzte Kruste Schwarzbrot und eine Scheibe Wurst. Soult amüsierte sich. Damit war der Marschall ungefährlich und er konnte einen langen, geruhsamen Winter in den Bergen verbringen, seine müden Knochen ausruhen, die Füße unter einen gedeckten Tisch strecken, sich jeden Tag ausschlafen und im Warmen sitzen, wenn es draußen kalt und unfreundlich wurde. Als echter Soldat, der mehr Nächte im Feld verbracht hatte als in festen Behausungen, wußte er den kleinsten Luxus schätzen: „Ich verstehe euch nicht! Mir gefällt Burgershs Bericht ausgesprochen gut! So lange mein Freund Soult damit beschäftigt ist, die Speisekarte in Sevilla auszuprobieren und die Weinkeller der Stadt leerzutrinken, läßt er uns doch in Ruhe. Ist es nicht wunderbar, jeden morgen aufzustehen und zu wissen, daß kein Adler vor der Tür steht und mit dem Säbel rasselt?” Er ließ die Uhr aufschnappen. Es war kurz vor zwei Uhr am Nachmittag:
„So, ihr beiden! Ich habe einen wichtigen Termin mit dem jungen Master Seward! Wenn jemand mitkommen möchte, um in den Bergen auszureiten ...”
„Geh ohne mich los, Arthur! Ich will versuchen, auf dem Markt irgend etwas Vernünftiges für das Abendessen aufzutreiben. John wartet schon auf mich!” Lady Lennox war von der Idee nach Süßigkeiten besessen, seit sie Burgershs Bericht hatte ertragen müssen. Sie wollte Sergeant Dunn überreden, einen großen Apfelkuchen zu backen. Zumindest Äpfel gab es in diesem verlorenen Nest reichlich. Eigentlich war Freneida ja gar nicht so übel: In etwas mehr als 30 kleinen Steinhäusern wohnten schrecklich nette Bauersleute. Die drei größeren Gebäude hatte der britische Stab mit sanftem Druck und einer fairen Summe Geld für die ausquartierten Besitzer requiriert. Eine kleine Kirche, ein Kaffee, eine Bodega und einen Marktplatz, auf dem immer etwas los war, rundeten das Bild des Provinzfleckens ab. Alles ähnelte dem Nest, aus dem ihre Mutter stammte, hoch oben in den Bergen Schottlands.
Jack Robertson rieb sich das Rückgrat. Der Sommerfeldzug und die langen Stunden im Sattel hatten ihn doch ein wenig angestrengt. Er beschloß, das Angebot von Lord Wellington dankend abzulehnen und lieber einen besinnlichen Nachmittag mit seinem spanischen Kollegen im Pfarrhaus von Freneida zu verbringen und dabei einen Schoppen Landwein zu leeren.
Arthur sattelte Kopenhagen und Sarahs alte, dunkelbraune Stute. Seit die junge Frau Libertad ritt, benutzte sie das brave Tier nur noch als Packpferd. Es war sanft genug, um Rob Sewards kleinem Sohn einen ungefährlichen Ausritt in den Bergen zu ermöglichen. Der Ire liebte Kinder und Marys nun vierjähriger Junge war ihm seit Talavera sehr ans Herz gewachsen. Er ritt bis zu dem Bauernhaus, in dem die Familie seines Leutnants einquartiert worden war. Miss Seward saß vor der Tür, nähte an einem Kleidungsstück und schwatzte angeregt mit der Bäuerin, die ihre Gastgeberin war. Sie hatte offensichtlich ein gutes Ohr. Ihr Spanisch klang sehr korrekt. Arthur stieg vom Pferd und verbeugte sich leicht vor den beiden Frauen: „Mary, vertraust du mir deinen kleinen Jungen für den Nachmittag an?”
„Mit Freuden, Mylord! Seit dem Frühstück macht er mich schon damit verrückt, daß er ganz alleine mit Ihnen ausreiten darf!” Sie rief ins Haus hinein und der Vierjährige kam wie ein Wirbelwind durch die Tür geschossen. Er ignorierte seine Mutter völlig und stob zu Wellington, der ihn auffing und in die Arme nahm. Ein kleines Mädchen mit langen, schwarzen Zöpfen rannte ihm hinterher. „Ich hab schon schrecklich auf dich gewartet, Arthur!”, keuchte der kleine Junge aufgeregt. Seine Mutter warf ihm einen strafenden Blick zu. Ihr Sohn duzte den Oberkommandierenden der alliierten Armee und einen Pair von England. Und dem schien das gar nichts auszumachen. Als sie noch ein Kind in Grennock gewesen war, hatten sie sich vor dem Laird tief zu verbeugen gehabt und durften ihn nicht einmal ansprechen. Paddy zeigte auf das kleine, spanische Mädchen hinunter: „Sie ist meine Freundin! Darf sie auch mit?” Die Bäuerin wollte ihr Kind an der Hand zurückziehen. Doch Lord Wellington schüttelte den Kopf und lächelte ihr zu: „Esta bien, Señora? Die Kleinen sind ein Geschenk des Himmels! Wir dürfen ihnen ihre Wünsche nicht verweigern!” Zuerst setze er Paddy in den Sattel von Sarahs Stute, dann hob er das kleine Mädchen hinauf: „Wie heißt Du?” Die Kleine war schüchtern. Paddy mußte für sie antworten: „Sie heißt Manuela und ist schon fünf Jahre alt!”
Lord Wellington verbeugte sich spielerisch: „Encantado de conocerle, Señorita! Du mußt dich nur gut an Paddy festhalten und brauchst keine Angst zu haben. Es ist ein ganz braves Pferd!”
„Ich hab überhaupt keine Angst!”, kam eine stolze, spanische Antwort zurück. Der Ire legte Paddy die Zügel in die Händchen und zog einen Strick durch den Trensenring am Reithalfter der alten Stute. Sein kleiner schottischer Freund wollte es unbedingt den Großen nachtun und alleine reiten. Zufrieden trotteten die Drei vom Hof.
Am späten Nachmittag lieferte Arthur zwei müde, aber zufriedene Sprößlinge bei ihren Eltern ab. Sie hatten einen ruhigen Ausritt durch die Berge gemacht und angenehm miteinander geplaudert. Nach den nervenaufreibenden Monaten im Felde gab es nichts besseres, als die unschuldigen Geschichten von Kindern anzuhören, um ein angeschlagenes Nervenkostüm wieder in Ordnung zu bringen. Wellington ließ sich noch auf ein Glas Wein mit den Sewards und der spanischen Bauernfamilie einladen. Rob hatte seinem Gastgeber auf dem Acker geholfen. Im Herzen war er immer noch Bauer, so wie sein Vater, sein Großvater und zig Generationen Sewards es gewesen waren. Erst als die Dunkelheit sich über das winzige Dorf senkte, machte der General sich zurück auf den Weg in sein eigenes Quartier. Paddy umarmte ihn zum Abschied: „Und wann läßt du mich auf Kopenhagen reiten?”
„Wenn du genausolange Beine hast, wie dein Papa!” Lord Wellington zwinkerte dem Kleinen zu und verschwand in der Nacht.
Anfang November erreichten aufregende Neuigkeiten das kleine Dorf in der Beira. Rowland Hill hatte bei Arroya dos Molinos den französischen General Girard vernichtend geschlagen. Der Adler hatte es gewagt, sich dem Sicherheitsperimeter von Elvas zu nähern. Hill hatte Aufklärer in der Estremadura. Sie berichteten, daß der Franzosen ohne Unterstützung gekommen war. Die Gelegenheit war günstig gewesen. Der Kommandeur der Alliierten Südarmee hatte sie genutzt. Girards Streitmacht war fast vollständig aufgerieben. Nur 600 Adlern gelang die Flucht. Die Alliierten machten 1300 Gefangene, unter ihnen General Bron, der Kommandeur der Kavallerie, den Prinzen von Aremberg, Chef des Stabes des Fünften Korps und 30 weitere hohe Offiziere. Außerdem verloren die Adler drei Geschütze und eine Kriegskasse mit 5000 goldenen Dollares, die Hill als Preisgelder unter seinen Leoparden aufteilte. Der gesamte Troß der unglücklichen Franzosen fiel den Briten und Spaniern in die Hände. Seine eigenen Verluste, die er an den Oberkommandierenden in der Beira melden mußte, waren verschwindend gering: Sieben tote Soldaten, sieben verwundete Offiziere und 75 verwundete Mannschaftsdienstgrade. Die spanischen Verbündeten, mit denen er gemeinsam gefochten hatte, beklagten 30 Verletzte. Der General aus Shropeshire hatte kurzfristig sogar in Erwägung gezogen, einen Vorstoß bis an den Guadiana zu wagen, denn nach der Abreibung, die die Adler bei Arroyo dos Molinos erhalten hatten, wäre der Graf d’Erlon mit den Überresten seines Korps sicher einfach vor ihm weggelaufen. Doch Sir Rowland besann sich: Er würde seinen Gegner zwangsläufig bis in die Sierra Morena treiben und damit riskieren, daß Marschall Soult seinem Untergebenen zur Hilfe eilte – und zwar mit allen Truppen, die er in Andalusien stehen hatte. Dann wäre die französische Südarmee konzentriert und gefährlich! Er selbst hatte 12.000 Leoparden unter Waffen. Soults 60.000 Adler schienen doch ein bißchen übermächtig. Lord Wellington las die Siegesmeldung des wackeren Sir Rowland zum zweiten Mal. Sie amüsierte ihn. Hill war ein wirklich umsichtiger Untergebener. Er verstand augenblicklich, daß 60.000 Franzosen ein ziemlich großer Wurm am Angelhaken waren. Der Kurier der Alliierten Südarmee stand unruhig neben ihm. Sein Kommandeur hatte ihn angewiesen, so schnell wie möglich mit einer Antwort nach Elvas zurückzureiten.
Der Ire holte Papier und Feder: „Nichts hätte mich mehr zufrieden stellen können als genau das, was du getan hast! Ich freue mich sehr, deinen Bruder, Hauptmann Hill, mit der Depesche über deinen Sieg bei Arroyo dos Molinos und deinen Folgehandlungen nach London schicken zu dürfen! Ich gratuliere dem tapferen Kommandeur meiner Südarmee zu seiner weisen Entscheidung, sich noch nicht gegen Marschall Soult zu schlagen, sondern bis zum Frühjahr zu warten, damit wir anderen auch noch ein bißchen Spaß mit den Adlern haben können!” Dann wandte er sich dem Offizier an seiner Seite zu: „Hauptmann Hill, Sie werden sich jetzt ausruhen und morgen nach Oporto reiten und von dort aus nach London segeln! Das Schreiben an Ihren Bruder überbringt einer meiner Kuriere!” Der junge Mann strahlte übers ganze Gesicht. Er salutierte und schlug die Haken zusammen: „Wie Sie befehlen, Mylord!”
„Schlitzohr”, dachte Lord Wellington, „du weißt ganz genau, daß die Überbringer solcher Depeschen zu Hause vor Freude gleich mitbefördert werden. Und garantiert wartet ein niedliches Vögelchen in London auf dich, mit dem es angenehmer ist, Weihnachten zu verbringen als mit dem Haufen alter Schlachtrosse in Elvas!” Zynisch fragte er den jungen Hill: „Na, wie heißt sie denn?”
Der Hauptmann wurde feuerrot im Gesicht. Dem Alten entging einfach nichts. „Alexandra, Sir!”, stammelte er verlegen.
„Reichen sechs Wochen, um eine ehrenwerte Dame aus der kleinen Lady zu machen?”
Der junge Hill wurde noch röter: „Danke, Sir!” Er stürzte aus dem Zimmer. Lord Wellington war nicht dafür bekannt, daß er mit Urlaubsscheinen um sich warf. Der Hauptmann rannte, als ob der Leibhaftige hinter ihm her wäre. Wenn Nosey es sich anders überlegte, dann würde Lady Alexandra Campbell of Glenure möglicherweise noch Jahre auf ihren Trauring warten und vielleicht sogar an Liebeskummer sterben. Die letzten Briefe, die der junge Offizier aus London erhalten hatte, waren besorgniserregend. Alexandra schrieb, daß sie vor Liebe zu ihm vergehe, nicht mehr esse, nicht mehr schlafe und nicht mehr in die Oper gehe. Die Situation war kritisch. Seine Ehre, als Offizier gebot ihm, die junge Frau augenblicklich zu retten und vor den Traualtar zu führen.
Während der glückliche Hauptmann in der kleinen Bodega am Marktplatz von Freneida ein paar ungläubigen Stabsoffizieren detailliert schilderte, wie er Lady Campbell of Glenure vor dem sicheren Tod zu bewahren gedachte, beschloß Lord Wellington, daß er sich für den heutigen Tag genug um das Schicksal der Nationen gekümmert hatte. Es war kurz vor drei am Nachmittag, das Wetter war schön und ein Spaziergang durch das Dorf und die umliegenden Apfelgärten bot sich an. Er nahm seinen Soldatenmantel vom Haken und verließ das Hauptquartier. Er war froh, daß seine unnützen Adjutanten ihn ein wenig zufriedenließen und sich um ihre eigenen Familien kümmerten: Don Antonio war mit Donna Ines in der Quinta dos Lagrimas, Colin Campbell mit seiner Frau in Oporto und Fitzroy Somerset bemüht, um die Gunst einer jungen Portugiesin, irgendwo in der Gegend von Coimbra zu werben. Er hatte sie im Vorjahr kennengelernt und sich unsterblich verliebt. Arthur war skeptisch: Die Kleine hatte vier eifersüchtige Brüder und einen grimmigen Vater, außerdem noch mindestens 30 Cousins, die ebenfalls um ihre Ehre besorgt waren. Vor der Tür sah er sich kurz um und blinzelte zufrieden in die Herbstsonne. Ein Mädchen, vielleicht fünf Jahre alt, kam auf ihn zu. Sie trug ein weißes Kleidchen und hatte lange, schwarze Zöpfe, die ordentlich von roten Bändern zusammengehalten wurden. Bestimmt packte sie Wellingtons Hand. Es war Manuela, die Tochter von Leutnant Sewards Gastgebern: „Donde esta Paddy, Querida?”, fragte der General interessiert. Normalerweise trieben die beiden sich immer zusammen herum.
„Der war nicht brav und muß heute zu Hause bleiben!”
Wellington folgte Manuela wohlerzogen in Richtung Marktplatz. Es war Mittwoch und der fliegende Händler aus Lissabon hatte seinen Stand aufgeschlagen. Den kleinen Strolchen war es nicht schwergefallen herauszufinden, daß er sich leichter überreden ließ, an diesem verhängnisvollen Wochentag an diesen verhängnisvollen Ort zu gehen als ihre beiden Mütter. Der fliegende Händler brachte immer Karamellbonbons mit. Paddy und Manuela hatten eine gemeinsame Schwäche für dieses seltene Gut. Der General verstand, wie hart der Hausarrest den kleinen Seward getroffen haben mußte. Er beschloß, Miss Marys strenge Erziehungsmethode zu umgehen. Vor der Auslage des Händlers hob er das kleine Mädchen hoch, damit sie ihre Lieblingsbonbons auswählen konnte. Der alte Mann lächelte dem irischen Offizier freundlich zu. Er kannte die Szene. Manuela entschloß sich für Butterkaramellen. Der Händler erkundigte sich nach dem jungen Seward. „Hausarrest!”, war Lord Wellingtons lakonische Antwort, „Hat wohl irgendwas ausgefressen, der rothaarige Teufelsbraten! Aber wir nehmen ihm seine Wochenration mit!” Manuela empfing zufrieden ihre Tüte Butterkaramellen. Dann folgte eine längere, ernste Verhandlung mit Paddys spanischer Freundin. Es war notwendig, sicherzustellen, daß die zweite Tüte auch wirklich beim unglücklichen jungen Seward landete und nicht in Manuelas übergroßem Kindermagen. Unschuldig sah sie Wellington an: „Du glaubst doch nicht etwa, daß ich ...!”
„Oh doch, kleine Lady! Also, versprich’s! Die eine Tüte gibst du Paddy!” Mißtrauisch-amüsiert steckte er ihr die Bonbons in die Tasche des Kleidchens. Manuela überlegte angestrengt, ob sie ihr Ehrenwort geben sollte. Sie legte den Kopf schief: „Aber er war wirklich nicht brav, Arthur!”
„Bist du immer ein Engel?”
„Hmm! Ja ... Eigentlich!” Sie sah verlegen auf ihre Füße. „Na gut! Ehrenwort!”
Der fliegende Händler aus Lissabon grinste. Es war erstaunlich, doch den höchsten Offizier in ganz Portugal schien in diesem Moment nicht anderes zu bekümmern als die gerechte Verteilung von Butterkaramellen. Und dies, obwohl dieser irische General den Ruf hatte, ein Feuerfresser zu sein, der seine Tage damit zubrachte, Franzosen umzubringen und seine Nächte, Pläne zu schmieden, wie er noch mehr von ihnen ins Jenseits oder zurück über die Pyrenäen befördern konnte.
Nachdem Manuela und Lord Wellington sich über den Sinn eines Ehrenwortes geeinigt hatten, setzten sie zufrieden ihren Spaziergang fort. Nächstes Ziel war das kleine Kaffee neben der Pfarrkirche. Wie immer fand der Ire seinen Chefspion, den Pfarrer von Freneida und Lady Lennox um einen Tisch versammelt. Der nachmittägliche Tratsch war genauso ein Zeremoniell, wie die Karamellbonbons. Er setzte Manuela auf Sarahs Schoß, zog sich einen Stuhl heran und tratschte in einer bunten Mischung aus Spanisch und Englisch mit. Der Wirt brachte Kaffee für den Iren und eine Mandelmilch für das kleine Mädchen. Genau so, wie der fliegende Händler aus Lissabon, erkundigte er sich nach Paddy. Das ganze Dorf kannte den Rotschopf, der immer zu Streichen aufgelegt war und schon von so manch braver Hausfrau ein paar hinter die Ohren bekommen hatte. Man befragte seine spanische Freundin neugierig, was denn dieses Mal der Grund für die erzieherische Maßnahme seiner strengen Mutter gewesen war. Manuela nippte an der Mandelmilch. Dann strahlte sie die ganze Runde an: „Er hat seinem Papa eine Kröte ins Bett gelegt!”
„War’s wenigstens eine große?” Arthur erinnerte sich, daß er als Kind mit seinem Vater ähnliche Spiele getrieben hatte. Für eine kleine Kröte war ein ganzer Nachmittag Hausarrest hart. Lord Mornington hatte sich meist damit begnügt, seinen Sohn fünfzig Mal schreiben zu lassen‘ Ich darf meinem Vater keine Kröten in die Jackentaschen stecken!’
„Riesig, klatschnaß und schrecklich häßlich!”, nickte das kleine Mädchen ihm begeistert zu.
“Na, dann hat es sich wenigstens gelohnt!”, murmelte der Oberkommandierende des alliierten Feldheeres in seine Kaffeetasse. Es stimmte ihn nachdenklich, daß er seine eigenen Kinder nicht kannte: Arthur Richard war so alt wie Manuela, William etwas älter als Paddy Seward. Zuerst betrachtete er traurig die kleine Spanierin in Sarahs Armen, dann Lady Lennox. Miss Pakenham mußte seine Jungen inzwischen mit ihrer absonderlichen Mischung aus Bigotterie, Dummheit und Überängstlichkeit fürs Leben verdorben haben. Er fragte sich, was wohl an dem Tag geschehen würde, an dem er seine Söhne wiedersah. Sie wußten nichts über ihren Vater, er nichts über sie. Nur von Zeit zu Zeit schrieb Kitty ihm einen knappen Brief: „Den Kindern geht es gut! Schicke mir Geld!” Alles, was seine sogenannte Ehefrau interessierte, war seine Unterschrift unter einem Wechsel an die Coutt’s Bank in London. Wie sehr mußte sie doch darauf hoffen, daß eines Tages ein Offizier des Kriegsministeriums mit Trauermiene bei ihr auftauchte, um ihr mitzuteilen, daß ihr Gemahl, irgendwo fern der Heimat, für König und Vaterland gefallen sei. Damit wäre sie endlich die ungeliebte Beschäftigung los, ihm Bettelbriefe zu schreiben. England sorgte gut für die Witwen ihrer toten Helden!
Sarah bemerkte seine traurigen Augen. Sie zog ein paar kleine, spanische Münzen aus der Tasche, legte sie auf den Tisch und gab dem General Zeichen aufzustehen und mitzukommen. Er verabschiedete sich von Robertson und dem Dorfgeistlichen. Mit Manuela an der Hand spazierten Lord Wellington und Lady Lennox durch die Herbstsonne auf die Obstgärten zu. Sie suchten sich einen Platz unter einem Apfelbaum. Das kleine Mädchen tollte im Gras herum.
„Du denkst an deine Kinder, Arthur!” Sarah hatte seine Hand in die ihre genommen.
„Meine Kinder? Auf dem Papier! Ich habe Arthur Richard zum letzten Mal gesehen, als er drei Monate alt war. Heute ist er fast sechs. Und William ist für mich nur ein Name auf einem Auszug im Kirchenregister!” Er zuckte mit den Schultern. Vielleicht war es ja besser so. Zumindest beschäftigte ihn auf einem Schlachtfeld nicht auch noch der Gedanken an eine geliebte Frau, die zu Hause um ihn zitterte und an Kinder, die um ihren Vater weinen würden, wenn es das Schicksal eines Tages nicht gut mit ihm meinen sollte. Es war einfacher, einem Feind entgegenzutreten, wenn man nichts zu verlieren hatte. Und Sarah machte es ihm leicht. Sie hatte nicht diese leidige Angewohnheit vieler Offiziersfrauen, ihren Männern dauernd die Ohren voll zu jammern. Er hatte schon eine große Anzahl guter Soldaten an diese leidige weibliche Gewohnheit verloren. Die Ladys schrieben Klagebrief um Klagebrief und irgendwann standen die entnervten Offiziere vor ihm, redeten sich mit imaginären Krankheiten heraus oder mit dringenden Geschäften. Dann verschwanden sie vom Kriegsschauplatz und kehrten nie wieder zurück. In London gab es immer eine Möglichkeit, sich über irgendwelche Beziehungen ein warmes, sicheres Plätzchen in einer Garnison oder im Kriegsministerium zu sichern. In seiner Welt aus Schwarz und Weiß existierte dieses Problem nicht: Wer einen Soldaten heiratete, wußte woran er war und hatte kein Recht, hinterher zu jammern! „Warum heulst du mir eigentlich nie die Ohren voll, Kleines?”, fragte er Lady Lennox schnippisch.
Sanft nahm sie sein Gesicht in ihre Hände und blickte ihm tief in die Augen: „Was würde das ändern, Sepoy-General?”
„Garnichts! Wir lägen nur dauernd im Streit miteinander und würden uns die Freude an der Gesellschaft des anderen verderben!” Er hatte sie angeschwindelt. Arthur hoffte, daß die feinfühlige junge Frau ihm die Lüge nicht an den Augen ablas. Vielleicht, wenn sie ihm damals keinen Korb gegeben hätte und heute mit seinen Kindern, an Kittys Stelle, in Irland auf ihn warten würde, vielleicht würde er sich genausoverzweifelt wie die anderen darum bemühen, von Spanien und aus dem Krieg weg, nach Kildare zu verschwinden. Vielleicht müßte sie ihm nicht einmal Klagebrief um Klagebrief schreiben, um ihn dazu zu bewegen, die Armee zu verlassen. Liebevoll strich eine kleine Hand über sein kurzes Haar. Lady Lennox lächelte und schüttelte den Kopf. Sie durchschaute ihn schon seit langer Zeit. Der Ire sagte und tat oft Dinge, nur um sich zu schützen. Er mochte es überhaupt nicht, wenn es seinen Mitmenschen gelang, hinter den Schutzwall zu blicken und zu erkennen, daß er mit seinem Zynismus und seiner Ruppigkeit ein weiches Herz und eine verletzliche Seele zu verbergen suchte: „Weißt du, ich mache mir auch Sorgen um dich! Da unterscheide ich mich in nichts von den anderen Soldatenfrauen. Doch immer wenn ihr laut nach Blut und Ehre schreit und mit dem Säbel rasselt, bin ich damit beschäftigt, die Folgen eurer Dummheiten zu beheben. Da hat man dann keine Zeit zu lamentieren und zu heulen. Und wenn du nicht auf Macs Liste stehst, beruhige ich mich wieder ganz schnell, weil ich ja immer noch mit den Überresten eurer Heldentaten zu tun habe! Während ihr euch schlagt, haben wir kein Recht darauf, Angst zu haben und die Nerven zu verlieren ...” Sarahs Augen blitzten spöttisch. Der Ire legte den Arm um ihre Schulter und zog sie eng an sich. Wie sehr er sie liebte; sie war so klug, so unabhängig und selbstständig. Sie brauchte niemanden, der ihr eine Stütze war und der sie durchs Leben führte und ihr schwerwiegende Entscheidungen abnahm. Sarah war ein Geschenk für einen Mann, keine Last: „Wenn du mir damals keinen Korb gegeben hättest und an Kittys Stelle wärst ...”
„... dann würde ich nicht mit rotgeweinten Augen in Irland auf dich warten, mein Freund! Da kannst du ganz sicher sein!”
Die Tage im Winterlager von Freneida vergingen ruhig. Alle waren damit beschäftigt, sich von einem anstrengenden Sommer zu erholen. Arthurs eigenes Regiment war gemeinsam mit ihm in dem kleinen Marktflecken selbst einquartiert. Alexander Wallace und seine Connaught Rangers befanden sich, nur ein paar Meilen weiter in ihrem traditionellen Quartier Fuentes de Onoro, Tom Picton saß keine Stunde entfernt in Aldea da Ponte und Black Bob Craufurd hatte sich in der malerischen Ruine von Fort Concepçion eingenistet. Wenn die Männer in den grünen Jacken nicht gerade damit beschäftigt waren, die Spuren der Schlacht von Fuentes de Onoro zu beseitigen, trieben sie sich bei ihren Kameraden vom 33. Regiment in Freneida herum. Rote und grüne Röcke vermischten sich auf dem Marktplatz bunt mit den Bauern der Umgebung. An den Lagerfeuern, die am Abend vor den Zelten der 33. Infanterie brannten erklangen fröhlich gälische Stimmen, die Iren und Schotten sangen gemeinsam, tranken, amüsierten sich. In Freneida war reges Leben eingekehrt. Durch diese unerwartete Bevölkerungsexplosion wurden Händler aus allen Teilen Portugals und aus Leon angezogen und der kleine Markt war zwischenzeitlich bestens mit Obst, Gemüse, Geflügel und anderen Dingen, die das Leben angenehm machten, versorgt. Die gesamte Beira, auf beiden Seiten der Grenze, profitierte von der Anwesenheit der anglo-alliierten Armee. Im Gegensatz zu den Franzosen verschreckten die Soldaten Lord Wellingtons niemanden: Sie bezahlten, was sie nahmen in harten Dollares und vermieden jede Art von Zusammenstößen mit ihren Gastgebern, die über eine einfache Wirtshausschlägerei hinausgingen. Die Militärpolizei wachte streng über die Einhaltung von Sir Arthurs Spielregeln. Man war im Land eines Verbündeten. Plündernde, Angst verbreitende Söldnerscharen störten den strengen Oberkommandierenden. Wer nicht gehorchen wollte, wurde schnell durch die neunschwänzige Katze daran erinnert, daß sich hinter seinem ruhigen, beherrschten Äußeren ein hitziger, irischer Charakter und eine Hand aus Eisen verbargen. Doch in diesem Winter in der Beira mußte der Provost-Marschall nur selten zu den gefürchteten Instrumenten britischer Disziplin greifen.
Wellington selbst hatte für einen kurzen Winter den Krieg gegen Napoleon Bonaparte vollkommen aus seinem Gedächtnis gestrichen. Er lebte, wie jeder irischer Landadelige zwischen dem County Cork und Connemara: In den frühen Morgenstunden des Tages entledigte er sich rasch seiner leidigen Pflichten. Dann ritt er mit seinen Offizieren auf die Jagd in die Berge. Irgend jemand hatte eine kleine Meute aufgetrieben. Während die Männer unbefangen hinter den Hunden und einem Fuchs oder einer Wildkatze hergaloppierten, um zufrieden und vergnügt am späten Nachmittag nach Freneida heimzukehren, sorgten Sergeant Dunn und Miss Mary, gemeinsam mit den Waschfrauen des 33. Regiments dafür, daß die Tafel für das Abendessen im Hauptquartier reichlich gedeckt war. Sir Arthurs Tür stand in diesen Monaten jedem offen, den es in das kleine Dorf in der Beira verschlug: Die Aristokratie aus der Umgebung, Guerilleros, wandernde Mönche oder portugiesische, spanische und britische Offiziere, die bei Einbruch der Nacht anklopften, wurden an den Tisch gebeten. Oft kamen Picton und Craufurd vorbei, um dem Chef Gesellschaft zu leisten. Sir William de Lancey, Wellingtons Quartiermeister-General schüttelte beim Anblick der ständig überfüllten Tafel regelmäßig den Kopf. Er war davon überzeugt, daß der alliierte Oberkommandierende sich irgendwann finanziell ruinieren mußte, wenn er weiterhin ganz Portugal und Leon und die Hälfte seiner Armee durchfütterte. Gäste ließ man nur mit einer großzügige Menge des besten Rotweins in den Satteltaschen ziehen, wandernde Mönche oft auch noch mit einem prall gefüllten Beutel Dollares für die Notleidenden und Opfer des Krieges im Gepäck. Der Oberkommandierende führte ein unbekümmertes Leben. Doch nicht nur in seinem Haus ging es ausgelassen und kurzweilig zu. Auch die Männer seiner 33. Infanterie lebten unvergleichlich gut. Die Kochkessel der Soldaten über den großen Feuern quollen genauso über wie die Schüsseln im Hauptquartier. Brandy und spanischer Landwein waren reichlich vorhanden. Wenn John Dunn auszog, um für das Hauptquartier einzukaufen, begleitetet ihn immer der alte Quartiermeister der 33. mit einem großen ledernen Geldbeutel, der prall mit Dollares gefüllt war, denn Sir Arthur beschränkte sich nicht darauf, dem Mann die Schillinge des Königs für die Verpflegung auszuhändigen. Aus seiner eigenen Kasse flossen schwere silberne Sterling für seine eigenen Leoparden. Wenn der Ire nicht kämpfte, sah er keinen Grund, sie schlechter leben zu lassen, als er es sich selbst gestattete. Geld war für ihn noch nie ein Selbstzweck gewesen, immer nur ein Mittel, um sich Unabhängigkeit zu sichern. Die Preisgelder waren ein ganzes Jahr lang geflossen. Sollten nur alle davon profitieren! Der nächste Feldzug und die nächsten Entbehrungen kamen bestimmt. Zu lange schon kannte man sich, zu lange schon kämpfte man Seite an Seite, um nicht gemeinsam ein bißchen Frieden in diesem großen Wahnsinn Krieg zu genießen. Schnell sprach es sich bei den umliegenden Regimentern herum, daß es in Freneida immer volle Fleischtöpfe und gut gefüllte Weinfässer gab. Als Sir Arthur sich eines Abends, gemeinsam mit Tom Picton, Freddy Ponsonby und Bob Craufurd, mit denen er den Tag auf der Jagd verbracht hatte, den Weg durch den überfüllten Marktplatz zu seiner Unterkunft zu bahnen versuchte – die Spanier und Portugiesen an der Grenze schickten sich an, das Fest irgendeines Heiligen zu feiern –, schlich sich gerade eine einfach gekleidete, schlanke Gestalt mit vollem Bart und wachsamen grünen Augen durch die Obstgärten, entlang einer kleinen, halbzerfallenen Steinmauer auf den Hintereingang des Hauptquartiers zu. Der Mann bewegte sich lautlos, ein scharfes Messer zwischen die Zähne geklemmt. Beim leisesten Geräusch fiel er zu Boden und preßte sich ins hohe Gras. Im Inneren waren John Dunn und Miss Mary eifrig damit beschäftigt, den Tisch zu decken. Paddy, ihr Sohn und seine Freundin Manuela spielten auf einem Schaffell vor dem Feuer mit kleinen Holzfiguren, die Leutnant Seward ihnen geschnitzt hatte. Der Offizier saß in einem Schaukelstuhl, ein Glas Portwein in der Hand, und unterhielt seine Frau und seinen alten Kameraden mit einer Anekdote aus dem heimatlichen Schottland. Die Ruhe in dem kleinen Raum würde sich schon bald in regen Aufruhr verwandeln. Sobald Wellington auftauchte, mit seinen Gästen für den Abend, würde auch Robertson auftauchen, mit den Neuankömmlingen des Tages, die den Bewohnern des abgeschiedenen Freneida aus der großen weiten Welt berichten mußten. Der Bürgermeister und der Dorfpriester waren Dauergäste, Lady Lennox und die Ärzte auch und Don Julian Sanchez hatte sich angekündigt. „Glaubst du, wir können 30 hungrige Mäuler stopfen, Johnny?” Mary Seward sah zufrieden den gedeckten Tisch an.
„Zumindest reichen Wein und Brandy für ein ganzes Regiment, meine Liebe! Wenn das Essen ausgeht, müssen die Mädchen nur immer kräftig die Gläser füllen, dann merkt es niemand. Nosey ist im Winterlager ein größeres logistisches Problem als unsere ganze Armee auf einem Feldzug ... In Indien war er ja schon schlimm, aber hier ist er unberechenbar geworden ...!” Dunn zählte die Stühle. Er hatte das Gefühl, daß es besser war, gleich bei den Nachbarn anzuklopfen und sich noch ein Dutzend auszuleihen. Während der alte Sergeant das Haus verließ, schlich die bärtige Gestalt geduckt bis zum Küchenfenster. Als sie niemanden in dem hell erleuchteten Raum ausmachen konnte, schwang sie sich geschickt aufs Fenstersims. Zwei starke Arme suchten Halt in den Natursteinen. Lautlos gelang es dem Mann, bis in den zweiten Stock zu klettern. Er schob sein Messer in die Spalte zwischen den beiden Fensterflügeln direkt über der Küche. Leicht ließen sie sich öffnen. Der Bärtige stützte sich auf dem Sims auf und zog energisch seine Beine nach. Nur wenige Sekunden später war er im Inneren des Hauses verschwunden, das Fenster war wieder verschlossen. Die Augen des Eindringlings sahen ausgezeichnet im Dunkeln. Er hatte schnell festgestellt, daß er im richtigen Raum des Hauptquartiers gelandet war. Die drei Tage stummen Beobachtens aus den Obstgärten von Freneida hatten sich gelohnt. Er war im Schlafzimmer des Oberkommandierenden des anglo-alliierten Feldheeres angekommen. Der Mann machte es sich in einem Stuhl bequem und wartete.
Wie John Dunn befürchtet hatte, überraschte Lord Wellington ihn mit mehr als 30 Gästen. Der irische General schätzte nicht nur die Gesellschaft seiner kühnen, jungen Männer und kampferprobten Generäle. Er fühlte sich auch höchst behaglich in einem intelligenten Umfeld von Menschen verschiedener Herkunft und Interessen, in dem er sicher sein konnte, daß ein abendliches Gespräch sich nicht nur um den Krieg und seinen leidigen Gegner Bonny drehen würde. An diesem Tag bereicherte ein Astronomiegelehrter der berühmten Universität Salamanca mit seinen Assistenten die Tafel des Oberkommandierenden. Der Professor war auf der Durchreise nach Coimbra. Lange zog sich das Abendessen hin. Jack Robertson und der Gelehrte aus der berühmtesten Universität Spaniens führten ein wildes Streitgespräch, das alle anderen Anwesenden zum Lachen brachte. Erst weit nach Mitternacht löste die Runde sich auf.
John Dunn zog sich erschlagen in seine Kammer zurück. Arthur schob Lady Lennox gutgelaunt vor sich die Treppe nach oben und durch die Tür des Schlafzimmers. Das erste, was der wartende Bärtige im sanften Schein einer Kerze sah, waren Sarahs lange, dunkelbraune Haare. Erschrocken sprang er aus seinem Stuhl, ein Messer flog durch die Dunkelheit und blieb keinen Inch neben dem Kopf der jungen Frau im Türrahmen stecken. Sie war so überrascht, daß ihr der Schrei des Entsetzens in der Kehle steckenblieb. Arthur reagierte schnell, denn er hatte das Geräusch der Waffe wahrgenommen, die durch die Luft flog, und Sarahs Zurückweichen. Im Reflex stieß er sie zu Boden, um sie vor einem zweiten Angriff zu schützen. Dann hechtete er über ihren Körper hinweg auf den Angreifer. Er war unbewaffnet und nur seine Geschicklichkeit und körperliche Kraft standen möglicherweise zwischen einem entschlossenen Gegner und dem Tod. In Indien hatten die Marathen ihm häufig bezahlte Mörder geschickt, Anhänger der Göttin Kali, die mit bleigefüllten Tüchern ihre Opfer erwürgten – Thugs. Und ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit hatte ihn damals mehr gekostet als alles Gold der Welt ... es war immer noch unerträglich schmerzhaft, sich an jene Nacht zurückzuerinnern ... und an das Grab!
Der Mann, der das Messer geworfen hatte, war jung und sehr kräftig. Verzweifelt wehrte er sich. Wellington hatte große Mühe, ihn zu bändigen. Er versuchte, einen Arm des Mannes mit dem Knie zu Boden zu drücken, während seine freie Hand nach dem Stillet im Stiefel suchte. Schließlich gelang es dem General, seine scharfe Klinge gegen die Kehle des Unbekannten zu pressen. Der Bärtige beruhigte sich augenblicklich. Aus seinen grünen Augen blitzten dem Iren Zorn und Angst entgegen. Leise zischte Arthur ihn auf Spanisch an: „Wer hat Sie geschickt?” Der Mann keuchte vor Anstrengung und Furcht. Inzwischen hatte Sarah sich vom Boden aufgerappelt und eine neue Kerze angezündet. Im Schein des Lichtes veränderte sich der Gesichtsausdruck des Bärtigen plötzlich. Endlich konnte er seinen Bezwinger erkennen. Er wollte den Mund aufmachen und etwas sagen, doch das scharfe Stilett an seiner Kehle machte jedes Wort unmöglich. Langsam beruhigte auch Wellington sich wieder. Er hatte die Oberhand über diese mögliche Gefahr errungen und der Druck seines Knies auf den Arm verringerte sich etwas. Lady Lennox legte dem General die Hand leicht auf die Schulter: „Nimm das Messer fort! Der Mann will etwas sagen, Arthur!”
Wendig, wie eine Katze sprang der Ire auf die Beine und warf gleichzeitig sein Opfer mit einer flinken Bewegung gegen die Wand des Zimmers: „Wer, zum Teufel, sind Sie?”
„Mylord”, antwortete der Bärtige ihm mühsam nach Atem ringend, „mein Name ist Dullmore! Ich bin der Soldat, den Sie als Ausbilder zu den Partisanen nach Navarra abkommandiert haben!”
Wellington steckte das Stilett in den Stiefel zurück und zog den Waffenrock glatt: „Warum, um alles in der Welt, werfen Sie dann mit einem Messer nach mir?”
„Ich habe nur die langen dunklen Haare gesehen und dachte, ich wäre verraten worden ...” Der britische Offizier gewann seine Fassung wieder. Sein Atem wurde ruhiger. Er nahm vor seinem Oberkommandierenden Haltung an.
Der Ire zuckte etwas konsterniert die Schultern: „Ich freue mich, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Major Dullmore!” Er wies ihm einen Stuhl zu und setzte sich selbst auf die Bettkante. Sarah drückte jedem der Beiden ein Glas in die Hand und füllte es mit Brandy. Sie zwinkerte dem Iren zu: „Ich werde euch jetzt alleine lassen, damit ihr etwas friedlicher Bekanntschaft schließen könnt!” Sie stellte die Flasche zurück auf den Tisch, machte auf den Haken kehrt und zog die Zimmertüre hinter sich ins Schloß.
Lange musterten sich Dullmore und Wellington stumm über den Rand ihrer Gläser hinweg. Sie schienen sich gegenseitig abzuschätzen. Jeder war zu arrogant, um den ersten Schritt zu tun oder das erste Wort zu sagen. In diesem Augenblick saßen sich nicht der Oberkommandierende des anglo-alliierten Feldheeres und sein Untergebener gegenüber, sondern nur zwei sehr stolze und unbeugsame Männer. Irgendwann ging ein Lächeln über Wellingtons Gesicht. Er war der Ältere und damit der Vernünftigere. Er mußte den ersten Schritt tun. Langsam stellte er sein leeres Glas auf den mit Papieren überladenen Schreibtisch. Dann verschränkte er die Arme vor der Brust und blickte dem Jüngeren provokativ in die Augen. „Was haben Sie mir aus Navarra zu berichten Dullmore!”, fragte er ihn streng.
Der Major erklärte Lord Wellington in kurzen, präzisen Worten die Lage in Nordostspanien. Am 26. September hatte El Empecinado gemeinsam mit seinem britischen Militärberater Leutnant Duran Calataynal, die bedeutendste französische Garnison in Aragon belagert. Mit 5000 Guerilleros zu Fuß und 500 Berittenen, war es ihm gelungen, die Festung zu nehmen. Gleichzeitig hatte eine zweite Truppe des Mannes vom Strom die kleine Garnison von Molina unweit der Stadt Saragossa belagert und dann ausgelöscht. Suchet hatte große Probleme mit den spanischen Widerstandskämpfern. General Reille versuchte von Navarra aus, die Männer in Calataynal zu entsetzen. Und General Musnier verfolgte Duran und den Empecinado. Doch der Guerillero verweigerte den Kampf und verschwand einfach im Gebirge. Gleichzeitig brachten Dullmore und El Minas ihre Männer über die Grenze nach Aragon, um El Empecinado zur Hilfe zu eilen. In einem Gewaltmarsch erreichten die Partisanen aus Navarra die Straße von Ayerbe nach Huesca und dann nach Exea. El Minas beschloß, eine Belagerung der Garnison zu wagen, da Suchet noch mit der Verfolgung El Empecinados befaßt war. Exea fiel innerhalb weniger Tage. Die Franzosen konnten der Garnison nicht mehr zur Hilfe eilen. Alle italienischen Hilfstruppen, die Exea verteidigt hatten, wurden niedergemetzelt. Jamie Dullmore empfahl den Partisanen aus Navarra dann den Rückzug in ihre Berge. Auf dem Weg nach Navarra kreuzten sie, Mitte Oktober, den Weg eines französischen Regiments unter Oberst Ceccopière, das von Suchet losgeschickt worden war, um El Empecinado weiter zu verfolgen. Bei Huesca ergab sich eine günstige Gelegenheit. Es gelang El Minas und Dullmore, die Adler zu umzingeln. Da die Navarrener große Erfahrung mit dem Kampf in den Bergen hatten, war es für sie nicht schwer gewesen, den Obersten und sein Regiment aufzureiben. 200 Adler verloren ihr Leben, 600 führten die Guerilleros in die Gefangenschaft. Obwohl ihnen nach diesem Gefecht bei Huesca mehrere französische Regimenter auf den Fersen waren, gelang es Dullmore und El Minas durch Navarra über Alave bis an den Golf von Biskaya zu marschieren und dort der britischen Fregatte Isis die 600 gefangenen Adler zu übergeben. Gleich nach dieser brillanten Aktion hatte Jamie Dullmore sich in den Sattel geschwungen, um Kastilien und Leon zu durchqueren und Wellington Bericht zu erstatten.
Der Ire mochte die knappe und eindeutige Sprache des jungen Offiziers. Außerdem schien Dullmore überhaupt keine Angst vor seinem Vorgesetzten zu haben. Wenn es um seine eigene Leistung ging, durfte ein Mann sich nur an seinen eigenen, strengen Maßstäben messen. Dieser ehemalige Sergeant der Connaught Rangers war ganz offensichtlich nicht nur ein Gentleman, obwohl ihn weder Erziehung noch gesellschaftliche Stellung hierfür prädestiniert hatten, sondern auch ein ganz ausgezeichneter Taktiker. Zufrieden klopfte Sir Arthur seinem Untergebenen auf die Schulter: „Sehr gut, Dullmore! Und welche weiteren Aktionen schlagen Sie vor, um unseren Freunden, den Adlern, in ihrem Einsatzgebiet im neuen Jahr das Leben zur Hölle zu machen?“ Wieder erklärte der junge Offizier knapp und präzise seinem Vorgesetzten, was er sich für 1812 vorstellte. Dann griff er in eine Tasche seiner weiten Schaffellweste und überreichte dem General eine Hand voll Papier: „Ich hätte es beinahe vergessen! Diese Depeschen des Kaisers haben wir in den letzten Wochen abgefangen! Einen Teil vermag ich zu lesen. Mönche in den Pyrenäen haben uns beim Entschlüsseln geholfen. Der Rest ist unverständlich. Bonny scheint einen Spaziergang nach Rußland zu planen, General! Er hat fast eine halbe Million Männer um Paris, in der Champagne und im Elsaß zusammengezogen. Er wird sich bald auf den Weg nach Osten machen!”
Wellington nickte dem Major zu. Er erinnerte sich an seine schwarze Nacht voll der Selbstzweifel, nach dem Gefecht von Sabugal. Aus lauter Angst vor einem Treffen mit dem Kaiser der Franzosen auf der Iberischen Halbinsel hatte er damals stundenlang eine geladene Pistole angestarrt. Nur die Nachricht über die Geburt des kleinen Napoleon hatte ihn davor bewahrt, den Abzugshahn durchzudrücken und seinem Leben ein Ende zu setzen. Eine Niederlage auf einem Schlachtfeld war für den Iren eine schlimmere Vorstellung als der Tod. Zu sehr noch war er in den Traditionen des 18. Jahrhunderts verwurzelt: Die Freiheit für England, den Ruhm für den König, die Ehre für sich selbst, so wie Marlborough es einst auf sein altes Schwert hatte gravieren lassen! Der junge Offizier, der ihm in diesem Augenblick gegenübersaß, schien aus demselben Holz geschnitzt. Sir Arthur beschloß, daß er Jamie Dullmore mochte: „Schlafen Sie sich aus, Major!” Er wies auf sein eigenes Bett. „Und morgen unterhalten wir uns in aller Ruhe weiter! Bleiben Sie ein paar Tage in Freneida und erholen Sie sich. Das nächste Jahr wird für uns alle sehr anstrengend werden.” Der Major schlug die Haken zusammen und salutierte vor dem General. Wellington erwiderte den Gruß lächelnd. Dann zog er sich, die abgefangenen französischen Depeschen in der Hand, aus dem kleinen Zimmer im ersten Stock zurück.