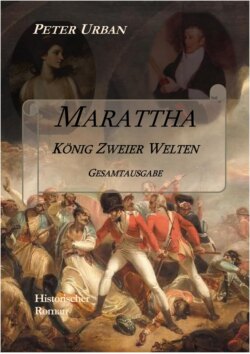Читать книгу Marattha König Zweier Welten Gesamtausgabe - Peter Urban - Страница 6
Kapitel 4 Nur ein grosses Spiel
ОглавлениеArthur kehrte erst in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages von seinem Ausflug in den geheimnisvollen Orient zurück. Er teilte sich ein kleines Haus unweit der Unterkünfte des 33. Regiments mit Sir John Sherbrooke. Doch obwohl die beiden jungen Offiziere in einem ziemlich engen Provisorium lebten, das nur aus zwei Schlafzimmern, einem Salon, einem Speisezimmer und einer hübschen, mit Jasmin überwachsenen Veranda bestand, bemerkte Sherbrooke den späten Heimkehrer nicht. So leise wie möglich kleidete Arthur sich aus und ging zu Bett. Der indische Bedienstete, den die beiden Offiziere eingestellt hatten, wohnte in einem winzigen Häuschen hinter dem ihren. Auch er hatte den Heimkehrer nicht gehört.
Arthur wusste, dass es keinen Sinn mehr hatte zu schlafen. Er würde bereits um vier Uhr in der Früh bei seinen Männern sein und dafür sorgen, dass Shee und West seine Befehle ordentlich ausführten. Und wenn das 33. Regiment sich während der schlimmsten Hitze des neuen Tages unter schattigen Bäumen ausruhen durfte, wartete auf ihn die Aufgabe, die Sir John Shore ihm gestellt hatte. Er schloss sorgfältig das feine Gazenetz, das von der Decke hing und sein Bett zum Schutz vor Stechfliegen einhüllte. Dann verschränkte er die Arme hinter dem Kopf und dachte nach: Es war nicht das Problem Spanisch-Manilas, das ihn beschäftigte, sondern der denkwürdige Abend, den er mit dem Kabuli Lutuf Ullah im Kaschmir-Serai verbracht hatte. Sie hatten sich ausführlich über Indien unterhalten. Lutuf kam als Pferdehändler nicht nur nach Kalkutta. Er bereiste auch regelmäßig die Fürstentümer der unabhängigen Rajahs, das Maharashtra, Gujerat, Rajasthan und den Punjab. Er war ein Kind seines Volkes und erzählte leidenschaftlich gerne von diesen weiten Reisen, und Arthur war ihm ein aufmerksamer und dankbarer Zuhörer gewesen.
Vieles, das der junge Oberst im Verlauf der Überfahrt in seinen Büchern gelesen hatte, hatte Lutuf bestätigt. Anderes hatte er als irrige Annahmen bezeichnet, die auf einem falschen Verständnis des Subkontinents durch die Europäer beruhten. Arthur hatte jedes Detail der abendlichen und nächtlichen Unterhaltung gierig aufgesogen und sich eingeprägt. Bereits während des unglückseligen Flandernfeldzugs war ihm klar geworden, wie kriegsentscheidend genaue Informationen waren. Hier in Indien – einem Land, das nicht nur unglaublich groß war, sondern auch fremdartig – war die nachrichtendienstliche Arbeit noch viel bedeutender. Ein britischer Offizier im Felde, der nicht nur über eigene britische und indische Armeeaufklärer verfügte, sondern überdies auf ein Netzwerk aus Informanten zurückgreifen konnte, wie Lutuf Ullah es besaß, würde erfolgreicher sein als ein Mann wie Frederick von York, der auf einem Kriegsschauplatz auftauchte und nicht einmal wusste, dass die winterlichen Verhältnisse an der Nordseeküste und im holländischen Flachland so grausam waren, dass eine besondere Ausrüstung für die Soldaten erforderlich war, um überhaupt kämpfen zu können.
Arthur nahm sich vor, Lutuf Ullah in den nächsten Tagen einen weiteren Besuch abzustatten: Zum einen brauchte er unbedingt ein, zwei Reitpferde, zum anderen konnte er sich durchaus vorstellen, dass der Kontakt zu Lutuf Ullah in nicht allzu ferner Zukunft nützlich sein würde. Sir John Shore hatte ihm, Arthur, den Auftrag erteilt, den Plan für einen Schachzug gegen Spanisch-Manila zu entwerfen. Er würde dem Generalgouverneur ein paar weitere Vorschläge unterbreiten, die nicht mit diesem begrenzten Territorium zu tun hatten, sondern mit Englands Herrschaft über den gesamten Subkontinent. Es würde ein großes, aufregendes Spiel werden, ein wunderbares Abenteuer. Er würde niemandem von seinem Ausflug nach Hoara erzählen, und auch alle weiteren Ausflüge in diese fremde Welt mussten sein Geheimnis bleiben.
Ausgestreckt auf seinem bequemen Bett und umgeben von der Ruhe einer indischen Sommernacht, war ihm eine Idee gekommen. Arthur war nun felsenfest davon überzeugt, dass ein ungefährliches, ruhiges Leben nur etwas für alte Männer und Schreiberlinge war.
»Ich verstehe einfach nicht, wie ein vernünftiger Mann mitten in der Nacht aufstehen kann, um ein königliches Regiment durch die Dunkelheit laufen zu lassen, Arthur!« flüsterte Sir John Sherbrooke seinem Kommandeur zu, während 733 unausgeschlafene, murrende Rotröcke versuchten, Aufstellung zu nehmen und sich so die Rüffel ihres jungen Obersten zu ersparen. Major John Shee konnte das Trinkgelage der vorausgegangenen kurzen Nacht kaum verbergen. Mit tiefen, schwarzen Ringen unter den Augen stand er schlecht rasiert vor seinen Kompanien. Major Francis West hatte in der Nacht zwar weitaus weniger Alkohol konsumiert als sein Kamerad, war aber dennoch kaum zum Schlafen gekommen, da er der Einladung einiger alter Bekannter aus England gefolgt war, gemeinsam zu Abend zu essen und anschließend einige Partien Trick-Track im Offiziersclub von Kalkutta zu spielen. Major West hatte Glück gehabt: Ein gewisser Hauptmann Lord Clinton hatte eines seiner Poloponys an ihn verloren. West war ein Pferdenarr, und sein Gewinn hatte ihn in solche Aufregung versetzt, dass er das Tier um Mitternacht noch geritten hatte. Es war ihm mit großer Mühe gelungen, von Wesley ungesehen im letzten Moment zu seinen Kompanien zu stoßen und Aufstellung zu nehmen.
Arthur legte den Kopf schief und grinste John Sherbrooke hinterlistig an. »Du solltest weniger feiern und meinem guten Beispiel folgen. Zeitig ins Bett und früh aus den Federn! Wo hast du dich denn gestern herumgetrieben, dass du heute so zerknittert aussiehst?«
Auf Befehl ihrer Offiziere führten die Soldaten des 33. Regiments die vorschriftsmäßigen Übungen des Waffendrills aus. Ladestöcke schlugen hohl in leere Gewehrläufe, hölzerne Gewehrkolben hämmerten auf die trockene indische Erde.
»Du hast wirklich etwas verpasst, Arthur! Der alte St. Leger versteht es, Empfänge zu geben – nur den besten französischen Champagner, Claret und Madeira in Strömen. Und seine Küche zählt zu den erlesensten in der ganzen Stadt. Außerdem hat er Humor. Er war ein wenig enttäuscht, dass du nicht mitgekommen bist, aber ich habe ihm erklärt, dass Sir John Shore dich am späten Nachmittag noch nach Fort William beordert hat. Aber heute Abend wirst du dich nicht drücken können. Connor McLeod vom 74. Hochlandregiment gibt ein großes Abendessen. Seine Frau hat ihm am letzten Sonntag einen kräftigen, gesunden Sohn geschenkt. Ganz Kalkutta und die besten Soldaten Englands sind eingeladen.«
Wesley nickte. »Ich weiß. Das ist auch einer der Gründe, warum ihr in aller Herrgottsfrühe hier antreten müsst. Shore will einen Plan für einen Feldzug gegen Spanisch-Manila – und zwar schnell.«
»Und er hat dich damit beauftragt! Gratuliere, Arthur! Wer den Plan entwirft, bekommt auch das Kommando ... und die Preisgelder dürften nicht zu knapp sein. Ich hab dir bei der Abreise aus Dublin ja gleich gesagt, dass du deine finanziellen Sorgen bald los sein wirst.« Wesley zuckte nur mit den Schultern. Was kümmerte ihn seine finanzielle Lage, wo er jetzt die Aussicht auf ein Kommando und einen abenteuerlichen Feldzug hatte? Er wollte in den Krieg ziehen und kämpfen und all den Unken und Kröten zu Hause beweisen, dass er nicht nur Richard Lord Morningtons dummer kleiner Bruder war.
Nach einem anstrengenden Morgenappell, gefolgt von einem harten Marsch mit vollem Gepäck, versuchten die Männer des 33. Regiments sich so gut wie möglich zu erholen. Einige reinigten ihre Ausrüstung, andere waren damit beschäftigt, unter dem prüfenden Auge von Sergeant-Major John Dunn die Baracken zu kalken, während ihre Frauen putzten und schrubbten. Dunn hatte nach Wesleys Gefühlsausbruch vom Vortag ein paar große Holzzuber besorgt und durchgesetzt, dass auch der unwilligste Rotrock sein Hemd und seine Socken vorbeibrachte, um alles waschen zu lassen. Viele nörgelten, während Sergeant Robin Seward auf seiner Regimentsliste abhakte, wer befehlsgemäß seine Wäsche abgeliefert hatte. Jeder Mann erfuhr aus dem Mund des freundlichen jungen Schotten, dass Oberst Wesleys Sorge um seine Gesundheit mit vier Dimes pro Woche zu bezahlen sei – für die Regimentswäscherinnen und ein paar indische Hilfskräfte, die er vorsorglich angeheuert hatte.
Arthur saß im Schatten duftenden Jasmins auf der kleinen Veranda seines Hauses. Vor ihm lagen große Karten ausgebreitet, und neben ihm stand eine Tasse Kaffee. Während seine Augen immer wieder auf imaginären Linien über die Landkarten reisten, kaute er nervös auf seinem Bleistift. Doch es war eine anregende Art von Nervosität, die einen Mann überkam, wenn er seiner Sache immer sicherer wurde. Von Zeit zu Zeit kritzelte Arthur ein paar Worte auf ein Stück Papier. Die Sache mit Spanisch-Manila war eigentlich ein Kinderspiel, wenn man sorgfältig eins und eins zusammenzählte.
Vingetty, der indische Bedienstete, den Sir John Sherbrooke bereits einen Tag nach Ankunft des 33. Regiments in Indien eingestellt hatte, tauchte mit der Kaffeekanne neben ihm auf. »Darf ich Ihnen nachschenken, Wesley-Sahib?« erkundigte er sich in seinem harten, aber fehlerfreien Englisch. Arthur schrak zusammen. Er war zu tief in Gedanken versunken gewesen, um zu bemerken, dass jemand aus dem Haus auf die Veranda getreten war.
»Ja, gerne!« erwiderte er auf Hindustani. Vingetty füllte schwarzen Kaffee in die Tasse. Dann wiederholte er freundlich und langsam die Hindustani-Worte, die sein Herr soeben benutzt hatte – allerdings in der richtigen Aussprache.
»Danke!« Arthur lächelte ihm zu und warf einen Blick auf seine Taschenuhr, die er vor sich auf den Tisch gelegt hatte, um seinen geplanten Ausflug zum Pferdemarkt von Kalkutta nicht zu verpassen. Es war kurz vor Mittag, und er würde noch knapp eine Stunde an seinem Plan für Sir John Shore arbeiten können.
»Was hast du vor, mein Freund?« tönte es aus dem angenehm kühlen Salon auf die Veranda hinaus, als Wesley seine Papiere wegpackte. John Sherbrooke hatte sich die Zeit mit Faulenzen vertrieben, doch den lieben langen Tag von Jemima zu träumen, wurde ihm doch ein wenig langweilig. Alleine wagte er sich kaum in die belebten Straßen von Kalkutta; deshalb hoffte er, dass sein Kommandeur nicht dienstlich fort musste, sondern private Pläne verfolgte.
»Los, zieh dir deinen roten Rock über und vergiss Jemima, John! Vingetty hat mir genau erklärt, wie man zum Bhawanipur-Bazar kommt.«
»Du willst dir ein Pferd kaufen?«
»Wenn ich unentwegt zu Fuß gehe, schade ich dem Ruf des 33. Regiments. Die anderen werden noch denken, wir könnten uns nicht einmal mehr Beritt leisten.«
»Hast du schon was Bestimmtes im Auge?«
Wesley grinste wie ein Verschwörer. »Man hat mir einen Händler aus Kabul empfohlen, der die besten Tiere in ganz Indien anbietet.«
Die beiden jungen Offiziere verließen gemeinsam die Kaserne bei Fort William. Zuerst mussten sie eine große Parklandschaft durchqueren, die direkt an den Sitz des Generalgouverneurs und die Truppenunterkünfte der Briten anschloss. An einem kleinen See vorbei schlenderten die Offiziere in Richtung Pferdemarkt. Im Gegensatz zu den Bazaren der Kaufleute, die sich in der Nähe der Jain-Tempel am äußersten nördlichen Rand der Stadt befanden, boten die Pferdehändler ihre Vollblüter und Poloponys direkt am Rande des britischen Teils der Stadt an. Ihre Kundschaft rekrutierte sich fast ausschließlich aus den Offizieren, die in Bengalen stationiert waren. Es waren gute Kunden, die immer bereit waren, für gute Tiere Höchstpreise zu bezahlen.
Es war kaum möglich, den Pferdemarkt von Bhawanipur zu verfehlen. Schon von weitem hörten Wesley und Sherbrooke schrilles Wiehern und aufgeregtes Schnauben und Stampfen. Jeder Pferdehändler hatte seine eigene Philosophie: Der eine band seine Tiere an starken Seilen in einer langen Reihe an und führte den Kaufinteressenten an ihnen vorbei. Der andere ließ seine Herde frei in einem eingezäunten Bereich laufen und befahl seinen Knechten, das gewünschte Tier einzufangen und dann an einem Seil vortraben zu lassen. Wieder andere zogen es vor, alle Tiere gesattelt in einem Stallzelt zu belassen und dann gemäß dem Wunsch des Käufers selbst ein Tier auszuwählen und vorzuführen. Diesen Männern war nur eines gemein: Alle stammten aus dem Norden, aus den Bergregionen und aus Afghanistan, und alle beteten zu Allah. Fünfmal am Tag kam der Markt für fünf Minuten zu einem völligen Stillstand. Man hörte kein Rufen und Feilschen mehr, nur noch das Schnauben der Tiere und den einstimmigen Ruf »Allah u Akbar!« – »Allah ist groß!«
Arthur und Sherbrooke hatten Glück. Sie erreichten ihren Bestimmungsort nicht in einer dieser religiös bedingten Pausen, sondern in einem Augenblick größter Betriebsamkeit. Es war nicht schwer, Lutuf Ullah auszumachen. Er war der bei weitem wichtigste Händler des ganzen Bazars und nahm den gesamten Mittelteil der großen Marktfläche in Anspruch. Lutuf hatte fast einhundert Pferde von seiner letzten Reise nach Turkmenistan und Dagestan mitgebracht. Es waren wunderbare Tiere, groß und muskulös und dennoch elegant und rassig. Es waren Pferde für den Krieg, zäh, ausdauernd, genügsam und schnell wie Windhunde. Mit Poloponys wollte Lutuf sich nicht abgeben. Er betrachtete sie als Spielzeug, als schmückendes Beiwerk. Rasch hatte Arthur den hennagefärbten Bart und die breite Gestalt des Kabuli in einer Menschenansammlung ausgemacht. »Also die Beschreibung stimmt schon mal, John. Das da drüben ist unser Mann.« Sherbrooke betrachtete zuerst den Pferdehändler, dann die Tiere, die allesamt frei in einem mit Seilen abgezäunten Paddock herumliefen. »Wesley, du wirst dich ruinieren! Auf den ersten Blick ist keines dieser Prachtstücke weniger als 100 Pfund Sterling wert.«
Arthur zuckte mit den Schultern. »Ist doch egal, womit ich den Sold dreier Jahre durchbringe. Außerdem hab ich nicht vor, auf einem Polo-Pony in den Krieg zu ziehen.«
»Du hast dich schon in Dublin dauernd wegen dieser Viecher ruiniert. Lernst du denn nie dazu?« versuchte der Oberstleutnant seinen Kommandeur vor Schaden zu bewahren. Auch wenn Wesley sich kaum noch die Kartoffel in der Suppe hatte leisten können, hatte er immer nur gute, teure Pferde geritten. Während des Flandernfeldzugs hatte sich seine Theorie vom Unterschied zwischen gut und schlecht für einen Soldaten im Felde zwar mehr als einmal bewahrheitet – trotzdem konnte Sherbrooke sich angesichts der Tiere, die Lutuf Ullah anbot, ein verzweifeltes Kopfschütteln nicht verkneifen. Doch in diesem Augenblick war es für die brüderliche Sorge des jungen Offiziers bereits zu spät. Sein Kommandeur war zielstrebig zwischen den Seilen durchgeschlüpft und mitten in Lutuf Ullahs Herde verschwunden. Der bärtige Kabuli hatte den potentiellen Kunden aus dem Augenwinkel bemerkt. Er verabschiedete sich mit einem kurzen Kopfnicken von den Männern, mit denen er gesprochen hatte. Dann verschwand er ebenfalls inmitten seiner Tiere.
Arthur hatte sich bereits ein Tier ausgesucht. Prüfend hob er das Vorderbein des Pferdes und bog es kräftig nach oben. »Namaste – Ich grüße dich, Lutuf Ullah«, zischte er dem Mann aus Kabul leise in seinem noch ungelenken Hindustani zu. Dann fuhr er genauso leise auf Englisch fort: » Es wäre besser, wenn wir uns hier, inmitten englischer Soldaten, nicht kennen würden.«
»Schämst du dich etwa meiner Bekanntschaft, Wesley-Sahib?« brummte Lutuf ungehalten.
»Sei nicht gleich so aufbrausend, mein Freund. Ich werde dich morgen Abend im Kaschmir-Serai besuchen, denn ich habe dir einen interessanten Vorschlag zu machen, bei dem du das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kannst und viele Pferde an die britischen Offiziere verkaufen wirst.« Arthur zog das Hinterbein des Goldfuchses kräftig nach außen. Der Kabuli brummte jetzt nicht mehr ungehalten, sondern amüsiert. »Entweder ist Wesley-Sahib ein bestechlicher britischer Offizier, der einem kleinen >dustoorie< nicht abgeneigt ist, oder der größte Halunke, den der gute König Georg je in dieses Land geschickt hat.«
»Weder das eine noch das andere«, flüsterte Arthur leise. Dann wandte er sich um und verkündete laut und vernehmlich: »Kann ich das Tier ausprobieren?«
Der Kabuli packte den Goldfuchs am Halfter und führte ihn aus der Herde hinaus an die Abzäunung. In der Sprache seiner Heimat rief er nach einem Bediensteten: »Kabir, du fauler Herumtreiber! Sattle den Fuchs für den Oberst-Sahib!« Dann drehte er sich zu Arthur um und schaute ihm amüsiert in die Augen. »Du hast die Sprache der Diplomatie bereits gelernt, Wesley-Sahib aus Dublin.«
Arthur erwiderte seinen Blick genauso amüsiert und fuhr geschäftsmäßig fort: »Was verlangst du für den Hengst?«
»Du bist ein Halunke, Wesley-Sahib. Du hast dir das beste Pferd von allen ausgesucht. Eigentlich wollte ich den Goldfuchs selbst behalten«, flüsterte der Kabuli, dann fuhr er mit lauter Stimme fort: »Es ist ein wildes, junges Tier – kaum zugeritten. Versucht lieber den großen Schwarzen dort.« Arthur folgte ihm zu einem grobschlächtigen, schwerknochigen Tier mit Senkrücken. »Nur fünfzig Pfund Sterling für diesen edlen Vollblüter. Ich garantiere Euch, dass seine Abstammung bis auf die Pferde des Propheten zurückreicht.«
Der Oberst umkreiste die vierbeinige Katastrophe mit Kennerblick. »Kastriert ist er auch noch! Gütiger Himmel, Lutuf, nur weil ich zu Fuß bei dir aufgetaucht bin, heißt das noch lange nicht, dass ich ein Kutschpferd brauche.« Eine zweite Umrundung des Tieres folgte. »Sieht ganz ordentlich aus, dieser Schwarze. Ich schicke dir den Quartiermeister meines Regiments vorbei. Er braucht ein kräftiges Tier, um den Proviantwagen vom Markt zu ziehen. Ich biete dir zwei Pfund.«
»Willst du mich berauben, Oberst-Sahib?« rief Lutuf empört. »Juliallee! – Schrecklich!« fügte er ungehalten auf Hindustani hinzu. Alle britischen Offiziere, die auf dem Bhawanipur-Bazar versammelt waren, drehten die Köpfe in Richtung der vermeintlichen Streithähne. Kabir, der faule Bedienstete, hatte den Goldfuchs inzwischen gesattelt.
»Willst du mich betrügen, Mann aus den Bergen?« fauchte nun Wesley genauso laut. Seine Augen funkelten vergnügt.
»Wie du willst, Sahib!« Der Kabuli hob beschwichtigend die Hände. »Probiere den Fuchs! Ich habe dich gewarnt. Er wird dir das Genick brechen. Er ist nicht >jumalee< – wohlerzogen.«
Der britische Offizier machte ein ungehaltenes Gesicht. »Das werden wir sehen.«
Kabir brachte das Tier und hielt es fest, damit Arthur in den Sattel steigen konnte. John Sherbrooke hatte, wie alle anderen auch, die kleine Streiterei neugierig verfolgt. Nun verfolgte er interessiert eine unablässige Folge gefährlich aussehender Luftsprünge und Seitenhiebe. »Du schaffst es immer, den einzigen Teufel in einer ganzen Horde Engel auszumachen, mein Freund«, dachte er amüsiert. »Wenn die Viecher sich nicht aufführen, als würden sie von einem Schwarm Bienen gestochen, sind sie nichts für dich.«
Der Goldfuchs beruhigte sich allmählich und wölbte den Hals. Nur der heftig schlagende Schweif zeigte, wie unbehaglich das junge Tier sich noch unter dem Sattel fühlte. Leise und freundlich sprach Arthur auf das Pferd ein. Zehn Minuten später trabte es friedfertig im Kreis, wechselte willig von der einen auf die andere Hand und gestattete seinem Reiter, die Knie zu schließen, ohne mit einem Sprung in die Luft zu reagieren. Der Oberst schnalzte leicht mit der Zunge und gab sachte mit der Hand nach, während er den linken Schenkel gegen den Bauch des Goldfuchses drückte. Der Galopp war noch sehr schwankend und schlecht ausbalanciert. Es würde einige Mühe kosten, aus diesem wunderschönen Rohdiamanten ein Kriegspferd zu schleifen, auf das man sich auch in schwierigen Situationen verlassen konnte. Trotzdem beschloss Arthur, den Versuch zu wagen.
»Was kostet der Hengst?« erkundigte er sich bei Lutuf Ullah, nachdem er das Tier mit einiger Anstrengung zum Stehen gebracht hatte. »Gib mir sechzig Pfund Sterling, Sahib, und er gehört dir.« In den Augen des Kabuli blitzte der Schalk.
»Er ist das Fünffache wert«, flüsterte Arthur.
»Chabuk sawai – du bist ein kluger Kopf. Das Zehnfache, Wesley. Du hast seinen Stammbaum noch nicht gesehen. Aber wenn ich ihn schon nicht behalten kann, dann soll ein guter Reiter dieses Tier besitzen, nicht einer von diesen Verrückten im roten Rock, die ihn umbringen werden, weil sie dauernd mit langen Stöcken nach kleinen Bällen schlagen wollen.«
»Du magst Polo nicht, Lutuf?«
»Ein unsinniges Spiel. Man reitet die Pferde zuschanden. Und wofür?«
»Dieser hier wird nie auf einem grünen Rasen hinter einer Holzkugel her hetzen. Du hast mein Wort, Lutuf!« Arthur stieg vom Rücken des jungen Tieres und tätschelte ihm den Hals. »Ich bin mit dem Preis einverstanden. Lasse den Hengst heute Abend zu den Baracken des 33. Regiments bringen. Man wird dir dort dein Geld aushändigen.« »Shabash, shabash! Nimm das Tier mit, Oberst-Sahib! Als Zeichen meines guten Willens. Ich wollte dich vorhin mit dem Schwarzen nicht betrügen ... Heute Abend schicke ich dann meinen Bediensteten mit dem Stammbaum des Hengstes. Man soll ihm das Geld übergeben.«
»Einverstanden!« Arthur schlug in die dargebotene Rechte des Kabuli. Der Pferdehandel war besiegelt. Zufrieden betrachtete er seinen Goldfuchs, während Kabir dem jungen Tier Sattel und Zaumzeug abnahm und ihm ein Halfter mit einem Führstrick überstreifte. Ohne ein weiteres Wort an Lutuf Ullah zu richten, verließ Arthur den Zentralplatz des Pferdemarktes. Er ging mit seiner Neuerwerbung zu John Sherbrooke, der, an einen schattenspendenden Baum gelehnt, ein Stück abseits vom großen Trubel auf seinen Freund und Kommandeur wartete. Interessiert und bewundernd glitten die Augen des Oberstleutnants über den Hengst. »Der Bärtige hat dich nicht betrogen, Arthur. Wieviel hat er dir für dieses Prachtexemplar abgeknöpft?«
»Fast ein Geschenk. Er wollte nur sechzig Pfund, weil das Pferdchen sich ein bisschen unruhig verhält.«
»Ich hab einen Moment lang geglaubt, das Pferdchen würde dir das Genick brechen ...«
Mit strahlenden Augen tätschelte Wesley dem Fuchs den Hals. »Das Pferd, das mir das Genick bricht, ist noch nicht geboren, mein Freund.
Du brauchst nur Geduld und Ruhe und darfst nie grob zu ihnen sein ... Wenn du sie liebst, lieben sie dich auch und lassen dich nie im Stich. Hast du kein Tier gefunden, das dein Herz höher schlagen lässt?«
»Ehrlich gesagt, Arthur, ziehe ich es vor, den Schimmel zu kaufen, den St. Leger mir gestern gezeigt hat. Zumindest benimmt er sich, wie es sich für ein ordentliches britisches Pferd geziemt.«
Der Oberstleutnant war nicht besonders abenteuerlustig. Zu Hause in England warteten ein großes Erbe und ein Sitz im Oberhaus auf ihn. Er wollte sich in Indien, diesem schrecklichen Land, nicht auch noch den Hals brechen, wo er schon riskierte, an irgendeiner unbekannten, grauenvollen tropischen Krankheit zu sterben oder von den Spaniern totgeschossen zu werden. Er hatte seinen Vater gebeten, ihm ein Offizierspatent zu kaufen, weil er sich ein wenig gelangweilt hatte und eine schmucke Uniform die jungen Damen der Gesellschaft stets beeindruckte. Er hatte nicht vor, sein ganzes Leben als Soldat zu verbringen.
Während des gesamten Rückwegs durch den »maidan« redete Arthur munter auf das Pferd ein. John Sherbrooke fühlte sich von der angeregten Unterhaltung naturgemäß ausgeschlossen, doch er kannte seinen Kameraden schon so lange, dass er ihm verzieh. Wesley liebte Pferde über alles, und das Prachtexemplar, das er gerade auf dem Markt von Bhawanipur gekauft hatte, bedurfte mehr seiner Zusprache als der britische Oberstleutnant, der eine fremde Stadt mit fremden Geräuschen, fremden Gerüchen und neuen Eindrücken auch alleine verhältnismäßig zuversichtlich und furchtlos zu durchqueren vermochte. Das Füchschen tänzelte zwar und sprang auch ab und an erschrocken zur Seite, legte aber zutraulich die Ohren nach vorne und hörte seinem neuen Herrn aufmerksam zu.
John Sherbrooke konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Jedesmal wenn ich solche Dinge über meine Jemima sage, beschwert er sich, aber selbst ... Augapfel! Kleine Schönheit! Perle! Was muss der arme Gaul sich alles anhören!«
Während die Offiziere des 33. Infanterieregiments sich für die Abendgesellschaft bei ihren Kameraden vom 74. Hochlandregiment umkleideten und John Sherbrooke sich bei einem Glas kühler Limonade von seinem anstrengenden Nachmittag im Herzen Kalkuttas erholte, stand der Kommandeur des Regiments mit strahlenden Augen am Zaun der kleinen Koppel hinter den Stallungen und beobachtete seinen blutjungen Goldfuchs, der wie ein Fohlen durch die Gegend tobte und wilde Bocksprünge machte. Er dachte in diesem Augenblick weder an Sir John Shore und Spanisch-Manila noch an seine Idee vom geheimen Nachrichtendienst, der die Soldaten Englands mit wichtigen politischen und militärischen Informationen versorgen sollte, während sie im Felde standen. Auch die anstehende Feier der Geburt von Connor McLeods erstem Sohn schien er vergessen zu haben. Erst als all seine Offiziere abmarschbereit und in schmucken Uniformen hinter ihm standen, wandte er seinen Blick von dem Hengst ab.
»Er ist traumhaft schön, Sir«, flüsterte Major Francis West leise. Arthur nickte nur glücklich und atmete ein paarmal tief durch, um sich von den Ereignissen dieses denkwürdigen Nachmittags zu erholen. »Hat er schon einen Namen?« erkundigte sich West. Er war der zweite Pferdenarr des 33. Regiments und stand in nichts hinter seinem Kommandeur zurück, wenn es um Vierbeiner ging.
»Eochaid«, antwortete Arthur leise, als würde er mit sich selbst und nicht mit seinem Untergebenen sprechen.
»Ein schöner Name, Sir. Das sagenumwobene weiße Pferd des Krieges, auf dem Morrigan in die Schlacht reitet.«
»Sie kennen die Geschichte?« Der Oberst war ein wenig verwundert, dass ein junger Mann, der in der schottischen Grafschaft Berwick zur Welt gekommen war, über eine uralte Sage seiner grünen Insel Bescheid wusste.
»Auch wir Männer aus den Lowlands haben noch ein bisschen keltisches Blut in den Adern, Sir«, erwiderte West grinsend.
»Geben Sie mir zehn Minuten Zeit, meine Herren! Dann können wir uns auf den Weg zum 74. Regiment machen.« Arthur verließ die Offiziere eilig und begab sich ins Haus. Vingetty, der indische Diener, war inzwischen unruhig geworden. Die neue Uniform und ein frisch gebügeltes und gestärktes Leinenhemd lagen auf dem Bett des Obersten.
Gerade noch pünktlich erschienen die Offiziere des 33. Regiments und ihr Kommandeur im Haus von Connor McLeod. Die heiße Vormonsunzeit war auch die Zeit der Festlichkeiten, Hausbälle und Empfänge in der kleinen britischen Kolonie von Kalkutta.
McLeod hatte keine Kosten und Mühen gescheut und die Feier besonders prächtig ausrichten lassen – nicht nur, weil man die Geburt seines sehnlich erwarteten Sohnes feierte, sondern auch, weil die Iren an diesem Tag ihrem Schutzpatron St. Patrick die Aufwartung machten. Die meisten Männer in der Kolonie waren irischer oder schottischer Herkunft, und Oberst McLeod hatte eben diesen Abend für die denkwürdige Feier ausgewählt, um auch seinen Kameraden von der grünen Insel eine Freude zu bereiten.
Das Haus, das der Kommandeur des 74. Hochlandregiments mit seiner Frau und einer ganzen Schar von Bediensteten bewohnte, lag in Chinsurah, ein Stück außerhalb der Stadt. Es war eher ein kleines Schloss als ein Haus: Aus schweren Lehmziegeln erbaut, zierten barock anmutende Stukkaturen und blumenumrankte Veranden auf dorischen Pfeilern die Fassade. Der große, parkähnliche Garten stand in voller Blüte, und der schwere Duft von Jasmin und Rosen erfüllte die Luft dieser warmen Sommernacht. Entlang der Auffahrt zu Connor McLeods kleinem »Chateau« brannten Laternen, und das Gebäude selbst war von tausend Kerzen hell erleuchtet. Aus dem Inneren drangen Musik und Lachen zu den Offizieren des 33. Regiments in den Abend hinaus.
»Meine Herren, ich möchte Sie alle bitten, sich ordentlich zu benehmen und dem Regiment keine Schande zu machen«, flüsterte Arthur seinen Männern leise zu. Sein Blick war dabei auf Major John Shee gerichtet. Dann wandte er sich einem livrierten Majordomus zu und bat ihn, das 33. Regiment bei Oberst McLeod zu melden. Der schottische Offizier stammte aus einer einflussreichen und sehr wohlhabenden alten Familie, die traditionsgemäß seit den Tagen des großen Clive ihre Söhne zum Dienst nach Indien schickte. Die große Villa gehörte den McLeods bereits seit einem knappen Jahrhundert.
Immer wieder entsandte das 74. Regiment Rekrutierungsoffiziere in die Heimat, die in den schottischen Bergen nach stämmigen Burschen Ausschau hielten, die einem abenteuerlichen Leben am anderen Ende der Welt nicht abgeneigt waren. Diese Männer waren die einzigen in ganz Indien, die anstelle der üblichen Tuchhosen der britischen Infanterie den Kilt trugen. Wesley hatte Oberst Connor McLeod erst vor wenigen Tagen bei einer Gesellschaft im Hause des Residenten der Ostindischen Kompanie, William Hickey, persönlich kennengelernt, doch das Kastenwesen der britischen Armee war genauso tief verwurzelt wie das der Inder: Die Offiziere betrachteten sich allesamt als Angehörige einer großen Familie. Ein Mann, der den roten Rock und die Schulterstücke eines Offiziers trug, war ein Bruder, egal ob und wie lange man ihn schon kannte – ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das durch die beschränkte Anzahl von Briten auf dem indischen Subkontinent noch verstärkt wurde.
Wesley umarmte seinen Kameraden vom 74. Hochlandregiment herzlich und gratulierte ihm zur Geburt seines Sohnes. Dann verbeugte er sich tief vor Lady McLeod. Schließlich stellte er den Gastgebern seine Offiziere vor. Nachdem John Sherbrooke der Dame des Hauses seine Reverenz erwiesen hatte, bewunderten alle gebührend das Kind, das in den Armen seiner schottischen Amme lag und trotz des Lärm im ganzen Haus fest schlief.
McLeod war ein Bär von einem Mann. Er überragte Arthur um einen ganzen Kopf. Seine Schultern waren breit wie ein Kleiderschrank und seine Stimme so laut und so tief, dass selbst ein freundliches Wort des Hochländers wie ein Befehl klang. »Lizzy, da jetzt auch das 33. Regiment den kleinen Prinzen gesehen hat, können Sie ihn ins Bett bringen«, brummte er die Kinderfrau gutmütig an. Dann packte seine linke Pranke den zarten Arm seiner hübschen jungen Frau, während die rechte den Kommandeur des 33. Regiments zu einem langen Tisch in einem völlig überfüllten Speisezimmer zerrte. Arthur erkannte Generalmajor John St. Leger, William Hickey und Sir John Shore. Die meisten der anderen Gäste waren ihm unbekannt. Connor McLeod stellte die Gentlemen einander vor. Dann endlich konnte das Dinner beginnen.
Es war eine laute, fröhliche, ja übermütige Ansammlung von Menschen, die sich an diesem Abend in Chinsurah eingefunden hatte, und der besondere Anlass würde gebührend gefeiert. Ein Toast nach dem anderen wurde auf den Erben der McLeods getrunken; der Champagner floss in Strömen. Jeder wollte dem kleinen Prinzen eine glückliche Zukunft wünschen. Die Bediensteten kamen kaum damit nach, immer wieder die großen Kristallgläser zu füllen, die sich unter Hochrufen, Hurras und lautem Lachen leerten. Obwohl Arthur der Unart britischer Offiziersmessen, bis zur Besinnungslosigkeit zu trinken, abgeschworen hatte, hielt er bis zum 22. Toast mit seinen Offizieren des 33. Regiments mit. Erst als Connor McLeod laut nach dem Madeira rief und damit den umtriebigen Teil des
Abends mit Musik und Tanz einleitete, beschloss der Ire, es gut sein zu lassen.
»Sie werden Schottland doch nicht beleidigen, Wesley«, knurrte ein riesiger Bursche mit feuerrotem Gesicht und ebensolchem Haar ihm über den Tisch hinweg zu.
»Mit wem habe ich die Ehre?« lenkte Arthur von dieser unerwünschten Bemerkung ab, während er sein halb volles Champagnerglas nahm und sich erhob, um aus dem Speisesaal in einen angrenzenden Ballsaal umzuziehen.
»Baird!« knurrte der Hüne unfreundlich und mit alkoholschwerer Zunge. »Sir John Baird!«
Arthur verbeugte sich leicht. »Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Sir John. Ich habe viel von Ihnen gehört.«
Er freute sich nicht im Geringsten, die Aufmerksamkeit des Riesen mit dem roten Gesicht und den roten Haaren erregt zu haben. Sir John Baird war Generalmajor und zwölf Jahre älter als Arthur. Er hatte einen Ruf, der selbst in die abgelegensten Baracken von Dublin gedrungen war, und besaß den Charakter eines hungrigen, bösartigen Tigers. Baird war schon seit ewigen Zeiten in Indien, obwohl er die Inder und das Land hasste. Jeden Versuch einer Versetzung nach Europa durch die Horse Guards wusste Sir John – dank seiner einflussreichen familiären Verbindungen – geschickt zu verhindern. Seine gesamte Existenz schien sich nur um ein einziges Wort zu drehen: »Rache!«
Im Jahre 1780 war Baird auf dem blutigen Schlachtfeld von Perambaukum von Hyder Ali, dem Herrscher von Mysore, gefangengenommen worden und hatte dreieinhalb Jahre in Ketten in einem finsteren, verseuchten Verlies unter dem Sultanspalast von Seringapatam geschmachtet, bis ihm die Flucht aus dieser Hölle gelang. Seit diesen schrecklichen Tagen seiner endlosen Gefangenschaft in den Händen eines grausamen, skrupellosen Tyrannen lebte er nur noch dafür, einen Schlag gegen seinen Todfeind zu führen. Baird gierte danach, in den Krieg zu ziehen. Es ging dabei nicht um Englands Ruhm oder militärische Notwendigkeit, sondern nur darum, für jeden einzelnen Tag seines Leidens und seiner Verzweiflung in einem finsteren Verlies mindestens hundert Inder zur Hölle zu schicken. Wenn Baird nicht über seinen Racheplänen brütete, war er beständig auf der Suche nach Streit. Dabei war es ihm gleich, mit wem er stritt und warum. Sich mit den eigenen Landsleuten in den Haaren zu liegen, lenkte wenigstens zeitweilig seinen unruhigen Geist und seine zerstörte Seele von diesem alles verschlingenden Gedanken der Rache an Hyder Ali und Mysore ab.
Wie jeder britische Offizier kannte auch Arthur die Geschichte über Bairds jahrelange Kerkerhaft. Doch soviel Mitgefühl er auf der menschlichen Ebene auch für diesen Mann empfand – er hatte nicht die geringste Lust, sich einen angenehmen Abend von einem notorischen Streithahn verderben zu lassen. Noch bevor Baird den Tisch umrunden konnte, um sich seinem potentiellen Opfer zu nähern, war Arthur gemeinsam mit John Sherbrooke in einer aufgeregten Menschenmasse verschwunden.
»Uff!« entfuhr es ihm erleichtert. »Diesem Problem wären wir vorerst aus dem Weg gegangen.«
»Baird! Ihm steht die pure Mordlust ins Gesicht geschrieben. Man sagt, dass er mehr britische Offiziere totgeschlagen hat als der Feind, weil er einfach nicht an diesen Hydra herankommt, oder wie immer er heißen mag.« John Sherbrooke schlenderte neben seinem Kommandeur durch die Menge der Gäste und blickte dabei hin und wieder besorgt über die Schulter.
»Hyder Ali! Aber der ist vor ein paar Jahren gestorben, also kann Sir John ihm nicht mehr ans Leder. Ich hab’s während der Überfahrt gelesen. Sein Nachfolger heißt Tippu Sultan und ist der älteste Sohn von Bairds verblichenem Erzfeind. Aber ich glaube, unser Kamerad aus dem Hochland sieht das nicht so eng. Wenn er kann, reißt der auch dem Sohn für die Schandtaten des Vaters den Kopf ab«, klärte Wesley Sherbrooke auf.
»Und was machen wir jetzt?« In Sherbrookes Stimme schwang Unruhe mit.
»Jetzt werden wir uns im Ballsaal zwei hübsche Mädels suchen, die nicht von einem uniformierten Zerberus bewacht werden, und ein paar Runden mit den Schönen tanzen. Gestern wolltest du dich doch noch unbedingt amüsieren ... Bediene dich, mein Freund! Der Abend ist wundervoll, die Gesellschaft angenehm, und uns stehen arbeitsreiche und anstrengende Wochen bevor.«
Noch während Arthur mit seinem Regimentskameraden sprach, glitten seine Augen bereits von links nach rechts über die Menschenmenge. Kaum hatte er seinen Satz beendet, drückte er Sherbrooke auch schon vergnügt sein Champagnerglas in die Hand und ließ ihn irgendwo im Niemandsland im Stich. Dann bahnte er sich höflich, aber zielstrebig seinen Weg durch die Menge. Zwischen einer behäbigen älteren Dame in einer zartrosa Robe, die ihre rundlichen Formen durch viele, weit drapierte Stoffbahnen zusätzlich unterstrich, und einem gutmütig aussehenden, stark ergrauten Herren mit Backenbart und ordensgeschmückter Brust, stand in einem einfachen, aber sehr geschmackvollen nachtblauen Kleid eine junge Frau und blickte mit sehnsüchtigen Augen auf die Tanzfläche. Offenbar hatte keiner der britischen Soldaten es für opportun befunden, das Mädchen zum Tanzen aufzufordern.
Als der Kommandeur des 33. Regiments sich näherte, schlug der Blick der Kleinen von Sehnsucht in Hoffnung um. Arthur fand, dass sie einfach reizend aussah, wie sie ihn durch ihre kleine runde Nickelbrille fixierte. Er vermutete, dass genau diese Brille der Grund dafür war, dass keiner seiner Kameraden sich bis jetzt um einen Tanz bemüht hatte. Es galt als unschicklich für eine Frau, in der Öffentlichkeit mit einer Sehhilfe aufzutauchen. Arthur teilte diese Meinung nicht.
Auch auf dem Gesicht der Dame in Rosa zeigte sich Freude, als der Mann in roter Uniform sich galant vor dem Mädchen verbeugte und sich höflich vorstellte. Der hoffnungsvolle Blick der Kleinen war inzwischen einem offenen, unbefangenen Lächeln gewichen, und Arthur fand die winzige runde Brille auf der Nasenspitze sogar reizvoll. Sie stand dem Mädchen besser als der schönste Schmuck.
Inzwischen hatte der Herr mit Backenbart seine Familie vorgestellt, und Arthur wusste nun, dass er in wenigen Augenblicken mit Charlotte, der Tochter von Sir Edwin Hall, dem höchsten Justizbeamten in Britisch-Indien, die Tanzfläche unsicher machen würde. Charlotte war bereits vor einem Jahr in die Gesellschaft Kalkuttas eingeführt worden, und trotzdem hatte sie noch kein einziges Mal die magischen Worte sagen dürfen: »Ja, gerne!« Ihr Ballbüchlein war noch so leer und jungfräulich wie am ersten Tag, und immer nur mit ihrem Vater zu tanzen, machte der Kleinen keinen Spaß. Und nun war plötzlich ein hübscher junger Offizier vor ihr aufgetaucht und hatte sie um den nächsten Tanz gebeten ...
Entschlossen nahm Charlotte den dargebotenen Arm und ging hoch erhobenen Hauptes an einigen anderen jungen Frauen vorbei in die
Mitte des Saales. Das Orchester des 74. Regiments setzte gerade dazu an, einen Real zu spielen, einen beliebten schottischen Volkstanz. Noch während Charlotte ihre kleine Hand auf Arthurs Schulter legte, erklärte sie ihm selbstbewusst, wenn auch wenig damenhaft: »So, diesen tuschelnden Gänsen hätten wir’s gezeigt! Seit zehn Jahren schon muss ich mir dauernd >Brillenschlange< anhören, oder >Blaustrumpf<, und dass niemand mich je ansehen würde, wenn ich dauernd mit diesem verdammten Ding auf der Nase herumlaufe.«
»Nicht gleich so heftig, junge Lady«, schmunzelte Wesley. »Ich finde die Brille reizend.«
»Tanzen Sie etwa nur mit mir, um sich über mich lustig zu machen, Oberst?« erkundigte Charlotte sich misstrauisch. Sie war Spott gewöhnt.
»Ganz und gar nicht«, erwiderte der junge Offizier amüsiert. »Ich finde, Sie sind das hübscheste Mädchen im ganzen Saal, Miss Hall.« Charlotte lief feuerrot an und trat Arthur vor Schreck kräftig auf die Füße. Es gelang ihm gerade noch, die Kleine ein wenig fester zu packen, um sie vor einem peinlichen Ausrutscher mitten in einer Drehung zu bewahren.
»Danke, Herr Oberst!«
»Ist doch selbstverständlich.« Er lächelte sie weiter an. »Wenn ich Sie in diesem Trubel verliere, werden Ihre Eltern gar nicht zufrieden mit mir sein.«
Nach dem Real spielte das Regimentsorchester einen Two Step, dann eine Quadrille. Obwohl Wesley nur um einen Tanz gebeten und Charlotte ihm nur einen gewährt hatte, trennte das Paar sich nicht. Die anfänglich ein wenig zögerliche Unterhaltung hatte sich in ein angeregtes, interessantes Gespräch verwandelt, und beide lachten viel und vergnügten sich prächtig. Charlotte war ein kluges Kind, und Arthur hatte eine Schwäche für intelligente Frauen.
Als die Musiker des 74. Hochlandregiments eine Pause einlegten, hatte Arthur nicht das Verlangen, Charlotte wieder bei ihren Eltern abzuliefern. Sie verstand es, humorvoll über Kalkutta und Bengalen zu erzählen, das sie mit ihrem Vater oft bereist hatte, und ihm gefielen ihre Anekdoten und persönlichen Bewertungen eines verwirrenden und geheimnisvollen Landes.
»Wenn meine Gesellschaft Sie nicht langweilt, Miss Hall, werde ich Ihre Eltern fragen, ob sie uns beiden erlauben, draußen auf der Veranda ein Glas Bowle zu trinken und uns ein wenig auszuruhen. Wenn Sie möchten, stelle ich Ihnen dann meine Herren Offiziere vor.«
Charlottes Antwort war ein begeistertes Nicken. Mit hoch erhobenem Haupt – genau wie zu Beginn des Tanzvergnügens – zog sie nun am Arm ihres Obersten an den anderen jungen Frauen vorbei, zurück zu ihren Eltern. Überaus zufrieden bemerkte sie, dass die meisten dieser Mädchen sich am Arm eines Leutnants oder bestenfalls Hauptmannes eingehakt hatten.
Lord und Lady Hall hatten dem Paar zu Anfang besorgt und beunruhigt zugeschaut. Schließlich war ihre Tochter gerade erst achtzehn Jahre alt geworden. Doch als sie feststellten, wie höflich und galant der Kommandeur des 33. Regiments sich verhielt, war ihre Sorge rasch verflogen. Natürlich hatten sie nichts gegen ein Glas Bowle auf der Veranda und eine anschließende Vorstellung der Offiziere des Regiments einzuwenden. Sir Edwin und seine Gemahlin hatten sich insgeheim schon damit abgefunden, dass ihr Kind nie eine gute Partie machen würde, weil alle potentiellen Kandidaten vor der runden Brille zurückschreckten. Doch die Ankunft des 33. Regiments in Kalkutta gab ihnen neue Hoffnung. Oberst Wesleys Ruf war weder gut noch schlecht. Er war schließlich erst seit vierzehn Tagen mit seinen Männern im Lande, aber er stammte aus einer angesehenen Familie und hatte viele andere junge Offiziere aus ordentlichen Familien mit nach Indien gebracht.
Vielleicht würde sich aus dem Abend in Connor McLeods Haus ja etwas ergeben, das Charlottes Zukunft rosiger aussehen ließ ...
Der Abend war wunderbar kühl, und ein prächtiger Vollmond erleuchtete den großen Garten vor Connor McLeods »Chateau«. Bequeme, aus Rattan geflochtene Stühle und kleine Tische waren auf der großen Veranda aufgestellt worden, vom Tanzen erhitzt und außer Atem waren die meisten Gäste während der Pause der Musiker nach draußen geflohen, um sich ein wenig abzukühlen. Arthur konnte keinen freien Platz mehr ausmachen. Aber sein praktischer irischer Verstand fand rasch eine Lösung dieses Problems. Von der Veranda führte eine lange, flache Holztreppe hinab in den Garten. Er führte Charlotte den letzten, ein wenig höheren Treppenabsatz hinunter, kramte ein Taschentuch hervor und breitete es für das junge Mädchen auf dem Holz aus. Dann verschwand er, um ein Glas Bowle für sie zu besorgen.
Auf dem Weg zurück begegnete er Oberstleutnant Sherbrooke, Major West und Fähnrich Fitzgerald. Sie standen in einer kleinen Gruppe mit Offizieren aus einigen anderen in Kalkutta stationierten Regimentern beisammen. Wesley gab ihnen mit dem Kopf ein Zeichen, ihm zu folgen.
»Dir scheint es offensichtlich besser zu gehen als uns dreien«, bemerkte Sherbrooke, als er sah, dass sein Kommandeur sie zu einem Mädchen in dunklem Ballkleid geleitete.
»Niemanden zum Tanzen gefunden?« erkundigte Wesley sich belustigt.
»Nicht mal einen einzigen Tanz! Die Damen haben alle volle Ballbüchlein, und man muss sich als Neuankömmling hinten anstellen.« »Ihr hättet es vielleicht bei den Müttern versuchen sollen«, riet der Kommandeur des 33. Regiments seinen Offizieren. Sein Blick war dabei auf den neunzehnjährigen Fähnrich Fitzgerald gerichtet. Der jüngste Bruder des Ritters von Kerry schluckte entsetzt. »Sir?«
Arthur nickte ihm ernst zu. Fitzgerald war der jüngste Offiziersanwärter seines Regiments und der Bruder eines alten Freundes aus irischen Kindertagen. Der Ritter von Kerry hatte Wesley vor der Abreise nach Indien gebeten, den »Kleinen« unter seine Fittiche zu nehmen und gut auf ihn aufzupassen.
»Nichts für ungut, Fähnrich! Ich habe eine junge Lady gefunden, die sicher glücklich wäre, wenn Sie sie um einen der nächsten Tänze bitten.«
Zuerst drückte der Oberst Charlotte ihr Glas in die Hand, dann stellte er ihr reihum und gemäß ihrem Dienstalter seine Offiziere vor. Weder Sherbrooke noch West noch Fitzgerald wagten es, in Anwesenheit ihres strengen Vorgesetzten eine Bemerkung über die runde Brille auf Charlottes Nase zu machen, und jeder bat das Mädchen pflichtbewusst um einen der nächsten Tänze. Glücklich streckte die Tochter von Sir Edwin Hall jedem ihr Ballbüchlein entgegen und ließ sie unterschreiben, während Arthur zufrieden zuschaute. Als sich dann auch noch eine nette Unterhaltung zwischen seinen Offizieren und der kleinen Lady entwickelte, spiegelten sich Zufriedenheit und Genugtuung auf seinem Gesicht. Er mochte es nicht, wenn man einen Menschen wegen irgendeinem Makel, für den er nichts konnte, aus der Gesellschaft ausschloss.
Aus den drei Offizieren des 33. Regiments wurden schließlich fünf und dann sieben. Nur Major John Shee ließ sich nicht bei der Gruppe blicken.
Als das Orchester des 74. Hochlandregiments wieder zu spielen anfing, bedeutete Arthur seinen Männern aufmunternd, mit Miss Hall in den Ballsaal zurückzukehren, während er selbst sich in eine Ecke stellte und mit strengem Blick darüber wachte, das alle sich dem jungen Mädchen gegenüber angemessen benahmen. Nachdem sämtliche Offiziere des 33. Regiments, bis hinunter zu den beiden Fähnrichen, mit Miss Hall getanzt hatten und sie kurz nach Mitternacht schon ganz außer Atem war, nahm Arthur sie wieder in seine Obhut und führte sie auf die nun menschenleere Veranda hinaus in die indische Nacht. Wegen der vielen Insekten, die vom Licht der großen Kronleuchter angezogen wurden, schloss ein Bediensteter sorgfältig die Tür hinter den beiden. Draußen hörte man nur noch die gedämpfte Musik und das Zwitschern vieler hundert Vögel, die in den alten Bäumen des großen Gartens nisteten.
»Ist die kleine Lady mit dem Ball zufrieden?« erkundigte sich Wesley. Charlotte nickte glücklich. »Ihr tun inzwischen sogar die Füße weh. Danke, ich habe mich noch nie so gut unterhalten, seit Mama und Papa mich zu gesellschaftlichen Empfängen mitnehmen. Und Sie, Oberst Wesley? Sind Sie auch mit dem Ball zufrieden?«
Arthur legte den Kopf schief und blickte Miss Hall lange in die blauen Augen. »Nicht nur mit dieser Abendgesellschaft ... Sie wissen viel über Indien, kleine Lady, und Sie verstehen es, Ihre Zuhörer zu fesseln.«
Charlotte nahm ihre runde Brille von der Nase und begann verlegen mit dem ungeliebten Objekt zu spielen. »Indien existiert nicht, Oberst Wesley. Ich kenne mich lediglich hier in Bengalen ziemlich gut aus, weil ich in Kalkutta zur Welt gekommen bin und viel mit meinem Vater herumreisen durfte – Digha, Bakkhali, Sagar, Vishnupur, Shantiniketan, Doars. In den heißen Monaten des Jahres, kurz vor Beginn des Monsuns, habe ich dann mit meiner Mutter in den Bergen gelebt. Wir besitzen ein Haus in Kishangani. Dort ist es angenehm kühl, und die Landschaft ist wunderbar grün, wenn hier in der Stadt alles in braunem Staub versinkt. Man kann sogar die weißen, schneebedeckten Gipfel des Himalaja sehen. Manchmal male ich mir aus, was sich auf der anderen Seite der Berge befindet: Dorje Ling, Sikkim, Bhutan, Xigaze Shan – Welten, die noch kein Europäer betreten hat. Nicht einmal die Soldaten des Königs wagen sich hinauf in den Schnee und das ewige Eis. Die Gipfel des Kanchenjunga kann man niemals sehen. Sie liegen in einem Meer von Wolken verborgen. Man sagt, es gibt dort oben Schneemenschen und Ungeheuer, und wenn ein Unwetter über die Berge hinwegfegt, gibt es sogar Tage, an denen ich diese Ammenmärchen glaube.«
»Zu Hause in Irland gab es auch ein paar Ammenmärchen, an die ich als Kind immer glauben wollte. Erzählen Sie mir mehr von Ihren Schneemenschen und Ungeheuern und von diesen sagenhaften Welten hoch oben in den Bergen, Miss Charlotte.«
»Kommen Sie am Sonntagnachmittag zum Tee zu uns, und ich zeige Ihnen meine Zeichnungen, Oberst. Warum interessiert Sie das alles eigentlich? Die anderen Herren Offiziere ... ihnen ist dieses Land gleichgültig, solange sie nur ein paar gute Ponys finden, um Polo zu spielen oder eine Offiziersmesse mit einem Backgammonbrett, Karten und reichlich Brandy zu besuchen ...«
Neugierig fixierte Charlotte Arthurs blaugraue Augen, als versuchte sie darin den tieferen Grund für seine Fragen zu lesen. Ihre kleine Brille kreiste zwischen Mittel- und Zeigefinger durch die Luft. »Vielleicht, weil ich Polo für einen dummen Sport halte und nicht genug Geld habe, um mich in der Offiziersmesse beim Backgammon zu ruinieren. Vielleicht, weil ich Brandy für ein abscheuliches Getränk halte, mit dem man sich in diesem Klima in kürzester Zeit umbringt, ohne dabei die Hilfe eines ehrenvollen Gegners in Anspruch zu nehmen ...«, antwortete Wesley der jungen Dame amüsiert. »Ich nehme Ihre Einladung zum Tee gerne an, Miss Hall. Wenn Ihre Eltern es erlauben ...«