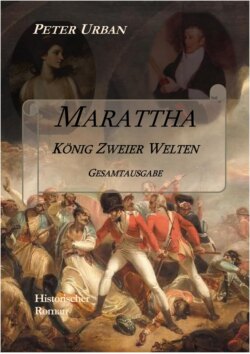Читать книгу Marattha König Zweier Welten Gesamtausgabe - Peter Urban - Страница 8
Kapitel 6 Zu fernen Ufern
ОглавлениеEs geschah genauso, wie Sir Edwin Hall es angekündigt hatte: Der britische Generalgouverneur in Kalkutta, Sir John Shore, befahl Oberst Wesley an einem Sonntag dringlich nach Fort William. Das Gespräch fand nicht, wie ansonsten üblich, unter vier Augen statt: Arthur stand vor sechs Männern – den sechs wichtigsten Männern in Britisch-Indien. Nach einigen sehr förmlichen einleitenden Worten des Generalgouverneurs nahm Arthur seine Befehle in Empfang. Er hatte nicht nur in der Sache des Nachrichtendienstes gesiegt, er hatte die Gentlemen auch von seinen Vorschlägen überzeugt, was die Artillerie betraf. Vor allem aber hatten sie seinem Plan für einen Militärschlag gegen Spanisch-Manila zugestimmt.
Es war so viel auf einmal, dass dem jungen Offizier schwindlig wurde. Nur mit äußerster Selbstbeherrschung gelang es ihm, auf butterweichen Knien weiter vor den sechs Männern strammzustehen und mit ernstem Gesichtsausdruck zu erklären, dass er seine Befehle verstanden hatte und genau auszuführen gedachte.
Als man Wesley aus dem Amtszimmer des Generalgouverneurs entließ, musste er sich erst einmal für ein paar Minuten in eine ruhige Ecke setzen, um seine Emotionen wieder unter Kontrolle zu bekommen. Es war eine gewaltige Verantwortung, die innerhalb der kurzen Zeitspanne von nur fünfzehn Minuten – so lange hatte die Audienz bei Sir John gedauert – in seine Hände gelegt worden war. Das letzte Papier, das sie ihm feierlich überreicht hatten, war der Marschbefehl für Penang.
Er ritt im Schritt und am langen Zügel zurück zu den Kasernen seines Regiments. Als die beiden Wachposten ihren Kommandeur begrüßten, konnte dieser in der Ferne bereits ausmachen, wie seine Männer exerzierten. Auch am Tag des Herrn gab Wesley ihnen nicht frei: Er selbst hatte nichts mit Gott im Sinn, und was seine Soldaten betraf, war er davon überzeugt, dass eine ordentliche Ausbildung ihnen auf dem Schlachtfeld mehr helfen würde als alle Stoßgebete.
Er lenkte sein Pferd auf die lange Reihe im roten Rock zu. Als Sir John Sherbrooke den Freund bemerkte, befahl er laut: »Habt Acht! Der Kommandeur!«
In einer einzigen Bewegung schlugen die Männer die Hacken zusammen und präsentierten die Gewehre. Arthur zügelte seinen Goldfuchs. Lange betrachtete er seine Soldaten schweigend. Die Männer verharrten regungslos. »Rühren!« befahl er ihnen leise. West, Shee, Sherbrooke und die anderen Offiziere mussten sich meist mit lauten Worten Aufmerksamkeit verschaffen. Arthur konnte flüstern – die Männer gehorchten.
Jeder von ihnen hatte mehr als drei Dienstjahre im 33. Infanterieregiment hinter sich. Jeder erinnerte sich bis ins kleinste Detail an den grauenhaften Flandernfeldzug und daran, wie ein dreiundzwanzigjähriger Junge mit silbernen Schulterstücken sie wieder nach Hause geführt hatte: über die Weser, die Alle und die Ems, über die eisigen, verschneiten Ebenen Hollands, durch die feindlichen Linien hindurch, auf die Schanzen von Boxtel und schließlich in den rettenden Hafen von Ostende.
Den Divisionskommandeur von Wesleys Brigade hatten die Männer während all der Schrecken nicht ein einziges Mal gesehen. Er hatte sich nicht darum gesorgt, ob sie aßen oder verhungerten, ob man für die Verletzten sorgte oder ob sie krepierten. Er hatte es nicht einmal für nötig befunden, sich darum zu kümmern, dass die Männer bis nach Ostende und lebend zurück nach England kamen. Nachdem man Frederick Augustus, Herzog von York und Albany, gemeldet hatte, dass der Tross und das Gepäck des Generalstabes in Sicherheit waren, hatte der Oberkommandierende sich erleichtert von seinem unglückseligen Kriegsschauplatz verabschiedet. Der dreiundzwanzigjährige Junge im roten Rock aber hatte die Männer nicht im Stich gelassen.
Als sie krank und halb tot vor Hunger nach Irland zurückkehrten, stellte sich heraus, dass das 33. Infanterieregiment das Regiment mit den geringsten Verlusten war – und eines der wenigen, das mit einem kleinen Sieg nach Hause kam. Vor dem Flandernfeldzug hatten die meisten der rauen Gesellen im roten Rock den Jungen mit den silbernen Schulterstücken nicht ernst genommen: Ein feiner Herr, der ein bisschen Soldat spielen wollte. Doch seit dem Flandernfeldzug verehrten sie ihren Obersten. Sie wussten, dass dieser feine Herr aus gutem Hause ein wahrer Soldat war und die Seele eines Kriegers besaß. Er hatte Not und Elend, Kälte und Hunger mit seinen Leuten geteilt. Nie hatte er sich selbst mehr zugestanden als ihnen. Oft hatte er den Schwächeren von dem Wenigen gegeben, das er selbst besaß – ohne Rücksicht auf den Rang. Heute waren die Männer des 33. Regiments bereit, Oberst Wesley durch die Hölle zu folgen, falls er es von ihnen verlangte.
Der Goldfuchs stand vollkommen regungslos, als Arthur den Marschbefehl nach Penang aus der Tasche zog. Mit ruhiger Stimme verlas er den Mannschaften und Offizieren, was sie in Kürze erwartete. »Ich weiß, dass ihr mich nicht enttäuschen werdet, Männer!« beendete er seine Ansprache – die längste, die Oberst Arthur Wesley vor seinem Regiment je gehalten hatte.
Genauso langsam, wie er zu seinen Männern geritten war, ritt er nun wieder fort. Erst als er aus dem Blickfeld seiner Rotröcke verschwunden war, ging ein Murmeln und Raunen durch die langen Reihen. »Maul halten!« herrschte Major John Shee seine Kompanien an. »Ich bitte Sie, meine Herren!« versuchte Francis West, die Aufmerksamkeit seiner Soldaten zurückzuerobern.
Oberstleutnant Sir John Sherbrooke stand unter Schock. Er sagte gar nichts.
Wesleys und Sherbrookes kleines Haus verwandelte sich von einem Tag auf den anderen in einen Bienenstock, der einem Stabsquartier ähnelte. Das 33. Regiment würde in Begleitung eines provisorischen Sepoy-Regiments ins Feld ziehen, das sich aus handverlesenen Männern der besten indischen Einheiten im Dienste der Ostindischen Kompanie zusammensetzte. Alles in allem würden 2200 Soldaten aus
Kalkutta nach Penang segeln und dort auf eine etwa gleich starke Truppe aus Madras treffen. Die auserwählten europäischen Regimenter waren das 12. Infanterieregiment mit 461 Mann unter Henry Harvey Ashton, das 74. Hochlandregiment von Connor McLeod mit 438 Mann, sowie 673 Sepoys aus Südindien und Einheiten der Königlichen und der Madras-Artillerie.
Arthur versuchte seine Vorbereitungen geheimzuhalten, um den Schlag gegen Spanisch-Manila als Überraschungsangriff führen zu können. Doch in den drei Monaten, die er sich nun in Indien aufhielt, hatte er begriffen, dass Britisch-Indien ein Dorf und die Zivilisten geschwätzige Marktweiber waren, die jedem, der es hören wollte, alles erzählten, was sie wussten. Darum griff Arthur bereits im Anfangsstadium seiner Vorbereitungen zu einer Kriegslist, die zugleich den ersten Versuch darstellte, seinen neuen militärischen Nachrichtendienst ins Feld zu schicken. Außer den langen Beratungen mit den englischen Offizieren in seinem kleinen Haus unweit von Fort William, fanden noch andere Konferenzen an einem weniger frequentierten Ort statt: Howrah und der Kaschmir-Serai entwickelten sich langsam, aber sicher zu Wesleys nächtlichen Stabsquartieren. Er hatte Lutuf Ullah für »die Sache« gewonnen. Einerseits gab es die Sympathie zwischen dem jungen britischen Offizier und dem alten Pferdehändler aus Kabul, andererseits erinnerte der Afghane sich mit einer gewissen Nostalgie an seine Jahre als »Gast« von Warren Hastings zurück. Er konnte seine pro-britische Einstellung nur schwer verbergen.
Doch Lutuf war für Arthur zu kostbar, als dass er den Kabuli wegen Penang eingesetzt hätte. Er setzte ihn nur ein, um zu ermitteln, ob die Männer, die Sir Edwin Halls abenteuerlustige Tochter anschleppte, für seine Zwecke geeignet waren oder nicht. Wesley und C 1 – so lautete seit kurzem der Deckname Lutuf Ullahs in den Büchern der Armee und der Ostindischen Kompanie – stellten erstaunt fest, dass die junge Frau sich nur selten irrte.
Bald schon schwirrten wilde Gerüchte durch die Märkte und Spelunken von Kalkutta. Einem dänischen Handelsschiff gestattete Kapitän Rodrick Brodham, der Hafenmeister, auf allerhöchsten Befehl sogar die Ausfahrt aus dem Hoogley in Richtung Spanisch-Manila. An Bord befand sich ein Seidenhändler aus Hyderabad, der nicht nur seine schönen teuren Stoffe im Gepäck hatte, sondern auch das Silber von »John Company« und eine Menge Neuigkeiten über einen bevorstehenden britischen Angriff gegen die Kolonie des neuesten französischen Verbündeten. Lutuf hatte den Mann empfohlen. Nicht etwa, weil er sich besonders zum Spion eignete, sondern weil er ein unverbesserliches Klatschmaul war. Rajendrah Singh wurde nicht bezahlt, um zu suchen und zu erkunden: Man hatte ihm die Silberlinge zugeschoben und ihn schwören lassen, dass er kein Wort sagen würde über das, was er wusste – was im Fall von Rajendrah Singh, dem geschwätzigen Seidenhändler aus Hyderabad, die beste Methode war, dafür zu sorgen, dass dem Feind jede Fehlinformation bis ins letzte Detail übermittelt wurde.
Während die Offiziere beratschlagten, Lutuf Ullah wilde Gerüchte in Umlauf setzte und Charlotte Hall Augen und Ohren nach vielversprechenden Rekruten für Wesleys Spionagedienst aufsperrte, mussten die Männer des 33. Regiments lernen, mit ihren indischen Kameraden aus den beiden Sepoy-Bataillonen zu kooperieren. Die Inder wurden von britischen Offizieren befehligt. Es waren Männer, die kein königliches Patent in der Tasche hatten, nur ein Patent der Ostindischen Kompanie. Sie waren meist um Jahre älter als ihre Kameraden im roten Rock und dienten schon seit ewigen Zeiten in Indien. Dennoch unterstand ein Hauptmann der »Company« stets einem Hauptmann des Königs, was anfangs nicht nur zu Konflikten mit Arthurs Offizieren führte, sondern sogar zu Streitigkeiten zwischen den britischen und den einheimischen Soldaten.
Doch ein Machtwort des jungen Obersten führte zumindest zu einem Waffenstillstand und dem Versuch friedlicher Kooperation zwischen beiden Seiten. Wesley hatte weder die Zeit noch die Lust, sich einen Angriff gegen die Spanier und damit gegen den französischen Erzfeind durch sinnlose Geplänkel in den eigenen Reihen verderben zu lassen. Und er brauchte in seinem Stab die Männer von »John Company«.
Das Machtwort Wesleys war für seinen Charakter bezeichnend gewesen. Er hatte die Offiziere von König und Company auf die jasminüberwachsene Veranda seines provisorischen Stabsquartiers gebeten. Höflich, aber sehr bestimmt. Dann hatte er sich vor der versammelten Bande eitler und streitsüchtiger Pfaue aufgebaut und ihnen deutlich gemacht, dass es ihn nicht im mindesten interessierte, wer welches Patent in welcher Tasche hatte. Sein Stab sei ein Team und habe entsprechend zu arbeiten. Einzelkämpfer und bornierte Individualisten, die nur an die nächste Beförderung dachten, wären ihm ein Gräuel; außerdem habe er keine Lust, seine Zeit mit dem Schlichten kindischer Streitigkeiten zwischen erwachsenen Männern zu vergeuden.
Vor Wesley hatten Hauptleute der Ostindischen Kompanie gestanden, die doppelt so alt waren wie er, denn um Kosten zu sparen, beförderte »John Company« nur entsprechend der Dienstzeit. Von tausend Offizieren der britischen Handelsgesellschaft waren insgesamt nur 62 im selben Rang wie Arthur. Der Ire war gerade erst sechsundzwanzig Jahre alt, seine Kameraden dagegen standen meist kurz vor der Pensionierung. Die Männer hatten nach Wesleys kerniger Ansprache geschluckt und verwundert festgestellt, dass Autorität und Führungsqualitäten nicht unbedingt graues Haar voraussetzten. Dann hatten sie ihr Haupt vor dem jungen Offizier gebeugt und seine Entscheidung akzeptiert. Von nun an verfügte das Expeditionskorps gegen Spanisch-Manila über einen Stab, in dem die Funktionen gerecht zwischen Königlichen und »Company«-Offizieren aufgeteilt waren.
Auch die zwei Adjutanten Wesleys kamen aus den einst gegnerischen Lagern. Der eine war Francis West, der seine Kompanien verlor und dafür eine Stabsfunktion gewann. Der andere war Hauptmann William Barclay von der Ostindischen Kompanie, der noch wenige Stunden zuvor mit West gestritten hatte, um herauszufinden, wer das Sagen hatte. Nun musste Barclay im Schnellverfahren lernen, nicht nur mit dem vorlauten Francis West zurechtzukommen, sondern auch die Befehle eines Obersten auszuführen, der an dem Tag auf die Welt gekommen war, an dem er selbst zum ersten Mal seinen Fuß auf indischen Boden gesetzt hatte.
Nachdem Arthur Wesley, der Kommandeur des 33. Regiments und Oberbefehlshaber in spe der Spanisch-Manila-Expedition, seinem verschüchterten und verunsicherten Umfeld erklärt hatte, was er von den Herren Offizieren erwartete – ohne dabei in Betracht zu ziehen, dass es Menschen gab, die mehr als vier Stunden Schlaf pro Nacht benötigten –, verschwand er wortlos in Richtung der Stallungen. Wenige Augenblicke später hörte man nur noch das Klappern von Hufen und sah einen wehenden, goldfarbenen Schweif zwischen den Wachposten hindurch in einer belebten Straße Kalkuttas verschwinden.
Seine Offiziere hatten nur eine einzige Aufgabe: die Soldaten tüchtig zu drillen und dafür zu sorgen, dass die Impedimenta einer militärischen Operation zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verladefertig vorbereitet waren.
Wesley dagegen hatte noch hundert andere Dinge zu erledigen. Zuerst fuhr er wie ein Tropensturm durch Fort William, um Sir John Shore und dem Vizegouverneur Bericht über die rein militärischen und die nicht-militärischen Aspekte der Operation zu erstatten. Dann machte Wesley denselben Blitzbesuch bei William Hickey, dem Residenten von »John Company«, am entgegengesetzten Ende von Kalkutta. Nach Hickey kamen das Observatorium und der kartographische Dienst an die Reihe. Ein sorgfältig geplanter Kriegszug verlangte mehr als nur vernünftiges Kartenmaterial. Details wie das voraussichtliche Einsetzen der Monsunstürme, die durchschnittliche Temperatur in Penang zur Zeit des geplanten Angriffs, die Höhe der Gezeiten an den Stränden von Penang, um Transportboote sicher an Land zu bringen und nicht sinnlos Soldatenleben zu opfern, spielten in Wesleys Planung eine genauso große Rolle wie die Anzahl der Patronen, die der Quartiermeister des 33. Regiments aus den Arsenalen von Kalkutta für die Briten und die Sepoys besorgen musste.
Irgendwann nach Einbruch der Dunkelheit stellte Wesley seinen verschwitzten Goldfuchs im Stall von Sir Edwin Hall ab. Der bengalische Bursche des Justizbeamten kannte das kleine Spiel bereits in- und auswendig. Noch bevor er dem erschöpften Tier Sattel und Zaumzeug abnahm, rannte er zum Wohnhaus der Halls, klopfte dreimal an die Tür, die von der Veranda zu Miss Charlottes Zimmer führte, und eilte dann in den Stall zurück. Währenddessen hatte sich der Kommandeur des 33. Regiments in einen nicht besonders auffälligen Einheimischen verwandelt, seine rote Uniform samt Waffe ins Stroh geworfen und zwei gesattelte, durchschnittliche Pferde in den Hof geführt. Bereits eine halbe Stunde später überquerten zwei Reiter die Brücke über den Hoogley und bahnten sich ihren Weg durch die überfüllten Straßen von Howrah in Richtung Kaschmir-Serai.
Charlotte fand das neue Spiel sehr aufregend. Arthur fand es anstrengend, denn er schaffte es nicht, einem Tag mehr als vierundzwanzig Stunden abzuringen. Als er sich in die bunt bestickten Kissen im Salon von Lutuf Ullah fallen ließ und sich unter dem aufmerksamen Blick einer bis über die Nase verschleierten Frau mit den Fingern eine große Portion Reis und fettes Lammfleisch – »rogan josh« – in einen »chappatti« legte, entfuhr es ihm auf Hindustani: »Dem Himmel sei Dank für das gastliche Haus meines geschätzten Freundes Lutuf und die nahrhafte Küche seiner Sahibaa Huneefa! Nie ist mir ein köstlicheres Mahl serviert worden als hier unter deinem Dach, und glücklich ist der Mann, der dich zum Weib hat!«
Lutufs Hauptfrau errötete leicht unter ihrem Schleier. Der junge britische Offizier hatte zwar einen grauenhaften Akzent, aber sie hatte ihn nun schon so oft Hindustani sprechen hören, dass sie ihn trotz seiner holperigen Aussprache ausgezeichnet verstand. Charlotte lachte schallend, und der Kabuli brummte gerührt: »Wesley-Sahib lernt schnell. Hör ihn dir an, Weib! Wenn er nicht mein Freund wäre, würde ich ihn für dieses unziemliche Schäkern mit der Sahibaa eines strenggläubigen Muslims erschlagen. Schließlich bin ich ein >hadji<, der den Weg nach Mekka schon zweimal gemacht hat.«
Huneefa verschwand kichernd hinter den Vorhängen ihrer Küche. Charlotte kreuzte die Beine und bediente sich nun gleichfalls aus der großen Kupferschüssel. »Haan! – Du hast Recht, Lutuf! Er lernt schnell. Wenn wir uns ein bisschen Mühe geben, machen wir aus diesem >gorah-log< noch einen echten >pahari<.«
Während Arthur sich seinen leeren Magen mit mehreren großen Portionen Hammelfleisch und Reis füllte und dazu Tasse um Tasse starken Kaffee trank, berichteten der Pferdehändler aus Kabul und Charlotte von der erfolgreichen Entsendung Rajendrah Singhs nach Penang. »Und du kannst mir glauben, Wesley-Sahib. Dieser Mann ist so geschwätzig, dass die Gerüchte eures bevorstehenden Angriffs bis zu den >heresi< nach Paris durchdringen werden, falls die Schiffe der Spanier schnell genug segeln, bevor der Monsun einsetzt.«
»Das wäre phantastisch, mein Freund. Aber so weit müssen die falschen Informationen gar nicht vordringen. Mir reicht es schon, wenn die Spanier davon überzeugt sind, dass wir Truppen von Osten her anlanden und dass nur Schiffe aus Kalkutta gegen Penang in See stechen ... Sag mal, warum nennt ihr die Franzosen >heresi<?«
Der alte Kabuli wischte sich die fettigen Finger an seinem Kaftan ab und rülpste genüsslich. Er war mit dem Mahl zufrieden, das Huneefa zubereitet hatte, und die Frage, die sein britischer Gast ihm gestellt hatte, gefiel ihm, denn er erzählte leidenschaftlich gerne von seinen weiten Reisen über den Subkontinent. Das Interesse an den »heresi«, den Franzosen, gab ihm nun Gelegenheit, von einem Winter im Maharastra zu berichten.
»Wesley-Sahib, was weißt du über den Süden?« leitete er seine Erzählung mit einer rhetorischen Frage ein.
Charlotte bediente sich genüsslich von einem silbernen Teller mit »gulab jamun«, »sandesh« und »gajar ka halwa«. Sie kannte die Geschichte, doch ihr war es lieber, dass der Kommandeur des 33. Regiments sie aus dem Munde von Lutuf Ullah vernahm. Es fiel ihr schwer einzuschätzen, ob die Trikolore über dem Palast des Sultans von Mysore eine Bedeutung für Britisch-Indien hatte.
Lutuf Ullah streckte sich bequem in seinen weichen Kissen aus und rülpste noch einmal. Für Wesley war dieses Verhalten befremdlich, für Huneefa, die Hauptfrau des Kabuli, ein Ausdruck äußerster Zufriedenheit mit einem opulenten Abendmahl und zugleich ein Befehl, ihrem Herrn und seinen Gästen eine weitere Kanne mit Kaffee zu servieren. Hinter den Teppichen, die ihre Küche vom Wohnraum abtrennten, huschte sie diensteifrig hervor. Zuerst schenkte sie ihrem Gemahl aus einer schlanken, hohen Kupferkanne das heiße, aromatische Getränk ein. Dann bediente sie die beiden Gäste.
»Gesell dich ein wenig zu uns, Weib!« knurrte Lutuf ihr freundlich zu. Seine Hand wies auf ein Kissen hinter Charlotte. Obwohl der Kabuli seine Frau liebte und achtete, musste sie – nach den Gesetzen seiner strengen Religion – doch an ihrem Platz bleiben. Und der war weit hinten, außerhalb des Sichtfelds der Geladenen.
Charlotte dagegen war eine Mamsahib, eine weiße Frau. Darum galten für die Tochter des höchsten britischen Justizbeamten in Indien andere Spielregeln. Lutuf hatte während seiner Jugendjahre als Geisel von Warren Hastings viel über die »firanguis« – die Europäer – gelernt. Auf ein Zeichen des Pferdehändlers schenkte seine Frau sich ebenfalls Kaffee ein, und ein anderes, tief verschleiertes Geschöpf brachte ihr demütig und mit gesenktem Haupt einen kleinen Teller voller orientalischer Süßigkeiten.
Als seine erwartungsvollen Zuhörer gut versorgt und die junge Nebenfrau wieder in der Küche verschwunden war, begann der Paschtune zu erzählen. Charlotte kannte ihn gut. Sie wusste, dass es eine lange Nacht werden würde, denn vor den aktuellen Ereignissen, die den Süden erschütterten, würde Wesley eine ausführliche Exkursion in die Geschichte des Maharastra über sich ergehen lassen müssen.
»Ah, meine Freunde! Ich führte ein unbeschwertes und leichtes Leben zwischen den Bergen meiner Heimat und den endlosen grünen Ebenen dieses Landes. Meine Jahre in Kalkutta, während ich die Gastfreundschaft des großen Hastings-Sahib genießen durfte – möge Allah sich seiner Seele annehmen, er war ein tapferer Krieger –, hatten mir eine zufriedene und treue Kundschaft unter den >pardesi< geschaffen. Ich brachte meine Pferde auf den Markt von Bhawanipur und anschließend, nach einer weiten Reise durch Orissa und den Karnataka, auf den Pferdemarkt von Chennai im Süden. Mit jedem Handelsunternehmen wurde ich reicher und angesehener. Immer wenn ich von meinen Abenteuern nach Hause zurückkehrte, stellte ich erfreut fest, dass mein Weib Huneefa mir wieder einen gesunden Sohn geschenkt hatte. Eines Tages beschloss ich, mein Weib an einer meiner Reisen nach Chennai teilhaben zu lassen. Also verbrachten wir, nachdem ich – Allah ist gütig – einhundert Pferde verkauft hatte, ruhige, beschauliche Tage in Fort St. George. Huneefa besuchte die Märkte der Stadt und kaufte feine Seidenstoffe und duftendes Santal ein. Ich selbst trank zufrieden Tee mit meinen Freunden, und wir unterhielten uns lange und ausführlich über die Geschäfte des vergangenen Jahres.« Er hielt kurz inne und seufzte.
»Genau in diese guten Tage an der Küste des heißen Meeres, das man auch den Golf von Oman nennt, fiel eine erschütternde Neuigkeit: Hyder Ali, der Herrscher von Mysore, ließ seine raubenden und plündernden Horden wieder auf den Karnataka los. Bis an die Zähne bewaffnet, unbeugsam und unbesiegt, bedrohten seine Maisuri-Krieger nicht nur das Landesinnere, sondern auch die Küste und Chennai – Fort St. George!«
Lutuf trank einen großen Schluck Kaffee und stopfte sich »lukkum« in den bärtigen Mund. »Schreckliche Tage erwarteten uns alle! Oh, ich muss es gestehen! Hyder Ali war ein großer Mann – tapfer, wagemutig und ohne Furcht. Ein wahrer Herrscher, den die >heresi< sich zum Freund und Verbündeten gemacht hatten. Der Sultan von Mysore verfolgte einen alten Traum seines Volkes: das Land unter einer Hand zu einen und wieder so stark zu machen wie in den glorreichen Tagen der Moguln ... Die >heresi< aber verfolgten einen anderen Traum – Indien und insbesondere den reichen Süden des Landes den >inglis< zu entreißen und wieder jene Vorherrschaft zu erringen, die Clive-Sahib ihnen so grausam entrissen hatte. Für die >heresi< war
Hyder Ali nur eine Schachfigur in ihrem neuen großen Spiel gegen die >inglis<. Mit jedem Schlag der Trommeln und Zimbeln kam der Schatten des Krieges näher und näher. Bald schon konnte man in Chennai am fernen Horizont den Rauch brennender Dörfer erkennen, und das Grollen der Kanonen raubte uns den Schlaf. Es waren furchtbare Tage. Als die Gefahr so groß schien, dass wir uns alle verloren glaubten, erwachten die >inglis< plötzlich aus ihrer sonderbaren Erstarrung. Cornwallis-Sahib zog die langen Stiefel an. Er war gerade erst, nach vielen Jahren auf der anderen Seite der Welt, nach Indien zurückgekehrt. Er sammelte die roten Röcke und die Sepoys um sich und Dutzende von großen, schweren Kanonen, die Tod und Verwüstung über Hyder Ali und das Maharastra bringen sollten. Ich war jung in diesen Tagen und hatte Geschmack am Abenteuer. Also vertraute ich Huneefa und meine Pferde einem alten Freund an – Orford-Sahib, dem Surveyor General von Fort St. George. Er und seine Sahibaa versprachen mir, die Ehre meines Weibes zu schützen, während ich mit den >inglis< gegen Hyder zog. Oh, Wesley, du kannst dir nicht vorstellen, wie gerührt Cornwallis-Sahib war, als ich mit meinen Paschtunen zu ihm kam und anbot, gegen unseren Feind zu ziehen. Lutuf ist ein Freund der >inglis<, und Cornwallis-Sahib versprach uns, dass die Armee und die Kompanie immer meine Pferde kaufen würden, damit der Reichtum und die Macht nie das Haus Ullah verließen. Es waren ruhmreiche Tage. Wir haben Tausende unserer Feinde erschlagen. Die anderen flüchteten zusammen mit ihren ungläubigen französischen Beratern wie die Hasen. Die Rache Allahs kam über Hyder, denn er hatte gefrevelt und den Islam verraten. Bald schon standen wir mit den >inglis< vor seiner Trutzburg – Seringapatam. Die Kanonen von Cornwallis-Sahib spien Tod und Verwüstung. Und obwohl die Mauern in sich zusammenstürzten wie Spielkarten, war der Kampf noch längst nicht entschieden. Die Monsunstürme setzten ein und ertränkten das Land. Die Geschütze konnten nicht mehr nach vorne und nicht mehr zurück bewegt werden. Zehntausend >inglis< und Sepoys lagen vor Seringapatam, und die Nahrung wurde mit jedem Tag knapper. Der Monsun brachte Fieber. Viele der >inglis< starben nicht durch die Hand des Feindes, sondern vor Hunger und Krankheit.« Wieder hielt er kurz inne, den Blick in die Vergangenheit gerichtet.
»Nach sechzehn endlos langen Wochen musste Cornwallis-Sahib aufgeben, obwohl wir alle Tag für Tag zu Allah gebetet hatten und um den Sieg flehten. Er zerstörte die Kanonen, und wir zogen wieder zurück nach Chennai. Obwohl wir Hyder Alis Trutzburg nicht hatten zerstören können, hatten wir den Maisuri und den >heresi< doch einen Schuss vor den Bug versetzt, wie ihr so schön sagt. Die Bedrohung des Karnataka und der Küste war verschwunden. Cornwallis-Sahib hatte einen großen Sieg errungen und die >heresi< von den Handelswegen vertrieben. Er hatte ihnen alle Häfen weggenommen und ihnen nur noch Pondicherry und das elende Fischerdorf Mahé gelassen ...«
Lutufs Blick war verträumt. Die Erinnerung an die Abenteuer seiner Jugend tat dem alten Paschtunen gut. Arthur hatte ihm aufmerksam zugehört. Er hatte nicht einmal gewagt, seinen Kaffee zu trinken, um auch ja kein Wort des Pferdehändlers zu verpassen. Nun aber hatte sein Freund aus den Bergen geendet, und er brannte vor Neugier und musste ihm einfach ein paar Fragen stellen.
»Lutuf, erinnerst du dich noch an die >heresi<, die mit Hyder Ali kämpften? Waren es viele, oder bildeten sie nur seine Maisuri aus? Wie sieht diese Festung Seringapatam aus? Haben die Moguln sie erbaut, oder waren es unsere Leute? Warum ist Cornwallis mitten durch den Monsun gegen den Feind gezogen? Wieso ist euch die Nahrung ausgegangen?«
Charlotte grinste und knabberte an einer kandierten Mandel. Huneefa schüttelte unter ihrem Schleier den Kopf. Sie verstand genügend »inglis«, um der Erzählung ihres Gemahls zu folgen. Außerdem war sie ja selbst dabeigewesen.
Zufrieden strich Lutuf sich über den roten Bart. »Wesley-Sahib, ich freue mich, dass meine kleine Geschichte dir so gut gefallen hat. Was die >heresi< angeht, kann ich dir natürlich einiges erzählen, doch was die Eingebungen von Cornwallis-Sahib und den >inglis<-Soldaten anbetrifft, ist es schwierig. Ich bin ein Pferdehändler und kein Berufssoldat, mein Freund.«
»Versuch dich zu erinnern, Lutuf! Was in den Büchern geschrieben steht, habe ich gelesen ... aber du hast alles selbst erlebt. Bücher ersetzen nicht den Bericht des Augenzeugen.«
Der Ire war aufgeregt wie ein Kind. Das erste Kapitel über Indien, das er am ersten Tag seiner Reise gelesen hatte, handelte von Mysore und Hyder Ali. Er hatte erfahren, dass die Maisuri und ihr Sultan Englands gefährlichster und aktivster Feind in Indien gewesen waren. Sein
Sohn, Tippu, schien Hyder in nichts nachzustehen. England hatte in Indien nicht nur Siege errungen, sondern auch grauenhafte und demütigende Niederlagen erlitten. Am 10. September 1780 war sogar eine ganze britische Armee von mehr als 3700 Mann vollständig aufgerieben worden: Hyder hatte das Gemetzel inszeniert und Tippu bei Perambakam die Pläne des Sultans in die Tat umgesetzt. Eine zweite britische Streitmacht, die sich nur zwei Meilen von Baillie und seinen bedrängten Soldaten befunden hatte, war durch den Lärm des Kampfes so verunsichert worden, dass General Hector Munro sich zurückzog, statt Baillie zu Hilfe zu kommen.
»Cornwallis zog von Vellore aus durch den Baramahal und die östlichen >gauths< auf die südindische Hochebene. Zuerst hat er Bangalore genommen. Mit Bangalore als Nachschubbasis schickte er sich an, gegen Hyder Ali und Mysore zu marschieren«, konstatierte Arthur, um Lutufs Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
»Sicher, Wesley-Sahib! Auf der Karte, die Moll-Sahib vor achtzig Jahren gezeichnet hat, sieht das auch sehr einfach aus. Aber in der Realität bedeutet dies, zuerst durch ein langes, enges Tal zu marschieren, zu dessen linker und rechter Seite sich nichts als Steinwüste befindet. Dann geht es über die Pässe. Sie sind unbefestigt. Nichts als Steine und Sand. Die Geschütze bereiten furchtbare Probleme; ihre Räder, ihre Achsen brechen, die Zugtiere sind zu Tode erschöpft. Sie müssen gut gefüttert werden, um die Strapazen zu überstehen. Für dieses Futter brauchen die Sahibs aber Trosswagen, und die haben Achsen, Räder und Zugtiere ... Der Weg, den Cornwallis gewählt hat, war gut und vernünftig – für eine Handelskarawane mit sechzig oder siebzig Dromedaren und ein paar Elefanten. Doch für eine große Streitmacht mit einem riesigen, unübersichtlichen und hungrigen Tross war es einfach zu weit. Der Gouverneur-Sahib ist nicht durch den Monsun gezogen. Der Monsun hat ihn nur eingeholt, mein Freund.«
Arthur nickte nachdenklich. Charlotte beobachtete ihn und Lutuf aufmerksam. Huneefa schien in ihrem weichen Kissenberg friedlich eingeschlafen zu sein.
»Du musst selbst in den Karnatik hinunterreiten und mit eigenen Augen sehen, welche Hindernisse die Natur einer Armee in den Weg legt. Für uns und unsere Handelskarawanen ist alles viel einfacher, Wesley-Sahib. Niemand zwingt uns, schnell zu reisen. Wir haben keine Feinde vor oder hinter uns. Gastliche Serais gibt es überall ...«
»Ich habe verstanden, Lutuf. Eine gute Karte allein reicht nicht, um einen Kriegszug zu planen. Erzähl mir von den Franzosen.«
Der Kabuli schenkte sich Kaffee nach und überlegte einige Minuten, bevor er antwortete: »Es sind sonderbare Männer, diese >heresi<, die Hyder Ali und heute Tippu dienen. Ich bin nicht nur unter den Fahnen des Krieges nach Mysore gezogen. Letztes Jahr waren mein Ältester, Barrak ben Lutuf ibn Ullah, und unser >jawan< Hadji Bedi ben Haleff ibn Ullah in Seringapatam. Tippu hatte eine große Anzahl Pferde von uns gekauft, und ich habe meinen Sohn geschickt, um das Geld für die Tiere zu holen und dem Sultan unsere Aufwartung zu machen. Weißt du, ich bin ein Handelsherr. Ich muss mich mit allen Kunden gut stellen.« Lutuf zwinkerte dem Iren verschmitzt zu. »Aber jeder hier in Bharat weiß um die vertrauliche Beziehung zwischen mir und den >inglis<, deswegen schicke ich immer Barrak und Bedi ben Haleff los, wenn wir mit unabhängigen Gebieten arbeiten, die George-Sultan und dem >Raj< nicht wohlgesonnen sind.«
»Weiter, mein Freund! Mach es doch nicht so spannend!« trieb Arthur den Paschtunen an.
Doch der alte Mann besaß die sonderbare orientalische Ruhe, und nichts konnte ihn erschüttern. »Acha, Wesley-Sahib! Acha! Gedulde dich ... Die Uhren in Bharat gehen viel langsamer als dieses schöne Stück von Piaget, das du in deiner Tasche versteckst.«
Arthur lachte schallend. Die Spannung, die von ihm Besitz ergriffen hatte, löste sich mit einem Schlag. »Du hast die Augen eines Adlers, mein Freund.«
»Ein Mann, der so pünktlich ist wie du, muss eine Uhr der >heresi< besitzen. Man sagt, es seien die besten Uhren der Welt«, amüsierte sich der Kabuli. Dann erhob er sich aus seinen Kissen. »Du willst den Rest der Geschichte hören? Warte, es fehlt noch ein Mann in dieser Runde. Ich wollte ihn dir schon lange vorstellen, doch Allah hatte erst heute die Güte, mir den Stolz der Familie Ullah zurückzuschicken. Er hat einen weiten Weg hinter sich. Seine Karawane aus Dagestan ist erst vor wenigen Stunden im Serai eingetroffen, und meine gute Huneefa bestand darauf, dass ihr Augapfel sich zuerst ausruht ...«
Er verließ den schönen, teppichgeschmückten Salon und verschwand in den unergründlichen Tiefen seiner Gemächer. Arthur sah Charlotte neugierig an. Doch Sir Edwin Halls Tochter schwieg und knabberte genussvoll orientalische Süßigkeiten.
Eine Viertelstunde später tauchte Lutuf gemeinsam mit einem jungen Mann wieder auf. Er war etwa im selben Alter wie Wesley, hochgewachsen und sehr schlank. Seine Kleidung war prächtig. Ein edelsteingeschmückter Dolch steckte unter einer feuerroten, fein bestickten Schärpe. Im Gegensatz zu seinem konservativen Vater trug der junge Barrak europäische Reitstiefel und eine teure Reithose aus Leder unter seinen weiten Gewändern. Seine grünen Augen strahlten, als er Charlotte Hall erblickte. Langes, gewelltes schwarzes Haar fiel ihm locker über die Schultern. In der Intimität des Hauses seines Vaters trug der Patschtune keinen Turban. Wesley bemerkte, dass auch Charlottes Augen aufleuchteten, als Barrak den Raum betrat. Zuerst verbeugte der Sohn des Pferdehändlers sich vor seiner Mutter. Sie war aufgewacht, als sie seine Schritte vernommen hatte, und schnatterte besorgt unter ihrem Schleier. Doch Barrak beruhigt sie in der Sprache seiner Väter, dann küsste er ihr die Hände und die Stirn. Vor Wesley verbeugte er sich kurz und respektvoll, senkte aber nicht das Haupt. Der Ire erwiderte den Gruß. Schließlich kam die Reihe an Charlotte. Lutufs Mund verzog sich zu einem breiten, wohlgefälligen Grinsen, als sein Sohn zu der jungen Frau hintrat.
»Sallam aleikkum! Der Friede sei mit dir und mit den Deinen, Charlotte!« begrüßte er sie in der persischen Hochsprache, während seine Rechte Stirn und Brust berührte.
»Em aleikkum esallam, Barrak ben Lutuf ibn Ullah! Und der Friede sei mit dir! Ich hoffe, dass Allah seinem getreuen Diener auf seiner langen Reise nach Dagestan all das gegeben hat, was du dir gewünscht hast. Ich freue mich, dich wohlbehalten wiederzusehen. Der Weg war weit und gefährlich, doch das Haus der Ullah steht unter einem guten Stern! Ich habe jeden Tag für deine glückliche Heimkehr gebetet!« antwortete die junge Frau in einem eleganten Farsi.
Der junge Paschtune lächelte sie glücklich an. Dann holte er aus seinem weiten Gewand ein kleines Päckchen hervor und hielt es Charlotte hin. »Allah war gnädig! Wir haben herrliche Tiere gekauft und zu einem sehr guten Preis ... Pferde mit einer goldenen Robe, des Propheten würdig und ausdauernd wie Windhunde. Deine Gebete sind von Allah erhört worden ...«
Sir Edwins Tochter kreuzte die Hände vor der Brust und beugte ihr Haupt leicht vor Barrak, dann nahm sie das Geschenk aus seinen Händen entgegen. Vorsichtig öffnete sie das Seidentuch. Ein sonderbarer, fast durchsichtiger Stein hob sich leuchtend vom dunklen Stoff ab. Charlotte hob den Blick. Fast strafend schüttelte sie den Kopf. Doch Lutuf warf ihr über die Schulter seines Sohnes nur ein munteres »Shabash, shabash!« zu und lachte.
Barrak hatte Charlotte einen fast eigroßen Rohdiamanten in die Hände gelegt. Leise, für Wesley unverständlich, dankte sie Lutufs Ältestem in der persischen Hochsprache. Noch einmal verbeugte der junge Mann sich vor ihr, berührte Stirn und Brust mit der Rechten und ließ sich dann – unter dem wohlwollenden Blick seines Vaters – neben der jungen Frau nieder. Interessiert hatte Arthur beobachtet, wie sehr Charlotte sich in der Gesellschaft des Paschtunen veränderte: Sie schien weiblicher, sanfter und weniger aggressiv als sonst.
»So, Wesley-Sahib! Nun können wir deine Neugier über Mysore und Tippu befriedigen. Mein Sohn wird dir erzählen, was er und der >jawan< gesehen haben ... Übrigens, Barrak spricht eure Sprache. Er hat sogar die >madrissah< der Sahibs besucht – St. John of Calcutta. Möge Allah sich meiner erbarmen, es sind Ungläubige, die die >madrissah< leiten. Aber Hastings-Sahib sprach immer davon, dass Wissen Macht sei, deswegen habe ich Barrak in die >madrissah< geschickt.«
»... und dann nach Europa, >baba<! Ich bin in London gewesen und habe dann ein ganzes Jahr lang Ihr Land bereist und viel gelernt, Oberst Wesley!« unterbrach Barrak seinen Vater sehr selbstbewusst. Sein Englisch war fast perfekt. Hätte der Paschtune nicht die Tracht seines Volkes getragen, Arthur hätte ihm ohne Frage geglaubt, dass er Europäer sei.
»Es ist nicht mein Land, Ibn Ullah«, erwiderte der Offizier leise. »Ich bin Ire.«
Barrak schmunzelte. »Während meiner Reise habe ich bemerkt, dass Ihr Volk und die >inglis< nicht gerade die besten Beziehungen haben. Nicht nur in Indien stiftet die Religion Unfrieden, nicht wahr?«
Wesley nickte. Sein Gesichtsausdruck war ein bisschen nachdenklich. Immer, wenn er weit von den Inseln fort in der Fremde war, spürte er, wie sehr er doch Ire war und wie wenig ihn mit den Engländern verband. Sie benahmen sich überall wie die Herren der Welt und konnten sich nirgendwo anpassen.
Lutuf hatte sich wieder bequem in seinen Kissen ausgebreitet und bediente sich vom großen Silberteller mit den orientalischen Süßigkeiten. Es schien, als wollte er seinem ältesten Sohn und Erben nun die ganze Initiative überlassen. Barrak tauschte sich zuerst leise auf Persisch mit Charlotte aus. Wesley verstand, dass er sich bei der jungen Frau sehr höflich dafür entschuldigte, dass er nun seine Aufmerksamkeit dem Gast von den britischen Landstreitkräften zuwenden müsse. Sir Edwin Halls Tochter lächelte ihm nur aufmunternd zu und legte ihre kleine Hand beschwichtigend auf seinen Arm.
»Als wir den letzten Winter in Mysore verbrachten, haben wir nur ein einziges europäisches Regiment im Dienst des Sultans bemerkt. Es wird von Franzosen befehligt, besteht aber aus einer bunten Mischung europäischer Söldner. Sogar Engländer, die aus Euren Truppen und denen der Ostindischen Kompanie geflüchtet sind, dienen Tippu. Er bezahlt die Männer und die französischen Offiziere fürstlich. Von Zeit zu Zeit empfängt er geheimnisvolle Boten, die über Pondicherry aus Frankreich zu ihm kommen. Die Maisuri verfügen über viele europäische Kanonen. Die Wälle von Seringapatam sind reich bestückt, aber ich konnte nicht alles sehen ... es gibt streng bewachte Sperrgebiete an den Außenmauern der Stadt und ein Waffenlager, zu dem der Zutritt verwehrt ist. Die meisten Geschütze werden von den Europäern bedient. Einige wenige von ausgesuchten Männern aus der Leibgarde Tippus. Er selbst ist ein sehr beeindruckender Mann. Mutig wie ein Tiger, gerissen wie ein Affe und falsch wie eine Schlange. Sein Volk verehrt ihn. Obwohl er ein strenggläubiger Muslim ist, behandelt er die anderen religiösen Gruppen, die in seinem Herrschaftsgebiet leben, gerecht und respektvoll. Sein Fürstentum ist unendlich reich. Ein großer Teil dieser Schätze wurde in den Ausbau der Verteidigungsanlagen in Mysore investiert und in den Ankauf guter europäischer Bewaffnung für die Fußtruppen. Ich hatte im Verlauf der vier Monate, die ich dort war, irgendwie das Gefühl, dass Tippu große Pläne schmiedet. Täglich inspizierte er seine Truppen. Laufend ließ er sich von seinen französischen Offizieren vorführen, wie weit die Ausbildung der Männer gediehen war. Er muss Unsummen verschwendet haben, um seine Landsleute an den europäischen Geschützen mit scharfer Munition üben zu lassen ... und er verhandelt mit den Herrschern der Fürstentümer von Audh und Gujerat. Sogar Boten des Nizam von Hyderabad kamen und gingen. Ich bin kein Politiker, Oberst Wesley, aber selbst einem einfachen Kaufmann wie mir fiel diese unterschwellige Spannung in der Hauptstadt auf und die Wehrhaftigkeit, die die gesamte Provinz ausstrahlte. Die südliche Hälfte des Kontinents wird bald schon vor Tippu und seinen französischen Verbündeten zittern.«
Wesley pfiff durch die Zähne. Der Bericht von Barrak ben Lutuf ibn Ullah war all seine gelehrten Bücher und die schlafraubenden Studien wert. In Fort William war das Problem Tippu Sultan nie in dieser Schärfe und Tiefe angesprochen worden. Es schien auch keine bedrohlichen Meldungen aus Fort St. George zu geben, die Sir John Shore irgendwie in Aufregung versetzten. Das Gehirn des Iren arbeitete schnell: Falls der Generalgouverneur wusste, dass im Herzen Indiens eine solche Gefahr in Gestalt eines geachteten, einheimischen Herrschers und französischer Militärberater lauerte, war es sträflicher Leichtsinn, eine Expedition gegen Spanisch-Manila zu befehlen und die britischen und Sepoy-Kontingente auszudünnen, um sich mit einem unbedeutenden Gegner wegen eines lächerlichen Hafens zu schlagen.
»Gibt es eine Möglichkeit, diskret und schnell Informationen aus Mysore zu bekommen?«
Es war Charlotte, die Arthurs Frage beantwortete. »Im Baramahal hat die Ostindische Kompanie einen tüchtigen Militärkommandeur: Oberstleutnant Read! Sein Vorname fällt mir nicht ein, Arthur, aber ich weiß von meinem Vater, dass es derselbe Read ist, der die neue Straße von Vellore nach Ryacotta und bis an die Grenze von Mysore gebaut hat. Read hat einen Steuerbeamten, Hauptmann MacLeod, der gleichzeitig für den Gouverneur von Madras, Lord Clive, herumschnüffelt ... zumindest hab ich das vor ein paar Wochen aufgeschnappt, als Sir John und Hyde Colebrooke bei uns zu Hause eingeladen waren.«
Barrak ben Lutuf ibn Ullah nickte der jungen Frau zu. »Du hast Recht. Ich habe nicht mehr an MacLeod gedacht. Aber der hat noch nie seinen Fuß über die Grenze nach Mysore gesetzt. Er muss sich an die Gebiete der Ostindischen Kompanie halten. Vielleicht wäre es einfacher, Oberst Wesley würde sein Glück bei den Führern der großen Handelskarawanen versuchen, oder bei den >hirrcarrahs<.«
»Du weißt, wie misstrauisch die Menschen unten im Süden sind, mein Sohn!« warf Lutuf ein. »Wenn Wesley-Sahib sich der >hirrcarrahs< bedienen will, muss er Leute aus dem Maharastra, dem Karnataka und dem Dekkan anwerben. Ein >brahmin< aus Kalkutta oder Chennai würde sofort alle Augen in Seringapatam auf sich ziehen...Vielleicht, wenn du mit N Govinda Bhat Verbindung aufnehmen würdest...«
»Den hätte ich fast vergessen, Vater! Aber N Govinda ist ein fetter, träger Feigling.«
»Trotzdem ist er seit zwanzig Jahren mein treuer Diener im Serai von Seringapatam. Er hat dem Hause Ullah noch nie einen einzelnen >pagoda< unterschlagen oder uns auch nur um das Kupferkleingeld betrogen. Und selbst wenn er vor Angst zittert – er wird Bedi ben Haleff keinen Wunsch abschlagen. Wir haben N Govinda immer gut für seine Dienste entlohnt. Er ist loyal und weiß, dass die Paschtunen kein großes Aufheben machen, wenn man sie betrügt ...«
Der Pferdehändler fuhr sich mit einer raschen Geste über die Stelle, an der sich unter seinem langen Bart offensichtlich der Hals verbarg. Wesley beobachtete still, während sein Verstand auf Hochtouren arbeitete. Lutuf hatte recht: Die Führer der Karawanen und die Kaufleute stellten eine unerschöpfliche Informationsquelle dar. Doch einer einzigen Quelle zu vertrauen war Leichtsinn, darum brauchte er mindestens drei parallel existierende, aber voneinander völlig unabhängige Spionagenetze. Er hatte in Fort William sehr diskret Auskünfte über seinen Freund aus Kabul eingeholt. Man hatte ihm bestätigt, dass der Mann – seit er Geisel von Warren Hastings gewesen war – ein Freund der Briten war. Er hatte schon öfter Dienste und Gefälligkeiten erwiesen.
Damit hatte der Ire sein erstes Netzwerk abgesichert und guten Händen anvertraut. Er würde dafür sorgen, dass man dem Kabuli für die wertvollen Dienste, die er leistete, seine schönen Pferde zu Höchstpreisen abkaufte.
Was das zweite und dritte Spionagenetz anging, war er sich an diesem Abend plötzlich sicher, dass die Zeit dieses Problem von alleine lösen würde: der Zufall, gepaart mit seinem täglich wachsenden Verständnis des neuen Kriegsschauplatzes und ein paar ausgedehnten Reisen über Land ... Nach der Expedition gegen Spanisch-Manila wollte er weitersehen.
Erst in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages verabschiedeten sich Arthur und Charlotte. Während der Offizier die junge Frau zurück nach Chowringhee begleitete, hatte er das Gefühl, dass sie Barrak ben Lutuf ibn Ullah nur ungern verlassen hatte, und auch in den grünen Augen des ältesten Sohnes seines Freundes aus den wilden afghanischen Bergen hatte er so etwas wie Trauer ausgemacht. Außerdem war Sir Edwin Halls Tochter ungewöhnlich schweigsam. »Du hast ihn gern, nicht wahr?« versuchte er sein Glück.
»Wir kennen uns seit ewigen Zeiten. Als der alte Lutuf Barrak aufs St. John’s College schickte, hat er bei uns gewohnt, und Mama und Papa haben sich um ihn gekümmert, während sein Vater auf seinen ausgedehnten Handelsreisen war. Darum spricht er so gut Englisch. Er ist ein bisschen wie ein älterer Bruder. Barrak wäre damals fast von der Schule geflogen, weil er den Sohn eines Mitarbeiters von Hickey fürchterlich verprügelt hat.«
»Der Unglückliche hat sich ...«
»... über meine Brille lustig gemacht. Du hast’s erfasst, Arthur.«
»Ich mag Lutufs Sohn. Er ist ein kluger Kopf.«
»Nicht nur ein kluger Kopf, mein Lieber! Eines Tages wird er in sein Land zurückkehren und dort einen sehr bedeutenden Platz einnehmen. Lutuf ist nicht bloß ein steinreicher Pferdehändler aus den Bergen, er ist der Bruder des Amirs von Kabul.«
»Wessen Bruder?« Wesley hatte viel über Indien gelesen, aber mit dem Norden und Afghanistan hatte er sich nie auseinandergesetzt. »Das ist so etwas Ähnliches wie ein Rajah oder ein Sultan. Lutuf ist nicht nur schon zweimal in Mekka gewesen, seine Vorfahren kommen aus der arabischen Wüste und können ihre Ahnenreihe bis in die Tage des Propheten zurückverfolgen. Sie sind sehr einflussreich und mächtig. Der Pferdehandel liegt den Paschtunen im Blut. Deshalb kommen sie hierher und verkaufen ihre Tiere. Aber sie brauchen den Handel nicht. Sie sind unermesslich reich. In ihren Bergen gibt es Edelsteine von sagenhafter Reinheit. Und auch Silber. Darum hilft Lutuf jetzt dir, und darum hat er seinen Sohn in die Schulen der Ungläubigen und sogar nach England geschickt. Der Amir hat keinen Erben. Der nächste Amir von Kabul wird Barrak ibn Lutuf ben Ullah heißen ...«