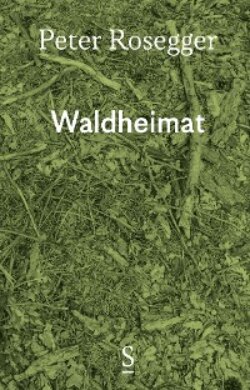Читать книгу Waldheimat - Peter Rosegger - Страница 5
VOM URGROSSVATER, DER AUF DER TANNE SASS
ОглавлениеEine Rückschau, nach der Erzählung meines Vaters
An die Felder meines Vaters grenzte der Ebenwald, der sich über Höhen weithin gegen Mitternacht erstreckte und dort mit den Hochwaldungen des Heugrabens und des Teufelsteins zusammenhing. Zu meiner Kindeszeit ragte über die Fichten- und Lärchenwipfel dieses Waldes das Gerippe einer Tanne empor, auf welcher der Sage nach vor mehreren hundert Jahren, als der Türke im Lande war, der Halbmond geprangt haben und unter welcher viel Christenblut geflossen sein soll.
Mich überkam immer ein Schauern, wenn ich von den Feldern und Weiden aus dieses Tannengerippe sah; es ragte so hoch über den Wald und streckte seine langen, dürren, wildverworrenen Äste so wüst gespensterhaft aus, daß es ein unheimlicher Anblick war. Nur an einem einzigen Aste wucherten noch einige dunkelgrüne Nadelballen, über diese ragte der scharfkantige Strunk, auf dem einst der Wipfel gesessen. Den Wipfel mußte der Sturm oder ein Blitzstrahl geknickt haben, niemand erinnerte sich, ihn auf dem Baume gesehen zu haben.
Von der Ferne, wenn ich auf dem Stoppelfelde die Rinder oder die Schafe weidete, sah ich die Tanne gern an; sie stand in der Sonne rötlich beleuchtet über dem frischgrünen Waldessaume, und war klar und rein in die Bläue des Himmels hineingezeichnet. Dagegen stand sie an bewölkten Tagen, oder wenn ein Gewitter heranzog, starr und dunkel da; und wenn im Walde weit und breit alle Äste fächelten und sich die Wipfel tief neigten vor dem Sturme, so stand sie still, ohne Regung und Bewegung.
Wenn sich aber ein Rind in den Wald verlief und ich, es zu suchen, an der Tanne vorüber mußte, so schlich ich gar angstvoll dahin und dachte an den Halbmond, an das Christenblut und an andere entsetzliche Geschichten, die man von diesem Baume erzählte. Ich wunderte mich aber auch über die Riesigkeit des Stammes, der auf der einen Seite kahl und von vielen Spalten durchfurcht, auf der anderen aber mit rauhen, zersprungenen Rinden bedeckt war. Der unterste Teil des Stammes war so dick, daß ihn zwei Männer nicht hätten zu umspannen vermocht. Die ungeheuren Wurzeln, welche zum Teile kahl dalagen, waren ebenso ineinander verschlungen und verknöchert wie das Geäste oben.
Man nannte den Baum die Türkentanne oder auch die graue Tanne. Von einem starrsinnigen oder hochmütigen Menschen sagte man in der Gegend: „Der tut, wie wenn er die Türkentanne als Hutsträußl hätt’!“ Und heute, da der Baum schon längst zusammengebrochen und vermodert, ist das Sprüchlein in manchem alten Munde noch lebendig.
In der Kornernte, wenn die Leute meines Vaters, und er voran, der Reihe nach am wogenden Getreide standen und die „Wellen“ herausschnitten, mußte ich auf bestimmte Plätze die Garben zusammentragen, wo sie dann zu je zehn in „Deckeln“ zum Trocknen aufgeschobert wurden. Mir war das nach dem steten Viehhüten ein angenehmes Geschäft, um so mehr, als mir der Altknecht oft zurief: „Trag’ nur, Bub’ und sei fleißig; die Zusammentrager werden reich!“ Ans Reichwerden dachte ich nicht, aber das Laufen war lustig. Und so lief ich mit den Garben, bis mein Vater mahnte: „Bub’ du rennst ja wie närrisch! Du trittst Halme in den Boden und du beutelst Körner aus. Laß dir Zeit!“
Als es aber gegen Abend und in die Dämmerung hineinging und als sich die Leute immer weiter und weiter in das Feld hineingeschnitten hatten, so daß ich mit meinen Garben weit zurückblieb, begann ich unruhig zu werden. Besonders kam es mir vor, als fingen dort die Äste der Türkentanne, die in unsicheren Umrissen in den Abendhimmel hineinstand, sich zu regen an. Ich redete mir zwar ein, es sei nicht so, und wollte nicht hinsehen – da hüpften meine Äuglein schon wieder hinüber.
Endlich, als die Finsternis für das Kornschneiden zu groß wurde, wischten die Leute mit taunassem Grase ihre Sicheln ab und kamen zu mir herüber und halfen mir unter lustigem Sang und Scherz die letzten Garben zusammentragen. Als wir damit fertig waren, gingen die Knechte und Mägde davon, um in Haus und Hof noch die abendlichen Verrichtungen zu tun; ich und mein Vater aber blieben zurück auf dem Kornfelde. Wir schoberten die Garben auf, wobei der Vater diese halmaufwärts aneinanderlehnte und ich sie zusammenhalten mußte, bis er aus einer letzten Garbe den Deckel bog und ihn auf den Schober stülpte.
Dieses Schöbern war mir in meiner Kindheit die liebste Arbeit; ich betrachtete dabei die „Romstraße“ am Himmel, die hinschießenden Sternschnuppen und die Johanniswürmchen, die wie Funken um uns herumtanzten, daß ich meinte, die Garben müßten zu brennen anfangen. Dann horchte ich wieder auf das Zirpen der Grillen, und ich fühlte den kühlen Tau, der gleich nach Sonnenuntergang die Halme und Gräser und gar auch ein wenig mein Jöpplein befeuchtete. Ich sprach über all das mit meinem Vater, der mir in seiner ruhigen, gemütlichen Weise Auskunft gab und über alles seine Meinung sagte, wozu er jedoch oft bemerkte, daß ich mich darauf nicht verlassen solle, weil er es nicht gewiß wisse.
So kurz und ernst mein Vater des Tages in der Arbeit gegen mich gewesen, so heiter, liebevoll und gemütlich war er in solchen Abendstunden. Vor allem half er mir immer meine kleine Jacke anziehen, daß mir nicht kühl werde. Wenn ich ihn mahnte, daß auch er sich den Rock zuknöpfen möge, sagte er stets: „Kind, mir ist warm genug.“ Ich hatte es oft bemerkt, wie er nach dem langen, schwierigen Tagewerk erschöpft war, wie er sich dann für Augenblicke auf eine Garbe niederließ und die Stirne trocknete. Er war durch eine langwierige Krankheit recht erschöpft worden; er wollte aber nie etwas davon merken lassen. Er dachte nicht an sich, er dachte an unsere Mutter, an uns Kinder und an den durch Unglücksfälle herabgekommenen Bauernhof, den er uns retten wollte.
Wir sprachen beim Schöbern oft von unserem Hofe, wie er zu meines Großvaters Zeiten gar reich und angesehen gewesen und wie er wieder reich und angesehen werden könne, wenn wir Kinder, einst erwachsen, eifrig und fleißig in der Arbeit sein würden, und wenn wir Glück hätten.
In solchen Stunden beim Kornschöbern, das oft spät in die Nacht hinein währte, sprach mein Vater mit mir auch gern von dem lieben Gott. Er war vollständig ungeschult und kannte keine Buchstaben; so mußte denn ich ihm stets erzählen, was ich da und dort von dem lieben Gott schon gehört oder endlich auch gelesen hatte. Besonders wußte ich dem Vater manches zu berichten von der Geburt des Herrn Jesus, wie er in der Krippe eines Stalles lag, wie ihn die Hirten besuchten und mit Lämmern, Böcken, und anderen Dingen beschenkten, wie er dann groß wurde und Wunder wirkte und wie ihn die Juden peinigten und ans Kreuz schlugen. Gern erzählte ich auch von der Schöpfung der Welt, den Patriarchen und Propheten, als wäre ich dabei gewesen. Dann sprach ich auch aus, was ich vernommen von dem jüngsten Tage, von dem Weltgerichte und von den ewigen Freuden, die der liebe Gott für alle armen, kummervollen Menschen in seinem Himmel bereitet hat.
Der Vater war davon oft sehr ergriffen.
Ein anderes Mal erzählte wieder mein Vater. Er wußte wunderbare Dinge aus den Zeiten der Ureltern, wie diese gelebt, was sie erfahren und was sich in diesen Gegenden einst für Sachen zugetragen, die sich in den heutigen Tagen nicht mehr ereignen.
„Hast du noch nie darüber nachgedacht“, sagte mein Vater einmal, „warum die Sterne am Himmel stehen?“
„Nein“, antwortete ich.
„Wir denken nicht daran“, sprach mein Vater weiter, „weil wir das schon so gewöhnt sind.“
„Es wird wohl eine Zeit kommen, Vater“, sagte ich einmal, „in welcher kein Stern mehr am Himmel steht; in jeder Nacht fallen so viele herab.“
„Die da herabfallen, mein Kind“, sprach der Vater, „das sind Menschensterne. Stirbt auf der Erde ein Mensch, so fällt vom Himmel so eine Sternreispe auf die Erden. Siehst du, dort hinter der grauen Tanne ist just wieder eine niedergegangen.“
Ich schwieg nach diesen Worten eine Weile, endlich aber fragte ich: „Warum heißen sie jenen wilden Baum die graue Tanne, Vater?“
Mein Vater bog eben einen Deckel ab, und als er diesen aufgestülpt hatte, sagte er: „Du weißt, daß man ihn auch Türkentanne nennt, weil der schreckbare Türk einmal seine Mondsichel hat draufgehangen. Die graue Tanne heißen sie ihn, weil sein Geäste und sein Moos grau ist, und weil auf diesem Baume dein Urgroßvater die ersten grauen Haare bekommen hat.“
„Mein Urgroßvater? Wie ist das hergegangen?“
„Ja“, sagte er, „wir haben hier noch sechs Deckel aufzusetzen, und ich will dir dieweilen eine Geschichte erzählen, die sehr merkwürdig ist.“
Und dann hub er an: „Es ist schon länger als achtzig Jahre, seitdem dein Urgroßvater meine Großmutter geheiratet hat. Er war sehr reich und ein schöner Mensch und er hätte die Tochter des angesehensten Bauers zum Weib bekommen können. Er nahm aber ein armes Mädchen aus der Waldhütten herab, das gut und sittsam gewesen ist. Von heute in zwei Tagen ist der Vorabend des Festes Mariä Himmelfahrt; das ist der Jahrestag, an welchem dein Urgroßvater zur Werbung in die Waldhütten ging. Es mag wohl auch im Kornschneiden gewesen sein; er machte frühzeitig Feierabend, weil durch den Ebenwald hinein und bis zur Waldhütten hinauf ein weiter Weg ist. Er brachte viel Bewegung mit in die kleine Wohnung. Der alte Waldhütter, der für die Köhler und Holzleute die Schuhe flickte, ihnen zuzeiten die Sägen und die Beile schärfte und nebenbei Fangschlingen für Raubtiere machte – weil es zur selben Zeit in der Gegend noch viele Wölfe gegeben hat – der Waldhütter nun ließ seine Arbeit aus der Hand fallen und sagte zu deinem Urgroßvater: ,Aber Josef, das kann doch nicht dein Ernst sein, daß du mein Katherl zum Weib haben willst, das wär’ ja gar aus der Weis’!’ Dein Urgroßvater sagte: ‚Ja, deswegen bin ich heraufgegangen, und wenn mich das Katherl mag und es ist ihr und Euer redlicher Willen, daß wir zusammen in den Ehestand treten, so machen wir’s heut’ richtig und wir gehen morgen zum Richter und zum Pfarrer und ich laß dem Katherl mein Haus und Hof verschreiben, wie’s Recht und Brauch ist.’ – Das Mädel hatte deinen Urgroßvater lieb und sagte, es wolle seine Hausfrau werden. Dann verzehrten sie zusammen ein kleines Mahl und endlich, als es schon zu dunkeln begann, trat der jung’ Bräutigam den Heimweg an.
Er ging über die Wiese, die vor der Waldhütten lag, auf der aber jetzt schon die großen Bäume stehen, er ging über das Geschläge und abwärts durch den Wald und er war freudig. Er achtete nicht darauf, daß es bereits finster geworden war, und er achtete nicht auf das Wetterleuchten, das zur Abendzeit nach einem schwülen Sommertag nichts Ungewöhnliches ist. Auf eines aber wurde er aufmerksam, er hörte von den gegenüberliegenden Waldungen ein Gebelle. Er dachte an Wölfe, die nicht selten in größeren Rudeln die Wälder durchzogen und heulten; er faßte seinen Knotenstock fester und nahm einen schnelleren Schritt. Dann hörte er wieder nichts als zeitweilig das Kreischen eines Nachtvogels, und sah nichts, als die dunkeln Stämme, zwischen welche der Fußsteig führte und durch welche von Zeit zu Zeit das Leuchten zuckte. Plötzlich vernahm er wieder das Heulen, aber nun viel näher als das erstemal. Er fing zu laufen an. Er lief, was er konnte; er hörte keinen Vogel mehr, er hörte nur immer das entsetzliche Heulen, das ihm auf dem Fuße folgte. Als er hierauf einmal umsah, bemerkte er hinter sich durch das Geäst funkelnde Lichter. Schon hört er das Schnaufen und Lechzen der Raubtiere, die ihn verfolgen, und denkt: ’s mag sein, daß morgen kein Versprechen ist beim Pfarrer! – da kommt er heraus zur Türkentanne. Kein anderes Entkommen mehr möglich – rasch faßt er den Gedanken und durch einen kühnen Sprung schwingt er sich auf einen Ast. Die Bestien sind schon da; einen Augenblick stehen sie bewegungslos und lauern; sie gewahren ihn auf dem Baum, sie schnaufen und mehrere setzen die Pfoten an den Stamm. Dein Urgroßvater klettert weiter hinauf und setzt sich auf einen dicken Ast. Nun ist er wohl sicher. Unten heulen sie und scharren an der Rinde; – es sind ihrer viele, ein ganzes Rudel. Zur Sommerszeit war es doch selten geschehen, daß Wölfe einen Menschen anfielen; sie mußten gereizt oder von irgendeiner anderen Beute verjagt worden sein. Dein Urgroßvater saß lange auf dem Ast; er hoffte, die Tiere würden davonziehen und sich zerstreuen. Aber sie umringten die Tanne und schnürfelten und heulten. Es war längst schon finstere Nacht; gegen Mittag und Morgen hin leuchteten alle Sterne, gegen Abend hin aber war es grau und durch dieses Grau schossen Blitzscheine. Sonst war es still und regte sich im Walde kein Ästchen. Dein Urgroßvater wußte nun wohl, daß er die ganze Nacht so würde zubringen müssen; er besann sich aber doch, ob er nicht Lärm machen und um Hilfe rufen sollte. Er tat es, aber die Bestien ließen sich nicht verscheuchen; kein Mensch war in der Nähe, das Haus zu weit entfernt. Damals hatte die Türkentanne unter dem abgerissenen Wipfelstrunk, wo heute die wenigen Reiserbüschel wachsen, noch eine dichte Krone aus grünenden Nadeln. Da denkt sich dein Urgroßvater: ,Wenn ich denn schon einmal hier Nachtherberge nehmen soll, so klimme ich noch weiter hinauf unter die Krone.’ Er tat’s und ließ sich oben in einer Zweigung nieder, da konnte er sich recht gut an die Äste lehnen.
Unten ist’s nach und nach ruhiger, aber das Wetterleuchten wird stärker und an der Abendseite ist ein fernes Donnern zu hören. – Wenn ich einen tüchtigen Ast bräche und hinabstiege und einen wilden Lärm machte und gewaltig um mich schlüge, man meint’, ich müßt’ den Rabenäsern entkommen! so denkt dein Urgroßvater – tut’s aber nicht; er weiß zu viele Geschichten, wie Wölfe trotz alledem Menschen zerrissen haben.
Das Donnern kommt näher, alle Sterne sind verloschen – ’s ist finster wie in einem Ofen; nur unten am Fuße des Baumes funkeln die Augensterne der Raubtiere. Wenn es blitzt, steht wieder der ganze Wald da. Nun beginnt es zu sieden und zu kochen im Gewölke wie in tausend Kesseln. Kommt ein fürchterliches Gewitter, denkt sich dein Urgroßvater und verbirgt sich unter die Krone, so gut er kann. Der Hut ist ihm hinabgefallen und er hört es, wie die Bestien den Filz zerfetzen. Jetzt zuckt ein Strahl über den Himmel, es ist einen Augenblick hell, wie zur Mittagsstunde – dann bricht in den Wolken ein Schnalzen und Krachen los, und weithin hallt es im Gewölke.
Jetzt ist es still, still in den Wolken, still auf der Erden – nur um einen gegenüberliegenden Wipfel flattert ein Nachtvogel. Aber bald erhebt sich der Sturm, es rauscht in den Bäumen, es tost durch die Äste, eiskalt ist der Wind. Dein Urgroßvater klammert sich fest an das Geäste. Jetzt wieder ein Blitz, schwefelgrün ist der Wald; alle Wipfel neigen sich, biegen sich tief; die nächststehenden Bäume schlagen an die Tanne, es ist, als fielen sie heran. Aber die Tanne steht starr und ragt über den ganzen Wald. Unten rennen die Raubtiere wild durcheinander und heulen. Plötzlich saust ein Körper durch die Äste wie ein Steinwurf. Da leuchtet es wieder – ein weißer Knollen hüpft auf dem Boden dahin. Dann dichte Nacht. Es braust, siedet, tost, krachend stürzen Wipfel. Ein Ungeheuer mit weitschlagenden Flügeln, im Augenblicke des Blitzes gespenstige Schatten werfend, naht in der Luft, stürzt der Tanne zu und birgt sich gerade über deinem Urgroßvater in die Krone. Ein Habicht, Junge, ein Habicht, der auf der Tanne sein Nest gehabt.“
Mein Vater hatte bei dieser Erzählung keine Garbe angerührt; ich hatte den ruhigen, schlichten Mann bisher auch nie mit solcher Lebhaftigkeit sprechen gehört.
„Wie’s weiter gewesen?“ fuhr er fort. „Ja, nun brach es erst los; das war Donnerschlag auf Donnerschlag, und beim Leuchten war zu sehen, wie glühenden Wurfspießen gleich Eiskörner auf den Wald niedersausten, an die Stämme prallten, auf den Boden flogen und wieder emporsprangen. So oft ein Hagelknollen an den Stamm der Tanne schlug, gab es im ganzen Baume einen hohlen Schall. Und über dem Heugraben gingen Blitze nieder; plötzlich war eine blendende Glut, ein heißer Luftschlag, ein Schmettern, und es loderte eine Fichte. Und die Türkentanne stand da, und dein Urgroßvater saß unter der Krone im Astwerk.
Die brennende Fichte warf weithin ihren Schein und nun war zu sehen, wie ein rötlicher Schleier lag über dem Walde, wie nach und nach das Gewebe der kreuzenden Eisstücke dünner und dünner wurde, und wie viele Wipfel keine Äste, dafür aber Schrammen hatten, wie endlich der Sturm in einen mäßigen Wind überging und ein dichter Regen rieselte.
Die Donner wurden seltener und dumpfer und zogen sich gegen Mittag dahin; aber die Blitze leuchteten noch ununterbrochen. Am Fuße des Baumes war kein Heulen und kein Augenfunkeln mehr. Die Raubtiere waren durch das Wetter verscheucht worden. Also stieg dein Urgroßvater wieder von Ast zu Ast bis zum Boden. Und er ging heraus durch den Wald über die Felder gegen das Haus.
Es ist schon nach Mitternacht. – Als der Bräutigam zum Hause kommt und kein Licht in der Stube sieht, wundert er sich, daß in einer solchen Nacht die Leute ruhig schlafen können. Haben aber nicht geschlafen, waren zusammen gewesen in der Stube um ein Kerzenlicht. Sie hatten nur die Fenster mit Brettern verlehnt, weil der Hagel alle Scheiben eingeschlagen hatte.
,Bist in der Waldhütten blieben, Sepp?‘ sagte deine Ururgroßmutter. Dein Urgroßvater antwortete: ,Nein, Mutter, in der Waldhütten nicht.‘
Es war an dem darauffolgenden Morgen ein starker Harzduft gewesen im Walde – die Bäume haben geblutet aus vielen Wunden. Und es war ein beschwerliches Gehen gewesen über die Eiskörner und es war eine kalte Luft. Als sie am Frauentag alle über die Verheerung und Zerstörung hin zur Kirche gingen, fanden sie im Walde unter dem herabgeschlagenen Reisig und Moos manchen toten Vogel und anderes Getier; unter einem geknickten Wipfel lag ein toter Wolf.
Dein Urgroßvater ist bei diesem Gange sehr ernst gewesen; da sagt auf einmal das Katherl von der Waldhütten zu ihm: ,O, du himmlisch’ Mirakel! Sepp, dir wachst ja schon graues Haar!‘
Später hatte er alles erzählt, und nun nannten die Leute den Baum, auf dem er dieselbige Nacht hat zubringen müssen, die graue Tanne!“ –
Das ist die Geschichte, wie sie mir mein Vater eines Abends beim Kornschöbern erzählt hat und wie ich sie später aus meiner Erinnerung niedergeschrieben. Als wir dann nach Hause gingen zur Abendsuppe und zur Nachtruhe, blickte ich noch hin auf den Baum, der hoch über dem Wald in den dunkeln Abendhimmel hineinstand.
*
Ich war schon erwachsen. Da war es in einer Herbstnacht, daß mich mein Vater aufweckte und sagte: „Wenn du die graue Tanne willst brennen sehen, so geh’ vor das Haus!“
Und als ich vor dem Hause stand, da sah ich über dem Walde eine hohe Flamme lodern und aus derselben qualmte Rauch in den Sternenhimmel auf. Wir hörten das Dröhnen der Flammen und wir sahen das Niederstürzen einzelner Äste; dann gingen wir wieder zu Bette. Am Morgen stand über dem Wald ein schwarzer Strunk mit nur wenigen Armen – und hoch am Himmel kreiste ein Geier.
Wir wußten nicht, wie sich in der stillen, heiteren Nacht der Baum entzündete, und wir wissen es noch heute nicht. In der Gegend ist vieles über dieses Ereignis gesprochen worden und man hat demselben Wunderliches und Bedeutsames zugrunde gelegt. Noch einige Jahre starrte der schwarze Strunk gegen den Himmel, dann brach er nach und nach zusammen und nun stand nichts mehr empor über dem Wald. Auf dem Stocke und auf den letzten Resten des Baumes, die langsam in die Erde sinken und vermodern, wächst Moos.