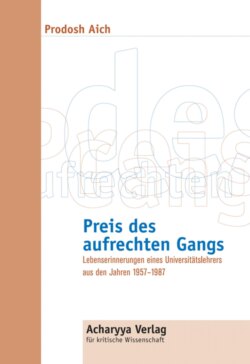Читать книгу Preis des aufrechten Gangs - Prodosh Aich - Страница 7
Prolog
ОглавлениеAugust 1966. Gerade angekommen im „off-shore“ von Bombay. Mit einem Frachter der damaligen deutschen Hansalinie. Köln, Rotterdam, Beirut, Port Said, Jidda, Aden. 30 Tage Seefahrt. Dazwischen zweimal festen Boden unter den Füßen. Jeweils für wenige Stunden. Wir sehen die Silhouette der westlichsten indischen Großstadt. Aber an Land gehen dürfen wir nicht – wir, meine Frau, deutsche Staatsangehörige und promovierte Ökonomin, und ich. Der einsetzende Monsun hat, wie alle Jahre wieder, zu einem Entladungsstau bei den Frachtschiffen geführt. Wartezeit von mindestens zwei Wochen. Und wir haben keine Zeit zum ungewissen Warten.
Ich habe eine einjährige Lehrverpflichtung übernommen an der Universität Rajasthan in der Hauptstadt Jaipur des Bundesstaates Rajasthan. Beurlaubter wissenschaftlicher Assistent im Institut für Soziologie an der Universität Köln. Das akademische Jahr hat schon am 7.Juli 1966 begonnen. Also drängen wir darauf, ausgeschifft zu werden. Auch die Reederei hat kein Interesse, uns für eine unbestimmte Zeit durchzufüttern, was nicht billig ist. Passagiere eines Frachtschiffes sind immer Erste–Klasse–Passagiere, mit allem Drum und Dran.
Wir haben Erfolg. Wie machte die Reederei es im durch und durch bürokratischen Indien möglich, Passagiere an Land gehen zu lassen aus einem noch gar nicht richtig in Indien angekommenem Schiff? Wir sind heil froh, am nächsten Tag samt unserem Gepäck mit einem Motorboot zur Zollabfertigungsstelle des Hafens gefahren zu werden. Der Warteraum des Zollamtes ist leer. Passagierschiffe meiden Indien während der Monsunzeit. Die Zollbeamten finden dennoch keine Zeit für unsere Abfertigung. Allesamt sitzen sie an ihren Schreibtischen und bearbeiten ihre Akten. Sie haben uns gesehen, und wir können sie sehen. Und, wie gesagt, wir sind in Eile!
Gut, daß wir zu zweit sind. Die Paßkontrolle ist besetzt. Ich eile nach dem Geldumtausch zum Hauptbahnhof. Die Eisenbahnfahrt nach Jaipur zu organisieren. Es ist eine Reise von eineinhalb Tagen mit der Eisenbahn. Reservierung ist Pflicht, ganz gleich, in welcher Klasse man fährt. Ich instruiere meine Frau, wenn es mit der Zollabfertigung so weit sei, jedes einzelne Gepäckstück zu öffnen und alle Gegenstände – und wir haben einige Gerätschaften für den einjährigen Lehr– und Forschungsaufenthalt mit –, die über das übliche Reisegepäck hinaus gehen, auf dem Abfertigungsbogen einzeln eintragen zu lassen. Eine eher intuitive Vorsichtsmaßnahme.
Die nächsten Tage sind restlos ausgebucht. So wird mir gesagt. Nichts zu machen. Zwar gibt es auch eine Luftverbindung zwischen Bombay und Jaipur, aber wie sollen wir die Flugkosten für das viele Gepäck bezahlen? Niedergeschlagen berichte ich meiner Frau über diese mißliche Situation. Sie ist auch ziemlich betrübt und nachdenklich. Immerhin hat sie inzwischen die Abfertigung hinter sich gebracht, wenn auch nicht ohne Komplikationen. Die Zollbeamten sehen das Ansinnen meiner Frau nicht ein, sich in unnütze Arbeit zu stürzen. Unnütz, weil ich mich ja elf Jahre im Ausland aufgehalten hatte und daher eh berechtigt gewesen wäre, unseren gesamten Hausstand zollfrei mitzubringen. Es war gut, daß ich nicht dabei war. Mein eindringlicher Hinweis an meine Frau hatte gefruchtet. Ich weiß nicht wie – die westfälische Beharrlichkeit meiner Frau und vielleicht auch ihr sich aus der sichtbaren Hilflosigkeit entwickelnder Charme –, aber sie hatte die Zollbeamten überredet, die „unnütze Extraarbeit“ auf sich zu nehmen, ohne dafür etwas auf die Hand überreicht zu bekommen. Meine Frau hatte kein Geld bei sich, und selbst wenn sie Geld gehabt hätte, hätte sie nicht gewußt, wie so etwas zu bewerkstelligen gewesen wäre.
Die Zollbeamten sind von Beruf aus neugierig. Sie fragen meine Frau aus. Nachdem sie so gut wie alles über unser bisheriges Leben wissen, wünschen sie ihr alles Gute. Durchaus zweideutig, ehrlich und ironisch zugleich. Der Leiter des Zollamtes macht eine Eintragung im Reisepaß meiner Frau, unterschreibt diese mit vollem Namen und bittet sie, nach ihm zu fragen, sollten wir unsere Rückreise von Bombay aus antreten. Er würde gern wissen wollen, wie unser Aufenthalt tatsächlich verlaufen ist. Der wohlwollend ironische Unterton kommt bei meiner Frau an. Ein Jahr in Indien, mit einem so „unindischen“ indischen Mann!
Was tun, um schnellstmöglich Jaipur zu erreichen? Ich kenne Bombay nicht, ich war nie in Bombay, ich habe auch keine Verwandten oder Freunde hier, aber wir haben einige Adressen für Bombay mit. Eigentlich hat jeder Inder Adressen mit, wenn er in die Fremde reist. Also rufe ich jemanden an, dessen Anschrift meine Frau von ihrem Hindi−Lehrer, auch ein Inder an der Universität Köln, erhalten hatte. Mr. Metha, ein Geschäftsmann aus dem benachbarten Bundesstaat Gujerat, aber seit langem in Bombay zu Hause. Er kommt auch relativ prompt, hilft uns, unsere Gepäckstücke zur Aufbewahrung zu bringen, und nimmt uns so selbstverständlich mit zu seiner Wohnung, als ob dies schon seit langem verabredet gewesen wäre. Uns tut das gut. Als er hört, daß wir dringend nach Jaipur müssen und für Tage keine Reservierung für eine Bahnfahrt möglich sei, lacht er. Wir können sein Lachen nicht deuten. Auch das belustigt ihn, aber dann beruhigt er uns. Wir sollten uns keine Sorge machen und uns beruhigen. Er will dafür sorgen, daß wir schnellstmöglich nach Jaipur kommen.
Die früheste Möglichkeit wäre ein Zug am nächsten Morgen. Wegen der langen Reise schlägt er die erste Klasse vor. Wir sollten uns ausruhen. Er will sich um die Fahrkarten kümmern. Tatsächlich bringt er zwei reservierte Fahrkarten für den nächsten Zug mit. Bevor wir unser Erstaunen in Worte fassen können, teilt er uns eher beiläufig mit, daß er pro Ticket 10 Rupien „extra“ habe bezahlen müssen. Darüber wird nicht verhandelt. Wie hätte ich das wissen können, daß es ohne „extra“ keine Fahrkarten gibt? Das hat man zu wissen. Mr. Metha verrät uns noch, daß in Indien jeder reibungslose Ablauf seinen festen Preis hat. Wir sollten dies beherzigen.
Diese kleinen Episoden hätten mich schon ernüchtern müssen, mir klar machen müssen, daß ich mein Land nicht kannte, nicht mehr kannte, vielleicht nie richtig gekannt habe. Nichts von alledem. Stattdessen verarbeite ich diese Kleinstepisoden europäisch intellektuell. Als moderner Sozialwissenschaftler identifiziere ich problemlos das Grundübel. Die Rückständigkeit Indiens sei verursacht durch die Traditionalität. Korruption ist nur ein wichtiger Teil davon. Selbstgefällig erkenne ich meine Verpflichtung, als modern ausgebildeter Wissenschaftler einen Beitrag für die Überwindung der Rückständigkeit meines Landes zu leisten. Ja, es stellen sich auch ein gewisser Stolz und eine innere Befriedigung bei mir ein, daß meine Sensibilität auch auf kleinste Hinweise reagiert. Ich weiß nun immer definitiver, daß ich eine wichtige Mission zu erfüllen habe. Zur Skepsis habe ich so keine Veranlassung. Denn zu dieser Gastprofessur wurde ich eingeladen. Gastprofessur im eigenen Land! Der Widerspruch fiel mir damals nicht auf. Wie sollte er auch? Was soll daran denn falsch sein?
Als es feststeht, daß ich nach elf ereignisreichen Lebensjahren in Deutschland nach Indien zurückkehre, ehrt mich Werner Höfer in seinem sonntäglichen „Internationalen Frühschoppen“. Ein bekannter indischer Wissenschaftler und Publizist, in Deutschland ausgebildet, geht in seine Heimat zurück. Das in Deutschland erworbene Wissen soll zum Fortschritt, zur Modernisierung seines Landes beitragen. Nach dieser öffentlichen Verabschiedung im deutschen Fernsehen interviewt mich Werner Höfer noch für seine wöchentliche Kolumne in der Wochenzeitung „Die Zeit.“ Peter Bender, damals in der WDR–Hauptabteilung Politik, regt an, daß ich Tagebuch führen sollte. Die Redaktionen „Morgen– und Mittagsmagazine“ des WDR bitten mich, unmittelbar nach meiner Ankunft in Jaipur meine Telefonnummer nach Köln zu übermitteln, damit die Redaktion mich für die Magazinsendungen einplanen kann.
Vieles ist in den letzten Jahren geschehen, mich in einen Rauschzustand von Dauer zu versetzen. Ich habe es geschafft, es jenen gleich zu tun, deren Vorfahren vom 16. Jahrhundert an in die Welt hinausgegangen sind und sich diese Untertan gemacht haben, jenen blonden, blauäugigen, weißen Christen, denen es gelang, ihrer Kultur weltweit Geltung zu verschaffen. Denen ebenbürtig geworden zu sein, dazu quasi im Zentrum der „blond-blauäugig-weiß-christlichen“ Kultur, ohne blond-blauäugig-weiß-christlich zu sein, hat mich berauscht; wenn nicht berauscht, so doch blind, blauäugig und überheblich gemacht. Später werde ich einsehen, einsehen müssen, daß dies keine besondere Leistung gewesen ist. Unzählige vor mir haben diese Leistung vollbracht und werden sie nach mir vollbringen. Denn alle Eroberer haben in den eroberten Gebieten instinktiv das vorgefundene Erziehungssystem unterminiert, unterwandert und zerschlagen und das eigene eingeführt. Aber die Briten haben diese Politik in Indien mit Bedacht eingeführt. So formulierte der Liberale Thomas Babington Macaulay (1800 – 1859), der 34jährig als Berater zu einem Salär von 10.000 britischen Pfund dem „Supreme Council of India“ diente, 1835 folgende bemerkenswerte Sätze zur Erziehungspolitik in Indien:
„Wir müssen im Augenblick alles tun, um eine Klasse zu formieren, die Vermittler werden könnte zwischen uns und den Millionen von Menschen, über die wir herrschen; eine Klasse von Personen, Inder in Blut und Farbe, aber englisch im Geschmack, in den Meinungen, in den Moralvorstellungen und im Intellekt.“
Der unverheiratete Thomas Babington Macaulay wird 1857 zum 1. Baron von Rothley erhoben.
Es folgte ein neues Erziehungssystem. Indische Aristokraten wie der Bengale Raja Rammohon Roy unterstützten die Politik der systematischen Einführung der blond-blauäugig-weiß-christlichen Kultur in Indien. Wissenschaftler haben dieser Kultur viele Namen gegeben, je nach Opportunität: christlich, westlich, okzidental, europäisch, modern, demokratisch, industriell usw. und usw. All die Bezeichnungen verdecken die wesentlichen Merkmale, die diese Kultur konstruieren: blond-blauäugig-weiß-christlich. Deshalb ziehe ich es vor, diese weltweit dominierende Kultur beim Namen zu nennen, die ja auch meine Kultur geworden ist, auch wenn mir einige Merkmale fehlen. Dank Thomas Babington Macaulay, dem Lord Rothley. All dies werde ich später, viel später, begreifen. Ich war also einer von „Macaulays Klasse" und bin das vielleicht auch heute noch.
Aber damals, 1966, nicht nur in Bombay, habe ich jeden Hinweis, der mich hätte nachdenklich machen müssen, umgedeutet als einen Fingerzeig, als ein Zeichen auf jenen kolossalen Berg von Aufgaben, meiner Mission, Indien zur „Modernität“ zu verhelfen. Vergessen, nein, verdrängt waren viele Ereignisse in den elf ereignisreichen Lebensjahren in Deutschland, die auch anders hätten gedeutet werden können, ja, vielleicht anders hätten gedeutet werden müssen.
*****
Frühmorgens im Mai 1955 komme ich in Hannover an. Über Colombo, Port Suez, Neapel, mit einem Passagierschiff in der billigsten Kabinenklasse. Aber im Gepäck habe ich ein teures Stück Papier: die Zulassung zum Studium des Bauingenieurwesens an der „Technischen Hochschule“ in Hannover. Ein Wunschtraum indischer Eltern war in Erfüllung gegangen. Ja, das Bauingenieurwesen! Nicht Sozialwissenschaften oder Publizistik.
Ein Taxi fährt mich mit meinen drei Gepäckstücken zum Immatrikula-tionsamt. Zwei Mark zeigt das Taxometer. Ich habe nur einen 50–Mark–Schein. Der Taxifahrer hat kein Kleingeld. Er schenkt mir die Fahrt und wünscht mir alles Gute. Am selben Tag der Zulassung werde ich beurlaubt für ein sechsmonatiges Praktikum, dessen erfolgreicher Abschluß Voraussetzung für den Beginn des eigentlichen Studiums ist. Ich bin der zweite Inder, der nach dem Zweiten Weltkrieg an der Technischen Hochschule in Hannover zugelassen wird. Das Immatrikulationsamt bringt mich in einem der wenigen Studentenheime unter. Es ist in Sichtweite des Hauptgebäudes der Hochschule. Der erste indische Student in Hannover lebt auch in diesem Heim. Auch er ist ein Kalkuttaner, ein Bengale also. Er ist kurz vor dem Abschluß seines Studiums. Er ist der Mittelpunkt bengalischer Praktikanten. In den ersten Tagen fühle ich mich wie zu Hause – bengalisches Essen kochen, indische Musik hören, sich in der Muttersprache verständigen in einer kalten, fremden Welt. Angenehme erste Tage!
Die Kriegsschäden sind noch unübersehbar. Auch in der technischen Hochschule selbst. 85 % der Stadt Hannover wurden zum Trümmerhaufen gebombt, wird mir erzählt. 1955 wird überall gebaut. Frühmorgens beginnt die Arbeit, nicht wie in Indien am späten Vormittag. Ich bin beeindruckt. Auch das Praktikum wird vom Immatrikulationsamt vermittelt. An diversen Baustellen. Es wird sogar ein Stundenlohn von einer DM bezahlt. Nicht wenig für die damalige Zeit. Der Stundenlohn hat diese Geschichte, die ich erzähle, nicht nur mittelbar beeinflußt. Körperliche Arbeit war mir bis dahin fremd. Ich lerne, zu arbeiten. Auch nach dem erfolgreichen Abschluß des Praktikums habe ich auf dem Bau gearbeitet, um als angelernter Maurer in den Semesterferien Geld zu verdienen. Das Geld habe ich bitter gebraucht.
Mein Vater, ein Eisenbahner im höheren Dienst im noch ungeteilten Britisch–Indien, hatte bei der Teilung im Jahre 1947 dem Appell Mahatma Gandhis folgend als Nichtmuslim für Ost–Pakistan optiert. So wurde er automatisch Pakistani. Ich blieb zurück in Kalkutta, blieb Schüler in der „Hindu School“ an der College Street, der damals besten Schule in Kalkutta, und erhielt automatisch die indische Staatsangehörigkeit. Nicht einmal zwei Minuten von der Schule entfernt, an der Kreuzung College Street und Harrison Road, ist die einzige „Boys Branch“ der CVJM in Kalkutta. Kein Internat, sondern ein Wohnheim für Schüler. Ich hatte Glück und konnte dort leben. Seit dieser Zeit organisiere ich mein Leben selbst. Mit bescheidenen Mitteln. Mein Vater mußte seinen „ausländischen“ Sohn monatlich mit Geld versorgen. Über den Schwarzmarkt. Pakistan gestattete eine geregelte Überweisung nach Indien nicht.
Und Überweisungen nach Deutschland wären allein wegen des Divisenmangels schwierig gewesen. Für das Studium des ausländischen Sohnes kamen sie überhaupt nicht in Frage. Also wird das Geldschicken nach Hannover kompliziert. Meine sieben Jahre ältere Schwester lebt, seit 1947 verheiratet, in Kalkutta. Sie erhält den monatlichen Wechsel, schwarz versteht sich, um ihn an mich weiterzuleiten. Sie zieht es aber vor, das Geld für sich zu behalten. So bleibt mein monatlicher Wechsel in Hannover aus. Ich nehme an, meine Eltern sind überfordert, das Geld zu überweisen.
Die Wechselkurse von Währungen aus der „Dritten Welt“ waren auch damals nicht günstig. Und dann der Wechsel in zwei fremde Währungen! Statt bei meinen Eltern den monatlichen Wechsel anzumahnen, bemühe ich mich lieber, das nötige Geld selbst zu verdienen. Arbeitsmöglichkeiten für „Werkstudenten“ gibt es genug. Im Semester als Gelegenheitstagelöhner – das Studentenwerk hat eine eigene Vermittlungsstelle –, in den Semesterferien als angelernter Maurer. Ich kann mich so, eher schlecht als recht, finanziell über Wasser halten. Zwölf Jahre später werde ich erfahren, daß meine Eltern tatsächlich regelmäßig das Geld an meine Schwester geschickt hatten, vier Jahre lang, wie verabredet.
Ein Mitbewohner im Studentenheim ist „Bursche“ in einer nichtschlagenden Verbindung, dem Schwarzburg–Bund. Er führt mich dort als „Verkehrsgast“ ein. Damit ich auch Anschluß zu den Deutschen bekomme. Verkehrsgast heißt, dabei sein zu dürfen, ohne Rechte. Aber auch ohne die „Lernzeiten“ als „Fuchs“. Ich fühle mich geehrt. Dort erfahre ich eindringlich, daß ich nicht nur „ich“ bin, sondern auch ein „Inder“, nein, zu allererst ein „Inder“ bin. Bei jeder Begegnung muß ich erzählen, erzählen und erzählen. Ich sollte nicht über mich erzählen, sondern über Indien. Meine Kenntnisse über die indische Philosophie und über die indischen Epen Mahabharata und Ramayana sind mir dabei hilfreich. In der ersten Zeit meines Aufenthaltes in diesem Land ist mein „lnder–sein“ immer wichtiger geworden, als mein „lch–sein“.
Zu meinem Bekanntenkreis in Kalkutta zählte auch Irmgard Bhaduri, Kalkuttanerin seit 1928 und deutsch–jüdischer Herkunft, mehr eine waschechte Berlinerin als eine Jüdin. In den zwanziger Jahren studierten viele Inder in Berlin, die nicht nach Großbritannien wollten. Anadi Bhaduri war einer davon. Irmgard und Anadi heirateten noch in Berlin und landeten in Kalkutta. So wurde Irmgard Bhaduri eine Kalkuttanerin, und ich wurde nicht nur mit dem Klang der deutschen Sprache vertraut. Hätte ich geahnt, welcher Druck zum Erzählen auf mich zukommen würde, hätte ich die deutsche Sprache doch vor meiner Abreise etwas systematischer erlernt. Ich hätte Irmgard Bhaduri mehr in Anspruch nehmen können.
Auch an den Baustellen muß ich viel erzählen. In den Pausen natürlich. Ich nehme immer das hilfreiche kleine Wörterbuch mit: Collins German Gem Dictionary. Ich habe das Wörterbuch heute noch, die erste Ausgabe von 1953, die ich vor meiner Abreise 1955 in Kalkutta kaufte. Während der Arbeit müssen die anderen erzählen, weil ich vieles zu Beginn nicht verstehe und ständig nachfragen muß. Mir wird klar, daß ich jede verfügbare Minute brauche, deutsch zu lernen. Also verzichte ich auf die häufigen bengalischen Essen im Studentenheim und die heimatlichen Klänge. Schon auf meiner ersten Baustelle sagt mir der Polier, ein möbliertes Zimmer mit Frühstück in einem Arbeiterhaushalt würde mir während der Praktikantenzeit hilfreicher sein, als das Leben in einem Studentenheim. Und wesentlich preiswerter. So ist es auch gewesen.
Seit meinem achten Lebensjahr habe ich „Bridge“ gespielt. Schon in den ersten Tagen in Hannover erkundige ich mich nach einem Bridge–Klub. Im Verkehrsverein der Stadt werde ich schließlich fündig. Ich werde im Bridge–Klub freundlich aufgenommen. Die Bridge–Spieler sind eine besondere Sorte von Menschen. Sie sind liberaler, offener, nicht so verbissen. Vom Bridge–Spiel selbst abgesehen. Beim Spiel sind sie mehr als verbissen. In diesem Klub in Hannover sind neben vielen reichbehangenen betagten Damen auch einige jüdische Rückkehrer. Einer von ihnen war nur wenige Monate vor mir nach Hannover gekommen. Norbert Manne. Zurück aus Montevideo. Mein erstes Turnier in Deutschland spielen wir zusammen und gewinnen. In Porta Westfalica. Wir werden Freunde und werden Freunde bleiben bis zu seinem Tod. Das Bridge–Spielen und die Bridge–Klubs spielen in dieser Sozialgeschichte eine nicht unwesentliche Rolle.
Nach dem Auszug aus dem Studentenheim bin ich ganz und gar der deutschen Umgebung ausgesetzt. Und es ist eine facettenreiche Umgebung. Ich lerne schnell die deutsche Sprache zu beherrschen. Nicht in der Grammatik, aber im Ausdruck, immer unmißverständlicher. Ich komme schnell zurecht. Konflikte, auch verursacht durch mein fremdländisches Aussehen, sind für mich selbstverständlich und nicht unerwartet. Sie hinterlassen auf mich keinen nachhaltigen Eindruck. Ich weiß mittlerweile, in welcher allgemeinen Wertschätzung „die Inder“ schon immer in Deutschland gewesen sind. Diskriminiert werde ich nur in Situationen, in denen ich nicht als Inder erkannt werde. Und Alltagskonflikte gibt es halt überall. Später, viel später, werde ich begreifen, daß ich es als Inder in Deutschland viel einfacher gehabt habe als andere dunkelhäutige Ausländer. Viel später werde ich auch begreifen, daß meine schnelle und angenehme Anpassung an die deutschen Verhältnisse auch schnelle Entfremdung von der indischen Wirklichkeit, von der indischen Kultur bedeutet hat.
Ich gründe den Deutsch–Indischen Verein in Hannover und organisiere indische kulturelle Veranstaltungen. Die Doppeldeutigkeit solcher Übungen war mir schon damals nicht ganz fremd. Nach meiner Zeit in Hannover habe ich nicht nur nicht mehr indische Kultur vermarktet, ich bin auch nie wieder Mitglied eines Deutsch–Indischen Vereins geworden – welcher Art auch immer.
Wie schon erwähnt, ein lngenieurstudium ist der Wunschtraum indischer Eltern. Unabhängig von der tatsächlichen Neigung der Kinder. Und mit einem erfolgreich im Westen absolvierten Ingenieurstudium ist man schon oben. Die Familie auch. Dennoch beginne ich zu zweifeln, ob das Bauingenieurstudium für mich das Richtige ist. Im dritten Semester beginnt so richtig die darstellende Geometrie, das Bauzeichnungswesen und Baurechnungswesen. Diese finde ich erheblich uninteressanter als die leitende Organisation eines Deutsch–Indischen Vereins oder auch als das Erzählen vor diverser Öffentlichkeit oder das Bridge–Spielen. Also mache ich mir ernsthaft Gedanken darüber, ob ich mir ein Leben als Bauingenieur wirklich leisten sollte. Außerdem steigt auch der Bedarf an Arbeitszeit für das Studium.
Etwa zur gleichen Zeit lese ich einen ausführlichen Reisebericht über Südostasien von Carlo Schmid. Engagiert, voller Nachdenklichkeit und Sympathie. Spontan schreibe ich ihm, erkundige mich über eine Studienmöglichkeit bei ihm, erhalte von ihm den Rat, nicht bei ihm, sondern mich besser um einen Studienplatz in Bonn zu kümmern, wollte ich mich mehr für Staat und Gesellschaft als für das Ingenieurwesen interessieren, was ich dann auch getan habe. Ich lasse mich am 22. Mai 1957 in Bonn für Staatswissenschaft immatrikulieren. Der nicht erhaltene monatliche Wechsel macht mir diese Entscheidung leichter. Ich glaubte, später, nach meiner Rückkehr, würde ich keine Rechenschaft oder Rechtfertigung meines Sinneswandels schuldig sein.
Das erste Semester in Bonn entspricht meiner Erwartung nicht, bis auf die eine Veranstaltung, „Internationale Wirtschaftsbeziehungen“. Andere erschöpften sich in Statistik, Buchhaltung, Steuerlehre, Betriebswirtschaftslehre, das Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre, Kredittheorie, usw., usw. Die Stadt gefällt mir, überschaubar und wirtlich, alles nah beieinander. Gewohnt habe ich in einem kleinen Studentenheim, unweit vom Poppelsdorfer Schloß. Neben den Veranstaltungen verbringe ich noch viel Zeit in der Universität. Ich beobachte die Aktivitäten des AStA, der politischen Gruppierungen, der Vereine der ausländischen Studierenden – die Inder haben auch einen eigenen Verein –, des WUS (World University Service) und des ISSF (Internationaler Studentenbund und Studenten Föderation). Ich bin auf der Suche nach einer politisierten studentischen Organisation, der ich mich aktiv anschließen will.
Einblicke in die studentischen Verbindungen in Hannover haben mir gereicht. Für diese Art von studentischer Aktivität habe ich mich nicht begeistern können. Nicht daß einzelne Füchse, Burschen und auch alte Herren nicht herzlich und nett gewesen wären. Die Werte und Normen der „Verbindungen“ sind es, die mir nicht behagen. In Bonn sind die Korporationsstudenten auch noch demonstrativ aggressiv. Farben tragen sie auch im Alltag. Und nicht zu knapp. Bierzipfel genügen ihnen nicht. Und dann die Verbindungshäuser! Und die nächtliche Belästigungen der Nachbarschaft. Beinahe jede Nacht. Gesänge sollen das gewesen sein.
Ich entscheide mich relativ bald für den ISSF. Auch der WUS wäre von der personellen Zusammensetzung her durchaus interessant gewesen, aber ihre Aktivitäten erschöpfen sich in Feten, Tanznachmittagen und „Betreuungsmaßnahmen“ eben für die „armen Ausländer“. Er war eher ein GUS (German University Service) für ausländische Studierende. Hilfe für ihre Anpassung. Durch hilflose deutsche Helfer. Nicht daß der ISSF völlig aus dem Rahmen fiel, nein, aber er bemühte sich redlich um die Internationalität und um Verständnis von Politik, vornehmlich von internationaler Politik. Im internationalen Studentenheim an der damaligen Koblenzer Straße ist ein kleines Büro für die Ortsgruppe. Der Bundesvorstand des ISSF sitzt auch im selben Haus und hat wesentlich mehr Räumlichkeiten. Der Veranstaltungsraum des Studentenheims wird mit anderen internationalen Gruppierungen geteilt.
Wirtschaftlich geht es mir in Bonn erheblich schlechter. Die Stadt Bonn war von Kriegsschäden verschont geblieben, also mußte nicht neu aufgebaut werden. Deshalb besteht für einen „angelernten Maurer“, wie ich einer bin, keine Nachfrage. Aber mein Deutsch ist mittlerweile brauchbar. Durch die Vermittlung der „SPD–Baracke“ erhalte ich während der ersten Semesterferien in Bonn eine Praktikantenstelle bei der Tageszeitung „Hannoversche Presse“ in Hannover. Die SPD hatte damals eine ganze Reihe von Tageszeitungen. Auf dem Bau hätte ich sicherlich mehr verdienen können, aber eine Tageszeitung reizt mich mehr.
Ende des Semesters werde ich zum 1. Vorsitzenden der Bonner Gruppe des ISSF gewählt, meiner Ortsabwesenheit während der Semesterferien zum Trotz. Das politische Programm werde eh schon immer zum Semesterbeginn für ein Jahr gemacht. Außerdem würde einer der Stellvertretender in Bonn sein. Ich buche dieses Gewähltwerden durchaus als eine Auszeichnung. Später werde ich es anders bewerten lernen. In Bridge–Klub (in Bad Godesberg) bin ich auch noch, aber nicht so häufig wie in Hannover. Der Tag hat leider nur 24 Stunden!
Am 20. Juli 1957 kann ich noch gerade die Semestergebühren für das Sommersemester 1957 aufbringen. Meine Notgroschen, von Kalkutta mitgebrachte Reiseschecks über 500 englische Pfund, sind beinah verbraucht. Die Praktikantentätigkeit bei der Zeitung würde gerade ausreichend für meinen Aufenthalt in Hannover sein. Also bitte ich jenen stellvertretenden Vorsitzenden der Bonner ISSF–Gruppe, der ein Bonner war, für mich eine „Schlafstelle“ mit Frühstück ab Oktober ausfindig zu machen. Billigst. Ich werde wenig Geld und viel Arbeit haben. Also brauchte ich kein gut möbliertes Zimmer. Das Praktikum bei der Zeitung ist für mich ein großer Gewinn in vielerlei Hinsicht. Das hat aber keinen direkten Bezug zu der Sozialgeschichte, die ich begonnen habe zu erzählen.
Ich beziehe tatsächlich eine der billigsten möblierten Unterkünfte in Bonn. Monatlich 30,- DM mit Frühstück. Nicht weit von der Universität, in der Weberstraße, Weberstraße 96. Am späten Vormittag klingele ich an der Tür. Eine ältere Dame mit offenem Gesicht begrüßt mich freundlich: „Sie sind sicherlich Herr Aich. Herzlich willkommen!“ Ich war wirklich willkommen. Ich werde in das Wohnzimmer geführt. Es ist ein Altbau. Hohe Räume mit Stuckarbeiten, alte, nein, altgewordene Seidentapeten, alte Biedermeiermöbel, ein Flügel im Raum. Auf dem Flügel sitzt eine große, fette braune Katze. Später werde ich wissen, daß diese Katze eigentlich ein kastrierter Kater namens Mutius ist. Der Katzengeruch im Zimmer kann nicht von ihm allein kommen. Mutius hat noch neun Hausgenossen. Meine Wirtin heißt Marga Lehner. Sie legt Wert darauf, als Fräulein Lehner angeredet zu werden. Und sie war, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Wirtin. Neugierig, fürsorglich, und was nicht so häufig vorkommt, gutmütig. Ich habe bewußt auf Adjektive vor diesen Eigenschaften verzichtet. Jedes Adjektiv würde diese Eigenschaften von Fräulein Lehner unzulässig relativieren.
Sie bietet mir eine Tasse Tee an. Dann beschreibt sie das Zimmer. Es ist ein Zimmer, eigentlich ein Nebenzimmer eines großen Zimmers im ersten Stock. Zugang zum Nebenzimmer ist leider nur durch das große Zimmer möglich. Im großen Zimmer wohnt und arbeitet ein verhinderter Gymnasiallehrer, Otto Schuart, der von Nachhilfeunterricht lebt. Eigentlich sei es kein Zimmer, meint sie etwas verlegen, eher eine Schlafstelle. Es hat ein Fenster, ein Bett, einen kleinen Tisch und eine Waschgelegenheit für beide Zimmer. Kalt. Keine Heizung. Das große Zimmer hat einen Kohleofen. Der reicht für beide Räume. Sie zeigt mir das Zimmer während einer Pause des Nachhilfeunterrichts von Herrn Schuart.
Es ist ein Einfamilienhaus eines Akademikers im einst verträumten Bonn. Eine halbhohe Treppe von der Straße zum Eingang. Lange breite Flure zum Treppenaufgang, und dann vorbei an der relativ breiten Treppe noch ein etwas schmalerer Flur bis hin zur Küche, die wenige Stufen niedriger liegt. Zwei Türen rechts vom Flur. Zum Wohnzimmer und zum Eßzimmer. Eine große Schiebetür dazwischen. Ein eher verwilderter Garten hinter dem Haus. Eine Treppe hinunter vom Kücheneingang zum Souterrain. Dienstmädchenzimmer, Bügelzimmer, Badezimmer, Toilette. Eine halbe Treppe aufwärts eine weitere Toilette. Sonst keine Toiletten, keine Bäder. Noch eine halbe Treppe hinauf zu meiner Schlafstelle. Ein Telefon an der Wand, rechts neben dem Eingang, des großen Zimmers. Noch Kinderzimmer an der linken Seite. Derselbe Grundriß im zweiten Stock.
Nach dem Tod der verwitweten Mutter hat Fräulein Lehner kein ausreichendes geregeltes Einkommen mehr. Ihre einzige Schwester lebt nicht mehr. Außer Musizieren haben die beiden Kinder nichts Berufliches gelernt. Fräulein Lehner hat keinen ordentlichen Abschluß in Musik, wird noch eine Zeitlang in Schulen als Musiklehrerin gebraucht. Aber nicht als volle Kraft. Sie hätte es mir nicht übel genommen, wenn ich rückwärts wieder hinausgegangen wäre. Sie konnte noch nicht wissen, in welcher Not ich gewesen bin. Und ich war später dankbar, daß ich in solcher Not gewesen war, ansonsten hätte ich die Begegnung mit einem wertvollen Menschen verpaßt. Sie bleibt meine Wirtin bis ich 1958 heirate. Dann wird sie unsere Wirtin bis 1965. Als wir heiraten wird das große Zimmer mit dem Nebenzimmer im 2. Stockwerk frei. Wir dürfen dort einziehen. Beim Einzug schenkt sie uns eine Siamkatze. Die elfte im Haus. Bis 1973 werden wir mit Fräulein Lehner befreundet bleiben. Sie wird einige Höhen und Tiefen unseres Lebens mitgehen.
Das Wintersemester 1957/1958, an der Bonner Universität hieß es „Winterhalbjahr“, ist für mich arbeitsreich, hektisch, ereignisreich und für meine weitere Entwicklung entscheidend. Ich belege weniger und gänzlich andere Veranstaltungsthemen. Philosophie von Descartes bis Kant, die philosophischen Strömungen seit Hegel, das Naturrecht und Staatsreform. Bei den Professoren Scheuner und Schätzel „Verfassungsgeschichte der Neuzeit“ und „Die wissenschaftlichen Grundlagen der Außenpolitik“.
Im ISSF plane und gestalte ich das Jahresprogramm. Ich will etwas mehr machen als nur Mitgliedertreffen, gesellige Abende, Karneval–Ball und einige wenige Informationsveranstaltungen. Es ist eine bewegte Zeit in der internationalen Politik: die „Blockfreien“ mit Nasser, Nehru, Sukarno und Tito; Dag Hammersköld als Generalsekretär der Vereinten Nationen; Kongo, Lumumba; Absturz von Dag Hammersköld bei einem Flug über dem Kongo, Ermordung von Lumumba, der merkwürdige Aufstieg von Feldwebel Mobuto; der Indochina– und später der Vietnamkrieg und natürlich der „Kalte Krieg“ der beiden Machtblöcke. Also suche ich Referenten für regelmäßige öffentliche Veranstaltungen. Möglichst ohne Honorar, aber doch mit anschließendem informellen Zusammensein mit dem Referenten bei kleinem Umtrunk. Auch die Bonner Gruppe des ISSF hat ein kleines Budget.
ISSF, Internationaler Studentenbund – Studentenbewegung für übernationale Föderation e.V. ist die Jugendorganisation von „World Association of World Federalists“ mit Sitz in Amsterdam und die Deutsche Sektion des „lnternational Students' Movement for United Nations“. Der ISSF hat ein illustres Ehrenpräsidium: Hermann J. Abs, Stefan Andres, Henry Brugmans, Wilhelm Grewe, Ulrich Haberland, Walter Hallstein, Eugen Kogon, Ernst Reuter, um nur einige Namen zu nennen. Auch die Bundesregierung unterstützt den ISSF mit Personal–, Sach– und Tagungsmitteln.
Bekanntlich stellen sich nicht nur Verteilungsprobleme ein, wenn es um Geld geht. Verteilungsprobleme bringen Machtkämpfe und neue Hierarchien. Auch die Beschaffung von Mitteln hat ihre Tücken. Sie wirken sich auf die innere Verfassung einer Organisation aus. Und wer beschafft, bestimmt auch Zusammenhänge, die ich so noch nicht kannte. Im Deutsch–Indischen Verein in Hannover war es schwierig, überhaupt einen Vorstand zusammenzubekommen. Nicht so im ISSF in Bonn. Im Vorstand zu sein heißt: Türen außerhalb der Universität zu öffnen, Kontakte zu knüpfen mit Ministerialbürokraten, Parteifunktionären, Journalisten, Diplomaten. Wichtig für die spätere Karriere. Bonn ist dafür ein wichtiger Platz. Einige der früheren Vorstandsmitglieder sind bereits in Amt und Würden. Sie stehen dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite, wie die „alten Herren“ in den Studentenverbindungen, aber nur als graue Eminenzen ohne Verpflichtungen eines „alten Herren“. Der Begriff „Seilschaften“ ist noch nicht kreiert.
Bei der Programmgestaltung kommt es zu Differenzen und Konflikten. Nicht so sehr über den Inhalt. Denn die bisherige Arbeit beschränkte sich fast auf Organisation geselliger Begegnungen. Es ist der Kölner ISSF–Gruppe beispielsweise bekannt, daß die Bonner Gruppe eine leistungsfähige Musikanlage besitzt. Also werde ich samt der Anlage und Schallplatten nach Köln zum Nikolausabend eingeladen. Nein, der Konflikt entsteht nicht über politische Inhalte. Für die beiden Stellvertreter bin ich zu initiativ und zu aktiv. Ich bin drauf und dran, den älteren Mitgliedern die Schau zu stehlen. Erst jetzt erfahre ich, daß ich ein zufälliger Kandidat für den Vorsitz gewesen bin. Zwei konkurrierende Fraktionen sind fast gleich stark. Beide Fraktionen hofften auf ihr Geschick, um aus dem Hintergrund die Drähte zu ziehen. Ich ließ mich schon immer überzeugen, nicht aber steuern. Um mich zu überzeugen, daß sich der ISSF von den anderen politischen Gruppen an der Universität nicht unterscheiden müßte und sich deshalb nicht hauptsächlich internationalen Problemen zuwenden sollte, reichen die Argumente nicht. Auch der Hinweis, daß der ISSF in der Hauptsache auf die Zuschüsse der Bundesregierung angewiesen ist, überzeugt mich nicht. So kommt es, wie es kommen muß.
Gegen Ende des Semesters ist die Mitgliederversammlung fällig, aber ohne Wahlen. In dieser Mitgliederversammlung wird ein Dringlichkeitsantrag zu meiner Abwahl eingebracht. Der Antrag muß inhaltlich begründet werden. Die Diskussion über diesen Antrag beansprucht Stunden. Ohne Ergebnis, d. h. ohne Abstimmung. Die Mitgliederversammlung muß unterbrochen werden. Nun sind die grauen Eminenzen dran. In mehreren Gesprächen überzeugen sie mich, den Konflikt einvernehmlich beizulegen. Zwei Wochen später wird die Mitgliederversammlung fortgesetzt. Ich trete vom Vorsitz zurück. Dieser Rücktritt ist eine verschleierte Abwahl. Ich mache mir nichts vor. Ich falle, so scheint es mir, in ein tiefes Loch.
*****
Wie schon erwähnt hat der Bundesvorstand des ISSF sein Büro im selben Haus wie die Ortsgruppe. Der Eingang zum internationalen Studentenheim ist an der Seite. Gleich links, geht eine halbe Treppe hoch zu einem kleinen Raum, dem Büro der Bonner Gruppe des ISSF. Genau gegenüber dieser Treppe, also rechts vom Eingang auf der Straßenseite, ist das Büro des Bundesvorstandes. Ein neuer Vorstand war dort eingezogen. Der 1. Vorsitzende, Günter Krabbe, ein Berliner. Ein diplomierter Politologe vom Otto–Suhr–Institut. Und der 2. Vorsitzende, Rolf Frings, ein Mitglied der Kölner Gruppe, fortgeschrittener Student der Meteorologie, haben den Konflikt innerhalb der Bonner Gruppe hautnah miterlebt. Offensichtlich mit Sympathie für meine inhaltliche Position und auch für meine Person. Sie haben sich selbstverständlich nicht eingemischt. Nach dem „Rücktritt“ bitten sie mich, beim Bundesvorstand als Referent mitzuarbeiten. Die Funktionsträger beim Bundesvorstand erhalten eine Aufwandsentschädigung. Ein Referent ist im Budget nicht vorgesehen. Sie wollen die Mittel dafür sofort beantragen.
Ich hatte mich schon vor dem Eklat in der Bonner Gruppe des ISSF wieder um eine Praktikantenstelle bei einer Tageszeitung bemüht. Wieder hilft mir die „SPD–Baracke“. Diesmal ist es die Lokalredaktion der „Neuen Ruhr Zeitung“ in Köln, die aber im Rheinland die „Neue Rhein Zeitung“ heißt. In Köln ist auch nur die Lokalredaktion. Diesmal darf ich auch schreiben. Ich hätte auch wieder nach Hannover gehen können. Aber die Reisekosten und Zimmermiete in Hannover hielten mich zurück. Mittlerweile ist mir die Schlafstelle in der Weberstraße lieb geworden. Im Haus komme ich bestens zurecht. Mit meinem Studium leider nicht so gut. Ich bin wieder mal im Zweifel, ob meine Wahl, Staatswissenschaft in Bonn zu studieren, die richtige Wahl gewesen ist. Am 4. März 1958 lasse ich mich exmatrikulieren. Ich kann meine Studiengebühren für das WS 1957/1958 nicht bezahlen. Damit ist das an sich intensiv studierte WS 1957/1958 aberkannt. Ich gerate, im wahrsten Sinne des Wortes, in eine tiefe Krise. All dies ist mir damals in Bombay, 1966, nicht präsent. Wäre die Erinnerungen an diese Zeit damals präsent gewesen, hätte ich mich möglicherweise weniger sendungsbewußt und weniger überheblich gefühlt.
*****
Warum bemühe ich mich trotz meiner finanziellen Nöte nicht um ein Stipendium, werde ich gefragt. Ich habe einfach nicht gewußt, daß es auch für ausländische Studierende Stipendien gibt. Ich habe auch nicht gewußt, daß es zum Erlaß von Studiengebühren die Einrichtung von „Fleißprüfungen“ gibt. Zwei studierte Semester habe ich aus finanziellen Nöten streichen lassen müssen.
Mir wird die SPD–nahe Friedrich–Ebert–Stiftung genannt. Sie ist die erste politische Stiftung überhaupt im Nachkriegsdeutschland und will die demokratische Volkserziehung fördern. Ihr Sitz ist in Bonn in der damaligen Koblenzer Straße, einige Häuser von dem Internationalen Studentenheim in Richtung Regierungsviertel entfernt, also vom Sitz des ISSF. Ich gehe dort hin, hole mir die Bewerbungsunterlagen und bewerbe mich um ein Stipendium zur Förderung des hochbegabten Nachwuchses. Warum auch nicht? In dem Antrag versäume ich nicht, einen eventuellen Universitätswechsel nach Berlin anzukündigen.
Die Arbeit in der Redaktion in Köln läßt mir noch genug Zeit, regelmäßig im Büro des Bundesvorstandes zu sein. Es entwickelt sich so etwas wie eine Freundschaft mit den beiden Vorsitzenden. Rolf Frings, verheiratet, wohnt in Hermülheim bei Köln in einem Haus mit seinen Schwiegereltern. Sein Schwiegervater spielt gern Skat. Auch deshalb bin ich dort willkommen. Günter Krabbe ist allein in Bonn. Er geht nach getaner Arbeit gern in Kino–Spätvorstellungen. Wir gehen immer öfter zusammen.
In der Redaktion in Köln bleibe ich für drei Monate. Eine Verlängerung wäre möglich, aber ein Studium habe ich nicht abgeschrieben. Ich rechne auch mit der „Referentenstelle“ beim Bundesvorstand. Und vage hoffe ich auf ein Stipendium von der Friedrich–Ebert–Stiftung. So habe ich im Augenblick keine konkrete Aufgabe mehr. Und ich besitze wenig Geld. Ich gehe spät ins Bett, stehe spät auf, meist nachmittags zum Frühstück. Immer wenn Fräulein Lehner im Haus ist, habe ich auch nachmittags heißen Tee zum Frühstücksbrötchen. Sonst gibt es halt kalten Tee. Nach dem Frühstück gehe ich zum ISSF. Dann ins Kino. Mit Günter Krabbe. Manchmal auch in zwei Vorstellungen. Kleiner Imbiß danach, dann zu Bett. Zu dieser Zeit gerate ich sogar mit der Mietzahlung in Rückstand. Peinlich. Und perspektivlos. Fräulein Lehner bleibt nach wie vor freundlich. Sie hat mehr Vertrauen in mich, als ich selbst.
Der Bundesvorstand des ISSF muß ein Mitglied für die Wahl im Vorstand des „Young World Federalists“ in Amsterdam benennen. Ich werde benannt und gewählt. Dieser Posten ist zwar ohne eine Aufwandsentschädigung, aber er ermöglicht mir Reisen nach Amsterdam und kostenlose Teilnahmen an außeruniversitären internationalen Seminare. Jeder Reise– und Seminartag bringt mir finanzielle Erleichterung. Die Friedrich–Ebert–Stiftung hat meine Bewerbung bearbeitet und für September zwei Prüfer bestellt: Charlotte Lütkens in Bonn, Sozialwissenschaftlerin und Schriftführerin der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, und Hermann Louis Brill in Wiesbaden, Juraprofessor und Staatssekretär in Hessen.
Im Sommer wird der Bundesvorstand des ISSF von der Unesco, Paris, gefragt, ob er sich zutraue, über die Betreuungssituation der ausländischen Studenten in den deutschen Universitäten einen Bericht zu schreiben. Es stünden dafür 5000,- US-$, also ca. 20000,- DM zur Verfügung. Ein europäischer Vergleich werde angestrebt, um Verbesserungen zur reibungsloseren Integration der ständig wachsenden Zahl der ausländischen Studierenden in Europa zu ermöglichen. Integration als Schlüssel für ein erfolgreiches Studium also. Der Bundesvorstand des ISSF traut sich dieses zu. So werde ich zum Unesco–Referenten des ISSF, noch ohne eine Aufwandsentschädigung.
Beide Prüfer der Friedrich–Ebert–Stiftung, Charlotte Lütkens und Hermann Louis Brill, beurteilen mich so gut, daß ich am 7.November 1958 in die „Hochbegabtenförderung der Stiftung“ aufgenommen werde. Noch ohne ein Stipendium. Die Etatmittel der Stiftung sind für das laufende Haushaltsjahr erschöpft. Die individuelle Betreuung durch Vertrauensdozenten, die Freizeitbegegnungen in der Heimvolkshochschule in Bergneustadt und „Bücherpakete“ gelten ab sofort. Die Stiftung ist großzügig, sie gewährt mir zwei Darlehen mit ordentlichen schriftlichen Verträgen, damit ich über die Runden komme. Zwischenzeitlich habe ich mich an der Universität Köln für das WS 1958/1959 immatrikulieren lassen. Einiges ist inzwischen geschehen.
Ab Herbst bekomme ich eine monatliche Aufwandsentschädigung von 150,- DM. Die beantragten Mittel sind bewilligt. Die 5000,- US-$ aus Paris sind zwar noch nicht da, aber ich beginne unverzüglich mit Erkundungen über Betreuungsmaßnahmen zunächst beim Auslandsamt an der Bonner Universität. Dann in Köln. Die Zeitungen berichten häufig über Diskriminierungen bei der Zimmersuche, in Gastwirtschaften, in Läden, in allen öffentlichen Orten. Das Problembewußtsein beschränkt sich auf Diskriminierung. Und Diskriminierungen seien nicht vorteilhaft für das Ansehen der deutschen Gesellschaft im Ausland. Dies ist auch die Zeit, in der die „Vorurteilsforschung“ ihre Hochkonjunktur erfährt. Vorurteile entständen in der Hauptsache aus Unkenntnis, vor allem bei Personen mit schwachem Ego. Ergo: Die deutsche Bevölkerung sollte mehr Gelegenheit bekommen, die ausländischen Studierenden persönlich kennenzulernen.
Organisierte Begegnungen sind das Rezept. Und Hilfe in allen Lebenslagen: bei der Zimmersuche, beim Erlernen der Sprache, beim Studium „unter die Arme greifen“. Betreuung ist das Zauberwort. Auch studentische Gruppierungen erhalten Mittel für Betreuungsarbeiten. Nur ein Erfolg stellt sich nicht ein. Trotz „Kontaktbörsen“ verschiedener Art. Die Betreuer sehen oft immer die gleichen Gesichter. Die meisten ausländischen Studierenden nehmen die Angebote nicht an. Viele Veranstaltungen fallen aus. Auch im internationalen Studentenheim hat die Bonner ISSF–Gruppe nur bei Tanzveranstaltungen Erfolg. Nach einem Beschluß des Bundesvorstandes besuche ich Betreuungsveranstaltungen der anderen ISSF–Gruppen in der Republik, um diese miteinander vergleichen zu können.
Also schreibe ich sämtliche ISSF–Gruppen an und bitte sie um die Übermittlung der Termine von Veranstaltungen. Die Reaktion ist prompt. Ich reise ohne vorherige Terminvereinbarung. Es ist überall das gleiche trostlose Bild. „Kontaktbörsen“ funktionieren nicht. Die Stammgäste sind relativ gut integriert. Die anderen, die die große Mehrheit bilden, lassen sich nicht anlocken. Wie soll man an sie herankommen?
Ich beginne systematisch Studien über soziale Vorurteile und über gesellschaftliche Benachteiligung zu lesen. Diese sozialpsychologischen, soziologischen und sozialphilosophischen Studien finde ich aufschlußreich. Die Schwägerin von Rolf Frings erzählt mir – ich spiele wiedermal Skat in Hermülheim mit ihrem Vater und ihrem Schwager – von interessanten soziologischen Vorlesungen. Als Nachfolger des eher philosophisch orientierten Leopold von Wiese war der mehr wirtschaftlich und ethnologisch orientierte René König Mitte der fünfziger Jahre zum Lehrstuhl für Soziologie berufen worden. Seine Vorlesungen sollen wegen seiner hervorragenden Rhetorik, seiner breiten Kenntnis über gesellschaftliche Entwicklung und deren Zusammenhänge sehr beliebt gewesen sein. Sie habe einige dieser Vorlesungen gehört, obwohl Soziologie nicht ihr Fach gewesen ist. Sie ist promovierte Volkswirtin der Kölner Universität und arbeitet in der volkswirtschaftlichen Abteilung der Deutschen Bank in Düsseldorf und wohnt in der Woche auch dort.
Also habe ich mich nach der Unterbrechung eines Semesters in Köln wieder immatrikulieren lassen. Aber nicht in der WiSo–, sondern in der philosophischen Fakultät. Soziologie war in den beiden Fakultäten eingebunden. Es ist ja auch für mich nur ein Risiko von 30,- DM als lmmatrikulationsgebühr. Eigentlich gar kein Risiko, weil diese Gebühr die studentische Krankenversorgung sicherstellt. Fräulein Lehner hat die Miete nicht erhöht. Und monatlich 150,- DM war damals nicht wenig Geld. Und dann die vielen Lebenshaltungskosten senkenden „Dienstreisen“ und Seminare.
Vom ersten Tag des Semesterbeginns in Köln macht mir das Studieren zum ersten Mal Spaß. Ich habe eine konkrete Aufgabe im ISSF: Vorschläge zur Verbesserung der Betreuungssituation der ausländischen Studierenden. Eigentlich eine soziologische und ethnologische Fragestellung, wie ich erkenne. Also besuche ich fleißig die Methodenseminare der Fächer Ethnologie, Soziologie, Philosophie und Geschichte. Und noch zwei Hauptseminare: „Geschichte der ethnologischen Theorienbildung“, „Die Angestellten in Betrieb und Gesellschaft“ und die Hauptvorlesung von René König: „Ursprung und Entwicklung von Familie, Wirtschaft, Recht und Staat“.
Jeder Tag an der Kölner Universität läßt mich wachsen. Die 5000,- US-$ von der Unesco, Paris, sind angekommen, aber noch nicht angebrochen. Das Geld ausgeben nur für Beobachtung von „Kontaktbörsen“ an verschiedenen Universitäten? Warum nicht eine Studie zur Überwindung von Vorurteilen? Ich will mir Zeit nehmen für eine solche Entscheidung, und der Bundesvorstand ist damit einverstanden.
Es ändert sich auch sonst einiges. Die Hauptvorlesung von René König ist in einem überfüllten großen Saal. Sie ist unterhaltend, witzig, anregend und informativ. Das erste Mal bin ich früh genug da und sitze in der vorderen Reihe. Der Nachbar zu meiner Rechten interessiert sich für mich. Er spricht mich an. Er hat einen leichten bayerischen Akzent. Nach der Veranstaltung machen wir beim Kaffee „small talk“. Er will freundlicherweise einen Platz frei halten, weil ich ja von Bonn anreise. Er hält sein Versprechen ein. Nach der Vorlesung will er mit König sprechen. Ich weiß nicht warum. Um ihn nicht aus den Augen zu verlieren, gehe ich hinter ihm her und warte, bis er mit dem Gespräch mit König fertig ist. Anschließend gehen wir zusammen in ein Café.
Er, Josef Gugler aus München, ist in der Endphase seiner Dissertation. Das Thema: die Französische Soziologie. Er war für mehrere Semester in Paris, spricht fließend französisch. Er ist nicht angeberisch und spricht leise. Als er hört, daß dies mein erstes Semester in Soziologie ist, nimmt sein Interesse an mir nicht ab. Wir verabreden uns wie das letzte Mal. Es bahnt sich eine Freundschaft an. Das übernächste Mal will er mich König vorstellen. Wieso? König habe ihm Vorwürfe gemacht, weil er mich nach der 2. Vorlesung hinten hatte warten lassen. Er hätte mich zumindest vorstellen sollen. König war selbst Immigrant. In Italien. Er weiß, was ein Auslandsaufenthalt ist. Ich bin befangen. Ich soll vorgestellt werden, nur weil ich ein Ausländer bin. Ich lerne also König kennen. Aufgeschlossen und freundlich. Wenn ich Probleme hätte, sollte ich ihn im Institut aufsuchen. Das Ganze ist überhaupt nicht formell. Die Atmosphäre ist locker, und ich nehme sein Angebot ernst. Nur habe ich kein Problem. Noch nicht.
Die Skatwochenenden haben Folgen. Die Schwägerin von Rolf Frings ist häufig da. Wir lernen uns kennen, uns lieben und heiraten bereits im Dezember 1958. Für das Studium sollte ich mir mehr Zeit lassen und nicht so wie sie, rastlos durch das Studium hetzen. Als Arbeiterkind mußte sie das Studium selbst finanzieren, mußte immer gut sein. In der Mindestzeit hatte sie den Diplomvolkswirt und Dr. rer. pol. gemacht. Immer am Ende jedes Semesters "Fleißprüfungen" für den Erlaß der Studiengebühren gemacht. Ich sollte es besser haben. Dieser gutgemeinte Wunsch verursacht Unbehagen bei mir. Ich nehme mir vor, Skat, Bridge und Kino kurz zu halten und zum ersten Mal in Deutschland ernsthaft und fleißig mit dem Studium voran zu machen.
König hatte bei seiner Berufung auch die renommierte „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie“, das Sprachrohr der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, aber herausgegeben im Auftrage des Forschungsinstituts für Sozial– und Verwaltungswissenschaften in Köln, geerbt. Er führte die „Empirische Sozialforschung“ in Deutschland richtig ein. Früh hatte er dazu zwei Lehrbände herausgegeben. Er hält engen Kontakt zu den USA. Die „empirische Soziologie“ hat dort seit Mitte der dreißiger Jahre Hochkonjunktur: die Immigration vieler Wissenschaftler des berühmten „Wiener Kreises“ und anderer Wissenschaftler in die USA dank des „tausendjährigen Reichs“ in Deutschland, die Kriegsforschung, das Anlegen der sogenannten „Human Area Files“ durch die US–Regierung.
Köln ist also der Platz für empirische soziologische Arbeiten. Andere Institutionen nehmen das Institut für Soziologie für Beratungen und Dienstleistungen in Anspruch, vor allem für die Ausbildung der Interviewer für Befragungen. Die Soziologiestudenten in Köln bekommen viele Gelegenheiten für Forschungsjobs: interviewen, das Material aufbereiten, kodieren, rechnen, usw. Und diese Arbeiten wurden gut bezahlt. Ich beteilige mich an diesen Arbeiten von Beginn an.
Ich bin in Köln vollauf beschäftigt. Wochentags den ganzen Tag in Köln, abends regelmäßig im Büro des ISSF in Bonn, nachts in der Schlafstelle in der Weberstraße 96. An den Wochenenden in Düsseldorf. Meine Frau hat eine stressige Arbeit. Die volkswirtschaftliche Abteilung muß auch Reden für Vorstandsmitglieder schreiben. Kollegialität in der Abteilung gab es auch damals nicht. Sie sind Konkurrenten. Und meine Frau hat gerade ihre Promotion hinter sich. Sie will sich keine Blöße geben. Also arbeitet sie viel. Sie bringt regelmäßig Arbeit mit nach Hause. Auch an den Wochenenden. Sie tut dies aus freien Stücken, sagt sie.
Wir diskutieren über das Unesco–Projekt, wann immer die Zeit dafür da ist. Erwartet wird sicherlich – darüber sind wir uns einig – eine Bestandsaufnahme der vielfältigen Betreuungsmaßnahmen für die ausländischen Studierenden und auch eventuelle Verbesserungsvorschläge. Mir ist klar, daß es um die afrikanischen und asiatischen Studierenden und nicht um die ausländischen Studierenden im Allgemeinen geht. Sie und ihre Schwierigkeiten sind im öffentlichen Gespräch. Sie fallen äußerlich auf. Sie werden diskriminiert. Vielfältig. Die Diskriminierung, Arten der Diskriminierung, deren Folgen – nicht nur für das Studium – sind das Problem und nicht die richtigen Betreuungsmaßnahmen. Ihre Lebenssituation in diesem Land müßte beschrieben werden. Wer sonst als die betroffenen Studierenden könnten uns genauer sagen, wie ihre Lebenssituation ausschaut, was sie dabei empfinden, welche Erwartungen sie haben.
Meine Überlegungen diskutiere ich auch im Vorstand des ISSF. Auch darüber, ob es nicht sinnvoller wäre, die 5000,- US-$ für die Beschreibung der Aufenthaltssituation der afrikanischen und asiatischen Studierenden zu verwenden, als für die Reise– und Spesenkosten des Unesco–Referenten, für Veranstaltungen mit kleinem Imbiß und Umtrunk einiger ISSF–Hochschulgruppen zu verplempern. Der Vorstand unterstützt mich. Also warum nicht eine fundierte Befragung dieser Studierenden?
Ich nehme das freundliche Angebot von René König in Anspruch. Ich berichte über das Anliegen von Unesco, über den Stand der Diskussion im ISSF und frage ohne Umschweife, ob er, ob sein Institut, unsere Befragung wissenschaftlich betreuen würde. Seine Antwort ist ein unmißverständliches „Nein“. Noch bevor ich meine Enttäuschung überspielen kann, fügt er hinzu:
„Beratende Unterstützung ja, aber keine Betreuung. Nehmen Sie die Veranstaltungen und Beratungen in Anspruch. Entwerfen Sie ein Erhebungsinstrument. Das Institut kann und wird für Sie diese Arbeit nicht machen.“
Beim Verabschieden bemerkt er, daß er das Gelingen des Projekts begrüßen werde. Ich nehme die Herausforderung an. Dies ist der Stand im Januar 1959.
Das sozialwissenschaftliche Arbeiten lerne ich an diesem Unesco–Projekt, das sich schließlich zu einer wissenschaftlichen Untersuchung mausert. Das nichtuniversitäre Forschungsinstitut für sozialpolitische Fragen, das „Institut für Selbsthilfe und Sozialforschung e.V.“, ist unweit der Gebäude der WiSo–Fakultät. Dort ist eine von IBM angeleitete Lochkartensortiermaschine der 2. Generation. Nur zum Sortieren und Auszählen. Diese Maschine reicht aus – wenn auch zeitaufwendig –, Tabellen in absoluten Zahlen zu erstellen. Dann die Prozente mit dem Rechenschieber. Diese einfache Aufbereitung des Materials reicht für die Berichte aus, die die Auftraggeber von diesem Institut erwarten. In diesem „Institut für Selbsthilfe und Sozialforschung“ ist immer Bedarf an Hilfskräften, an Tagelöhner. Ich habe häufig in diesem Institut gearbeitet. Bald bin ich kein Tagelöhner mehr. Ich lerne schnell. Interviewen, Schlüssellisten erstellen, kodieren, lochen, sortieren, zählen, Tabellen schreiben, Prozente ausrechnen, also praktisch alle Arbeiten, die zwischen dem Abschluß der Feldarbeiten und dem Schreiben des Ergebnisberichts anfallen.
Der Direktor des Instituts, Otto Blume, ist ein vielbeschäftigter, aber doch umgänglicher Mensch. Er ist auch Habilitationskandidat bei jenem Gerhard Weisser, der Hans Albert aus der Habilitationsmisere geholfen hatte. Gerhard Weisser hat einen guten Ruf. Als Sozialdemokrat achtet und kooperiert er beispielsweise mit Oswald von Nell–Breuning, einem an der katholischen Morallehre orientierten Sozialpolitiker. Er ist auch der Vorsitzende der Friedrich–Ebert–Stiftung. Und Otto Blume ist der Vertrauensdozent für die Stipendiaten in Köln, also auch mein Vertrauensdozent.
Noch vor dem Ende des Wintersemesters 1958/1959 erkundigt sich Blume, ob ich an einer festen Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter interessiert wäre. Nicht in seinem Institut, sondern als Mitarbeiter von Gerhard Weisser. Die ausschließliche Aufgabe wäre englischsprachige sozialpolitische Literatur zu „Entwicklungsländern“ zu sichten, zu bibliographieren, zu lesen und darüber ausführliche Zusammenfassungen anzufertigen. Auf Deutsch, versteht sich. Der Arbeitsplatz wird im vierten Stock in einem angemieteten Haus neben den Hauptgebäuden der Universität sein.
Im 2. Stock des gleichen Hauses ist das Institut für Soziologie und im Parterre ist das Seminar für Ethnologie. Weisser leitet neben seinem Seminar für Sozialpolitik noch die Institute: Institut für Genossenschaftswesen, Institut für Wohnungswirtschaft, Institut für Verwaltungswissenschaft, mit insgesamt ca. 18 wissenschaftlichen Mitarbeitern. König hat nur 2 Institute mit ca. 8 Mitarbeitern.
Meine Frau und ich diskutieren immer wieder, ob es für uns, auch für sie nicht sinnvoller wäre, sich um eine Stelle in Bonn zu bemühen, als sich in Düsseldorf für die Deutsche Bank abzurackern. Mit einem erfolgreichen Studiensemester, mit einigen Nebeneinkünften, mit dem bewilligten Stipendium und schließlich mit der Aussicht auf eine Stelle bei Weisser im Rücken überrede ich meine Frau bei der Deutschen Bank so rechtzeitig zu kündigen, daß sie bereits im Mai 1959 nach Bonn zieht. Ob diese Überredung für sie richtig und günstig gewesen ist, wird für immer ungeklärt bleiben. Unmittelbar nach dem Umzug hat sie eine Magenschleimhautentzündung. Die Ärztin von nebenan verordnet meiner Frau viel Ruhe, geriebene Äpfel und Erdbeeren mit Schlagsahne. Ihr Umzug nach Bonn wird für mein Studium und für unser späteres Leben ausschlaggebend sein.
Unsere Heirat hat uns beiden nicht wenig Ärger eingebracht. Ich spreche nicht von alltäglicher Diskriminierung. Schlagartig verliert meine Frau alle ihre Bekannten und Freunde an der Kölner Universität. Wie konnte sie einen farbigen Ausländer heiraten? Sie bewirbt sich in den Ministerien, erhält aber keine Stelle, obwohl sie mit dem Thema „Die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete der sozialen Sicherheit“ ihren Doktorgrad mit „Sehr Gut“ im Juli 1957 erworben hatte. Der Hauptreferent war der Verfasser des „kleinen Heyde“, des Standardlehrbuchs in Sozialpolitik seinerzeit, Ludwig Heyde, nachdem der eigentliche Betreuer, der Versicherungswissenschaftler Walter Rohrbeck, verstorben war. Der Koreferent war der eigentliche Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, Alfred Müller–Armack. Auch der Leiter der Abteilung der staatsbürgerlichen Abteilung der Friedrich–Ebert–Stiftung, Günter Grunwald, reagiert unfreundlich, als ich die Stiftung über unsere Heirat informiere. Ärger für mich auch an der Kölner Universität. Darüber später mehr.
Die Magenschleimhautentzündung meiner Frau klingt dank des Essens indischer Gewürze nach wenigen Monaten ab. Trotz ihres neuen Stresses in Bonn. Wirkliches Abschalten, sich erholen, kann sie möglicherweise im Bridge–Klub. Bevor sie nach Bonn umgezogen ist spielte ich nur ab und an bei kleinen Klubturnieren mit. Der Bonner Bridge–Klub ist was Besonderes. Es ist eigentlich kein Klub, obwohl er als solcher beim Deutschen Bridge–Verband eingetragen ist. Der Bonner Klub ist praktisch eine Privatveranstaltung eines deutsch–englischen Ehepaares namens Clare in deren Privathaus. Mr. F. C. Clare, ein Korvettenkapitän der englischen Armee im ersten Weltkrieg, blieb in Deutschland hängen und lebte von seiner Pension. Zu der Zeit spielt Deutschland Skat. Clare spielt aber Bridge und findet zu Recht Bridge viel interessanter als Skat. Er bringt seiner Frau ebenso Bridge bei wie seinen Freunden. So entsteht der Bridge–Klub in Bonn noch vor dem Deutschen–Bridge–Verband. Ich hatte das Privileg, als sein Partner zu spielen.
Als meine Frau nach Bonn zog, lebte Herr Clare nicht mehr. Frau Clare übernahm das Vermächtnis, besaß alle Arbeitsunterlagen und unterrichtete weiter. Sie spielt selbst keine Turniere mehr, sie leitet Turniere: wöchentlich einmal in ihrem Privathaus, Hochkreutz 5, Bad Godesberg, ein monatliches Turnier jeweils in der „Lese“ in Bonn und in der Stadthalle in Bad Godesberg und ein Jahresturnier in Bad Neuenahr. Sie sieht es gern, daß ich ihr bei der Ausrichtung und Ausrechnung der Monats– und Jahresturniere helfe. So ist auch meine Frau, quasi selbstverständlich, zum Bridge gekommen. Sie hat bei Frau Clare gelernt, zunächst mit anderen Anfängern die Wochenturniere gespielt, später mit mir alle Klubturniere. Wir sind auch deshalb ein gerngesehenes Paar im Klub, weil wir uns am Bridgetisch nicht zanken.
Die Bridge–Spieler sind merkwürdige Menschen. Bildungsprivilegiert, wohlhabend, freundlich, sonst mit guten Manieren, nicht aber am Bridge–Tisch. Am Bridge–Tisch sind sie unfair, unfreundlich, unehrlich, ja, ekelig. Nun, Bridge ist kein leichtes Spiel. Es erfordert Intelligenz, schnelle Intelligenz im Gegensatz zum Schach. Und im Bridge kann geblufft werden. Am Bridgetisch wird aus einer spielerisch intellektuellen Herausforderung doch eine Angelegenheit des persönlichen Ansehens. Leider!
Bridge ist ein 52–Karten–Spiel. Am Tisch sind vier Spieler. Die sich gegenübersitzenden Spieler bilden jeweils ein Paar. Die Karten werden gemischt und ausgeteilt. Noch habe ich nie dieselbe Verteilung von Karten in der Hand gehabt. Es ist also jedes Mal etwas anderes, obwohl jeweils nur 13 Karten zu halten sind und es letztlich jeweils nur um 13 Stiche geht. Gereizt wird um einen „Kontrakt“, die Ankündigung, wie viel von den 13 Stichen eine Partnerschaft bei welcher Trumpffarbe machen will, ohne die übrigen 39 Karten zu kennen. Jede Partnerschaft ist bemüht, durch die Reizung die eigene Hand über spezifische „Kartensprachen“ zu beschreiben, damit abgeschätzt werden kann, wie viel Stiche unter welcher Voraussetzung die 26 Karten einer Partnerschaft machen kann. Es ist keine leichte Aufgabe, und es gibt viele Möglichkeiten für Mißverständnisse und des Fehlermachens. Und im Turnier geht es um Punkte, wobei dieselben Austeilungen an allen Tischen gespielt werden. Wenn ein Paar schlechter gespielt hat als die übrigen Paare, ist natürlich der nichtdominante Partner schuld, bei gemischten Paaren der weibliche Partner und bei Ehepaaren die Frau schuld. Es ist unglaublich, aber wahr. Dies ist einer der Gründe, warum Ehepaare ungern Bridge–Turniere spielen. Der unerklärliche Ehrgeiz ist einer sonst harmonischen Partnerschaft nicht förderlich. Wir fielen also auf, weil wir uns nicht, wie zwischen Bridge–spielenden Ehepaaren üblich, zankten, ganz gleich, wie das Ergebnis war. So waren wir im Klub sehr gern gelitten. Für uns war das Bridge–Spielen gute Erholung. Beim Gewinnen freuten wir uns, ohne Neid bei den anderen zu erwecken, und wir haben in Bonn häufig gewonnen. Auch in der stressigsten Zeit haben wir die Bridge–Turniere im Bonner Klub regelmäßig gespielt, nicht zuletzt auch, um Frau Clare bei der Ausrechnung behilflich zu sein.
1959 ist für mich ereignisreich. Die Methodenseminare des ersten Semesters in Köln lehren mich, daß ich mich intensiver mit den methodologischen Fragen befassen müßte, als dies in den „Seminaren“ möglich ist, sollte aus dem „Unesco–Projekt“ eine wissenschaftliche Untersuchung werden. In den Seminaren werden nicht eigene Untersuchungen herangezogen. Warum? Weil die Lehrenden selbst keine Untersuchungen durchgeführt hatten. Statt also in den Methodenseminaren zu sitzen, lese ich selbst, um ein optimales Untersuchungsinstrument zu konstruieren. Die intensiven Diskussionen mit meiner Frau sind dabei hilfreicher als Gespräche mit den Mitarbeitern von König. Ich habe 1959 überhaupt viel lesen müssen.
Der Anfrage von Otto Blume über eine Zusammenarbeit mit Weisser folgt dann eine Einladung Weissers. Er bestellt mich an einem Samstag- Nachmittag ins Hotel Dresen in Bad Godesberg. Unsere erste Begegnung. Ich habe nur Gutes über ihn gehört. Ich bin gespannt und natürlich aufgeregt. Das Gespräch ist eine Mischung aus Informationsübermittlung und Prüfung. Er fragt mich aus, ohne eine Atmosphäre einer Prüfung aufkommen zu lassen. Jetzt erst begreife ich, warum Weisser für das Gespräch ein Hotel ausgewählt und mich nicht in sein Arbeitszimmer bestellt hat. Ich erfahre auch, daß er intensiv über die Grundprobleme der Wirtschaftsordnung in den „Entwicklungsländern“ nachdenkt. Ja, damals hießen diese Länder schon so. Davor hießen sie „Unterentwickelte Länder“. Er würde gern genau wissen wollen, wie der Diskussionsstand über dieses Problem im englischen Sprachraum ist. Er denkt auch über eventuelle Veröffentlichungen seiner Gedanken in diesem Bereich nach. Ich bestehe die Prüfung. Im Juli 1959 trete ich die Stelle an. Ich beginne also auch noch Sozioökonomie auf Englisch zu lesen und fertige fleißig deutsche Zusammenfassungen an.
Meine Frau meint, daß es mit den Zusammenfassungen nicht getan wäre. Ich müßte eigentlich Aufsatzentwürfe vorlegen und sie nach der Besprechung mit Weisser dann auch ins Englische übersetzen, wenn ich die Stelle behalten wollte. Jeder deutsche Mitarbeiter würde das wissen. Ich bin zum „ghost writing“ nicht bereit.
Weisser lädt regelmäßig seine Mitarbeiter zum „Jour fixe“ ein. Die Ehefrauen der Mitarbeiter auch. Es ist eine nette und nützliche Einrichtung. Nach einem solchen Treffen fragt mich meine Frau auf dem Nachhauseweg, was denn zwischen Weisser und mir vorgefallen sei, daß Weisser sich veranlaßt gesehen hat, ihr zu sagen, daß ich ein wildes Fohlen sei, er aber mich schon noch zähmen würde.
Eigentlich war nichts Direktes vorgefallen. Aber möglicherweise mittelbar doch. Als Stipendiat ohne monatliches Stipendium der Friedrich–Ebert–Stiftung war ich zu einer Großveranstaltung in der Heimvolkshochschule in Bergneustadt eingeladen. Auch Politiker und Journalisten. Die Heimvolkshochschule in Bergneustadt liegt abgeschieden vom Ort. Abends sitzt man deshalb, nach getaner Arbeit in der hauseigenen Kellerbar. Diskutiert werden dabei meist andere aktuelle Fragen. Der Leiter der staatsbürgerlichen Erziehung der Stiftung, Günter Grunwald – ein Intimus des SPD–Schatzmeisters Alfred Nau, wie ich später leidvoll erfahren werde –, ist in der Kellerbar mitteilungsbedürftig. Er ist gerade aus Indien zurück. Dienstreise, versteht sich. Auch Dienstreiseeindrücke sind bekanntlich trügerisch. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Schon gar nicht in der Kellerbar einer Heimvolkshochschule. Aber Grunwald will seine Eindrücke von mir bestätigt haben. Ich bin genervt. Als er auch noch die herumkriechenden Schlangen zum Thema machte, die er während seines kurzen Aufenthaltes gesehen haben wollte, und ich noch die Gefährlichkeit der „frei umherlaufenden Schlangen“ bestätigen sollte, rutscht mir heraus, daß er – was das Antreffen von Schlangen angeht – eigentlich mehr Glück gehabt hätte als ich in meinem 22jährigen Leben in Indien. Schallendes Gelächter in der Runde. Rotangelaufenes Gesicht bei Günter Grunwald. Das Thema ist beendet, aber ich habe mir einen dauerhaften Feind geschaffen. Und wie schon erwähnt, Gerhard Weisser ist Vorsitzender der Stiftung.
Es könnte auch das mehrtägige „Berlinseminar“ Anlaß für die Bemerkung Weissers gewesen sein. Aber ein mittelbarer Anlaß. Es war mein erstes Stipendiatenseminar. Es war grauenvoll. Kalter Krieg pur und plump. Jeder Stipendiat ist verpflichtet, einen Seminar– und Erfahrungsbericht an den Leiter der staatsbürgerlichen Erziehung zu schicken. Eher zufällig unterhalte ich mich über das primitive Niveau des Seminarprogramms mit Otto Blume, dem Vertrauensdozenten für die Stipendiaten in Köln. Er möchte gern meinen Seminarbericht lesen, bevor ich ihn nach Bonn schicke. Er liest ihn und ermahnt mich, den Bericht nicht so abzuschicken, selbst wenn meine Kritik zutreffen sollte. Nun, ich würde die Kritik nicht so formuliert haben, wenn ich selbst nicht davon überzeugt gewesen wäre. Auch ich habe meine Vorstellung von demokratischer Erziehung und Meinungsfreiheit. Ich schicke den Bericht ohne „diplomatische“ Korrekturen. Und wie gesagt, Gerhard Weisser ist Vorsitzender der Stiftung.
Wie auch immer. Die Finanzierung der Stelle läuft aus. Die Friedrich–Ebert–Stiftung hat angeblich dafür nach 10 Monaten keine Mittel mehr zur Verfügung. Ich habe für Weisser nie schreiben müssen. Ich habe für ihn nie geschrieben. Er hat nie Kritik an meiner Arbeit geäußert. Nur das Verhältnis der Friedrich–Ebert–Stiftung zu mir ist vergiftet. Das ist sicherlich keine uninteressante, aber vielleicht an anderem Ort zu erzählende, Geschichte. Ich habe nicht häufig das monatliche Stipendiumsgeld in Anspruch nehmen müssen. Dennoch hat es regen Schriftverkehr gegeben. Zunächst mit Grünwald, später nur mit Nau, Weisser und Willi Eichier. Am 28. März 1961 wurde mein Stipendium wieder einmal storniert. Nicht endgültig. Endgültig eigentlich am 4. Mai 1961. Die Begründung von Nau bei der Stornierung:
„ich darf hierbei noch erwähnen, daß die Mitglieder des Prüfungsausschusses einstimmig die Ansicht vertreten haben, daß Sie bis zu diesem Zeitpunkt Ihre schon seit längerer Zeit in Arbeit befindliche Dissertation zum Abschluß gebracht haben können.“
Dies ist bisher die allerletzte Äußerung seitens dieser Stiftung mir gegenüber gewesen. Ich stehe offensichtlich noch heute auf einer sicherlich nicht existenten „schwarze Liste“ der Stiftung. Ich bin dennoch der Stiftung dankbar. Die Stiftung hat mir viel gegeben. Ohne die Stiftung würde ich wahrscheinlich Carlo Schmid, Fritz Erler, Heinz Kühn, Willy Eichler und Hans–Jürgen Wischnewski nicht gekannt haben.
1959 beginnt auch meine publizistische Laufbahn in der Monatsschrift „Geist und Tat“. Herausgegeben von Willy Eichler. Thema: Sozialisten in Indien. 1959 beginnt auch meine Vortragstätigkeit. Das wichtigste Ereignis ist aber, daß der Fragebogen für die Untersuchung über die Situation der afrikanischen und asiatischen Studierenden in Deutschland nach Voruntersuchungen endgültig fertig ist. Daß meine Frau keine Arbeitsstelle in Bonn findet, kommt diesem Projekt zugute. Unbezahlte Mitarbeit, versteht sich. Sie ist mir eine unschätzbare Hilfe. Der Bundesvorstand des ISSF und die Unesco, Paris, ist mit dieser Entwicklung einverstanden. König billigt das Projekt inhaltlich und bescheinigt, daß das Projekt unter seiner Aufsicht läuft. Doch ist das Projekt auch ein finanzielles Abenteuer. König hat sicherlich bei Zeiten geahnt, daß 5000,- US-$ nicht ausreichen würden, die Sachkosten für eine Untersuchung an den Universitäten in Berlin, Hamburg, Heidelberg, München und Tübingen mit lnterviewerausbildung und Interviewhonoraren abzudecken. Aber er sagt nichts. Er schreibt aber die notwendigen Briefe an die entsprechenden Universitäten. Er will offensichtlich abwarten, wie die Feldarbeit tatsächlich an– und abläuft.
Wir wissen genau, daß es knapp werden würde, die Erhebung zum Abschluß zu bringen. An eine Aufwandsentschädigung unserer Arbeit war nicht zu denken. Im Februar 1960 lagern 386 ordentlich ausgeführte Interviewbögen von einem Sample von 479 in unserer kleinen Bleibe in Bonn, Weberstraße 96. Studierende aus Ägypten, Indien, Indonesien, Jordanien, Ghana, Nigeria und Norwegen. Norwegen als eine Kontrollgruppe. Aber das Geld ist fast alle. Es reicht nur noch für die Lochkarten und für die Leihgebühr für einen mechanischen IBM–Handlocher aus der 1. Generation.
*****
Im 2. Semester in Köln habe ich die Zahl meiner Veranstaltungsbesuche radikal gekürzt, obwohl ich für das 1. Semester 100 % Gebührenerlaß bekommen habe. Fleißprüfung. Später habe ich keine Studiengebühren mehr entrichten müssen. Ich besuche nur die Hauptseminare und Hauptvorlesungen in Ethnologie, Philosophie und Soziologie. Die Veranstaltungen haben wenig gebracht und viel Zeit gekostet.
Noch bevor die Interviewbögen aus den einzelnen Universitätsorten zurück sind, habe ich König gefragt, ob er bereit wäre, einen Antrag für die notwendigen Mittel für die Auswertung der Untersuchung zu stellen. „Nein“, sagt König, „den Antrag müssen Sie schon selbst formulieren und für den ISSF stellen. Wenn er begründet ist, werde ich ihn befürworten.“ Ich stelle den Antrag für den ISSF an das Hochschulreferat des Auswärtigen Amtes und König befürwortet den Antrag am 19. Februar 1960:
„ich bin über die ganze Untersuchung, die von meinem Institut wissenschaftlich betreut wird, eingehendst informiert. (...) Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, daß die Erfahrungen, die wir bisher mit Herrn Aich gemacht haben, ganz ungewöhnlich gut sind. Es handelt sich hier um einen sehr selbständigen, ungewöhnlich klugen und sehr liebenswürdigen jungen Mann, der für die ganze Untersuchung ein sehr persönliches Engagement mitbringt.“
Im März ist die Schlüsselliste und die Kodierung fertig. Es ist eine verrückte Zeit. Gleich nach dem Frühstück beginnen meine Frau und ich mit der Kodierung. Während meine Frau das Mittagessen bereitet, übertrage ich die Daten von Kodeblättern auf Lochkarten. Der Handlocher macht einen höllischen Krach. Unsere Wirtin, Fräulein Lehner, nimmt dieses Hämmern billigend in Kauf. Es müsse halt sein, meint sie. Nach dem Mittagessen wieder kodieren. Beim Kochen des Abendessens lochen. Wieder kodieren, bis es endlich Zeit wird für die Spätvorstellung im Kino um 22.30 Uhr. Zum Entspannen. Fräulein Lehner geht immer mit. Ab dem zweiten Tag beginne ich mit dem Lochen, während meine Frau den Frühstückstisch deckt. Wir sind ein effizientes Team, mehr als nur die Addition zweier fleißiger Arbeitskräfte. Auch die späteren Arbeiten, vor allem die hier im Mittelpunkt stehende Geschichte, wären ohne diese Team-Effizienz und ohne die gegenseitige Verläßlichkeit nicht entstanden.
Ende März ist die Randauszählung fertig. Erstellt mit der IBM–Sortiermaschine im „Institut für Selbsthilfe“. Ich lege sie König vor. König schickt eine ergänzende Stellungnahme an das Auswärtige Amt am 30. März 1960:
„hiermit möchte ich mir erlauben, zu dem Antrag um einen Zuschuß für eine Forschungsarbeit ... durch Herrn Prodosh Aich Stellung zu nehmen. Ich darf Sie daran erinnern, daß die Untersuchung unter unserer Überwachung läuft. Ich kenne Herrn Aich schon seit längerer Zeit, da er sehr intensiv bei uns mitgearbeitet hat. Jetzt, nachdem die ersten Ergebnisse seiner Erhebung eingegangen sind, kann ich beurteilen, daß ich mich in ihm nicht nur nicht getäuscht habe, sondern daß er sich auch als ein ganz ausgezeichneter Forschungsleiter bewiesen hat. Aus diesem Grunde möchte ich ganz persönlich den Antrag des Internationalen Studentenbundes befürworten. Gleichzeitig möchte ich bemerken, daß die ersten Ergebnisse bereits zeigen, wie interessant die vorliegende Untersuchung zu werden verspricht. Es wäre also äußerst unglücklich, wenn man sie auf dem Viertelswege liegen lassen wollte. Ich bin sicher, daß diese Studie für die Behörden von größter Wichtigkeit werden wird, wenn die Ergebnisse erst gesamthaft ausgewertet sein werden.“
Die folgenden Monate sind finanziell äußerst hart. Meine Tätigkeit für Weisser ist beendet. Dafür erhalte ich mein Stipendium von 250,- DM, Honorare für Aufsätze, Vorträge und gelegentliche Arbeiten im Institut von Otto Blume. Meine Frau hat kein regelmäßiges Einkommen. Wir hoffen auf die Bewilligung des Antrags durch das Auswärtige Amt. Der ISSF ist damit einverstanden, daß die eventuellen Mittel dann von der Kölner Universität verwaltet werden würden und ich dann im Institut für Soziologie als Forschungsbeauftragter geführt werde. Die Art und Weise, wie mein Beschäftigungsverhältnis mit Weisser beendet wurde, hat bei König und seinen Mitarbeitern Sympathien für mich geweckt. Diese sind: der Privatdozent Peter Heintz, schweizer Nationalität, dessen Buch über „Soziale Vorurteile“ bei der Planung meiner Untersuchung hilfreich war, der seine Vorlesungen auf „lexikondeutsch“ – sehr exakte, aber schwer gängige Bandwurmsätze – hält; der wissenschatliche Assistent im Institut für Mittelstandsforschung, Hans–Jürgen Daheim; die beiden wissenschaftlichen Assistenten Fritz Sack und Franz–Josef Stendenbach, so etwas wie ein Geschäftsführer des Instituts, zwei Sekretärinnen und zwei wissenschaftliche Assistenten im „Seminar für Soziologie“, dessen Leiter wiederum König ist.
Eine Ausnahme ist da: Erwin K. Scheuch. Nicht daß er etwas Negatives öffentlich kundgetan hätte. Er gibt sich gleichgültig. Er sitzt an seiner Habilitationsarbeit. Er läßt sich auch zu informellen Anlässen nicht sehen. Ich würde seiner Zurückhaltung keine besondere Bedeutung beigemessen haben, wenn meine Frau und Scheuch nicht Studienkollegen gewesen wären. Damals, aber auch zu meiner Zeit, war die Universität zu Köln klein. Die Angehörigen begegneten sich häufig. Auch damals wurde nicht wenig getratscht. Meine Frau war nicht nur wegen ihrer langen blonden Zöpfe auffällig. Sie hatte einen Professor geohrfeigt, weil der sie zum Beischlaf erpressen wollte. Sie war dem amtierenden Dekan glaubwürdiger als der betreffende Professor. Vollzogene Erpressungen waren den Universitätsangehörigen an der Kölner Universität nicht unbekannt. Aber einmalig war der Mißerfolg, eine universitätsöffentliche Ohrfeige, und dies noch in der Endphase ihrer Promotion. Daß just diese Frau in Universitätskreisen wieder auftaucht, ist vielen nicht recht. Sie war damals nach dem unüblichen Ereignis von ihren wissenschaftlichen Kollegen gemieden worden, von Unterstützung ganz zu schweigen. Scheuch hat meine Frau erkannt, auch ohne ihre Zöpfe.
Auch Scheuch war seinerzeit auffällig, weil er in Veranstaltungen zu spät herein hechelte mit einer stets übervollen Aktentasche, die eher auffiel als seine physische Erscheinung. Er fiel auch in Seminaren auf, weil er auf eine hektisch–ehrgeizige Art redete, eher in einem ihm eigenen Telegrammstil mit unvollständigen Sätzen, nervös augenzuckend, aber mit einer Gestik, die König so ähnelte, daß er den Beinamen „der kleine König“ erhielt. Zu meiner Zeit fühlt sich „der kleine König“ im Vergleich zu seinem Seminarassistentenkollegen Dietrich Rüschemeyer zurückgesetzt. König hat zu Rüschemeier ein entspanntes Verhältnis, zu Scheuch nicht.
Welche Gedanken Scheuch in der neuen Situation durch seinen Kopf geht, als er sieht, daß wir verheiratet sind oder daß ein farbiger Ausländer sich langsam im Institut etabliert, werde ich nie erfahren. Deshalb werde ich mich nur auf Fakten beschränken. Scheuch hat sich als „Fachmann“ in Sachen empirischer Sozialforschung – wenn auch nur ein theoretischer Fachmann – leicht ausrechnen können, was meine Frau mir über ihn alles erzählt haben könnte. Fakt ist, daß Scheuch und ich nie einen privaten Kontakt gehabt haben.
Der Vorfall mit der Ohrfeige soll bei den Professoren ein Gesprächsthema an den „Herrentischen“ gewesen sein. Ein Nachbeben davon erlebe ich auch. Gegen Ende des Jahres 1960 bestellt König mich zu einem Gespräch. Für längere Gespräche bestellt er gern Mitarbeiter an Samstagnachmittagen. An dem Tag haben wir auch eine andere Verabredung in Köln, daher ist meine Frau mit gefahren. Wir warten schon vor dem Institutsgebäude, als König ankommt. Ich stelle ihm natürlich meine Frau vor. Er ist verwirrt. Nach anmerkbarem Zögern fragt er meine Frau, ob sie in Köln studiert hätte und mit ihrem Mädchenname Knüwe hieße. Sie bejaht.
Wortlos schließt er die Haustür auf und geht die Treppen hoch zum zweiten Stock. Schweigend. Wir folgen ihm. Im Arbeitszimmer angelangt geht er zu seinem Sessel, setzt sich aber nicht, bittet uns mit einer Handbewegung, Platz zu nehmen. Immer noch stehend greift er zum Telefon. Er telefoniert mit seiner Frau fast eine halbe Stunde lang, über nichts oder Belanglosigkeiten. Dabei kommt er gerade von zu Haus. Ratlosigkeit und Verlegenheit stellen sich bei uns ein. Nach dem Telefongespräch stellt er keine Fragen, macht keine Anmerkungen. Nichts. Als König uns dann verabschiedet, weiß ich nicht, warum König mich bestellt hatte. Das Image von König, immer souverän und locker zu sein, bekommt einen ersten Kratzer. König kennt also den Vorfall. Auch er hatte seinerzeit nichts unternommen. Etwas Ähnliches ist bei Gerhard Weisser nicht geschehen. Seiner Verhaltensweise hat mir nicht den leisesten Hinweis gegeben, ob auch Weisser von dieser Ohrfeige gewußt hat oder ob er meine Frau mit diesem Vorfall in Verbindung gebracht hatte.
Die berechneten Daten unserer Untersuchung sind vom Rechenzentrum der Universität zurück. Aufregende Zeit. Die Rechenblätter enthalten nur Zahlenkolonnen, –Reihen und Symbole. Keine Texte. Die Zahlen übertragen wir auf vorbereitete Tabellenblätter und beschriften sie. Dann geht das Nachdenken und das Schreiben los. Zu meinem Glück und sicherlich zum Unglück meiner Frau kann sie auf Deutsch und Englisch stenographieren, beherrscht auch das Zehnfingersystem für das Maschinenschreiben. Sie hatte die Handelsschule besucht, bevor sie Abitur machte. Großzügig bietet sie mir ihre Hilfe an. Aus diesem Hilfsangebot ist leider für spätere Arbeiten eine Selbstverständlichkeit geworden. Alles schriftliche von mir bis 1987 hat sie mindestens dreimal geschrieben. Das erste Mal in Kurzschrift. Wenn ich mir die Anzahl der angesammelten Aktenordner ansehe, wird mir nicht nur schlecht. Wir fragen uns auch, wie wir das alles wirklich geschafft haben?
Ab April 1960 ist der Tagesablauf durch die Auswertung der Untersuchung geprägt: aufstehen, gedankliches Sammeln, Frühstück, die Tabellenblätter sortieren, entlang einer Reihe von Tabellenblättern konzipieren, diktieren bis der Kopf leer ist. Meine Frau tippt. Ich erledige alles übrige. Dann meist in die Spätvorstellung mit Fräulein Lehner. Sie läßt uns bis abends in Ruhe, hilft uns, wo sie nur kann, und leidet mit uns den Streß durch.
Monat für Monat gehöre ich dem Institut ein Stückchen mehr. Ich bin jener Forschungsbeauftragte, der keinen Arbeitsplatz im Institut hat und auch kein Gehalt vom Institut bekommt. Jeder hofft, daß der Antrag beim Auswärtigen Amt durchkommt. Eine Planstelle als wissenschaftlicher Assistent ist solange nicht in Sicht, bis Scheuch nach seiner Habilitation eine andere Stelle bekommt. Nicht daß König mir eine explizite Hoffnung gemacht hätte. Nein. Dennoch wissen alle Mitarbeiter von König, daß die nächste Assistentenstelle für den neu entstehenden Schwerpunkt „Soziologie der unterentwickelten Gebiete“ eingerichtet und durch mich besetzt werden würde.
Ich halte immer mehr Vorträge. Die Zahl der Aufsätze wächst auch. Die „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie“ berichtet auch über wissenschaftlichen Tagungen. Josef Gugler, jener freundliche Doktorand von König, der mich König vorstellte, und ich tauchen häufig zusammen im Institut auf. Irgendwann beginnt König, uns Max und Moritz zu nennen. Im Juni 1960 fragt er uns, ob wir an einem internationalen Seminar über „Leadership in the Nonwestern World“ in Wageningen (Niederlande) teilnehmen und darüber einen Bericht schreiben wollen. Wir wollten. Die Reisekosten würden übernommen, ebenso die Spesen vom 28.Juni bis 1. Juli, ein kleines Honorar winkt uns auch noch. Und lernen könnten wir auch von den Soziologiepäpsten auf diesem Gebiet der „Unterentwicklung“: W. F. Wertheim (Amsterdam), G. Balandier (Paris) M. Freedman (London).
Josef Gugler und ich haben eine etwas unterschiedliche Einschätzung über das Ergebnis und über den Nutzen des Seminars. Er ist nicht erbaut. Ich bin enttäuscht. Wir haben nichts Neues gelernt. Außer vielleicht, daß auch die Päpste nur mit Wasser kochen. Das können wir natürlich nicht schreiben. Und wie schreibt man einen Bericht zu zweit? Ich soll einen Entwurf machen. Josef Gugler ist erschrocken, als er meinen Entwurf liest. Alle drei Referenten sind Freunde von König. Lange Diskussion zwischen uns. Was stimmt im Entwurf nicht, frage ich ihn. Die Schärfe der Kritik wird etwas geglättet. Dann Audienz bei König. Josef Gugler berichtet, wie der gemeinsame Bericht zustande gekommen ist. König liest den Bericht sofort durch. Er ist einverstanden. Der Bericht erscheint unverändert in der „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie“ (12.Jahrgang, 1960, Heft 3). Gugler ist überrascht.
Im Spätsommer 1960 kann ich überblicken, daß die Auswertung der Untersuchung und der Bericht für die Unesco, Paris, spätestens bis zum nächsten Frühjahr fertig sein könnte. Muß ich den Bericht zeitlich mit meinen Studien– und Prüfungsinteressen koordinieren? Wie soll es weitergehen? Auch materiell? Fragen, die ich nicht verdrängen kann. Aber es sind auch Fragen, auf die keine Antworten zu finden sind. So komme ich auf einen platten, in der Sozialwissenschaft gängigen Einfall und schlage König vor, zunächst einen Bericht für die Unesco zu schreiben. Danach könnte ich das gesamte Material für meine Dissertation theoretisch aufarbeiten. Was auch immer man darunter verstehen mag. König ist einverstanden. Am 29. Oktober 1960 stelle ich beim Dekan der philosophischen Fakultät einen Antrag um die Zulassung zur Promotion. Nach der geltenden Prüfungsordnung wäre die Prüfung erst im neunten Fachsemester möglich. Also wird der Antrag auch mit diesem Hinweis auf die Prüfungsordnung abgewiesen.
Das Auswärtige Amt bewilligt tatsächlich den beantragten Betrag: 20000,- DM für die Auswertung der Untersuchung. Im Dezember 1960. Die Ausgaben sollten noch im Haushaltsjahr 1960 abgerechnet werden. Wie? Aufgeregt fahre ich sofort zu König. Er ist hocherfreut über die Bewilligung und versteht meine Aufregung nicht. „Jüngling“, sagt er, „alles, Sachkosten, was Sie bisher für die Untersuchung verausgabt haben und Honorare, die fällig geworden wären, wenn das Geld rechtzeitig gekommen wären, alles, belegen Sie mit entsprechendem Datum, und rechnen Sie die 20000,- DM noch im Dezember 1960 ab. Es ist Lauferei, aber tun Sie es.“ Dann klärt er mich auf, wie das Ganze funktioniert.
Das Auswärtige Amt wird wissen, daß die Belege nicht echt sind. Wir wissen, daß das Auswärtige Amt wissen wird, daß wir wissen, daß das Auswärtige Amt weiß, daß die Belege nicht echt sind. Auch das Auswärtige Amt wird wissen, daß wir wissen, daß das Auswärtige Amt wissen wird, daß wir es wissen, daß das Auswärtige Amt es weiß, daß die Belege nicht echt sind. Nur darf keine Seite über dieses gegenseitige Wissen je reden. Es sind mühsame Tage, aber es funktioniert. Nein, ich dachte nicht an Korruption. Damals ganz gewiß nicht. Denn Korruption gab es und gibt es nur in den Bananenrepubliken!
Ab Dezember 1960 werde ich offiziell als „Forschungsbeauftragter“ geführt. Aber ohne einen Arbeitsplatz im Institut. Schwerpunkt: „Unterentwickelte Gebiete“. Die politische wie wissenschaftliche Diskussion hierüber beginnt anzulaufen. Es wird bekannt, daß ich in der Endphase der Auswertung einer größeren empirischen Untersuchung über die afrikanischen und asiatischen Studenten in Deutschland bin. Viele sind interessiert, noch vor der Veröffentlichung das Material einzusehen, um es für ihre eigene Arbeit verwerten zu können, wie beispielsweise Dieter Danckwort und Diether Breitenbach, beide damals bei der „Deutschen Stiftung für Entwicklungsländer“ in der Villa Borsig, Berlin–Tegel. Eifer dieser Art ist Vorbote für die nahende Hochkonjunktur des Themas. Das Ansinnen, Einblicke in das Forschungsmaterial anderer schon vor der Veröffentlichung zu gewinnen, hat nichts mit „grabschen“ zu tun. Es gibt eben smarte und weniger smarte Sozialwissenschaftler. Und nicht nur Sozialwissenschaftler.
Die „Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer“ wird 1960 gegründet. Sie ist eine hundertprozentige Tochter des Bundes. Sie soll eine Reihe von „wissenschaftlichen Arbeitstagungen“ veranstalten. Zu der ersten – vom 2. bis 6. Januar 1961 – bin auch ich eingeladen. Ich soll auch über diese Tagung – geleitet wird sie von Arnold Bergsträßer – für die Kölner Zeitschrift berichten, zum ersten Mal allein, also nicht zusammen mit Josef Gugler. Teilnehmer dieser Tagung sind Wissenschaftler, die auf diesem Gebiet engagiert sind oder sich engagieren wollen.
Ich berichte nicht über jene 36 von 45 vorgesehenen „Kurzreferate“ von jeweils ca. 15 Minuten. Warum? Weil es darüber nichts zu berichten gegebenn hat. Ich berichte fast ausschließlich (Kölner Zeitschrift, 13. Jahrgang, 1961, Heft 1) über ein nicht geplantes längeres Referat von Ernst Bösch, Sozialpsychologe an der Universität Saarbrücken, dem nach 3½ „Arbeitstagen“ der Kragen geplatzt war. Es ist ein Levitenlesen. Auch über eine von den Stiftungsfunktionären abgewiegelte Resolution zur künftigen Gestaltung der Arbeit in der Stiftung. König bringt den Bericht in voller Länge, ohne diplomatische Glättungen.
Wenige Monate später kritisiere ich in einer Podiumsdiskussion die inhaltliche Arbeit und die materielle Ausstattung dieser Stiftung. Diese Veranstaltung findet in der Aula der Hamburger Universität statt. Es diskutieren: Fritz Baade (Prof. Dr. Dr. h.c., Mitglied des Bundestages (MdB) und Direktor des Forschungsinstituts für Wirtschaftsfragen der Entwicklungsländer), Viktor Kadalie, (ein promovierter Arzt aus Südafrika), Helmut Kalbitzer (MdB und Vizepräsident des Europaparlaments), Ludwig Rosenberg (stellvertretender Vorsitzender des DGB und Präsident des Wirtschafts– und Sozialausschusses der EWG) und ich. Der Kurator der Stiftung, F. G. Seib, fordert am 17. November 1961 König schriftlich auf, wegen meiner öffentlichen Kritik an der Stiftung in Hamburg mich nicht zu promovieren. Diese Deutsche Stiftung, heute die Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung, handelt offener und ehrlicher als die Friedrich–Ebert–Stiftung. Ja, die deutschen Stiftungen!
Die ersten Monate des Jahres 1961 bin ich intensiv beschäftigt, den Bericht über die Situation der afrikanischen und asiatischen Studierenden abzuschließen. Ihre Anpassungsschwierigkeiten und ihre Entfremdung nach erfolgter Anpassung bilden den Schwerpunkt. Ich denke weiter über diesen Forschungsschwerpunkt nach. Auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Was sollte ein Forschungsbeauftragter tun, wenn es keinen konkreten Forschungsgegenstand gäbe?
So taucht auch die Frage auf, wie sich wohl der Studienaufenthalt mit allem Drum und Dran auf ihre „Politische Einstellung“ auswirken. Beispiele wie Chau–En–Lai, ausgebildet in Moskau, später aber nicht nur der Politik der UdssR durchaus nicht grün, oder Gandhi, Nehru, Sukarno, alle ausgebildet im „Westen“, und später dann Führer der Unabhängigkeitsbewegung und Initiatoren der blockfreien Bewegung, oder Ho Chi Minh, ausgebildet in Paris, der später den französischen Streitmächten die schmähliche Niederlage in Dien Bien Phu beibrachte, legen die Frage nach der politischen Einstellung nahe. W. F. Wertheim, Universität Amsterdam, einer der Päpste auf diesem Gebiet, veröffentlicht die Theorie, daß der antikoloniale Kampf erst nach der Verinnerlichung der westlichen Werte durch die städtischen Intellektuellen mit Erfolg geführt werden könne. Ein Erkenntnisziel – etwas überspitzt formuliert – könnte lauten: Soll der Westen das Auslandsstudium der afrikanischen und asiatischen Studierenden im Westen oder im Osten finanzieren, um den maximalen politischen Einfluß auf die entkolonisierten Länder zu gewinnen? Ich trage König meine Gedanken vor. Er beauftragt mich, den Projektantrag zu formulieren.
Klaus von Bismarck wird neuer Intendant des „Westdeutschen Rundfunks“. Er ist auch der Vorsitzende der „Gesellschaft für Sozialen Fortschritt“. Diese Gesellschaft hat eine Monatsschrift. Ich hatte Gelegenheiten, für diese Zeitschrift zu schreiben. So weiß ich, daß Klaus von Bismarck an dem Problem ebenso interessiert ist wie auch an der wirksamen Vermittlung von Forschungsergebnissen durch die Medien. Und der WDR hat auch in beschränktem Umfang Forschungsmittel zu Programmzwecken zu vergeben. Nach einem ausführlichen Gespräch mit Klaus von Bismarck formuliere ich einen Antrag. Im Mai 1961 wird er gestellt. Vorausgegangen ist auch eine Zusage von „Free Europe Organizations and Publications“ in Paris, eine solche Untersuchung mit etwa 5.000,- US-$ zu unterstützen. Diese Zusage wird durch eine Vereinigung der ungarischen Exilstudenten in Krefeld vermittelt. Auch die Carl–Duisberg–Gesellschaft, die die ausländischen Praktikanten in Deutschland betreut, interessiert sich dafür, obwohl sie für Studierende nicht zuständig ist. Einer der beiden Geschäftsführer der Carl–Duisberg–Gesellschaft ist Doktorand bei König, Winfried Böll. Er befaßt sich zunehmend mit einer noch zu formulierenden Politik der Bundesrepublik gegenüber den „unterentwickelten Ländern“. Praktisch übt er drei Jobs aus: Studium, Carl–Duisberg–Gesellschaft (zuständig für Außenkontakte) und „Entwicklungspolitik“, verbunden mit Herumreisen und Vorträgehalten. Unsere Wege haben sich oft gekreuzt. Das Studium als Job bleibt bei Winfried Böll auf der Strecke. Er macht später eine unkonventionelle Karriere: Er brachte es zum Ministerialrat im ersten „Entwicklungshilfeministerium“ ohne einen akademischen Grad. Für mich sorgt er für eine Überraschung. Die Carl–Duisberg–Gesellschaft gewährt dem Institut für Soziologie an der Universität Köln ein Darlehen, weil das Genehmigungsverfahren beim WDR länger als erwartet andauert. Der WDR wird darüber informiert.
Der Bericht für die Unesco und für das Auswärtige Amt über die Situation der afrikanischen und asiatischen Studierenden wird umfangreich. 403 Seiten ohne den Anhang. Mir gelingt es nicht, ihn noch während des Sommersemesters 1961 vorzulegen. König ist seinem liebsten Steckenpferd gefolgt: „Summer school“ in den USA. Er reist gern. Jedes Jahr macht er den befreundeten Kollegen bekannt, wie es mit seinem Arbeitsdruck ausschaut und wann er wieder einmal Lehrverpflichtungen übernehmen könnte.
Ich überreiche König den Bericht, als er gerade aus den USA zurückkommt. In derselben Woche, am Samstagnachmittag, ruft mich Fräulein Lehner zum Telefon, etwas erregt, weil König am Apparat ist. Sie weiß natürlich, daß König die „Arbeit“ erhalten hatte. Ich melde mich. Unvermittelt fragt er mich, ob ich auch vor hätte, zu promovieren. Als ich ziemlich überrascht und mit einigem Zögern ein „Ja“ herausbringe, fragt er mich, warum ich den ihm vorliegenden Bericht nicht als Promotionsarbeit einreiche. Er schlägt mir einen Besprechungstermin vor, als ich die mir fehlenden Semester erwähne.
In der darauf folgenden Besprechung geht es nur um die vorzeitige Zulassung zur Prüfung. Den Bericht findet er gut. Änderungs– oder Ergänzungsvorschläge macht er nicht. Ich sollte den Bericht so lange zurückhalten, bis ich zur Prüfung zugelassen werde. Er spricht mit dem Dekan am 27. Oktober 1961. Am 29. Oktober stelle ich den förmlichen Antrag, um die Anerkennung der „Nicht–Fachsemester“ zum zweiten Mal. Am 7.November teilt mir der Dekan der philosophischen Fakultät mit:
„auf Ihren Antrag vom 29. 10. d. J. hat die Philosophische Fakultät Ihnen die beiden an der Wirtschaftsfakultät der Universität Bonn verbrachten Semester auf die zur Promotion erforderlichen acht Fachsemester angerechnet.“
Im Dezember 1961 mache ich meine abschließenden mündlichen Prüfungen.
Dies waren auch jene Monate, in denen ich das Befragungsinstrument für meine 2. Erhebung, also zur „Strukturierung der politischen Einstellung der afrikanischen und asiatischen Studierenden in den deutschsprachigen Ländern“ in Voruntersuchungen überprüfe. Die Interviews sollten bis Februar 1962 abgeschlossen sein. Diese Arbeit nimmt mich so in Anspruch, daß ich keinen Prüfungsdruck verspürt habe. Die Prüfung lief nebenher wie meine Teilnahme an den Hauptseminaren.
Erst nach den Prüfungen erhalten der ISSF, die Unesco, Paris, und das Auswärtige Amt jeweils eine Kopie des Berichts. Der ISSF und die Unesco, Paris, sind mit dem Bericht zufrieden. Das Auswärtige Amt nicht. Die Befunde sind politisch nicht opportun. Die Auswahl der Studierenden, die Beschreibung der Schwierigkeiten, das Hervorheben des Dilemmas: Erfolgreiche Überwindung der Schwierigkeiten, also die Anpassung an die hiesigen Verhältnisse, bedeutet im gleichen Maße die Entfremdung von der heimatlichen Kultur. Also fragt das Auswärtige Amt bei König diplomatisch an, ob es nicht opportun wäre, den Bericht vorläufig nicht zu veröffentlichen. König weiß den Brief richtig zu deuten. Er weiß, wie er das „vorläufig“ zu interpretieren hat. Er bestellt mich ins Institut. Er gibt mir das Schreiben zu lesen, ruft gleichzeitig eine seiner Sekretärinnen und diktiert das Antwortschreiben. Er will vom Auswärtigen Amt wissen, ob das Schreiben als Ankündigung einer Zensur zu deuten sei. Das Auswärtige Amt ist auf dem falschen Fuß erwischt. Natürlich will das Auswärtige Amt dieser Republik keine Zensur ausüben. Der Weg zur Veröffentlichung ist frei. Es wird aber leider ein Pyrrhussieg. Denn so etwas vergißt das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland nicht, wie ich später erfahren werde.
Bei der 2. Untersuchung darf meine Frau mir offiziell als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut helfen. Wir reisen zusammen zu den Universitäten, ziehen das Sample und bilden die Interviewer aus. Ihre Aufwandsentschädigungen und Reisekosten rechnet die Universitätsverwaltung getrennt ab. Bereits im Jahr 1967, im April wird König die Tatsache schriftlich leugnen, daß bei meiner 2. Untersuchung meine Frau mir offiziell als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts helfen durfte, obwohl viele Schriftstücke in den Akten des Instituts dieses belegen.
Insgesamt werden 709 Studierende an 8 verschiedenen Universitätsorten interviewt: Aachen, Berlin, Bonn, Göttingen, Köln, München, Wien und Zürich. Die Feldarbeit ist bis April 1962 abgeschlossen. Wieder das Erstellen der Schlüsselliste, Anmieten eines IBM–Handlochers, kodieren, ruhestörendes Lochen. Arbeitsplatz: Bonn, Weberstraße 96. Und fast immer zum Abschluß des langen Arbeitstages belohnen wir uns mit einer Kinospätvorstellung mit Fräulein Lehner.
Ich komme mit König überein, daß das Ergebnis der 2. Untersuchung zunächst nur vollständig aufbereitet, aber nicht schnellstmöglich veröffentlicht werden sollte. Denn zur sinnvollen Abrundung des Themas müßte logischerweise eine 3. Untersuchung durchgeführt werden zum Rückanpassungsprozeß nach dem Studium. Alle Aspekte des Auslandsstudiums sollen dann auch das Thema meiner Habilitation werden. Aber ich bin noch nicht an der Reihe. Im Institut gibt es eine inoffizielle Reihenfolge der Kandidaten. Vor mir sind Dietrich Rüschemeier, Hans–Jürgen Daheim und Franz–Josef Stendenbach dran. Rüschemeier geht in die USA, heiratet dort und will seiner jüdischen Frau ein Leben in Deutschland ersparen. Mit Hilfe von König und auf seine Empfehlung hin geht Stendenbach zur OECD nach Paris auf einen gutdotierten Posten. Nun ist Daheim noch vor mir dran. Er ist noch nicht so weit.
Also muß ich einen Forschungsplan über den Rückanpassungsprozeß entwerfen. Die geographischen Bezüge „afrikanisch“ und „asiatisch“ wie in den ersten beiden Untersuchungen sind nicht haltbar. Die von uns befragten Studierenden sind nach der Rückkehr in ihren Heimatländern weit verstreut. Weder zeitlich noch finanziell wären sie erreichbar. Eine Fallstudie kommt auch nicht in Frage. Also nehme ich mir die Unesco–Statistik der Auslandsstudierenden vor. In Afrika sind kaum Rückkehrer aus der Bundesrepublik zu finden. Auch die asiatischen Länder weisen eine unterschiedliche Verteilung auf. Aus 5 Gründen fällt die Wahl auf Indien:
1 Die indische Bevölkerung machte 40 % der Menschen aus, die in den nichtkommunistischen unterentwickelten Ländern leben
2 Zwei britische Wissenschaftler, das Ehepaar Ussem und Ussem, hatten 1955 eine Pilotstudie „Western Educated Man in India“ vorgelegt, worauf meine Untersuchung hätte sinnvoll aufbauen können;
3 Seit dem zweiten Weltkrieg kamen die meisten im Westen studierenden Ausländer aus Indien, dies bietet somit die Möglichkeit, ein sinnvolles Sample zu ziehen;
4 Rückkehrende indische Studierende verteilen sich auf die USA, England, die Bundesrepublik und in etwas geringerer Zahl auf die UdSSR. Dies würde die Möglichkeit erschließen, den Einfluß der verschiedenen Universitätssysteme zu untersuchen;
5 Die kulturelle Unterschiedlichkeit in Indien könnte eventuell die Möglichkeit einer Übertragung der Schlußfolgerungen dieser Untersuchung auf andere „unterentwickelte Gebiete“ rechtfertigen.
Wäre auch die dritte Untersuchung so verlaufen wie meine ersten beiden, würde ich vieles nicht wissen. Wir würden nicht mit einem Frachtschiff in Bombay angekommen sein, sondern mit einem Flugzeug in Neu Delhi. Bewilligte Forschungsaufträge sind termingebunden. Da bleibt keine Zeit für eine Reise mit einem Frachtschiff. Nach meiner ebenso reibungslos abgelaufenen Habilitation wäre ich ein Fachidiot in Fragen des „Auslandsstudiums“, oder des „interkulturellen Lernens“ geworden. Aber zurück zu der wirklichen Geschichte.
Winfried Böll von der Carl–Duisberg–Gesellschaft ist von der Konzeption der neuen Untersuchung angetan und denkt über eine Kontrollgruppe von „Praktikanten“ nach. Inzwischen pendelt er zwischen Köln und Bonn. Er hält sich immer mehr in Bonn, im „Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit“ auf. Zunächst als Berater, später als Planer und leitender Beamter. Böll meint noch im Herbst 1962, daß mein Antrag im neuen Ministerium, geleitet von Walter Scheel, ein Selbstgänger sein wird. Spätestens bis Ende Januar 1963 wird er bewilligt sein. Wir stellten den Antrag am 16. November 1962. Titel der Untersuchung: „Künftige Elite oder wurzellose Intellektuelle? Eine Untersuchung über die Auswirkung des Auslandsstudiums junger Inder auf den Modernisierungsprozeß ihres Landes nach ihrer Rückkehr.“
Zwischenzeitlich ist die Veröffentlichung der ersten Untersuchung auch als meine Promotionsarbeit gesichert. Sie soll als Band 10 in der Reihe „Beiträge zur Soziologie und Sozialphilosophie“ herausgegeben von Prof. Dr. René König im Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln erscheinen. In dieser Reihe ist die Habilitationsarbeit von Peter Heintz als Band 7 erschienen. Scheuch, Rüschemeier und Daheim haben vor mir promoviert. Ihre Promotionsarbeiten sind nicht in dieser Reihe, nicht als Buch publiziert. Der Verleger Dr. Witsch gratuliert mir in Gegenwart von König, weil ich als erster ein Autorenhonorar in dieser Reihe bekomme. Meine Promotionsarbeit erscheint im November 1962 unter dem Titel „Farbige unter Weißen“ mit einem Vorwort des Herausgebers. Darin heißt es zu Beginn:
„Wenn etwas den Nutzen der empirischen Sozialforschung augenfällig demonstrieren kann, so ist es die vorliegende Untersuchung ... Dabei stellt sich ganz eindeutig heraus, daß die in der Öffentlichkeit sehr stark unterstrichenen Schwierigkeiten der Studenten aus Entwicklungsländern zum Teil eine ganz geringfügige Rolle spielen, evtl. sogar nur individuell bedingte Ausnahmen darstellen, so daß hinter diesen meist vorschnell verallgemeinerten Klischees eine Fülle von unerwarteten neuen Problemen sichtbar wird, die die Problematik des ‚Auslandsstudenten‘ deutlich sichtbar werden läßt. Damit ist ein sehr ernsthaftes Thema angeschnitten, zu dessen Behandlung der Verfasser weit mehr gibt als nur eine Vorbereitung.“
In wenigen Wochen ist die erste Auflage verkauft. Sie ist ein Medienereignis. Vom „Kölner Stadt–Anzeiger“ bis zum „Spiegel“. Vom Fernsehen zu Illustrierten. Auch im europäischen Ausland. Berichte, Interviews, Veranstaltungen. Edward A. Shils, einer der Soziologiepäpste, Wanderer zwischen den Universitäten in Cambridge und Chicago, fragt mich über den Verlag Kiepenheuer & Witsch an, ob ich bereit wäre einen Aufsatz von 10000 Worten für die Zeitschrift „Minerva“ zum gleichen Thema wie im Buch zu schreiben. Honorarangebot: 200,- US-$.
Sauer ist nicht nur das Auswärtige Amt. Viele „farbige“ Studierende sind erbost. Vor allem bei dem Befund, daß sie eigentlich ihr Land nicht repräsentierten, weil ihr sozialer Hintergrund sie als eine überprivilegierte kleine Minderheit ausweist. Die Emotionen reichen von Beschimpfungen bis zu anonymen Morddrohungen. Auch König wird nicht von Morddrohungen verschont. Die philosophische Fakultät organisiert eine öffentliche Veranstaltung. Es geht hoch her, leider nicht immer einer Veranstaltung der Universität würdig. Mit Medienpräsenz und Polizeischutz. Der Historiker Theodor Schieder wird Jahre später bei seinem Abschied in den Ruhestand vom „Kölner Stadtanzeiger“ gefragt, was seine erfreulichste und schlimmste Erfahrung an der Kölner Universität gewesen sei. Seine schlimmste Erinnerung soll diese fast gewalttätige und emotionalisierte Veranstaltung unter Polizeischutz gewesen sein.
Dem Medienrummel folgen Einladungen zu Vorträgen, Rundfunksendungen, Rundfunk– und Fernsehdiskussionen und Aufsätze. König und ich treten meist gemeinsam auf: der Lehrer und sein – wie König es zu formulieren pflegt – „hochentwickelter unterentwickelter Schüler“. So werde ich auf eine joviale Weise auch von König vermarktet. Er rechnet fest damit, daß der Antrag beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) bewilligt wird. Wie sehr er damit rechnet, belegt ein kurzes Schreiben, das er mir am 4. Januar 1963 geschrieben hat:
„Mein lieber Herr Aich, anbei die Adresse von Mrs. Sabine Braun in Bombay, die früher als Fräulein Sabine Nipperdey bei uns studiert hat. Falls Sie Ihr Projekt in Indien verwirklichen können, wäre Frau Braun sehr daran interessiert, an Ihrem Projekt teilzunehmen. Sie hat bei uns eine vorzügliche Diplomarbeit geschrieben, so daß Sie in ihr eine wirkliche Hilfe hätten. Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen bin ich stets Ihr René König.“
Nipperdey ist der bekannte Arbeitsgerichtspräsident und Arbeitsrechtler an der Universität Köln. Nicht nur König und ich sind „ins Geschäft“ gekommen, sondern auch einige andere bestallte Soziologen. Aber für mich sind die Honorare für die folgenden Monate das einzige Einkommen. Interviews im Fernsehen und der „lnternationale Frühschoppen“ machen mein Gesicht bekannt. So werde ich in einer Gaststätte der Heidelberger Innenstadt von dem damals jüngsten Soziologieprofessor aller Zeiten, Ralf Dahrendorf, beglückwünscht, durchaus neidvoll. „Farbige unter Weißen“ widersprach seiner bekundeten Überzeugung, als er noch wissenschaftlicher Assistent in Saarbrücken war: „die Karrieren der Wissenschaftler werden mit dem Zentimetermaßstab bestimmt.“ Wenige Wochen vorher, anläßlich seines Vortrags auf Einladung Königs in Köln, schenkte er mir kaum Beachtung, als König mich ihm vorstellte. Natürlich mit seinem „jovialen“, latent rassistischen Spruch: unser „hochentwickelter Unterentwickelter“.
Horst Krüger, Schriftsteller, leitet auch die Abteilung „Kulturelles Wort“ beim Südwestfunk in Baden–Baden, nimmt eine „Nachtprogrammdiskus-sion“ über das Buch „Farbige unter Weißen“ auf. Teilnehmer sind auch K. W. Bötticher, René König und Helga Pross. Thema: Fördern wir unsere farbigen Studenten richtig? Horst Krüger will vor der Aufnahme, nicht nur scherzhaft, von mir wissen, wie man sich fühlt, wenn man gerade „einen Bestseller gelandet“ hat!
Winfried Böll, mit dem ich viele gemeinsame Veranstaltungen auch vor diesem Buch bestritten hatte, merkt an, ich hätte „einen gefährlichen Grad an Bekanntheit“ erreicht. All dies hätte mich nachdenklich machen müssen. Aber keine Spur davon. Meiner finanziellen Unsicherheit zum Trotz. Dieser Rauschzustand hält an. Die Ernüchterung stellt sich nicht einmal zur Halbzeit meiner „Gastprofessur in meinem eigenen Land“ ein, als die Untersuchung der „lndischen Universität“ beginnt, Gestalt anzunehmen.
Die Kehrseite dieser Erfolgsmedaille, dieses Rausches, ist aufschlußreicher. Wäre der Forschungsantrag zum Rückanpassungsprozeß „Künftige Elite oder wurzellose Intellektuelle?“ glatt durchgekommen, wie Winfried Böll mir noch vor „Farbige unter Weißen“ als Vertreter des Ministeriums zugesichert hatte, würde es weder einen Aufenthalt in Jaipur noch eine Untersuchung „Die Indische Universität“ gegeben haben. Ich würde gewissenhaft den Rückanpassungsprozeß beschrieben, eine Habilitationsarbeit über das Studium der „Farbigen unter Weißen“ und deren Folgen für die „beiden Welten“ geschrieben haben. Aber ich würde bestimmt nicht auf die Idee gekommen sein, mir die Frage zu stellen, wer die Ergebnisse meiner Untersuchungen mit Gewinn hätte verwerten können und wer die Verlierer gewesen sind. Ich wäre einem blond-blauäugig-weiß-christlichen Wissenschaftler gleich geworden, trotz meines nicht zu übersehenden fremdländischen Aussehens, und würde mich immer noch am Bauch gepinselt fühlen, wenn König und seinesgleichen mich als „hochentwickelten Unterentwickelten“ präsentieren würden.
Ich habe die Wirklichkeit hinter dem Medienrummel nicht wahrnehmen können. Dieser hat der Regierung der Bundesrepublik nicht gepaßt. Sie hätte jede Studie finanziert, die sicherzustellen versucht hätte, daß ausgewählte Personen aus den „Entwicklungsländern“ auf kostspieligen Studienplätzen nach ihrer Rückkehr in die Heimatländer Karriere machten und dennoch im Herzen blond-blauäugig-weiß-christliche Botschafter blieben. Den diplomatischen Wink mit diskretem Charme des Auswärtigen Amtes, ob mit einer Veröffentlichung des Unesco–Berichts nicht abgewartet werden sollte, habe ich nicht verstanden, trotz meiner Erfahrungen mit der Friedrich–Ebert–Stiftung oder mit der Deutschen Stiftung für Entwicklungsländer. Die BMZ war damals und ist heute noch lediglich eine Unterabteilung des Auswärtigen Amtes. Dort zählten nicht die thematische Sympathie eines sachkundigen Winfried Böll und auch nicht der Nutzen von Forschungsergebnissen für die praktische Arbeit einer Carl-Duisberg-Gesellschaft, sondern übergeordnete, öffentlich nicht zu Markte getragene Interessen.
Das „Abfeiern“ von „Farbige unter Weißen“ durch die Medien lockert nur zeitweilig unsere finanzielle Anspannung. Hans–Joachim Friedrich und Olrik Breckoff, damals Redaktionsmitglieder von „Report WDR“ unter Franz Wördemann („Monitor WDR“ gab es ncoh nicht), gehen mehrere Wochen schwanger damit, über „Farbige unter Weißen“ einen ausführlichen Bericht zu machen. Sie begleiten mich zu Veranstaltungen, aber zum Schluß finden sie die Zusammenhänge für einen Magazinbericht doch zu verwickelt. Dennoch bedenken sie mich mit einem großzügigen „Informationshonorar“. König muß mich noch am 22. März 1963 als Berater beim Kultusministerium von Nordrhein–Westfalen (NRW) andienen:
„... da Herr Dr. Aich über eine ungewöhnlich große Erfahrung verfügt, hat er doch nicht nur die erste, Ihnen bekannte Untersuchung über ‚Farbige unter Weißen' gemacht, sondern bereits eine zweite, die sich momentan noch im Auswertungsstadium befindet. Wir planen ferner noch eine dritte Studie, welche eine der Hauptthesen bestätigen soll, wonach die Heimkehrer in ihren Heimatländern große Anpassungsschwierigkeiten durchzumachen haben. Bevor die erwähnte Untersuchung anläuft, stehen Herrn Dr. Aich noch einige Monate zur Verfügung, während derer er Ihnen sehr gern zur Verfügung steht.
Ich kann Herrn Dr. Aich restlos empfehlen. Er ist ein außerordentlich liebenswürdiger und sympathischer junger Mann, in jeder Hinsicht sehr zuverlässig, der sich bei allen meinen Mitarbeitern sehr beliebt gemacht hat.“
So werde ich für drei Monate Berater. Am 6. Juni 1963 stellt König den folgenden Antrag, damit wir nicht am Hungertuch nagen müssen:
„hiermit möchte ich den Antrag stellen, daß die Unterstützung von Herrn Dr. Prodosh Aich aus den Mitteln des Kultusministeriums zur Förderung des Nachwuchses noch für die Monate Juli und August verlängert wird. Ab 01. 09. 1963 wird Herr Dr. Aich als planmäßiger Assistent des Forschungsinstitutes für Soziologie angestellt werden, wo ihm die Abteilung spezieller Probleme der Entwicktungsfragen übertragen werden soll.“
Dem Antrag wird stattgegeben. Am 23. August 1963 beantragt die Universität beim Herrn Kultusminister des Landes Nordrhein–Westfalen:
„Der Direktor des Forschungsinstituts für Soziologie der Universität zu Köln, Herr Professor Dr. König, bittet mit beiliegendem Antrag vom 26.07.1963, den indischen Staatsangehörigen Herrn Dr. phil. Prodosh Aich zum wissenschaftlichen Assistenten am vorgenannten Institut zu ernennen. ...
Abgesehen davon, daß Herr Dr. Aich in verschiedenen Fachrichtungen studierte, hat er unter Anrechnung aller seiner Studienzeiten einschließlich der praktischen Fachausbildung als Förderungsstipendiat nur eine Gesamtstudien– und praktische Ausbildungszeit von 5 ½ Jahren aufzuweisen. Außerdem besitzt er nicht den für seine Ernennung zum wissenschaftlichen Assistenten vorgeschriebenen Grad eines Dr. rer. pol., sondern den eines Dr. phil. Die in § 2 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 der Reichsassistentenordnung vom 1. 1. 1940 vorgeschriebenen Voraussetzungen für die Ernennung zum wissenschaftlichen Assistenten sind daher nicht als erfüllt anzusehen.
Entsprechend dem Antrag von Herrn Professor Dr. König bitte ich gleichwohl, unter Befreiung von diesen Vorschriften die Zustimmung zur Ernennung von Herrn Dr. Aich zum wissenschaftlichen Assistenten zu erteilen. Außerdem bitte ich, da Herr Dr. Aich die indische Staatsangehörigkeit besitzt, zu der Ernennung gemäß § 6 Abs. 3 LBG die Zustimmung des Herrn Innenministers zu erwirken.
Ich darf als bekannt voraussetzen, daß sich Herr Dr. Aich durch seine Arbeit ‚Farbige unter Weißen‘ schon einen Namen gemacht hat. Die Ernennung zum wissenschaftlichen Assistenten kann daher unbedenklich befürwortet werden.“
Auch diesem Antrag wird stattgegeben. Ich werde zum wissenschaftlichen Assistenten ernannt, verbeamtet, auf Widerruf. Weder im soziologischen Seminar noch im Forschungsinstitut für Soziologie wird ein Arbeitsplatz für mich bereitgestellt. Es gibt keine Räumlichkeiten. Mein Arbeitsplatz bleibt in der Weberstraße 96 in Bonn. Dieser bemerkenswerte Zustand wird von keiner Seite thematisiert. Fakt ist, daß für mich nie ein Arbeitsplatz in den Räumlichkeiten der Universität eingerichtet wurde.
Erwin K. Scheuch, noch habilitierter wissenschaftlicher Assistent im Seminar für Soziologie unter Direktor René König, erhält zur Überraschung vieler einen Ruf an die Harvard University, dem Mekka für deutsche Soziologen. Der Lehrstuhl von Samuel A. Stouffer, neben Paul Lazarsfeld der andere Papst der empirischen Sozialforschung, war nach seinem Tod im Jahre 1960 noch unbesetzt. Stouffer und Lazarsfeld waren erfahrene Sozialforscher und auch Kriegsforscher im Auftrag der USA–Regierung, und nicht fleißige „Sekundärauswerter“ von empirischen Untersuchungen anderer wie Scheuch und König. Scheuch folgt dem Ruf, steigt raketenhaft in der Hochachtung von König, der es nur bis zu „Summer Schools“ in den USA gebracht hatte. Andere im Institut grübeln darüber, ob Scheuch sich in Harvard halten wird. Nun, Scheuch hält sich nicht in Harvard und kommt zurück nach Köln mit einem Ruf zunächst als Kodirektor des Seminars für Soziologie. Ab sofort redet König Scheuch mit „Herr Kollege“ an. Meine Hochachtung vor König erfährt ein weiteres Beben.
Das BMZ lehnt den Forschungsantrag nicht ab. Aber es bewilligt ihn auch nicht. Es läßt den Antrag einfach schmoren. Nach meiner Ernennung halte ich Seminare im Auftrage von König ab und arbeite intensiv an der Entwicklung des Untersuchungsinstruments für die Rückkehrerstudie. Daß das BMZ nicht entscheidet, führe ich auf die Aufbauphase des neuen Ministeriums zurück. Auch Böll, der sich immer mehr unerreichbar macht, bestärkt mich in dieser Annahme. Wie König diese Verzögerung deutet, sagt er mir nicht. Routinemäßig macht der Kanzler der Universität König am 23. August 1965 mit einer hektographierten Mitteilung darauf aufmerksam, daß meine Ernennung nicht automatisch um weitere zwei Jahre verlängert werden würde. Also beantragt König eine Verlängerung um weitere zwei Jahre am 2. September 1965:
„Zur Begründung mache ich folgende Angaben. Herr Dr. Aich hat in meinem Auftrag bereits Semester–Lehrveranstaltungen, im Seminar übernommen und mit größtem Erfolg durchgeführt. Außerdem betreut er im Forschungsinstitut alle Angelegenheiten, die mit Entwicklungsproblematik zu tun haben und ist in diesem Zusammenhang mit der Abfassung einer größeren Arbeit beschäftigt. Ich bemerke noch, daß Herr Dr. Aich ein Habilitationskandidat ist und sich während der Zeit seiner Mitarbeit im Institut durch zahlreiche und viel beachtete Publikationen ausgezeichnet hat, so daß die Verlängerung seines Dienstverhältnisses voll und ganz gerechtfertigt ist.“
Das „Dienstverhältnis“ wird verlängert. Routinemäßig. Das ausgefüllte Formularblatt vom 21. September 1965 erreicht die Universität schon am nächsten Tag. Zwischenzeitlich hat sich etwas ereignet. Vermittelt durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) taucht im Juli 1965 T. K. N. Unnithan, Soziologieprofessor an der Universität Rajasthan in Jaipur, im Institut in Köln auf und erzählt von möglicher Zusammenarbeit zwischen den beiden Universitäten. Nun, „Zusammenarbeit“ ist auch damals „in“, denn Zusammenarbeit bringt für den stärkeren Teil in der Partnerschaft großen Einfluß. Solche Zusammenarbeit wird vom Auswärtigen Amt gern gesehen. Der DAAD ist eine Unterabteilung des Auswärtigen Amtes. Die Universitäten Köln und Bochum unterhielten zu der Zeit eine WiSo–Außenstelle an der Universität Kabul, natürlich mit dem Segen des Auswärtigen Amtes. Was die „Zusammenarbeit“ dieser Art auch an Nutzen für den Steuerzahler erbracht haben mag, eröffneten sie doch ungeahnte Reisemöglichkeiten für viele. Reisen ohne Kosten, versteht sich.
König reicht den indischen Kollegen weiter an seinen neuen Kollegen Scheuch. Beide sind für eine Zusammenarbeit. Bonitätsfragen sind ein zu teurer Luxus, wenn gesicherte Reisen winken. Schließlich ist Indien märchenhaft exotisch. König erzählt Unnithan die Erfolgstory seines „hochentwickelten Unterentwickelten“ und fragt an, ob nicht sinnvollerweise die Zusammenarbeit mit einer Einladung zu Gastvorlesungen an mich beginnen sollte. Unnithan ist begeistert. Ich werde ihm vorgestellt. Unnithan setzt seine Deutschlandsreise fort. Seine Reisekosten werden selbstverständlich auch von den deutschen Steuerzahlern übernommen. Denn er ist Gast des DAAD. Nach seiner Rückkehr bemüht sich Unnithan mit Erfolg um die anvisierte Einladung an mich. Aus dieser zufälligen (wirklich zufälligen?) Begebenheit entwickelt sich bis zum März 1966 der Plan meines Aufenthaltes in Indien beginnend vom Juli 1966. Geplante Abreise aus Köln Anfang Juni, dann per Frachtschiff von Rotterdam, auch wegen der Kosten. Wir sind keine Minibotschafter.
Dazwischen, genauer am 25. Januar 1966, schreibt König mir einen Brief. Er ist nicht nur unvermittelt, nein, er ist auch auf den ersten Blick irrational, weil er in keinem mir bekannten Zusammenhang steht. Was soll denn zwischen dem 2. September 1965 und dem 25. Januar 1966 vorgefallen sein? Hier ist der vollständige Text:
„Mein lieber Herr Aich, schon seit längerer Zeit wollte ich auf unsere Besprechung von neulich zurückkommen. Ich mußte es aus verschiedenen Gründen immer verschieben. Nachdem nun aber die Verlängerung Ihres Dienstverhältnisses mit dem Soziologischen Institut akut geworden ist, möchte ich noch einmal mit aller Deutlichkeit auf die besprochenen Fragen zurückkommen.
Ich hatte von Ihnen erwartet, daß Sie im Laufe der letzten zwei Jahre Ihre Arbeit fertiggestellt hätten. Darum hatte ich Sie ja auch außer der Abhaltung von Übungen von der Arbeit im Institut völlig freigestellt. Nun teilen Sie mir mit, daß gar nichts geschehen ist. Ich finde das sehr enttäuschend und auch durch schwierige persönliche Verhältnisse nicht erklärlich. Ich kann auch die Weiterführung dieser Situation gegenüber der Universitätsverwaltung nicht mehr verantworten. Darum legte ich Ihnen neulich nahe, daß Sie nun möglichst umgehend irgendeine Arbeit fertigstellen, die mir zeigt, daß Sie in den letzten Jahren überhaupt irgendetwas getan haben. Ich gab Ihnen dafür zwei Monate Frist. Ich möchte in diesem Brief unterstreichen, daß ich diese Frist beim Wort zu nehmen bitte, d.h. mit anderen Worten, ich erwarte von Ihnen ein Manuskript spätestens bei meiner Rückkehr aus Afrika am 20. April dieses Jahres. Das ist aber auch der letzte Termin. Ich möchte Ihnen jetzt schon sagen, daß ich Ihr Arbeitsverhältnis werde eingehend überprüfen müssen, wenn Sie mich nochmals enttäuschen wie in der Vergangenheit. Ich bitte Sie, diesen Brief sehr ernst zu nehmen.
In der Hoffnung, bald von Ihnen etwas über Ihre Arbeit zu hören, bin ich mit den besten Grüßen stets Ihr Prof. Dr. René König.“
Der Kulturschock?
Nach der Bahnreservierung gehe ich mit Mr. Metha zur Post und telegraphiere unsere Ankunftszeit in Jaipur. Mr. Metha will uns unbedingt zum Bahnhof begleiten. Wir werden es bald wissen und schätzen lernen, warum er so stur gewesen ist. Das Arrangement mit unserem vielen Gepäck, mit den hastigen Gepäckträgern und das in Marathi, hätte ich kaum fertiggebracht. Es ist nicht eine freundliche Geste. Es ist Fürsorge. Während wir ihn herzlich und dankbar verabschieden, kribbelt in mir die Sorge hoch, daß wir in Ahmedabad, der Hauptstadt des Bundesstaates Gujerat, umsteigen müssen. Die dortige Landessprache Gujerati verstehe ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin Kalkuttaner. Kalkutta ist etwa 2000 km östlich von Bombay. In Westbengalen. Meine Muttersprache ist Bengali. Nun fahren wir von Bombay nach Nordosten. Fast eine gerade Linie von Bombay nach Delhi. Ahmedabad ist etwa in der Mitte. Aber das Umsteigen ist unausweichbar. Die Eisenbahn in Indien hat eine unterschiedliche Schienenbreite. Breite, mittlere und enge, mit ebenso unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Leistungsfähigkeiten. Eine Hinterlassenschaft der Kolonialzeit.
Die indische Eisenbahn wird von den „Entwicklungssoziologen“ viel besungen, als eines der positivsten Erbteile der Kolonialzeit. Über die unterschiedlichen Schienenbreiten erfährt man nichts. Eine Erwähnung würde ja auch nach einer Erklärung verlangen. Also bleibt sie unerwähnt. Dieses nicht Erwähnen verfälscht die Kolonialgeschichte. Dabei ist eine Erklärung dafür einfach. In der Phase des Raubkolonialismus ist alles zu den Häfen geschleppt worden zum Abtransport. Zunächst mit den dort vorhandenen Transportmitteln. Die wachsenden Mengen an Raubgut und die Erschließung der Märkte in den Kolonien, also die „Umstrukturierung" der Handels– und Wirtschaftsverhältnisse, verlangte nach leistungsfähigeren Transportsystemen. Die Gütermenge bestimmte die Breite der Schienen. Denn die Eisenbahn wurde vom Ausbeutungsgewinn finanziert.
Wo es wenig wegzuschleppen gab, reichte schon eine enge Schienenbreite (narrow gauge) aus. Von Ahmedabad nach Jaipur ist eine mittlere Schienenbreite (meter gauge) von einem Meter Breite gelegt. Zu den Häfen hin wurde natürlich immer die breiteste Schienenbreite (broad gauge) genommen. Auch heute kann von der Schienenbreite abgelesen werden, welche Regionen Indiens stärker in die „Weltwirtschaftsordnung" eingebunden sind. Aber welcher „Entwicklungssoziologe“ ist schon an dieser Beschreibung interessiert? Und wer will es wissen? Außerdem ist ein Langzeitgedächtnis in der blond-blauäugig-weiß-christlichen Kultur eh nicht gefragt. Keine Nachfrage, kein Angebot.
Aber „Entwicklungssoziologie“ plagt mich im Augenblick wenig, sondern schlicht und einfach die Sorgen des Umsteigens. Der Zug rollt in Ahamedabad ein. Werde ich mit unserem vielen Gepäck problemlos umsteigen können? Meine Sorgen sind überflüssig, wie sich bald erweist. Der Zugführer kommt und organisiert das Umsteigen. Er war von Mr. Metha so instruiert worden. Der Zugführer sagt uns, was das Umsteigen kostet. Wir sitzen bequem im neuen Abteil und sind erleichtert. Ja, dieser Mr. Metha!
Wir nähern uns Jaipur. Der Übergang zur Wüste ist begleitet von immer geringerer Luftfeuchtigkeit. Auffällig sind auch die vielen bunten Vögel, Sittiche, Papageien, Pfauen. Der Wüstenstaat Rajasthan ist auch ein Vogelparadies. Jaipur ist die Hauptstadt des Bundesstaates Rajasthan. Rajasthan ist ein Zusammenschluß von „Princely States“ der Rajputs, die sich bei der „indischen Unabhängigkeit“ der neu gegründeten „lndischen Union“ anschlossen. Später darüber mehr.
Am Nachmittag rollt der Zug in Jaipur ein. Ich öffne die Tür und schaue aus dem Abteil. Unnithan ist da – mit einem unerwartet großen Gefolge. Alle Mitglieder des „Department of Sociology“ sind zum Empfang gekommen. Mit Girlanden für uns, wie es in Indien üblich ist. Meine Frau und ich sind gerührt. Wir werden noch auf dem Bahnsteig allen Einzelnen vorgestellt. Freundliche Gesichter. Alle heißen uns willkommen. Die Namen zu den Gesichtern können wir uns nicht so schnell merken. Aber das ist ja auch natürlich. Unnithan hat ein Auto für uns organisiert. Er bringt uns samt Gepäck vom Bahnhof zum Gästehaus der Universität.
An den großen Pfützen am Straßenrand merken wir, daß der nachmittägliche Monsunregen schon da gewesen ist. Es ist nicht mehr heiß. Die Luft ist nicht feucht. Die Sonne scheint wieder. Vor allem in Bombay war die Feuchtigkeit in der Luft so hoch, daß wir ständig schwitzten. Auch in den Morgenstunden, als wir in den Zug stiegen. Selbst im Winter soll die Luftfeuchtigkeit in Bombay hoch sein. Im Sommer erreicht sie häufig über 95 %.
Die kurze Fahrt erzählt uns augenscheinlich, warum Jaipur als rosa Stadt (Pink city) weltweit bekannt ist. Die Maharajas von Jaipur brachten das Kunststück fertig, sich den Rajputs unähnlich aus allen kriegerischen Auseinandersetzungen herauszuhalten. Als die Moguls fest im Sattel saßen und die Kriegsgefahren gebannt waren, ließ Maharaja Jai Singh vor 250 Jahren die Stadt Jaipur auf dem Reißbrett planen und bauen. Auf ebener Erde unweit von seinem auf einem Berg gelegenem Palast Amber. Gerade breite Straßen, einheitlicher Baustil, quadratische Grundrisse, einheimische rosarote Natursteine als Baumaterial. Um die Stadt herum eine hohe Mauer. Vier riesige Eingänge, „Gates“ genannt, in vier Himmelsrichtungen. Die Stadt ist natürlich in allen Richtungen gewachsen, also längst über die Stadtmauern hinaus. Der einheitliche Baustil ist aber geblieben. Trotz der Bonbonfarbe wirkt die Stadt nicht kitschig. Der Übergang vom goldgelben Sand zu dem etwas rötlicheren Naturstein, der mit unregelmäßigen Fugen in Häusermauern verarbeitet ist, und schließlich das Übermalen der Fugenflächen in Rosarot bilden eine einzigartig angenehme Einheit. Die Stadt Jaipur ist schön und seit je her eine Attraktion für Touristen.
Wir passieren stadtauswärts das südliche Gate. Außerhalb der Gates werden die Straßen noch breiter. Kreuzungen sind mit Rondell gesichert. Die hügelige Landschaft dieses Teils Rajasthans ist schon im südlichen Stadtteil sichtbar. Die Wüste auch. Die Stadt wächst nach Süden, indem immer mehr Wüste wohnbar gemacht wird. Unmittelbar vor dem Campus auf der linken Straßenseite auf einem kleinen Hügel sehen wir einen Palast, einer der Paläste der Maharani von Jaipur. „Motidungi“ heißt er. Wie eine Bildpostkarte. Aber nicht mehr dauerhaft bewohnt.
Unterhalb dieses Hügels ist die Nordseite des Campus nur durch eine breite Straße nach Osten getrennt. Die Universität ist ein großzügig angelegter Campus, auch an der linken Seite einer der Hauptausfallstrassen nach Süden. Gegenüber dem Campus, getrennt durch diese Allee, ist ein neu entstandenes Wohngebiet, aber nicht so großzügig angelegt wie der Campus. Verständlich. Grundstücke gegenüber der Universität sind gefragt und deshalb auch teuer. Ähnlich wie die Stadt ist auch der Campus quadratisch angelegt und mit Gates versehen. Der Campus hat mehrere Gebäudekomplexe, weitläufig, getrennt nach Fakultäten. Im gleichen Stil wie die Paläste in der Stadt. Rechts von dem Hauptportal, am westlichen Rand des Campus, ist die Hauptverwaltung. Etwa 500 Meter weiter südwärts ist das „University Guest House“. Gebaut im gleichen märchenhaften Stil, von der Straßenseite mit Mauern umgeben. Von dem Gate führt ein Weg durch eine Riesentür zur Empfangshalle. Sie ist wie in einem Hotel. Ein Durchgang zu der Innenseite. Die Innenseite stellt ein offenes „U“ dar und ist umgeben von weitläufigen, gepflegten Rasen. Satt grün, umrandet mit goldgelbem Sand. Auf der linken Seite sind die einzigen Gästezimmer zur ebenen Erde. Auf der rechten Seite ist ein großer Saal, viel zu groß für eine „Dining Hall“. Es ist eigentlich eine Vielzweckhalle für Feierlichkeiten. Sie fungiert auch als eine Bühne für Aufführungen aller Art. Neben dieser Halle befinden sich die Wirtschaftsräume auf der anderen Seite vom offenen „U“. Im ersten Stock sind nur Gästezimmer. Großzügig ausgelegt.
Die Temperatur wird gegen Abend angenehmer. Die Dunkelheit bricht plötzlich ein. Ohne Dämmerung. Wie es in den Tropen und Subtropen üblich ist. Wir haben keine Zeit, viel auszupacken. Wir trinken Tee, ruhen etwas aus, machen uns anschließend frisch. Es ist „Dinner–Zeit“. Der Eßsaal ist nicht ganz leer. Für uns war das Essen bereits bestellt. Europäische Küche, wie sie in Indien kultiviert wird. Nach dem Abendessen sitzen wir auf dem Rasen. Bequeme Rattansessel– und tische. Draußen ist es schon fast kühl. Eine leichte Brise. Nicht stark genug, um einem die Moskitos vom Leib zu halten. Wir bekommen noch Besuch. Mrs. Unnithan, eine Niederländerin, heißt uns willkommen und erzählt: Ja, die Moskitos! Sie verschwinden erst mit den Sandstürmen, die regelmäßig in den Monaten April bis Juni kommen. Aus dem Süden. Wie eine rote hohe Wand. Blitzschnell. Dann wird es kurze Zeit dunkel. Selbst fest geschlossene Fenster helfen da nicht. Nach dem Sturm muß die Wohnung ausgekehrt werden. Der feine Sand findet seinen Weg überallhin. Jaipuries, die es sich leisten können, machen eben Sommerurlaub.
Ich bin schon lange nicht mehr bei dem „small-talk“. Mich beschäftigt anderes. Wie wird der Tag morgen sein? Mein erster Arbeitstag. Meine Frau hat keinen „Kulturschock“ bekommen. Auch ich werde einen mächtigen Kulturschock erleiden, hieß es immer wieder im Institut in Köln. Bei meiner Entfremdung! Fehlanzeige, zumindest bislang. Tritt der Kulturschock auch dann auf, wenn der Vorgang bekannt ist und gar erwartet wird? Ist es nicht wie bei den sonstigen sozialwissenschaftlichen Prognosen? Diese treffen ja bekanntlich selten ein, weil die Menschen sich nach der Prognose angeblich anders verhalten würden, als wenn diese nicht gemacht worden wären. Na ja. Ich werde über meinen Kulturschock erst nachdenken, wenn meine Frau einen solchen erlebt hat.
*****
Heute bin ich erstaunt, daß ich einen ruhigen Schlaf in der ersten Nacht in Jaipur hatte. Nicht wegen des ständigen Geräusches des Ventilators in der stillen, wirklich stillen Nacht gelegentlich gestört durch das Summen von Moskitos. Sie sind zahlreich und bekanntlich beißen diese Viecher auch. Nicht die Störung der stillen Nacht, nein, ich meine etwas anderes.
Spätestens nach unserer Ankunft – ein Lebensabschnitt abgeschlossen und ein neuer noch nicht begonnen – hätte ich mir Zeit nehmen müssen, über vieles nachzudenken. Schon viel früher hätte ich mir Zeit zum Nachdenken nehmen müssen. Und auch wirklich nachdenken! Viele unübersehbare Ungereimtheiten habe ich nicht einmal wahrgenommen. Ich bin Sozialwissenschaftler, vertraut mit der Forschung über Vorurteile, vertraut mit Wahrnehmungstheorien, vertraut mit Logik und Widerspruch, dennoch erkenne ich nicht offensichtliche Widersprüche in meiner bisherigen Karriere. Ist es die den Sozialwissenschaftlern eigene Betriebsblindheit oder ist dies meine sehr spezifische Blindheit, verursacht durch den Rausch der ständigen Medienpräsenz in Deutschland nach „Farbige unter Weißen“?
Die Versuchung ist groß, mit dem heutigen Bewußtsein neunmalkluge Analysen jener Jahre der „lndischen Universität“ zu machen und alle möglichen Erklärungen zu finden. Deshalb schränke ich mich zunächst ein auf die Beschreibung der Ungereimtheiten und auf Fragen, die daraus zwingend hätten entstehen müssen, aber nicht entstanden waren. So zum Beispiel: Josef Gugler, Deutscher, in der Endphase seiner Promotion im Fach Soziologie, will den Bericht über ein internationales soziologisches Seminar selbst nicht entwerfen, überläßt die Aufgabe einem, der Ausländer ist und erst im 2. Fachsemester Soziologie studiert. Er ist mit meinem Entwurf nicht einverstanden, macht aber keinen Gegenentwurf. Nun gut! Aber bei der Abgabe, wie schon berichtet, distanziert er sich von dem Bericht auf eine subtile Weise. König hatte keine Vorbehalte. Und wir gingen zur Tagesordnung über. Hätten wir nicht zumindest fragen müssen, welche Qualität der Studiengang Soziologie eigentlich hat, wenn es zwischen einem Studienbeginner und einem mit der Promotion das Studium abschließenden keinen Qualitätsunterschied gibt. Ich weiß nicht, ob Josef Gugler diese Frage gestellt hatte. Ich weiß, daß ich diese an sich naheliegende Frage nicht gestellt habe.
Wie berichtet, gelange ich nach Beteiligung an den Veranstaltungen über die Methodologie zu der Erkenntnis, ich müßte mir selbst jene Kenntnisse aneignen, die für das „Zusammenbasteln“ des Erhebungsinstrumentes für das Unesco–Projekt erforderlich wären. Und ich tue dies mit Erfolg. Ich stelle aber nicht die Frage, welchen Wert universitäre methodologische Veranstaltungen haben, die weniger als ein Autodidakt zustande bringen.
Dezember 1960 bewilliht das Auswärtige Amt 20000,- DM für das laufende Unesco–Projekt. Das Auswärtige Amt erhält den „Unesco–Bericht“ im Herbst 1961 und fragt bei König nach, ob von einer Veröffentlichung vorläufig abgesehen werden könnte. Bevor dieser Bericht veröffentlicht ist, finanziert der WDR, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, eine zweite Untersuchung über die selbe gesellschaftliche Gruppe mit Blick auf einen weiterführenden Aspekt. Die Carl–Duisberg–Gesellschaft, eine private Einrichtung für die Betreuung der ausländischen Praktikanten, auch angewiesen auf die Unterstützung der Bundesregierung, ermöglicht die Durchführung der Untersuchung mittels eines Überbrückungskredits an ein Universitätsinstitut, auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, weil die Gremien des WDR nicht so schnell wie erwartet die Formalitäten erledigen.
Winfried Böll, einflußreicher Berater im BMZ, versichert noch im Oktober 1962, daß der Forschungsantrag über die „Rückanpassung“ bis Ende Januar 1963 bewilligt sein würde, welches dann nach der Veröffentlichung von „Farbige unter Weißen“ aber doch nicht bewilligt wird. Nicht 1963, nicht 1964, nicht 1965, nicht 1966. Der Antrag wird auch nicht abgelehnt. Und was tue ich? Ich befolge blind den blöden Rat von Max Weber, dem Oberguru aller Soziologen, und bohre an jenem dicken Brett, auf dem der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit eine Entscheidung über den Antrag aussitzt. Mit Billigung von König. Auch er glaubt, wie seine wiederholten schriftlichen Äußerungen dies belegen, daß das Projekt über den „Rückanpassungsprozeß“ tatsächlich verwirklicht werden würde und ich dann auch meine Habilitationsschrift darüber verfassen werde.
Ich registriere nicht die veränderte Haltung vieler vor und nach der Veröffentlichung von „Farbige unter Weißen“. Auch dann nicht, als Winfried Böll mich durchaus wohlwollend darauf aufmerksam macht, daß ich durch „Farbige unter Weißen“ einen gefährlichen Grad an Bekanntheit erreicht hätte. Was hatte mich so blind gemacht? Hätte ich nicht erahnen müßen, daß ich als Veranlasser dieser kritischen öffentlichen Diskussion keine öffentlichen Gelder für Forschung auf diesem Gebiet zu erwarten haben würde? Hätte ich wenigstens nicht vermuten können, daß die Hochkonjunktur des Themas „Entwicklungsländer“ möglicherweise ausläuft bzw. die Politik zu diesem Thema keine weiteren Forschungen benötigt. Nein, ich habe alle diese Fragen nicht gestellt. Ich weiß nicht, ob König sich Fragen dieser Art gestellt hatte. Seine Aktivitäten deuten eher darauf hin, daß auch er die wirklichen Verhältnisse nicht überblickt hat.
Am 22. März 1963 empfiehlt mich König als Berater für das Kultusministerium des Landes Nordrhein–Westfalen und erwähnt:
„Wir planen ferner eine 3. Studie, welche eine der Hauptthesen bestätigen soll, wonach die Heimkehrer in ihren Heimatländern große Anpassungsschwierigkeiten durchzumachen haben. Bevor die erwähnte Untersuchung anläuft, stehen Herrn Dr. Aich noch einige Monate zur Verfügung, während derer er Ihnen sehr gern zur Verfügung steht.“
Am 7. Oktober 1963 werde ich zum wissenschaftlichen Assistenten an der Universität zu Köln ernannt. Mitte Juli 1965 schlägt Unnithan eine Zusammenarbeit zwischen der Universität Köln und Universität Rajasthan vor. Sie soll sich mit meinem Aufenthalt in Jaipur konkretisieren.
Am 2. September 1965 beantragt König die Verlängerung meines Vertrags. Begründung:
„Zur Begründung mache ich folgende Angaben Herr Dr. Aich hat in meinem Auftrag bereits Semester–Lehrveranstaltungen im Seminar übernommen und mit größtem Erfolg durchgeführt. Außerdem betreut er im Forschungsinstitut alle Angelegenheiten, die mit der Entwicklungsproblematik zu tun haben und ist in diesem Zusammenhang mit der Abfassung einer größeren Arbeit beschäftigt. Ich bemerke noch. daß Herr Dr. Aich ein Habilitationskandidat ist, und sich während der Zeit seiner Mitarbeit im Institut durch zahlreiche und viel beachtete Publikationen ausgezeichnet hat, so daß die Verlängerung seines Dienstverhältnisses voll und ganz gerechtfertigt ist.“
Der Vertrag wird auf weitere 2 Jahre verlängert. Aus heiterem Himmel – so schien es mir damals – schreibt mir König am 25. Januar 1966:
„Nachdem nun aber die Verlängerung Ihres Dienstvertrages mit dem Soziologischen Institut akut geworden ist, möchte ich noch einmal mit aller Deutlichkeit auf die besprochenen Fragen zurückkommen. Ich hatte von Ihnen erwartet, daß Sie im Laufe der letzten zwei Jahre Ihre Arbeit fertiggestellt hätten. ... Darum legte ich Ihnen neulich nahe, daß Sie nun möglichst umgehend irgendeine Arbeit fertigstellen, die mir zeigt, daß Sie in den letzten Jahren überhaupt etwas getan haben. ... ich erwarte von Ihnen ein Manuskript spätestens bei meiner Rückkehr aus Afrika am 20. April dieses Jahres. Das ist auch der letzte Termin. Ich möchte Ihnen jetzt schon sagen, daß ich Ihr Arbeitsverhältnis werde eingehend überprüfen müssen, wenn Sie mich nochmals enttäuschen wie in der Vergangenheit.“
Wieso hatte ich diesem so irrationalen Brief nicht schriftlich widersprochen, die unwahren Behauptungen zurückgewiesen? Wie konnte ich stattdessen binnen acht Wochen den Bericht über meine zweite Untersuchung über die politische Einstellung für die Veröffentlichung freigeben und damit einen wichtigen Bestandteil meiner geplanten Habilitationsschrift entwerten? Wie konnte ich dieses als eine Marotte von König abtun? Wie benebelt war mein Bewußtsein als Sozialwissenschaftler, daß ich keine Analyse über meine wirkliche Situation anstellte?
Ich nahm nicht wahr, was zwischenzeitlich geschehen war. Meine Medienpräsenz hielt an, die der anderen nicht. Ich schrieb nicht wenig in den Zeitschriften und auch für den Rundfunk. Die anderen Soziologen in Köln nicht. Scheuch hielt sich nicht an der Harvard Universität. Welche Trendmeldungen über die sogenannte Entwicklungssoziologie brachte der neue „Herr Kollege“ von König mit nach Köln? Welche Einstellung hegte Scheuch gegenüber uns, nachdem er nun zu Amt und Macht gekommen war?
Statt nachzudenken hielt ich mich mit dem Erhebungsinstrument für die Untersuchung über die Rückanpassung beschäftigt, mit Vorbereitungen der Seminarveranstaltungen und später (seit Juli 1965) mit Vorbereitungen einer eventuellen Lehrtätigkeit an der Universität Rajasthan. Die offizielle Einladung der Universität Rajasthan vom 19. Februar 1966 erreicht das Institut am Ende des Monats. In der Einladung steht nicht einmal eine Andeutung von einer beginnenden Zusammenarbeit beider Universitäten. König weist mich an, an den Kanzler der Universität einen sofortigen Antrag auf Beurlaubung zu stellen. Dies geschieht am 10. März 1966. Auch König schreibt dem Kanzler am gleichen Tag:
„ich möchte Sie hiermit bitten, Herrn Dr. Aich vom 1. 7. 1966 bis zum 30. 6. 1967 unter Fortzahlung seiner Bezüge zu beurlauben. Er wird während dieser Zeit ein Forschungsprojekt in Indien durchführen. Dieses Forschungsprojekt ist nicht nur von Bedeutung für unser Institut, es ist auch wichtig für die Habilitationsschrift von Herrn Dr. Aich. Außerdem wird Herr Dr. Aich während seines Aufenthaltes in Indien Gelegenheit haben, 9 Monate Gastvorlesungen zu halten. ... Ich möchte noch bemerken, daß ich im Interesse meines Instituts großen Wert auf die Realisierung dieses Projekts lege. Es ist auch von öffentlichem Interesse, daß ein von uns ausgebildeter Angehöriger der Dritten Welt die Gelegenheit erhält, an einer indischen Universität zu lehren. Diese seltene Chance sollte unbedingt genutzt werden. Es ist daher ganz gerechtfertigt, Herrn Dr. Aich für den genannten Zeitraum zu beurlauben und ihm seine Dienstbezüge weiterzuzahlen.“
Zwischen dem 25. Januar 1966 und dem 10. März 1966 habe ich König nicht gesehen. Die Kopie seiner Befürwortung an den Kanzler stellt er mir zu. Beim Lesen fällt mir die naheliegende Frage nicht ein. Von welchem Forschungsvorhaben ist in dem Schreiben eigentlich die Rede und welcher Gegenstand soll „von Bedeutung für unser Institut, es ist auch wichtig für die Habilitationsschrift von Herrn Dr. Aich.“ sein? Mit welchen Mitteln sollte welches Forschungsvorhaben in Indien durchgeführt werden?
Noch am 10. März 1966 stellt König einen Antrag auf Sachbeihilfe in Höhe von 57 263,- DM, nach dem ich in seinem Auftrag meinen ursprünglichen Antrag an das BMZ vom 16. November 1962 in Höhe von 94 256,- DM verschlankt hatte. Als Anlage schickt er auch eine Veröffentlichungsliste von mir zu diesem Themenkomplex. Unter anderem heißt es in diesem Antrag:
„Die endgültige Antwort darauf, ob die Ausbildung im Ausland trotz der niedrigen Erfolgsquote nicht doch sinnvoller ist, kann nur durch eine Untersuchung gefunden werden, die nach der Rückkehr der Studenten ihre Rolle im sozialen Wandel durchleuchtet. Dies ist das Ziel der Untersuchung, die mein Institut nach Abschluß von zwei umfangreichen Untersuchungen im Gastland nun in Indien gewissermaßen als letztes Glied des Komplexes durchführen will. Mit der Erhebung der Daten in Indien werde ich meinen Assistenten, Dr. Prodosh Aich beauftragen, der schon die erwähnten zwei Untersuchungen meines Instituts geleitet hat. Er wird die Ergebnisse der Forschung in Indien in seiner Habilitationsschrift verwenden. ... Ich möchte Sie bitten, die Sachbeihilfe für das Forschungsvorhaben zu genehmigen, damit die geplante Untersuchung durchgeführt werden kann und einer meiner Schüler die Gelegenheit erhält, an einer indischen Universität Vorlesungen zu halten.“
Nach Gesprächen mit dem anderen Geschäftsführer der Carl–Duisberg–Gesellschaft, Dr. H. Deimann – Winfried Böll ist in dieser Zeit kaum erreichbar – beantrage ich auch ein Ergänzungsprojekt über Praktikanten, die nach einer Ausbildung in Deutschland nach Indien zurückgekehrt sind, wiederum beim BMZ. Kostenpunkt: 19 564,- DM. Nach telefonischer Übereinstimmung erläutert Deimann noch schriftlich das besondere Interesse seiner Gesellschaft dem Ministerium gegenüber:
„Unter Bezugnahme auf die Besprechungen und Ausarbeitungen zusammen mit Herrn Diether Breitenbach (früherer Mitarbeiter der Deutschen Stiftung für Entwicklungsländer) sind wir der Auffassung, daß das Forschungsvorhaben von Herrn Dr. Aich unter Umständen interessant sein könnte für die Problematik der Erfolgskontrolle im Bereich auch der Praktikanntenprogramme. Unabhängig von möglichen Einzelergebnissen scheint uns der Versuch von Herrn Dr. Aich, eine Definition des Begriffs ‚Erfolg‘ im Zusammenhang mit einer Berufsfortbildung im Ausland zu erarbeiten, sehr interessant zu sein. ... Sollte eine Förderung des Projektes in Aussicht genommen werden, so schlagen wir eine gemeinsame Planung zwischen Ihnen, Herrn Dr. Aich und uns vor. Gleichzeitig stellen wir anheim, Herrn Breitenbach hinzuzuziehen.“
Die Mittel für mein Forschungsvorhaben waren nicht bewilligt vor unserer Abreise nach Indien, eben nach Jaipur in Rajasthan, wo ich die erste Nacht so friedlich hinter mich gebracht habe. Welche Qualität hatte meine Ausbildung in Köln, daß ich alle diese und noch andere Ungereimtheiten einfach nicht wahrgenommen habe? Wie konnte ich bereit gewesen sein, Dienstverpflichtungen in einer völlig obskuren Universität, in einer mir völlig fremden Gegend in Indien aufzunehmen? Ohne einen bewilligten Forschungsauftrag als Stütze? Ohne dienstliche Reisekosten? Daß ich nicht in der Lage gewesen bin, diese und ähnliche Fragen zu stellen, belegt meine Blindheit, aber stellt auch die Qualität einer Wissenschaftsdisziplin in Frage, die die gesellschaftliche Wirklichkeit wissenschaftlich beschreiben will.
Vieles läßt sich entschuldigen. Vieles läßt sich plausibel erklären. Richtiger wird es dadurch nicht. Sicherlich läßt der Dauerstreß von lernen, arbeiten, Zukunft planen, über mehrere Jahre – immerhin bis Juni 1966 –, und das ganz ohne Urlaubspause, wenig Möglichkeiten, über die abgelaufenen Monate und Jahre gründlich nachzudenken und daraus für die Zukunft zu lernen. Man läßt sich möglicherweise auch lange wie Strandgut treiben, bis Spitzen von Felsen oder Stromschnellen sichtbar werden. Möglicherweise.
Die Seereise beginnt in Rotterdam. Wir steigen nur mit leichtem Gepäck in den Zug in Köln. Alle Gepäckstücke, es sind 15 Koffer unterschiedlicher Größe, sind schon mit einer Spedition zur Reederei vorausgeschickt. Bis Rotterdam ist es ja eine kurze Reise. Dort angekommen nehmen wir ein Taxi zum Reedereiagenten. Wir dürfen sofort auf das Schiff, obwohl es erst am nächsten Tag auslaufen soll. Ohne einen Arzt auf dem Schiff dürfen die Frachtschiffe höchstens 12 Passagiere transportieren. Wir sind insgesamt 7 Personen. Die Kabinen sind wie die der ersten Klasse in den Passagierschiffen. 24 Stunden Service. Kein Kleiderzwang im Gegensatz zu den Passagierschiffen. Eigentlich ideale Voraussetzungen für ruhiges Nachdenken und für Erholung.
Voraussichtliche Reisezeit: ca. 4 Wochen. Die Reiseroute sieht das Anlaufen von Beirut und Aden vor. Später wird noch Jidda hinzukommen. Und dazwischen natürlich der obligatorische Aufenthalt vor Port Said am Suez Kanal. Bei einer so langen Seefahrt durchlebt man alle Rauhheiten der Meere. Bis Windstärke 11. Bewegliche Gegenstände in den Kabinen werden festgebunden. Die Tischplatten im Eßsaal werden entfernt, damit der darunterliegende wattierte Teil des Tisches durchnäßt werden kann. Sonst fliegen die Kaffeetasse oder der Suppenteller beim Wellengang über den Tisch. Zum Glück werden wir nicht seekrank.
In Beirut ist der Ladevorgang so kurz, daß der Frachter außerhalb des Hafens ankert, um die Hafengebühren zu sparen. Also können wir nicht an Land. Aber fliegende Händler kommen, einige dürfen sogar auf das Schiff. Nicht die Händler lenken uns ab, sondern der Blick auf die wunderschöne Silhouette des noch unzerstörten Beiruts, der Perle des Orients, durch die farbenprächtigen Daus, die in unterschiedlicher Entfernung ankerten oder die an unserem industriell gebauten Frachtschiff vorbei segeln.
Ablenkung haben wir erst in Port Said. Nicht durch die fliegenden Händler, obwohl diese um das Schiff herum reichlich touristische Andenken lautstark feil bieten. Nein. Die Ablenkung beginnt mit unserem Wunsch, an Land gehen zu wollen. Die zufällige Tischordnung hat uns den Kapitän und den ersten Offizier beschert. Beim Frühstück erwähnen wir, daß wir gern an Land gehen wollen. Wir werden ernstlich gewarnt. Port Said soll einer der berüchtigten Häfen sein, was Nepp, Raub etc. angeht. Sie würden nie in den ägyptischen Häfen an Land gehen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Nach dem Frühstück steigen wir ins Motorboot der Hafenbehörde. Wir werden gebeten, noch im Hellen zurückzukommen, obwohl das Schiff erst am nächsten Morgen den Kanal passieren kann.
Außer uns beiden ist sonst keiner ins Motorboot gestiegen. Von dem Ankerplatz ist die Stadt so weit entfernt, daß unser Frachter nur langsam aus dem Blick verschwindet. In Augenblick kommen nur Schiffe aus Port Suez. Der Ausstieg aus dem Motorboot ist problemlos. Es ist nicht viel los am Vormittag. Wir laufen langsam in Richtung Stadt. Eigentlich wissen wir nicht, wohin wir gehen sollen. In einiger Entfernung sehen wir eine Moschee. Wir nehmen diese Richtung. In der Nähe der Moschee spricht uns einer an. Auf Englisch. Ein älterer, freundlicher Herr. Er ist erfreut, nachdem wir uns alles erzählt haben, was in so einer Situation zu erzählen ist. Indien, das heißt Nehru, ein großes Land, meint der ältere, freundliche Herr. Ich habe nicht gewußt, in welcher Hochachtung Indien im muslimischen Ägypten trotz der Kriege zwischen Indien und Pakistan steht. Und deutschfreundlich waren die Ägypter schon immer. Er heißt uns willkommen und fragt uns, ob wir die Moschee von innen besichtigen wollen. Wir wollen.
Er verhält sich wie ein Fremdenführer. Innen ist die Moschee sehr weitläufig. Mit vielen unterteilten Räumlichkeiten. Eine große Halle und viele kleinere Hallen unterschiedlicher Größe. Die Fußböden der Hallen sind mit Teppich bedeckt, praktisch von Wand zu Wand. Nicht wie in Europa mit Teppichböden. Die Teppiche haben unterschiedliche Muster, unterschiedliche Farbtöne, auch unterschiedliche Größen. Aber zusammen wirken sie wie ein einziger Schmuck, wie ein Gemälde in einem riesigen, sonst schmucklosen Bauwerk. Wie nehmen uns Zeit. Draußen ist es schon heiß. Im Inneren der Moschee ist es angenehm kühl. Als wir schließlich aus der Moschee kommen, wollen wir uns von unserem ägyptischen „Fremdenführer“ verabschieden. Er ist damit nicht einverstanden. Er will uns doch die Stadt noch zeigen. Wir stimmen zu. Wir spazieren gemächlich immer auf der Schattenseite der Straßen und besichtigen die wenigen Sehenswürdigkeiten. Am frühen Nachmittag haben wir Hunger, obwohl die Hitze bereits unappetitlich stark ist. Wir suchen so etwas wie ein Café auf und imbissen. Während dessen unterhalten wir uns, über nichts Bestimmtes und fragen beiläufig, warum die Stadt so leer ist. Wir haben den Freitag erwischt. Als wir im Café bezahlen wollen, ist er uns fast böse. Wir sind heute seine Gäste. Er hätte sich so gefreut, mit uns durch die Stadt zu spazieren und daß wir keine Hetze hatten und überhaupt. Nichts zu machen. Er setzt seinen Willen durch. Er weiß und wir wissen, daß wir uns im Leben nie wieder begegnen werden. Was für eine Gastfreundschaft!
Es wird bald dunkel. Wir sind traurig, daß wir nichts von dem Warenangebot gesehen haben, weil der Bazar auch nachmittags nicht geöffnet wird. Als wir traurig erwähnen, daß wir nicht wissen, wann wir wieder ägyptischen Boden betreten werden, versteht er unser Bedrücktsein. Er meint, wenn es uns das Warenangebot im Bazar wirklich interessieren würde, könnte er das schon arrangieren. Aber wir würden dann nicht mehr im Hellen aufs Schiff gehen können, meint er. Na, wenn schon! Wir begleiten ihn genauso gemächlich wie vorher zu dem Einkaufsviertel. Ein Laden neben dem anderen. Leider sind alle zu. Mit Holzläden. Er bittet uns dort, etwas zu warten. Nach einiger Zeit kommt er in Begleitung eines jüngeren Mannes zurück. Dieser macht seinen Laden auf. Unser Begleiter versichert uns, daß wir nichts kaufen müßten. Einige Neugierige kommen auch dazu. Es hat sich herumgesprochen, daß unser Begleiter Gäste hat.
Das Angebot ist vielfältig: diverse Lederwaren, Schmiedearbeiten, auch in Gold und Silber, und Edelsteine. Wir dürfen alles genau betrachten. Der Händler ist freundlich und geduldig. Vieles hätten wir gern gekauft. Aber wir erkundigen uns nicht einmal nach den Preisen. Wir haben auch keinen Vergleich. Und Geld auch nicht, leider. Zum Schluß zeigt er uns Schmuck und Edelsteine, auch Alexandrite. Wunderschöne Steine, die je nach Lichteinfall grün, blau und dunkellila durchschimmern. Meine Frau ist hingerissen. Sie betrachtet intensiv einen Stein. Der Ladeninhaber und unser Begleiter unterhalten sich. Am Ende der Unterhaltung sagt uns unser Begleiter, also drei englische Pfund müßte der Ladeninhaber für den Stein wirklich haben. Der Stein hat ca. 18 Karat. Es kommt uns fast wie ein Geschenk vor. Meine Frau trägt den Stein gefaßt in einem Ring heute noch am liebsten. Wir werden schließlich bis zum Motorboot begleitet. Was für ein schöner Tag in Port Said!
Dieses Erlebnis und zuvor die Warnungen auf dem Schiff beschäftigen uns lange. Selbst die Ein– und Ausfahrt in Jidda, gelotst von einem Araber in landeseigener Kleidung, lenken uns nicht ab. Auch nicht die britischen Soldaten mit angezogenen Schnellfeuerwaffen an jeder Straßenecke in der zollfreien Hafenstadt Aden, das reiche Angebot an internationalen elektrotechnischen Konsumgütern oder die papierfressenden Ziegen auf den gepflasterten Straßen. Uns bleibt es ein Rätsel, wie die deutschen Seeleute auf dem Schiff zu dem negativen Urteil über die Ägypter gelangt waren und wo sie ihre Erfahrungen mit den Ägyptern gesammelt haben. Durch den Rotlichtviertel waren wir natürlich nicht spaziert und auch nicht in eine Bar eingekehrt. Aber gibt es diesbezüglich überhaupt Unterschiede zwischen den Städten oder den Ländern?
Ansonsten haben wir schlicht in den Tag hineingelebt, das heißt gefaulenzt ohne zu bedenken, daß selbst wenn alles gut geht, wir eine sehr ereignisreiche und hektische Zeit vor uns haben werden. Entwürfe von möglichen unterschiedlichen Szenarien hätten für uns durchaus hilfreich sein können. Fehlanzeige. Wir verließen uns einfach darauf, daß die Lehrveranstaltungen mir kein Problem bereiten dürften, und auf die Durchführung der geplanten Interviews der „Zurückgekommenen“ sind wir ja bestens vorbereitet. Das Erhebungsinstrument stand schon. Umfangreiche Voruntersuchungen würden wahrscheinlich nicht nötig sein. Also wozu Szenarien entwerfen, schwarzmalen? Erholung hatten wir schließlich auch nötig. Im Nachhinein muß ich mir schwere Vorhaltungen machen, so arglos, so sorglos, so naiv, so vertrauensselig, so faul, so gedankenlos und so geschichtslos gewesen zu sein – insbesondere in jenen Tagen auf dem Schiff.
*****
Das Zimmer im Gästehaus der Universität in Jaipur ist von Sonnenschein überflutet als wir wach werden. Der Morgen ist kühl, obwohl die Sonne schon warm ist. Die Holzfensterläden im Speisesaal sind bereits beim Frühstück zugezogen, damit die Hitze nicht in den Saal eindringt. Die Abdunkelung ist das kleinere Übel. Wir nehmen uns Zeit, bevor der erste Arbeitstag für mich beginnt. Unnithan holt mich kurz nach 10.00 Uhr ab. Der Tag ist bereits heiß. Wir müssen etwa 10 Minuten laufen bis zu dem „Department“. Unnithan empfiehlt mir, für den nächsten Tag einen Sonnenschirm zu besorgen, einen wie seinen. Trotz der geringen Luftfeuchtigkeit bin ich fast durchgeschwitzt. Unnithan nicht. Unter dem Schirm ist es kühler.
Es ist ein freistehendes Gebäude ohne Stockwerke mit hohen Räumen. In den Räumen ist es auch ohne die obligatorischen elektrischen Ventilatoren kühl. Vier Departments sind dort untergebracht. Ökonomie, Politik, Statistik und Soziologie. Das Gebäude ist von allen vier Seiten begehbar. Individuelle Arbeitsräume gibt es nur für die „Head of the Department“. Die übrigen Kollegen teilen sich einen Raum jeweils in einem Department. Keine richtig eigenen Arbeitsplätze.
Die Veranstaltungen beginnen um 11.00 Uhr. Nach 18.00 Uhr ist dieser Teil des Campus leer. Nur die heißeste Tageszeit wird für die Veranstaltungen genutzt. Warum? Weil es schon fast immer so gewesen ist. Ich weiß dies auch aus meiner eigenen Schul– und Studienzeit. Auch eine koloniale Hinterlassenschaft. Unnithan und auch andere Kollegen, es sind im Ganzen vier, haben meiner Bitte großzügig entsprochen, daß ich in den ersten Tagen auch ihre Veranstaltungen besuchen darf, immer wenn ich frei habe. Ich nehme die Gelegenheit schon am ersten Tag wahr.
Noch vor dem Abendessen besichtigen wir jene Unterkunft im sogenannten „Teachers' Hostel“, die für uns reserviert worden war. Der Weg führt vom „Guest House“ zur sogenannten „residential area“ vom Südwestrand hin zum Südostrand des Campus. Zu Fuß ca. 15 Minuten. Es ist das einzige Gebäude im Campus mit mehreren Stockwerken. Es ist noch im Bau. Die für uns vorgesehene Unterkunft ist noch lange nicht bezugsfertig. Es sind zwei kleine Räume mit einer Kochnische und einem kleinen Badezimmer. Das Platzangebot reicht nicht einmal für unsere mitgeschleppten Koffer, von einem eigenen Arbeitsplatz ganz zu schweigen. Deshalb informiere ich Unnithan, daß wir wohl solange im Guest House bleiben müssen, bis wir in einer Wohnung oder in einem Haus untergebracht werden können. Selbst die Suites im Guest House sind geräumiger als die Unterkunft im Teachers' Hostel. Unnithan versteht uns und macht uns Hoffnung, daß wir in wenigen Wochen vielleicht sogar mit einem Haus auf dem Campus rechnen könnten.
Ich habe ausschließlich Postgraduierte zu unterrichten. 15 Wochenstunden. Ich werde mich also mit Studierenden befassen, die mindestens 14 (M. A. previous) bzw. 15 Ausbildungsjahre (M. A. final) hinter sich haben. Andere Kollegen müssen auch noch nichtgraduierte Studierende unterrichten, in den „Colleges“ in der Stadt. Alle meine Veranstaltungen finden nur innerhalb des Campus statt. Eine gerade noch zu bewältigende Aufgabe, die uns noch Zeit lassen wird für unsere Forschungsvorbereitung, das heißt Anschriften der Rückkehrer sammeln, „Samples“ ziehen, Termine machen, usw.
*****
Das indische Ausbildungssystem – ich vermeide den Ausdruck „Bildungssystem", denn die Vermittlung indischer Bildung findet nicht in den Institutionen des Ausbildungssystems statt – sieht „Primary Schools“ als die breite unterste Stufe für vier Jahre vor. Nach dem geltenden Gesetz soll jedes Kind die Möglichkeit haben, diese Primarstufe zu durchlaufen. Je entfernter ein Ort von der Bundeshauptstadt, von den Landeshauptstädten, von den Städten ist, um so stärker bleibt die Wirklichkeit hinter diesem Ziel zurück. In der Regel sind die Schulen auf der Primarstufe öffentliche Einrichtungen. In der Regel sind diese auch schlechter eingerichtet als die wenigen Privatschulen. Kindergärten als Regeleinrichtung sind nicht vorgesehen. In den Städten gibt es private Kindergärten. Diese sind teuer.
Der Primarstufe folgt die „Secondary School“ für weitere sechs bzw. sieben Jahre, mit Abschlüssen: „Matriculation“ oder „Higher Secondary“. „Higher Secondary“ ist in Indien die Eingangsqualifikation für „Colleges“, die zwischen der Schule und der Universität angesiedelt sind. Von „Matriculation“ aufwärts werden die Prüfungen zentral abgehalten. Klausuren in verschiedenen Fächern. Nicht landeseinheitlich zentral, sondern universitätseinheitlich. Die gesamte Republik ist in „States“, also Länder, und in die sogenannten „Union Territories“, d.h. zentral regierte Gebiete, aufgeteilt. Indien ist ein föderaler Bundesstaat mit kultureller Autonomie. Die Universitäten sind flächendeckend.
Die Zugangsvoraussetzung für die Universität wird erworben mit der „Graduation“. Ein Graduierter hat mindestens 14 Ausbildungsjahre hinter sich. Ein Graduierter wird auch „Bachelor“ genannt. In den Universitäten erwirbt man in zwei Jahren den „Degree“ eines „Post–Graduates“, der auch der Grad eines „Masters“ genannt wird, etwa vergleichbar mit der Magisterprüfung. Dieser Grad ist die Eingangsvoraussetzung für „Research Degrees“. Das Niveau der Universitäten ist unterschiedlich, funktioniert aber nach demselben Prinzip, also je entfernter von der Hauptstadt, um so niedriger ist das Niveau. Die Medizin– und Ingenieurausbildung sieht nach „Higher Secondary“ sechs Jahre für den „Bachelor Degree“ vor.
Die Fächer bilden die kleinste organisatorische Einheit. Jedes Fach hat mehrere Lehrende. „Professor“, „Reader“ und „Lecturer“ ist die hierarchische Ordnung, die zusammen ein Department bilden. Die Spitze, der „Head of the Department“, wird von der „Faculty“ und „Syndicate“ bestimmt, vergleichbar mit der Fakultät und dem Senat. Einige verwandte Fächer bilden eine Fakultät. Die Fakultäten sind unterteilt in „Science“ und „Humanities“, also Natur– und Geisteswissenschaften. Die Spitze der Fakultät, der „Dean“, wird durch das „Syndicate“ bestimmt. Die akademische Spitze innerhalb der Universität ist der „Vice Chancelor“, der formal einem „Chancellor“ unterstellt ist. Der Chancellor hat juristische Aufsicht und ist auch zuständig für die Repräsentation der Universität. Meist ist er der Gouverneur des Bundesstaates. Der Gouverneur eines Bundesstaates wird auf Vorschlag der Zentralregierung vom Staatspräsidenten ernannt. Das oberste Repräsentationsamt der Universitäten ist das Amt des „Visitors“. Der Visitor ist meist der Staatspräsident der Republik. Die Universitäten sollen nach den Buchstaben der Statuten autonom sein.
*****
Die ersten Tage in Jaipur sind ausgefüllt mit unserer Orientierung innerhalb und außerhalb des Campus, mit Begegnungen mit den „Deans of the Faculty“, mit dem Vice Chancellor und ähnlichem. Der Vice Chancellor heißt uns willkommen und sichert uns zu, daß wir bei der ersten sich bietenden Möglichkeit eine Wohnung oder ein Haus zugewiesen bekommen werden. Er, M. V. Mathur, ist seit dem 4. Januar 1966 im Amt. Als Universitätslehrer ohne einen Forschungsgrad, also ohne Promotion, war er „Head of the Department of Economics“ in der Universität Rajasthan und als Mitglied der „Education Commission“ der indischen Regierung wird Mathur zum Nachfolger von Dr. Mohan Sinha Metha ernannt.
Unnithan möchte uns auch dem ausgeschiedenen Vice Chancellor, Mohan Sinha Metha, vorstellen, weil Metha die Einladung an mich auf den Weg gebracht hatte, eine Prozedur, die in den Statuten der Universität nicht vorgesehen ist. Aber Metha sei eine sehr dynamische Persönlichkeit gewesen. Eigentlich habe die Universität – gegründet nach der Unabhängigkeit Indiens am 15. August 1947 – vor Methas Zeit fast nur auf dem Papier bestanden. Der Campus ist sein Werk. Alles, was wir heute sehen, ist während seiner 6jährigen Amtszeit entstanden. Metha hätte sich für mich eingesetzt in der Hoffnung, daß ich der Universität Rajasthan eventuell länger erhalten bleiben könnte.
Mohan Sinha Metha hatte vor seiner Ernennung zum Vice Chancellor der Universität wenig mit Universitäten zu tun. Er war nicht, wie sein Nachfolger Mathur, Universitätsprofessor, nein, er war Botschafter Indiens in den Niederlanden, ein Diplomat und promovierter Jurist (Ph. D., Bar-at-Law). Vor der Unabhängigkeit war Metha Minister in einem „Princely State“.
Das weitaus größte Gebiet in Britisch–Indien vor 1947 wurde von der britischen Krone direkt verwaltet, durch einen Vizekönig. Daneben existierten die „Princely States“, Fürsten– bzw. Königtümer, ca. 680 an der Zahl, die auf Papier Autonomie genossen. Diese Fürsten bzw. Könige hatten für die britische Krone Verdienste erworben. Nicht immer waren sie Nachfahren tradierter Herrscherhäuser. Die Kolonialverwaltung pflegte auch besondere Verdienste durch solche Benennungen zu belohnen. Jenes Gesetz im britischen Parlament, das die Kolonisation Indiens beenden sollte, sah eine Teilung des Landes ebenso vor wie die Unabhängigkeit dieser „Princely States“, obwohl die meisten von ihnen weder wirtschaftlich noch politisch lebensfähig gewesen wären. Das Gesetz sah deshalb auch vor, daß alle diese „Staaten“ die Option hatten, sich Indien oder Pakistan anzuschließen. Das Gesetz legte keinerlei Kriterien für die Option fest. Allerdings hatte das Volk keine Option, sondern nur die Herrscher dieser Staaten.
Nach der Unabhängigkeit ging die Eingliederung nach den jeweils erfolgten Optionen der „Princely States" reibungslos vonstatten. Abgesehen von zwei „States". Der Nizam von Hydrabad, ein muslimischer Herrscher im Süden Indiens, wollte für das ferne muslimische Pakistan optieren. Indien widersetzte sich dieser Intention des Nizams, entmachtete ihn und gliederte den „Staat“ in die „indische Union“ ein. Der hinduistische Maharaja von Kaschmir optierte für Indien, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung Muslime sind. Nach dem Text des Gesetzes war das in Ordnung. Aber nicht nach dem Gesetz der Macht. Pakistan mischte sich ein und besetzte einen Teil dieses „Staates“ mit der Begründung, daß das Teilungsprinzip Britisch–Indiens die Religion gewesen sei. Deshalb dürfte der hinduistische Maharaja von Kaschmir die mehrheitlich muslimische Bevölkerung nicht zu Indien führen. Damit war jene Saat des britischen Gesetzes aufgegangen, die von vielen Briten so charakterisiert wurde: „Wir gehen, um zu bleiben.“ Wegen Kaschmir haben diese beiden Nachfolgestaaten bereits drei Kriege geführt. Diese hörten jeweils dann auf, nachdem die meist importierten Waffensysteme auf beiden Seiten verbraucht waren. Kein schlechtes Geschäft für die waffenexportierenden Länder.
Der heutige Bundesstaat Rajasthan ist ein Zusammenschluß von zahlreichen „Princely States“ der Rajputs, eines stolzen Kriegervolkes. Einem dieser Staaten im Nordwesten, Udaipur, nah an der pakistanischen Grenze, hatte Metha gedient. Nach der Unabhängigkeit betätigte sich Metha mit Erfolg als Politiker und ging dann zum diplomatischen Dienst. Bereits vor seiner Pensionierung als Botschafter in Den Haag hatte er die Ernennung zum Vice Chancellor der Universität Rajasthan in der Tasche. Im Januar 1960 trat er das Amt an. Für drei Jahre. Seine Amtszeit wurde für weitere drei Jahre, die maximale Zeit, verlängert. Er hatte sich für das Erziehungswesen in Rajasthan einen Namen gemacht.
Metha hat leichtes Fieber als wir ihn in Begleitung des Head of the Department der Zoologie und der beiden Unnithans besuchen. Metha begrüßt uns freundlich und führt eine Konversation, die nicht nur seine Bildung, sondern auch seine Souveränität in Erziehungsfragen zum Ausdruck bringt. Anders als bei seinem Nachfolger im Amt. Uns gefällt die devote Art der anderen beiden Herren nicht. Gerda Unnithan, wie schon erwähnt, eine Niederländerin und an der Universität zuständig für studentische Fragen, verhält sich nicht devot, sondern eher vertraut. So bewegte sie sich auch in der Wohnung von Metha. Abends besucht Gerda Unnithan meine Frau und lädt sie zu einem Spaziergang ein. Eher beiläufig erzählt sie meiner Frau, daß sie, meine Frau, auf dem Campus viel Gerede über sie, Gerda Unnithan, und Metha hören werde. Deshalb zieht sie es vor, meine Frau selbst zu informieren, daß Metha und sie miteinander ein vertrautes Verhältnis haben. Sie hat Metha bereits in den Niederlanden gekannt.
Unnithans laden uns zum „Dinner“ ein. Sie bewohnen einen Bungalow auf dem Campus. Sie haben eine kleine, gerade schulpflichtig gewordene Tochter. Ein weiteres Ehepaar kommt zum „Dinner“. Ein sehr junges Ehepaar aus Deutschland. Jansen heißen sie. Er unterrichtet Deutsch an der Universität. Von der Universität wird eine Wohnung auf dem Campus zur Verfügung gestellt. Sein Gehalt kommt ganz vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Warum? Wie soll man sonst auswärtige Kulturpolitik zur Absicherung der wirtschaftlichen Interessen betreiben? Diese „Kulturbotschafter“ kommen in Kreise hinein, die Botschaftsangehörigen oder Auslandskorrespondenten verschlossen sind. Schließlich: Information ist Macht. Und Machtabsicherung geht leider nicht zum Nulltarif. Nur die Steuerzahler dürfen den Zusammenhang nicht erkennen. Für sie heißt das Ganze „Entwicklungshilfe“.
Frau Jansen hat keine offizielle Funktion. Ehepaar Jansen hat einen VW–Käfer als Ausstattung bekommen. Sie fährt den Wagen viel herum und macht sich nützlich für die Leute auf dem Campus, die wichtig sind. Gleich an diesem Abend übermitteln die Jansens uns eine Einladung von einem „Nawab“, einem muslimischen „Prince“, der großes Interesse für deutsch–indische Begegnungen hat und uns gern kennenlernen möchte. Was sollen wir gegen diese Einladung haben? Wir besuchen den Nawab. Sein Domizil ist ein ansehnlicher Palast. Wie alle die ehemaligen „Princes“ besitzt auch er zwar keine Ländereien mehr, aber doch das Privileg einer konvertierbaren „Schatulle“, die auch die zollfreie Einfuhr europäischer Spirituosen ermöglicht. Das Ehepaar Jansen partizipiert an diesem Privileg. An Whisky. Dies ist der Preis für die Begegnungen mit diesem Nawab, der ansonsten eher langweilig ist. Wir sind schockiert. Kulturschock? Nein. Wir sind nicht ein weiteres Mal seiner Einladung gefolgt.
Ein unerwarteter Vorgang nimmt in den nächsten Tagen die meiste Zeit in Anspruch. Unnithan erzählt mir eine durchaus glaubhafte Geschichte. Als „Chairman“ der „World Sociologist Association“ (WSA) habe König ihn anläßlich seines Besuchs in Köln zum „World Sociology Congress“ Anfang September 1966 im französischen Evian eingeladen. Unnithan solle dem Weltkongreß über die Soziologieausbildung in Indien berichten. König und Scheuch hätten ihm die Übernahme aller seiner Kosten durch die WSA versichert. So habe er nur Dienstreiseurlaub genommen. Nun teile ihm König mit, daß der WSA nicht in der Lage sei, Unnithans Reisekosten zu übernehmen. WSA übernähme überhaupt keine Reisekosten. Daraufhin habe Unnithan bei der Regierung just mit diesem Hinweis für sich die Reisekosten beantragt. So weit so gut.
Nun soll aber bekannt geworden sein, daß der Head of the Department der Soziologie der Universität Agra, Saxena, bereits von der WSA sein Ticket erhalten hätte, obwohl er nicht als Referent eingeladen worden sei und auch kein Arbeitspapier vorlegen wird. Nun stünde Unnithan praktisch als Lügner und Betrüger da, weil er ja König und Scheuch glaubte und vertraute und seinen Antrag gegenüber der Regierung gerade mit dem Hinweis begründete, daß die WSA keinem die Reise bezahlte.
Auf seinen diversen, auch eingeschriebenen, Briefen, habe weder König noch Scheuch geantwortet. Er hätte am 12. Juli 1966 auch an mich geschrieben. Ich war aber schon unterwegs nach Indien. Ich sollte nun als einzig greifbarer „Vertreter der Kölner Universität“, die peinliche Situation glattbügeln, indem ich den beiden Herren klarstellte, in welch unmögliche Lage sie Unnithan gebracht hätten.
Die Geschichte kommt mir glaubhaft vor. Seit unserer Ankunft in Jaipur wissen wir, daß der ranghöchste Kollege nach Unnithan im Department, Dr. Yogendra Singh, von seinen Lehrveranstaltungen freigestellt worden ist, weil er für Unnithan ein Arbeitspapier für den Weltkongreß verfaßt. Ich gerate unter Druck. Wie soll eine künftige Zusammenarbeit der beiden Universitäten gedeihen, wenn Unnithan öffentlich so blamiert wird? Ich folge der Anregung Unnithans, schildere König die peinliche Situation und bitte ihn, dringendst die Flugkarte für Unnithan zu organisieren. Telefonisch erreiche ich König nicht, weil er wegen des Kongresses viel unterwegs ist. Unnithan hängt mir ständig in den Ohren. Fast jeden Tag muß ich die neuesten „Nachrichten“, Briefe oder Telegramme auf Unnithans Kosten nach Köln senden. Schließlich kommt die Flugkarte doch.
Unnithan bittet mich vor seiner Abreise, das Arbeitspapier zu redigieren. Ich kann seine Bitte nicht abschlagen. Wieder denke ich nicht über das Vorgefallene nach, weil ein Ereignis nach dem anderen mich überfällt bzw. mich beschäftigt hält. Vielleicht habe ich mich aber auch gern beschäftigt halten lassen. Heute weiß ich, daß das Sichselbsteinreden, keine-Zeit-zum-Nachdenken-haben schon System hat.
Viele Fragen stelle ich nicht. Nach welchem Verfahren werden die Teilnehmer eines solchen Weltkongreßes bestimmt? Wo ist die Meßlatte für die Qualität der Arbeitspapiere oder der Referate? Kommt es nur darauf an, daß auch einige exotische Personen unterschiedlicher Herkunft daran teilnehmen? Welche wirkliche Funktion haben Arbeitspapiere überhaupt? Wer hätte über das Soziologiestudium in Indien berichtet, um bei der Posse mit den Reisekosten zu bleiben, wenn Unnithan nicht auf Kosten der deutschen Steuerzahler in Köln aufgetaucht wäre? Warum erging keine Einladung an eine der älteren Universitäten wie die in Benares, Bombay, Delhi, Kalkutta oder Madras? Und wer ist dieser Saxena? Wieso wird die blosse Teilnahme Saxenas voll finanziert? Läuft das alles wirklich zum Nulltarif? Diese oder viele Fragen wie diese hätte ich stellen können oder gar stellen müssen. In der Hektik nehme ich nicht einmal Anstoß daran, daß Unnithan's Papier von einem „ghost writer“ geschrieben wird. Lehrveranstaltungen fallen aus. Heute weiß ich, daß die Hektik eine billige Ausrede war.
*****
Das ständige Wohnen im Gästehaus ist beschwerlich. Auch wenn die Räumlichkeiten großzügig sind, leben wir doch aus dem Koffer. Leben aus dem Koffer bedeutet auch Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Hinzu kommt noch der Servierrhythmus der Mahlzeiten und die Hygiene in der Küche. Wir trinken das abgekochte Wasser und essen nichts, was nicht heiß gekocht ist. Dennoch haben wir Durchfälle. Also bemühe ich mich, baldmöglichst eine Dienstwohnung zu bekommen, was mir von der Universitätsleitung zugesagt worden war, sobald eine Behausung frei ist!
Nach der Unabhängigkeit Indiens im Jahre 1947 sind Universitäten wie Pilze gewachsen. Universitäten mit unterschiedlicher Ausstattung, mit unterschiedlicher Zusammensetzung der Fächer, mit unterschiedlicher Qualität der Ausbildung. Statuten aller Universitäten schreiben vor, daß alle Stellen nationenweit ausgeschrieben und von einem „Selektion Board“ – vergleichbar mit einer Berufungskommission deutscher Universitäten mit dem Unterschied, daß diese stets Gelehrte anderer Universitäten hinzuziehen müssen – ausgewählt werden müssen. Als Vorsorgemaßnahme gegen die Vetternwirtschaft. Nun, wo Vetternwirtschaft droht, entsteht auch Vetternwirtschaft. Den gesetzlichen Bestimmungen zum Trotz. So sind die „Selection Boards“ auch die „Handelsplätze“ zum gegenseitigen Vorteil. Dies führt nicht zur Qualitätsverbesserung, dient aber zur Erhöhung der Einkünfte der agileren Universitätslehrer. Sie lassen sich berufen, haben aber die gesetzliche Möglichkeit, innerhalb eines Jahres in die alte Universität zurückzukommen. Mit höherem Gehalt, versteht sich. Und sie behalten ihre Dienstwohnung.
So war uns klar, daß wir bald eine Zuweisung bekommen werden. Also warten wir geduldig. Trotz unseres Lebens über die finanziellen Verhältnisse, trotz des Aus-dem-Koffer-lebens, trotz der Durchfälle, trotz der Reglementierungen möchten wir jene fast drei Monate im Gästehaus der Universität nicht missen. Wir begegnen Menschen, denen wir sonst nicht begegnet wären. Es ist ein schneller Durchgangsverkehr. Abends ankommen. Am übernächsten Morgen weiterreisen. Nach dem Frühstück. Wir begegnen ihnen beim Abendessen, später, wenn es kühl und dunkel wird, auf dem Rasen beim Kaffee oder bei einem kalten Getränk, am folgenden Tage jeweils bei und nach den Mahlzeiten.
Die indischen Gäste sind meist Würdenträger, geladen zu wichtigen „Meetings“. Im Speisesaal bestellen sie nichts selbst. Sie lassen bestellen. Durch den „PA“, den persönlichen Assistenten. Wenn die PAs noch nicht im Raum sind und der Kellner sich erkundigt – wie bei den ausländischen Gästen und auch wie bei uns –, ob Sie Tee oder Kaffee möchten, antworten sie nicht einmal. Der Kellner wartet verdutzt ab, und dann verschwindet er langsam. Zunächst wundert uns, daß der Kellner nicht lernt! Zunächst. Dann erfahren wir: Wenn der Kellner im Raum ist und nicht fragt, sind diese Würdenträger auch sauer. Dann interpretieren sie dies als Mißachtung. Also sehen wir das Ritual immer wieder. Bei der Nachbestellung könnte eigentlich auf die PAs verzichtet werden. Was sollen aber diese Würdenträger auch tun, wenn die PAs stets in Sichtweite auf Zeichen warten! Man kann ja auch den PAs nicht vor den Kopf stoßen oder ihr ehrfürchtiges Warten als überflüssiges Herumstehen hinstellen.
Die PAs sind richtig europäisch angezogen. Die Würdenträger ziehen sich auch europäisch an, wenn sie das Gästehaus verlassen. Aber nicht im Speisesaal. Beim Speisen sind sie leger angezogen. Häufig baumeln ihre Beine nicht vom Stuhl. Sie sitzen auf dem Stuhl im Schneidersitz. Was soll daran falsch sein? Die Frage stellen wir aber nicht. Denn meine Frau ist ja eine Deutsche. Und ich bin lange genug in Deutschland „zivilisiert“ worden. Und dann die diversen Geräusche beim und nach dem Essen! All dies verpaßt meiner Frau doch einen leichten Kulturschock. Sie ist innerlich empört. Eigentlich ungerechterweise. In Europa geschieht ähnliches auch. Nur etwas besser durchorganisiert, professionell eben!
Alle sind uns gegenüber höflich und auch aufgeschlossen. Manchmal geht es auch über die „small talks“ hinaus. Sie hören sich geduldig unsere Meinungen und Kritiken an. Keine Diskussionen. Übereinstimmungen und unterschiedliche Einschätzungen. Zu der Zeit werden in Indien zwei bemerkenswerte Sachbücher viel diskutiert. V. S. Naipaul, der „amerikanische“ Schriftsteller indischer Herkunft, besucht zum ersten Mal das Land seiner Vorväter, voller Neugier, geweckt durch die Erzählungen seiner Großmutter. Er steht die Wirklichkeit nicht durch, er ist geschockt, flüchtet aus dem Land und schreibt das Buch „Area of Darkness“. Der Titel ist auch Programm. Er findet überall nur „Traditionalität“, das Gegenteil von Modernität. Was immer die „Modernität“ auch sein mag. Die internationalen „Bildungsbürger“ sind einig darüber, daß „Entwicklungsländer“ rückständig sind, aber Fortschritt erzielen müssen über Entwicklungen, vorwiegend über die wirtschaftlichen. Und diese Entwicklungen wäre eben der Übergang von Traditionalität zur Modernität, Übergang von einer niedrigeren Phase der Entwicklung zu einer höheren. Naipaul hat dafür keine Anzeichen entdecken können, keine Ansätze gefunden. Er ist „zivilisiert“ worden in der „amerikanischen“ Gesellschaft.
Der andere Autor, Nirad C. Chaudhuri, ist im Gegensatz zu Naipaul in Indien aufgewachsen und ausgebildet, aber ein Bewunderer der britischen Kultur. Er erhält – wenn auch ziemlich spät – ein ansehnliches Forschungsstipendium aus Großbritannien und dort Zugang zu vielen exklusiven Archiven. Er reflektiert die Geschichte seines Landes, die koloniale Vergangenheit und natürlich den gegenwärtigen Zustand seines Landes und verfaßt das Buch „Autobiography of An Unknown Indian“. Auch er sieht Dunkles, nicht nur eine Region im Dunkeln, aber er flüchtet nicht. Wohin auch? Er beschreibt engagiert das Übel. Seine „halbgebildeten“ Landsleute ruinierten das Land – Bürokraten, Politiker, Wissenschaftler, weil sie weder traditionell noch modern, sondern eigentlich „nichts“ seien. Sie trügen unter der europäischen Hose doch noch das indische „Lendentuch".
Auf diese Art von Ungereimtheiten können wir uns in Diskussionen im Speisesaal einigen. Was sie über uns denken und was sie über uns später erzählen, haben wir nicht erfahren. Aber ich erzähle eine kurze Geschichte, eine beispielhafte wie ich meine, die unsere Einschätzung der dort erlebten Situation plastisch wiedergibt.
Wir sitzen bereits am Mittagstisch. Ein gutgekleideter Herr kommt herein, eben nicht leger gekleidet, ohne einen PA zwei Meter hinter sich, schaut im Saal herum, taxiert die Gäste, schreitet zu unserem Tisch und fragt formvollendet, ob er an unserem Tisch Platz nehmen darf. Natürlich darf er. Er stellt sich vor, wir uns auch. Eine normale Situation. Er ist Direktor eines Universitätsinstituts für „Business Management“. Er ist verabredet mit dem Vice Chancellor der Universität Rajasthan, der, wie schon berichtet, ein Nationalökonom ist. Wir tauschen unsere Meinungen aus. Themen: Modernität, Fortschritt, wirtschaftliche Entwicklung, was sonst? Auch er hat Auslandserfahrung. Ein „moderner“ Mensch also.
Nach dem Mittagessen trinken wir Kaffee. Plötzlich will er wissen, wie spät es schon ist. Auch er hat eine Armbanduhr. Ich sage ihm die Zeit nach meiner Uhr, wenige Minuten vor 14 Uhr. Er schaut nun auf seine Uhr. Seine Uhr geht genauso wie meine Uhr, zeigt dieselbe Uhrzeit. Er ist ernsthaft beunruhigt. Denn sein Termin ist um 14 Uhr. Der Vice Chancellor hat ihm versprochen, rechtzeitig einen Dienstwagen zu schicken. Der Wagen ist immer noch nicht da. Ich erkundige mich, ob der Termin in dem Büro des Vice Chancellors oder in seiner Residenz ist. Der Termin ist in der Residenz. Ich bedeute ihm, daß der Fußweg vom Gästehaus bis zu seiner Residenz nur etwa eine Minute lang ist. Mit dem Wagen mindestens 10 Autominuten. Wir würden so lange in der Empfangshalle warten, falls der Wagen doch noch kommt. Wir können auch telefonieren und Bescheid sagen, daß er schon zu Fuß unterwegs ist. Nein, er ist nicht damit einverstanden. Er wartet, macht sich selbst verrückt, macht uns verrückt. Und wir sind auch blöd genug, uns nicht zu verabschieden. Der Wagen kommt etwa um 14.18 Uhr. Er geht hinauf zu seinem Zimmer und holt seine Aktenmappe. Geht dann gemächlich zum Dienstwagen. Er hatte seine ruhige Art wieder.
Eine völlig überflüssige Vereinbarung mit dem Dienstwagen? Heute bin ich nicht mehr so sicher. Der Nationalökonom macht den Vorschlag, um möglicherweise seinem Diskussionspartner symbolisch mitzuteilen, daß er in der Lage ist, seine Gesprächspartner mit seinem Dienstwagen abholen zu lassen. Wie viele sind in der Lage, dieses Privileg zu demonstrieren? Der Dienstwagen macht vier Fahrten von je 10 Autominuten. Der Betriebswirt ist geehrt. Er glaubt aber seine Wichtigkeit eventuell zu verspielen, wenn er den Fußweg von einer Minute nimmt und seine Aktentasche selbst trägt. Lieber regt er sich selbst und uns auf. Moderne Rituale eben.
Wie schon erwähnt, sind die Suiten im Gästehaus großzügig ausgelegt. Die Eingangstür führt zu einem Raum mit Sitzgelegenheiten. Eine Tür von diesem Raum führt zum Schlafzimmer und von dort eine Tür zum Badezimmer. Das Badezimmer hat nur eine Duschmöglichkeit und ein Klo mit Wasserspülung. Die Wasserspülung hat Tücken. Der Tank ist etwa in zwei Meter Höhe angebracht und mit einem Kettenzug versehen. Die Höhe stellt den nötigen Druck bei der Spülung sicher. Technisch eigentlich unproblematisch, solange sich kein Reibungsverschleiß bei der Kette eingestellt hat. Mit dem Verschleiß entsteht das Problem, daß nicht jeder Zug der Kette die Spülung in Gang setzen kann, sondern nur ein Zug in einem bestimmten Winkel. Da helfen weder häufige noch kräftige Züge. Eine verhängnisvolle Tücke. Außerdem gibt es keine indischen Städte mit 24stündiger Wasserversorgung. Deshalb haben alle städtischen Gebäude einen Tank auf dem Dach. Eine elektrische Pumpe sorgt dafür, daß das Wasser den Tank versorgt. Wenn das Wasser in diesen Tanks verbraucht ist, wird auch die Wasserspülung für das Klo nicht versorgt. Das ist die zweite Tücke. Auch die elektrische Versorgung ist nicht ohne Unterbrechung, „load shedding“ heißt der unregelmäßig regelmäßige Stromausfall. Wenn der Strom tagsüber ausfällt, muß man schwitzen, weil die elektrischen Ventilatoren nicht mehr die Verdunstungskühle erzeugen können. In der Dunkelheit beim Stromausfall sind noch Kerzen nötig. Wenn aber der Strom just in den Zeiten ausfällt, in denen auch das Wasser fließt, dann bleibt der Tank halt unversorgt. Wir sind mittlerweile alte Hasen im Gästehaus. Wir kennen diese Tücken und sorgen schon vor.
Erstaunlich viele „abendländische“ Besucher im Gästehaus sind einfach Wissenschaftstouristen. Jaipur gehört zum Touristendreieck zwischen Agra und Neu–Delhi. Delhi hat eine alte Universität, Jaipur und Agra sind spätere Universitätsstädte. Auch die kurzweiligen Besucher aus den USA sind eigentlich insofern keine Touristen, weil ihre Reise– und Aufenthaltskosten von einer Stiftung 100 % abgedeckt werden. Diese Stiftung hat ihren Sitz in Neu–Delhi, heißt „Asia Foundation“, ist aber doch eine reine US–Stiftung. Sie finanziert alle möglichen Veranstaltungen, großzügig, weil sie immense Einnahmen in nicht konvertierbaren Rupien hat. Wieso?
„Modernisierung“ durch wirtschaftliche Entwicklung beschreitet manchmal seltsame Wege. Die US–Wirtschaftsexperten überzeugen oder überreden indische Wirtschaftsplaner, im fruchtbaren Weizenland Zuckerrohr anzubauen, weil die Zuckerausfuhr in die USA für Indien ungeahnte Möglichkeiten öffnen würde, wertvolle Devisen zu verdienen. Indien hat einen chronischen Divisenmangel und kann nicht die notwendigen Maschinen für die Modernisierung importieren. Die USA hat schon mehr als einen Boykott über den Zuckerimport von der Zuckerinsel Kuba verhängt. Die USA brauchen Zucker und haben Weizen in Überfluß. Also könnte Indien den ungedeckten Weizenbedarf durch begünstigte Einfuhr aus den USA abdecken. Begünstigt insofern, daß Indien die Einfuhr mit nichtumtauschbaren indischen Rupien zahlen durfte. Diese Vereinbarung ist als „PL 480“ in die Geschichte eingegangen. Mit der Zuckerausfuhr hat Indien wenig Vergnügen. Denn die eingenommenen Devisen muß es für den Transport des Weizenimports ausgeben, weil nach dieser Vereinbarung dieser Transport nur mit US–Frachtschiffen vonstattengehen durfte. Die Transportkosten mußte Indien in harter Währung zahlen. Zu US–Tarifen, versteht sich. Die USA häuften indische Rupien an. Für die Verwertung dieser Rupien wurde die „Asia Foundation“ gegründet. Diese reiche Stiftung investiert nun in alle möglichen Austausch– und Forschungsprogramme, die halt schlichte Politikfinanzierung, Meinungsmache und Spionageprojekte sind.
Also sind die Wissenschaftstouristen dem Gästehaus der Universität immer im Voraus angekündigt. In der Regel kommen sie in der Dunkelheit an, damit sie von dem Tag was gehabt haben. Die Tische werden schon in aller Ruhe nachmittags gedeckt. Herrlich gekocht. Ein Gedeck mit mindestens 4 Gängen. Es ist auch ein Augenschmaus. Nach der Ankunft wird reichlich geduscht. Das Wasser fließt ja und der Tag war heiß. Dann stürzen sie sich mit einem riesigen Appetit auf das Lukullische. Der Reiz ist ins unermeßliche gesteigert, wenn das Ganze im Kerzenschein vonstatten geht. Beim verführerischen Nachtisch ist ein Nachschlag selbstverständlich. Meine Frau und ich spekulieren darüber, um wie viel Uhr wohl heute „Akbars Rache“ einsetzen wird. Der programmierte Durchfall zwischen 2 und 3 Stunden nach dem Gaumengenuß. In der Regel kurz vor Mitternacht. Meist begleitet von Stromausfall. Und wenn „Akbars Rache“ einsetzt, bleibt kaum Zeit zum Kerzen anzünden. Die Wasserspülung tut es nicht. Die Stille der Nacht ist dahin. Geräusche von Metalketten, Fluchen aus allen Zimmern. Ein Höllenkonzert. Am nächsten Morgen, bleiche Gesichter und eine Handvoll Pillen zum Frühstück.
Alle sind im Voraus gewarnt. Sie sind auch vorsichtig. Aber was können sie machen, wenn das abgekochte Wasser nicht lange genug gekocht hat? Wenn der Pudding mittags schon fertig ist? Die Eiscreme so verführerisch ist! Und der Tisch stundenlang gedeckt bleibt! Vielleicht ist es auch nicht „Akbars Rache“. Vielleicht ist es die ausgleichende Gerechtigkeit! Wer will es so genau wissen?
Mit den Kurzbesuchern ist es schwierig, irgendein Problem zu diskutieren. Sie sind meist wie der Wirbelwind. Viele Ausländer besuchen die Universität zielbewußt. Sie bleiben etwas länger. Es gibt auch Besucher, die in regelmäßigen Abständen das Gästehaus beehren. Nur der Manager weiß das. Und auch solche Unglücksraben wie wir, die einen ungewollten längeren Aufenthalt im Gästehaus durchleben. Ein Politikwissenschaftler taucht etwa nach drei Wochen wieder auf. Er reist intensiv durch Rajasthan. Was er genau macht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, daß er sich seit einigen Monaten in Indien aufhält und viel herumreisen muß. Forschungsreisen, wie er gemeint hat. Er ist also wieder da zu einer Zeit, als meine Frau einen mittelprächtigen Kulturschock verpaßt bekommen hat. Noch bevor Unnithan zum Weltsoziologenkongreß reiste, macht das ganze Soziologie–Department samt Studierenden einen Ausflug. Ausflug heißt auch viel laufen. Meine Frau hat Sandalen an. Die Straßen sind voller Sand, wie es in der Wüste so üblich ist. Es scheuert an der Fußsohle. Sie bekommt eine Blase, und die ist nicht zu klein. Am nächsten Vormittag entschließt sie sich, in der Ambulanz der neuen Universitätsklinik die Blase aufmachen zu lassen. Der diensthabende Arzt sieht die Blase an und beruhigt meine Frau. Eine Kleinigkeit.
Er nimmt ein Skalpell, hält es unter fließendes Leitungswasser und will die Blase aufschneiden. Meine Frau protestiert. Es hilft nicht. Die Blase ist schon auf. Die Schmerzen sind weg. Noch vor der Dunkelheit schmerzt ihr Fuß wieder und sie bekommt Fieber. Steigend. Der Manager informiert uns, daß es in der Stadt einen deutschen Arzt gibt. Ein Dr. R. E. Heilig, ein Frühimmigrant aus der Zeit des Dritten Reiches. Er ist ein Herzspezialist und eine bekannte Persönlichkeit in der Stadt. Er ist gerade von dem „Governor of Rajasthan/Chancellor of the University“ wegen seiner umfassenden Kenntnisse in Medizin zum Professor Emeritus ernannt worden. Der Manager des Gästehauses ruft ihn an. Dr. Heilig will aber vorher wissen, ob wir auch in der Lage sind, sein nicht so knappes Honorar zu zahlen. Wir sind schockiert. Wieder kein Kulturschock. Denn Dr. Heilig gehört trotz seiner jüdischen Konfession der blond-blauäugig-weiß-christlichen Kultur an, wie ich auch. Es ist halt empörter Schock.
Wir bitten den Manager, einen indischen Arzt zu rufen. Er ruft einen Dr. Baldwa an, der auch prompt kommt. Er lehrt auch in der medizinischen Hochschule. Er nimmt sich Zeit. Ich erzähle ihm die ganze Geschichte, während er die üblichen Routinemessungen macht. Das Fieber ist bereits zu hoch. Er zögert, ein fiebersenkendes Mittel zu verabreichen. Zunächst nur kalte Umschläge. Er ist für Warten. Er wartet auch. Der US–Poltikwissenschaftler hat von dem Vorfall gehört. Er klopft an die Tür, kommt herein und ist besorgt. Auch er wartet mit uns. Die Temperatur steigt nicht mehr. Dr. Baldwa verabreicht das erste Medikament nach zwei Stunden. Er verschreibt auch Medikamente. Der Manager schickt einen Bediensteten zur Apotheke. Dr. Baldwa will am nächsten Morgen wiederkommen.
Der Politikwissenschaftler bleibt noch anteilnehmend. Da ich weiterhin kalte Umschläge mache, finde ich es nicht unangenehm, daß jemand fast ununterbrochen über seine Erfahrungen in Indien erzählt. Vieles kann ich nachvollziehen, einige Einschätzungen teile ich auch. Ich bin ein guter Zuhörer. Auch wenn manchmal meine Aufmerksamkeit geteilt ist. Innerlich bin ich wütend über den Arzt von der Ambulanz und auch über Dr. Heilig. Das besorgte Gesicht von Dr. Baldwa hatte mir Angst gemacht. Meine Frau ist immer noch apathisch. Plötzlich schrecke ich auf. Der Politikwissenschaftler bietet mir doch wirklich einen Forschungsjob an. Geld soll kein Problem sein. Es gäbe zu wenig fähige Forscher. Und Rajasthan ist ein so unerforschtes Gebiet. Was denkt die ländliche Bevölkerung? Welche Hoffnungen, welche Befürchtungen haben sie? An welchen Kommunikationsmitteln partizipieren sie? Wer sind die Meinungsmacher? Wie ist ihre Zukunftsplanung? Wie sieht es mit ihrer Vertrauensstruktur aus?
Ich bin erstaunt, was er alles über uns weiß: wer ich bin, daß ich mit der empirischen Sozialforschung vertraut bin, und daß meine Forschungsanträge in Deutschland noch nicht bewilligt sind. Und er ist direkt. Was ist, wenn ich über dieses unverhohlene Angebot zur Spionage reden würde? Rajasthan grenzt an Pakistan. Indien und Pakistan haben schon an dieser Grenze Krieg geführt. Und Geld soll dabei keine Rolle spielen? Ich hatte genug. Ich verabschiede ihn mit der beiläufigen Bemerkung, daß ich über das Gespräch nachdenken werde. In den nächsten Tagen begrüßen wir uns höflich. Ich sage ihm nichts. Auch er fragt nicht. Es gibt auch nichts zu fragen. Er kennt schon die Antwort. Übrigens sollte das Geld von der „Asia Foundation“ kommen. Er ist ein angesehener Anwerbeagent dieser Stiftung. Deshalb reist er so viel. In viele Gebiete kommen auch die „Amerikaner“ nicht rein. Also sind indische Forscher gefragt.
Eigentlich sind wir das Leben im Gästehaus ganz schön leid. Auch uns schont die „Rache Akbars“ nicht. Und alles bleibt in der Schwebe. Ich schreibe fleißig nach Köln, aber die Kollegen sind beschäftigt mit dem Weltkongreß. Die an sich freundliche Aufnahme im Campus erhält den ersten Riß, als wir erfahren, daß die erste freiwerdende Wohnung bereits vergeben ist, und zwar an einen, der sich erst seit drei Tagen in Jaipur aufhält. Ich erinnere schriftlich den Vice Chancellor am 11. September und bitte ihn, sich an seine Wohnungszusage zu halten und die Verwaltung entsprechend anzuweisen. Dr. R. J. Chelliah, Mathurs Nachfolger im Department of Economics, will einem Ruf nach Hydrabad im Süden Indiens, folgen. Er will seinen Anspruch auf das Haus, das er bewohnt, aufrechterhalten und will erklärterweise, daß wir während seiner Abwesenheit das Haus samt Mobiliar bewohnen. Nach einigem Hin und Her erhalten wir dann am 20. September die beruhigende schriftliche Bestätigung, daß wir den Bungalow Nr. C – 2, zur Zeit bewohnt von Dr. Chelliah, bekommen werden, sobald er frei wird.
*****
Wie schon erwähnt, habe ich Veranstaltungen von 15 Stunden in der Woche. Es gibt keinen Seminarraum. Die Studierenden haben Anwesenheitspflicht in jeder angebotenen Veranstaltung. Bindestrich–Soziologien. Jede Veranstaltung beginnt mit der namentlichen Überprüfung der Anwesenheit, die auch in einem Heft registriert wird. Nach der Feststellung der Anwesenheit erwarten die Studierenden, daß Vorlesung gehalten wird. So geschieht es auch meist vorgelesen!
Es ist wie in der Schule, mit dem Unterschied, daß hier nichts abgefragt wird. Eine Einbahn–Kommunikation. Dabei ist der Teilnehmerkreis zahlenmäßig überschaubar. Eine Vorlesung dauert jeweils 45 Minuten. Die letzten 5–10 Minuten sind für Fragen. Die Studierenden kommen nach vorn, stellen individuell die Fragen und erhalten auch individuell ihre Antworten mit entsprechend leiser Stimme. Dann gibt es eine kurze Pause. So läuft es jeden Tag von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. Diskussionen über den Stoff sind nicht vorgesehen. Deshalb bleibt es nicht aus, daß die Bezeichnung Vorlesung auch wörtlich genommen werden kann, begünstigt dadurch, daß das Department mit Büchern dünn bestückt ist. Wie stellen die Lehrenden fest, ob das Vorgetragene auch verstanden wird? Es gibt Klausuren. Natürlich bleibt nicht aus, daß für die Klausuren auswendig gelernt wird.
Der Bestand der Bücher zeigt, daß Soziologie in Jaipur nur amerikanische Soziologie bedeutet, mit einem größeren „time lag“, also mit einer größeren zeitlichen Verzögerung als in Deutschland. Die ausländischen Bücher sind teuer, wesentlich teurer als der Wechselkurs an sich bedingt. Die Mittel sind knapp. Empirische Untersuchungen sind gerade „in“. Abweichendes Verhalten ist 1966 groß in Mode. Die Konzepte, die Begriffe, die Fragen werden aus den amerikanischen Arbeiten übernommen. Natürlich kommen auch Ergebnisse heraus. Ergebnisse kommen immer heraus. Aber wie relevant sind Ergebnisse, die über kopierte Erhebungsinstrumente der US–Untersuchungen erzielt werden?
Dann das Problem der Auswertung. In Jaipur wird Statistik für den Magisterstudiengang aus Textbüchern der 40er Jahre gelehrt. Und, wo sollen die Lehrenden dieser Universität für die Lehre lernen, wenn sie selbst keine Möglichkeit für eigene Forschungen oder reichlichen Zugang zu Forschungsberichten anderer Länder haben? Ich sehe immer wieder das Gefälle. Zweifelsohne wird die neuere Soziologie anglosächsisch dominiert. Die an Empirie orientierte deutsche Soziologie zeigt schon einen „time lag“ von 10 bis15 Jahren auf. Sicherlich bedingt auch durch die Sprachbarriere. Die Sprache ist in Indien kein Problem. Aber die Resourcen fehlen. „Man power“ ebenso wie das konvertierbare Geld.
Ich bin gezwungen, immer genauer in die Verhältnisse dieser Universität und dieser Stadt hinein zu schauen, und mich ständig zu bemühen, das Beobachtete zu begreifen. Natürlich laufen die Prozesse der Wahrnehmung, der Beobachtung und Bewertung durch die Brille meiner Ausbildung. Und diese Brille läßt nur einen Blickwinkel zu: den der modernen Soziologie. Wo ist jener Korridor zur Modernität für das traditionelle Indien? Welche gesellschaftlichen Einrichtungen sind tatsächlich auf der Suche nach dem Korridor? Wer sind die Hauptakteure und Träger, wer könnten Hauptakteure und Träger für den Modernisierungsprozeß denn sein? Welche Einrichtungen stehen der Modernisierung im Weg? Welche kulturellen Werte? Religion? Kastenwesen? Fehlende Mobilität, materiell wie psychisch? Bürokratie? Vetternwirtschaft? Korruption? Die Geographie? Eine Kombination von mehreren Faktoren? Welche Kombination?
Jeder Tag bringt neue Perspektiven, neue Pläne. Forschungspläne am laufenden Band. Ich gehe immer noch davon aus, daß die Mittel für die beantragte Untersuchung bewilligt werden, daß wir viel werden herumreisen müssen und neben dem Material zur Rückanpassung auch Materialien zur Beantwortung vieler, vieler anderer Fragen werden sammeln können. Ohne nennenswerte zusätzliche Kosten. Nur arbeiten und selbst ausbeuten wie bisher! Und wir, meine Frau und ich, sind ein Team, das erheblich mehr leisten kann als die bloße Addition zweier Kräfte. In dieser Phase verdrängen wir die Widrigkeiten des Lebens in dem Gästehaus und sehen nur den Vorzug, in– und ausländische Gelehrte aus der nächsten Nähe zu beobachten und mit ihnen ausführlich vielfältige Probleme diskutieren zu können.
Eigentlich sind es keine Diskussionen. Es sind unsere Fragen und so etwas wie heraussprudelnde Eindrücke der ausländischen Gäste, die keine Wissenschaftstouristen sind. Wir gewinnen auch durch Fachdiskussionen mit den indischen Kollegen, durch die teilnehmenden Beobachtungen über den Unterschied von programmatischen Zielen und der tatsächlichen Praxis immer neue Eindrücke und Einblicke. Auf der Ebene der Beschreibung gibt es in diesem Gedankenaustausch keine Unterschiede. Auf der Ebene der Analyse bzw. der Erklärungsversuche beginnen die Unstimmigkeiten. Die indischen Gelehrten bieten Erklärungsversuche an, die sehr konkret, aber nicht ohne weiteres nach– und überprüfbar sind. Ich kann nicht leugnen, daß auch ich manche konkreten Hinweise der indischen Gelehrten als Ausweichmanöver ansehe, um Dinge nicht beim Namen nennen zu müssen. Uns überrascht es nicht, daß wir auf allen Ebenen, also auf den Ebenen der Beschreibung, Analyse und Veränderungsstrategien, mit den angelsächsischen Gelehrten übereinstimmen.
Beispiel: der Problembereich „Studentenunruhen“. In der Begegnung mit den einzelnen Studierenden ist überhaupt kein Gewaltpotential feststellbar. In der Masse jedoch sind jedem Einzelnen dieser Studierenden alle Arten von Gewalt zuzutrauen. Aus unwesentlichen Anlässen entsteht kollektiver Unmut, der im Laufe weniger Stunden in Demonstrationen, Besetzungen der Universitätseinrichtungen und zum Durchprügeln der Universitätsautoritäten eskalieren kann. Es finden aber keine Diskussionen zwischen den Lehrenden und Studierenden statt. Übrigens auch nicht über Lehrinhalte oder über die Organisation der Lehrveranstaltungen. Die Folge ist zunächst ein Abwarten und Beobachten, wie weit der Unmut eskaliert. Bleibt es auf der Ebene von Demonstrationen und Parolen, gibt es keine Aktivitäten bei den Universitätsautoritäten. Werden Anzeichen von Besetzung und Prügelei registriert, werden die Universitätsoberen aktiv. Zunächst beraten sie miteinander. Soll die Polizei gerufen werden? Die Polizei darf sonst den Campus nicht betreten. Wenn die Polizei gerufen wird, versuchen die Universitätsoberen sich selbst schnellstmöglich zu verbarrikadieren. Die Polizei löst dann die Demonstration auf. In der Regel gewaltsam.
Bis es zum nächsten Mal kommt. Lehrveranstaltungen fallen häufig aus. Die Lehrenden diskutieren nicht einmal untereinander, was die Ursachen der Studentenunruhen sein könnten, sie tauschen nur Informationen aus, was alles geschehen ist und wer was abgekriegt hat. Und dieser Meinungsaustausch findet mit großem Lustgewinn statt. Die Ursache ist eh bekannt. Die politischen Parteien seien schuld. Sie bringen die Unruhe in den Campus hinein. Es sei eh ein nationales Phänomen. Außerdem solle sich die Jugend auch mal abreagieren dürfen.
Den indischen Gelehrten im Gästehaus widerspreche ich. Ich berichte über mein erstes Erlebnis in Jaipur. Ich bin im Verwaltungsgebäude, als die erste Unruhe losgeht. Bevor ich die plötzliche Hektik der Verwaltungsbediensteten deuten kann, sind die wütenden Studierenden schon im Sitzungsraum. Die anderen Räume waren von innen verbarrikadiert. Fast gleichzeitig kommen die Polizisten mit Stöcken. Ich stehe erstarrt und befürchte das Schlimmste. Als die Prügelei dann mit Polizeigewalt beendet wird, kommen die anderen heraus. Auch ich bin erstaunt, daß ich von keiner Seite etwas abgekriegt habe. Beide Seiten haben mich verschont. Wieso? Welch überflüssige Frage! Ich hätte nur Glück gehabt und sollte das Schicksal nicht herausfordern. Das ist auch das Ende der Erörterung.
Beispiel: Problembereich Kommunikation. Es finden keine Gespräche zwischen Lehrenden und Studierenden statt, von einer Diskussion über den Inhalt oder über die Art und Weise der Vorlesung ganz zu schweigen. Es gibt auch keinen Raum für eine Zweiwege–Kommunikation. Feiern oder Ausflüge wären die einzigen Möglichkeiten. Von keiner Seite kommt ein Anlauf. Also bleibt alles, wie es ist. Meist sind sie unter sich. Und unter sich sind sie durchaus kommunikativ.
Beispiel: der Problembereich Niveau der Ausbildung. Der Mangel an materiellen und personellen Ressourcen beeinträchtigt insbesondere die natur– und ingenieurwissenschaftlichen Fächer. Hierüber und über den internationalen Vergleich gibt es Übereinstimmung. Aber über daraus folgende Fragen gibt es weder eine Übereinstimmung, noch eine Diskussion. Wird beispielsweise ein optimaler Gebrauch von den konkret vorhandenen Ressourcen gemacht? Ließe sich beispielsweise das unübersehbare Gefälle zwischen dem Wissen der Lehrenden und der Hochschulabsolventen durch eine andere Organisation überwinden? Hängt dieses Gefälle tatsächlich nur mit den Ressourcen zusammen?
Überraschend sind auch die unterschiedlich in Betracht gezogenen individuellen Handlungsalternativen. Keiner der ausländischen Gelehrten im Gästehaus hat vor, mit seinem indischen „Counterpart“ über konkrete Handlungsalternativen zu diskutieren. Das, was sie in Indien lernten, sei eine persönliche Angelegenheit. Diese Wahrnehmungen und Einschätzungen hätten mit ihrem konkreten Auftrag nichts zu tun. Der indische „Counterpart“ würde auch ein Gespräch über solche konkreten Verhältnisse innerhalb der Universität als persönlichen Affront ansehen. Woher man das so genau wisse? Na, das kann man sich an fünf Fingern abzählen! Damit ist die Diskussion auch am Ende. Es ist deshalb so überraschend, weil diese Besucher als „Modernisierungsexperten“ geschickt worden sind.
Werden sie ihre Wahrnehmungen, die wir im Gästehaus der Universität Rajasthan in der abendlichen Kühle fernab von der Hektik des Berufes mit so viel Engagement bereden, in den offiziellen Bericht aufnehmen? Nachdenkliche Pause. Sind denn solche persönlichen Wahrnehmungen wissenschaftlich gesichert? Die Gegenfrage ist auch eine Antwort. Aber eine Antwort dieser Qualität unterbindet auch jede weitere Diskussion. Einige sind ehrlicher. Als Anekdoten möglicherweise. Im offiziellen Bericht würden sie nur zu Unstimmigkeiten auf beiden Seiten führen. Wem wird damit wirklich geholfen? Ein Naturwissenschaftler erzählt uns wiederholt über die Kluft zwischen naturwissenschaftlicher Kompetenz seiner indischen Kollegen im Department und deren traditionellen Ansichten. Wir sind einig, daß es ohne die Überwindung dieser Kluft eine moderne Entwicklung nicht geben wird. Warum diskutiert er diesen Tatbestand mit den indischen Kollegen? Er will nicht sofort antworten. Er nimmt sich eine Auszeit. Er ist schon seit einigen Wochen in Jaipur. Er wird auch einige andere Departments in anderen Teilen des Landes besuchen. Seine Frau und sein Sohn begleiten ihn.
Am nächsten Tag kommt er selbst auf das Thema zurück. Wir sind nicht über seine Antwort überrascht. Überrascht sind wir über seine Offenheit und Ehrlichkeit. Es sei eine sehr schöne Zeit, die die ganze Familie in Jaipur erlebt. Er möchte seine persönliche Frustration nicht außer Kontrolle geraten lassen, möchte nicht, daß seine Mission hier oder in den anderen Universitätsorten in Indien gefährdet wird. Deshalb wird er mit seinen indischen Kollegen nicht diskutieren. Und später, in seinem offiziellen Bericht? Auch nicht. Er wird diese „Reisequelle“ nicht gern durch seine eigenen Handlungen versiegen lassen. Ohne offizielle Einladungen können Forschungsreisen wie diese nicht stattfinden. Dies hat mit Skrupel, mit Moral oder mit Courage nichts zu tun. Nur mit nüchterner Kalkulation. Auch seine Kinder sehen es gern, wie die Bananen wachsen, oder Mangos oder Pfeffer. Privat könnte er ihnen eine Reise wie diese nicht bieten.
*****
Die Redaktionen beider Magazinsendungen des WDR rufen häufig an. Die Verständigung ist schlecht. Die Idee des Telefoninterviews mußten wir fallen lassen. Wir vereinbaren die einzig mögliche Organisation der Zusammenarbeit. Bei etwas längerfristig voraussehbaren Themen werden sie eine Funkleitung beim ARD–Studio in Neu–Delhi bestellen. Ich müßte dann von Jaipur nach Delhi reisen. Über Nacht per Bahn. Ca. 8 Stunden.
Die Kommunikation mit dem Institut in Köln ist dürftig. Seit Mitte Juni sind wir weg aus Köln. Nach unserer Ankunft in Jaipur habe ich an die Kollegen im Institut und natürlich auch an König geschrieben. Dann kam die Geschichte mit Unnithans Flugticket. In meinem ersten ausführlichen Schreiben an König habe ich erwähnt: „Unnithan ist interessiert, mit uns zusammen eine Untersuchung über die Orientierung der indischen Bürokratie durchzuführen. Das erstaunlichste an der indischen Bürokratie ist, daß jeder einzelne das für seine Stellung richtige Verhalten herausgefunden hat und das Verhalten der anderen sehr genau antizipieren kann. Auf diese Weise kann jeder, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, wunderschön ineffektiv bleiben. Es ist nicht so, daß die Bürokraten hier nicht tüchtig wären. Nur daß sich ihre Tüchtigkeit in Verzögerung und Blockierung ausdrückt, die sich nur durch eine fast institutionalisierte Bestechung beheben läßt. Das hängt einmal damit zusammen, daß die Aspirationen der Beamten schneller gestiegen sind als die Gehälter anderer Gruppen. Ich war wirklich sehr erstaunt herauszufinden, daß hier jeder genau weiß, welche Leistung mit weichem Extra entlohnt werden muß. Über die Höhe wird nicht gehandelt, sie steht fest. Sie können uns sicherlich eine ganze Reihe Anregungen geben, wie wir die Untersuchung am besten anlegen können.“
Was hier unausgesprochen im Mittelpunkt steht, ist die Rolle der Bürokratie in dem Modernisierungsprozeß. Die Soziologen in Indien sind gerade mit Diskussionen über den die Soziologie bestimmenden Begriff der 40er und 50er Jahre „Westernisierung“ beschäftigt. Gesellschaftliche Veränderungen würden nur durch das Spannungsfeld zwischen „Westernisierung“ vs. „Sanskritisierung“ verständlich, praktisch die Vorläufer der Diskussion über das Spannungsfeld zwischen „Modernität“ vs. „Traditionalität“. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Die Richtung der früheren Diskussion war offen. Bei der späteren Diskussion ist Traditionalität als eine eindeutig frühere Phase der Entwicklung definiert, die dann zur Modernität übergeht. Zur gleichen Zeit wird auch die „Phasentheorie“ der weltwirtschaftlichen Entwicklung in den USA von Walter Rostow kreiert. Sicherlich nicht zufällig, wie ich heute weiß.
Aber damals befasse ich mich intensiv mit der Frage, wie der soziologische Begriff der Modernität, wie er von Daniel Lerner und Talcott Parsons diskutiert wird, für indische Verhältnisse operationalisiert, d.h. für eine Erhebung handhabbar gemacht werden kann. Ich beginne unterschiedliche Verhaltensweisen in gleichartigen Situationen zu identifizieren und diese im Spannungsfeld modern vs. traditionell zu bewerten. Dann versuche ich viele Verhaltenssituationen zu identifizieren, in denen unterschiedliche Verhaltensweisen in der definierten Bandbreite möglich sind.
Das erste Schreiben des Kölner Instituts trägt das Datum von 30. August 1966. Nachfolger Stendenbachs Dieter Fröhlich, früher in Afghanistan bei der Außenstelle der Universitäten Bochum und Köln an der Universität Kabul, schreibt:
„Am 28. Juli ging hier ein Schreiben (der Deutschen Forschungsgemeinschaft) ein, in dem uns mitgeteilt wurde, daß die Angelegenheit nun dem Hauptausschuß zur Entscheidung vorliegt, allerdings müsse über diesen Antrag mündlich verhandelt werden, und diese Sitzung findet erst am 7. Oktober statt. Das heißt also, daß noch alles in der Schwebe ist und Sie sich – wohl oder übel – noch gedulden müssen. Das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat noch nichts von sich hören lassen. Wir werden in den nächsten Tagen dort anrufen, um zu erfahren, wie weit Ihr Antrag gediehen ist.“
Nach der Abreise Unnithan‘s kehrt für uns etwas Ruhe ein. Wir lernen den Campus, die Kollegen und die Stadt näher kennen. Unsere Gedanken kreisen um längerfristige Perspektiven. Am 21. September 1966 erst beantworte ich das Schreiben Fröhlichs:
„Was meinen Antrag an die Forschungsgemeinschaft angeht, so finde ich es wirklich enttäuschend, daß sie jedes Mal telefonisch etwas versprechen, was sie nicht halten. ... An das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit habe ich vor einigen Tagen geschrieben. Noch besser wäre es, wenn Sie die Zeit fänden, Herrn Dr. Greif ab und zu anzurufen, damit das Interesse vom Institut aus gezeigt wird.“
Und zu unserem neuen Umfeld schreibe ich:
„Anlaß zur Kritik an den Verhältnissen hier gibt es natürlich in Fülle. Und ich weiß nicht, wenn ich für immer hierher gekommen wäre, ob ich nicht sehr frustriert wäre. Was mich wirklich erstaunt ist, daß die sogenannten gebildeten Menschen in ihrem Verhalten so irrational und traditionell sind. Man könnte fast von einer dualen Persönlichkeitsstruktur sprechen. Es ist nicht so sehr das fehlende Wissen, was im modernen Sektor alles verlangsamt, sondern die Attitüde der Personen, die ihr gesamtes Wissen nur darauf verwenden, sich vor jeglicher Verantwortung zu drücken. Wie sie das schaffen, muß man wirklich bewundern. Es gehört schon Intelligenz dazu, nichts zu tun in einer Weise, die kein Vorgesetzter kritisieren kann. Wenn alles programmgemäß verläuft, werde ich eine Untersuchung über die hohen Funktionäre des modernen Sektors durchführen, mit dem Ziel herauszufinden, inwieweit diese Gruppe das angeeignete Wissen tatsächlich anwendet, inwieweit diese Gruppe eine wissenschaftliche Attitüde entwickelt hat bzw. wie groß die Diskrepanz zwischen Wissen und dessen Anwendung ist. Meine Hypothese ist, daß das schwerste Hindernis, das der Modernisierung entgegensteht, nicht im traditionellen Sektor liegt. Wenn der sogenannte moderne Sektor nicht modernisiert wird, wird die Entwicklung eher verlangsamt als beschleunigt.“
Erst nach dem Soziologenkongreß beginnen auch andere Kollegen zu schreiben, eher privat, weil es offiziell nichts Neues zu berichten gibt. König hat mir noch keine Zeile geschrieben. Vielleicht ist er sauer auf mich, daß ich ihn wegen Unnithan so bedrängt hatte. Unnithan bringt die Kunde mit, daß König im Oktober in Kabul nach den Rechten sehen muß und bei der Gelegenheit einen Abstecher in Jaipur machen wird.
Hansjürgen Daheim, mit der Habilitation vor mir an der Reihe, leitet die soziologische Abteilung des Mittelstandsinstituts. Es ist nicht in einem der Universitätsgebäude untergebracht, sondern in der Stadt in einer Etagenwohnung. Daheim ist der einzige Mitarbeiter von König, der seine Briefe an uns nicht im Institut diktiert, sondern privat schreibt. Einen unmittelbaren Arbeitszusammenhang mit ihm habe ich nicht. Seine Briefe sind anders. Am 18. September hat er geschrieben:
„Liebe Frau Aich, lieber Herr Aich, herzlichen Dank für Ihren ausführlichen Brief, nach dem wir uns fast ein Bild davon machen können, wie Sie in Jaipur leben. Wir hoffen vor allem, daß es Ihnen inzwischen gelungen ist, eine Wohnung zu finden, die nicht derart teuer ist. Sie schreiben, daß der ausgebildete Inder das größte Hindernis für die Modernisierung des Landes darstellt. Das sollte Sie aber doch nicht wundem: Mit dem typischen deutschen Akademiker ist es ja wohl kaum besser bestellt. Schlimm ist nur, daß man sich hier wie dort wenigstens bis zu einem gewissen Grade an diese Leute anpassen muß, weil die Außenseiterrolle auf längere Sicht nur schwer erträglich ist.
Mich würde interessieren, was denn die Studenten mit ihren Statusansprüchen machen, die durchgefallen sind oder zwar ein Examen, aber keine Stelle haben.
Ich schreibe heute erst, weil uns Ihr Brief mitten in den Vorbereitungen für den Weltkongreß erreichte. Genau heute vor zwei Wochen habe ich Frau und Kinder zu den Schwiegereltern gebracht und bin mit Herrn Stöbe nach Evian gefahren. Der Kongreß wird am besten durch einen angeblichen Ausspruch einer hochgestellten Persönlichkeit der ISA charakterisiert. Er wäre eine Katastrophe geworden, wenn das Wetter nicht so gut gewesen wäre. Meine bleibenden Eindrücke werden wohl sein: Die Fahrten zum Montblanc und zu den Diablerets, die morgendlichen und abendlichen Aperitifs, eine zunächst unerfreuliche Diskussion mit Leuten aus der DDR und aus der Kongreßarbeit eine nette Geschichte: Ein Russe benutzte das Badehandtuch mit eingewickelter Badehose seines (englischen) Vorredners, um die Tafel abzuputzen. Beim zweiten Mal resignierte der Engländer und meinte, er hätte zwar seinen Beitrag zum Kongreß schon geleistet, wolle aber noch einen Beitrag zur internationalen Kooperation leisten. Das Niveau der papers in den beiden Arbeitsgruppen, die ich besucht habe, war m. E. sehr niedrig. Bemerkenswert war, daß russisch praktisch dritte Kongreßsprache war und daß im Unterschied zu dem Kongreß in Stresa 1959 die Leute aus der Sowjetunion und der DDR sich um sachliche Beiträge ohne Propaganda bemühten.
Mit der Habilitation geht es nun auch voran: Wie mir König gestern mitteilte ist der Umlauf der Arbeit praktisch beendet und die Probevorlesung auf die erste Fakultätssitzung, Mitte November gelegt, die Bestimmung des Themas soll im Umlaufverfahren erfolgen. So stehen die Chancen, daß wir in den ersten Januartagen nach Berkeley gehen werden, eigentlich gut. ...
Im übrigen fand ich, als ich von Evian wiederkam, einen Brief des Hauptgeschäftsführers des Zentralverbandes des deutschen Handwerks vor. Ein Journalist hatte aus Sacks Arbeit für das Hamburger Abendblatt einen Knüller fabriziert und der zweitoberste aller deutschen Handwerker verlangte etwas beleidigt und erregt Auskunft. Ich hoffe, das sich kein größerer Briefwechsel daraus ergibt.
Für heute alles Gute und herzliche Grüße. Ihre Elisabeth + Hansjürgen Daheim“
Zufällig schreibt auch Fritz Sack zwei Tage später zum Kulturschock:
„Ist Dir eigentlich gar nicht der lustige Widerspruch in der Schilderung über Eure ersten Eindrücke und Erlebnisse aufgefallen? Du schreibst zwar von dem ausgebliebenen berühmten Kulturschock, schreibst dann aber unmittelbar hinterher von der Magen und Darmverstimmung. Angesichts Deiner netten Ausführungen im Kölner Zeitschriftenartikel über Frustration, Aggression, Verschiebung, Sublimierung usw. sollte man eigentlich annehmen, daß Dir selbst die Beziehung zwischen dem Ausbleiben des Kulturschocks und dem Eintreten des Magen– und Darmschocks klar ist. Diese Geschichte hättest Du mal Frau Prof. Meistermann erzählen sollen. Du wärest bei Ihrer Reaktion sicher rot geworden.“
Und über den Weltsoziologentag:
„Wir sind seit wenigen Tagen aus Evian, dem großen Völkertreffen der Soziologen zurück. (Wie Du wahrscheinlich auch dort erfahren hast, ist die Sache mit Prof. Unnithan noch in Ordnung gegangen. Nach so viel Eilsendungen und Telegrammen hin und her konnte am Ende der Lohn auch nicht versagt werden.) Es gab dort ein großes Wiedersehen mit allen möglichen Leuten. Unter anderem waren Gugler, Rüschemeyer, Stendenbach, viele Bekannte für mich aus Amerika dort. Interessant war das mächtige Vordringen der osteuropäischen bzw. sozialistischen Soziologie auf dem Kongreß. Jedes Land von hinter dem Eisernen Vorhang rückte mit einer großen wohlausgerüsteten Kompanie an, und sie machten Trubel, wo sie nur konnten. Wissenschaftlich kann man von so einer Mammutveranstaltung kaum mehr ernsthaft profitieren, weil man die ganze Zeit mit sich ringen muß, wo man hingeht und wo man fort bleibt. Prof. König als Präsident hat sich seiner Sache mit Eleganz und Souveränität entledigt. Aber das war ja auch nicht anders zu erwarten.“
Vor der Abreise Unnithans hatte ich überhaupt keine Gelegenheit mich mit den Kollegen im Department zu unterhalten, außer mit Yogendra Singh, der das Papier für Unnithan geschrieben hatte. Auch ohne ein persönliches Gespräch hatten die übrigen drei meiner Bitte entsprochen, zu Beginn meiner Lehrtätigkeit ihre Veranstaltungen besuchen zu dürfen. Das war großzügig. Nun habe ich Zeit, das nachzuholen, was schon längst fällig gewesen ist. Trotz meiner Entschuldigung sind sie reserviert. Sie sagen mir offen, daß das Department mehrheitlich gegen die Einladung an mich war. Ich werde nun für ein ganzes Jahr eine höhere Stelle für einen von ihnen blockieren, nur weil Unnithan jemanden brauchte, der für ihn zu schreiben bereit ist. Der ehemalige Vice Chancellor Metha, hat wie immer dem Wunsch Unnithans, auch gegen alle Widerstände, entsprochen. Ohne Metha wäre Unnithan nicht der Head of the Department. Bei seiner eigenen Berufung hat Metha die Unnithans mit nach Jaipur gebracht. Beide sind nun in der Universität beschäftigt.
Auch in Indien gelte der in den USA für akademische Karriere kreierte Grundsatz „veröffentliche oder verrecke“. Das Problem für Unnithan sei, daß er nicht schreiben kann. Deshalb organisiere er sich „Schreiber“. Einer seiner Schreiber, lndra Dev, sei gerade in der Jodhpur University der Head of the Department geworden. Der andere, Yogendra Singh, gehe im Dezember für mehrere Monate an die McGill University. Nun werde ich wohl für ihn schreiben. Andere Kollegen würden für Unnithan nicht schreiben.
Ich bin geknickt, die Kollegen merken es, aber ich diskutiere nicht. Bei der nächst bester Gelegenheit frage ich Yogendra Singh, warum er sich dafür hergibt für Unnithan zu schreiben. Nun, Unnithan könne nur organisieren, aber nicht schreiben, sagt Singh. Dagegen fiele es ihm leicht zu schreiben, insbesondere wenn alle Vorbereitungen für das eigentliche Schreiben so vorbildlich organisiert werden, wie Unnithan dies tue. Schließlich werde auch er wie Indra Dev sehr bald von Jaipur weggehen. Das Schreiben für Unnithan sei ein kleineres Übel, als deswegen einen Dauerkonflikt mit Unnithan zu riskieren. So sei es auch mit Indra Dev gewesen.
All dies erzähle ich meiner Frau. Wir beraten und entscheiden uns für eine sanfte Ablehnung, sollten wir oder ich von Unnithan direkt angesprochen werden. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung eines hinreichend breit angelegten Instruments für die Messung vom Grad der Modernität im modernen Sektor und auf die Erprobung des Instruments bei unterschiedlichen Gruppierungen im modernen Sektor. Unnithan hat als gemeinsames Projekt eine Untersuchung über die Orientierung der indischen Bürokratie vorgeschlagen. Auch dafür werden wir ein solches Instrument gebrauchen können. Im Campus und in der Stadt sind genügend Möglichkeiten, um begleitende Voruntersuchungen durchzuführen. Dabei lernen wir die Studierenden und Lehrenden immer näher kennen. Viel näher als es nur über Beobachtungen und über zufällige Begegnungen möglich gewesen wäre. Je näher wir diesen beiden Gruppen kamen, um so mehr verfestigte sich unsere Idee, auf jeden Fall eine Befragung über deren Erwartungen, Wünsche, Einstellungen, Gedanken als mittelbare Träger der Modernisierung durchzuführen, zumal sie sehr wenig Finanzmittel beanspruchen würden. So sind wir dabei, dafür Erhebungsbögen fertigzustellen. Wir hatten dafür auch etwa vier Wochen Zeit, da Unnithan seine Teilnahme an dem Weltkongreß auch für weitere Reisen nutzen wollte.
Noch bevor Unnithan abreiste, organisierte er für Yogendra Singh einen Arbeitsplatz im Gästehaus der Universität. Er sollte in Abwesenheit von Unnithan die Auswertung einer Untersuchung über „Tradition of Nonviolence in East and West” voranbringen. Ein Doktorand assistierte ihm dabei. Zwei Tage vor Unnithans Rückkehr, um den 25. September 1966 herum, bittet mich Singh, den Stand der Auswertung anzusehen. Er käme nicht weiter. Gut, daß wir mit unseren Fragebögen so gut wie fertig waren. Diese eher harmlose Bitte von Yogendra Singh leitet für uns, und sicherlich auch für ihn, eine unvorhergesehene Phase ein.
Der provisorische Arbeitsplatz ist ein geräumiger Raum. Auf der Wandseite eines großen Schreibtisches sind Bücher über „Non-violence“ aufgereiht. Die übrige Fläche ist beansprucht von Ordnern, Fragebögen und Konzeptpapieren. Singh und der Doktorand wissen nicht, was sie mit den vielfältigen Antworten auf offene Fragen anfangen sollen. Der Fragebogen ist wie für demoskopische Erhebungen in den USA gestaltet. Aber Einschätzungen von „Non-violence“, Einstellungen dazu, Erfahrungen darüber und Bewertungen von Erfahrungen sind komplexere Problemstellungen. Offene Fragen sind halt das Naheliegendste. Sie haben keine ordentliche Schlüsselliste, um aus den einzelnen Fragebögen zu einzelnen Fragen die Bandbreite der Antworten in ordentliche und überschaubare Strichlisten zusammenzutragen. Also bin ich für Stunden beschäftigt, ihnen zu erläutern und beispielhaft vorzuführen, wie sie neue zusammenfassende Klassifikationen und Kategorien bilden könnten, skalieren könnten, wie sie über Strichlisten Tabellen erstellen könnten usw. usw.
Unnithan ist zurück. Er vermittelt uns den Eindruck, daß er in Evian mit König und Scheuch über Forschungskooperationen beraten hat. Er will schnellstmöglich über Modalitäten für die Kooperation der beiden Universitäten verhandeln. Wie könnten die aussehen? Welche Themen? Wie soll die Arbeitsteilung sein? Wer sollen die Verfasser sein usw. usw. Er will „eine institutionelle Zusammenarbeit“ auf der Grundlage von schriftlich fixierten Verträgen. Er will eine Diskussionsvorlage erarbeiten.
Schon am nächsten Tag fragt Unnithan meine Frau, ob sie bereit wäre, die Aufbereitung des Materials über das Projekt „Non-violence“ zu leiten, vor allem aber die Verantwortung für die Erstellung von ordentlichen Tabellen zu übernehmen. Er würde relativ schnell die hierfür notwendigen finanziellen Mittel herbeischaffen können. Meine Frau stimmt dem zu, auch angesichts unserer Lebenshaltungskosten im Gästehaus. Auch ich sehe keinen Grund, warum meine Frau diesem Vorschlag nicht zustimmen sollte, unabhängig von dem finanziellen Nutzen. Später wird sich herausstellen, daß dies eine unkluge Entscheidung gewesen ist.
Am nächsten Tag, 29. September 1966, organisiert Unnithan eine Diskussionsrunde über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Instituten. Unnithan bittet noch Singh an dieser Runde teilzunehmen, aber keinen anderen Kollegen im Department. Dieser Tatbestand hätte mich stutzig machen müssen, tut er aber nicht. Eine Vorlage von Unnithan liegt auch nicht vor. Er hätte keine Zeit gehabt, seine Gedanken zu Papier zu bringen. Ich schlage vier Diskussionspunkte vor: Auf welcher Ebene findet die Zusammenarbeit statt, wie soll die Arbeitsteilung zwischen den beiden Instituten aussehen, wie soll die Arbeitsteilung zwischen den beiden Instituten auf die personelle Ebene der Forscher übertragen werden und wie sollen die Modalitäten der Veröffentlichung sein. Singh und Unnithan stimmen ihnen zu. Wer soll protokollieren? Ein Protokoll wird wohl in dieser Phase nicht nötig sein, meint Unnithan. Ich bin immer noch nicht stutzig. Es wird kein Protokoll gemacht.
Eine Umsetzung von einigen allgemein anerkannten akademischen Normen stellt sich in der Diskussionsrunde als komplizierter heraus. Gewiß gibt es kodifizierte, allseitig akzeptierte akademische Normen nicht. Selbst wenn dennoch solche Übereinstimmungen bekundet werden, halten diese in der konkreten Praxis nicht immer. Schon beim ersten eher harmlosen Punkt wird die unterschiedliche Interessenlage deutlich. Unnithan will die Zusammenarbeit nur auf die Ebene der Direktoren der beiden Institute beschränken. Ich halte dagegen, vor allem mit zwei Argumenten. Auf der Ebene von Direktoren ist eine Vermischung von institutionellen und personellen Interessen schwierig auseinanderzuhalten. Und ohne Beteiligung der Gremien der Universität würde die Nutzung der universitären Einrichtungen nicht möglich sein. Unnithan akzeptiert schließlich die Institute als unterste Ebene und die Statuten der beiden Universitäten als verbindlichen Rahmen.
Was die Arbeits– und Kostenteilung angeht, einigen wir uns auf die Formel, daß die Feldarbeit, die Aufbereitung des Materials bis zu der Übertragung aller Daten auf die „Kodeblätter“, in Jaipur durchgeführt werden sollen. Die Aufbereitung für die Rechenanlage und die Tabellen sollen in Köln gemacht werden.
Schwierigkeit entsteht über die personelle Beteiligung einzelner Mitglieder der Institute bei gemeinsamen Forschungsprojekten. Unnithan will in seinem Department die Zusammenarbeit nur auf zwei Personen beschränken, auf Yogendra Singh und auf sich selbst, und im Kölner Institut nur auf König und mich. Nach einer ähnlichen Diskussion wie bei dem ersten Punkt einigen wir uns darauf, daß beide Institute bestrebt sein werden, für eine optimale personelle Zusammensetzung zu sorgen. Naturgemäß werden diejenigen die Hauptakteure sein, die das Projekt initiieren und gestalten. Welche Personen dann sinnvollerweise noch daran mitarbeiten sollen, entscheiden die beiden Partnerinstitute eigenverantwortlich.
Wie soll das Recht der Veröffentlichungen aussehen? Unnithan will sich auf die Formel nicht einlassen: wer das Projekt konzipiert, im Projekt arbeitet und Berichte schreibt, hat auch das Veröffentlichungsrecht als Autor. Unnithan will, daß die beiden Institutsdirektoren auf jeden Fall Autoren sind, weil sie die Veröffentlichung nach außen verantworten werden. Dem stimme ich nicht zu. Zwei andere Bereiche sind auch strittig. Wer soll welchen Teil schreiben bzw. den Erstentwurf machen, wenn ein Projekt gemeinsam konzipiert und entwickelt worden ist, und was passiert, wenn ein Institut seiner vereinbarten Verpflichtung nicht nachkommt oder die Arbeit nicht termingemäß abliefert? Singh hält sich bei diesem Ringen zurück. Unnithan akzeptiert schließlich folgende Regelung unter der Prämisse, daß es eine alleinige Autorenschaft eines der beiden Institute geben darf und daß die Arbeitsteilung der Autoren von beiden Institutsdirektoren gebilligt werden: alle Personen, die einen Beitrag leisten, werden auch entsprechend gebührend erwähnt; es wird unterschieden zwischen Autoren, Herausgeber, redaktionellen Hilfestellungen, Mitarbeit bei der Operationalisierung des Projekts, verantwortlicher Leitung der Feldarbeit und der Aufbereitung des Materials; bei mehr als einem Autor soll die Gestaltung der Arbeitsteilung den Autoren überlassen bleiben; keiner Seite wird erlaubt, die Veröffentlichung der Arbeit ohne beiderseitig akzeptierbare Begründung zu verzögern oder gar zu verhindern.
Unnithan will die Konsenspunkte zusammenstellen und auch für weitere Beratungen ein Exemplar des Papiers König zusenden. Er schließt diese erste Sitzung mit der Feststellung, wir hätten heute etwas sehr Wichtiges vereinbart. Nein, die Sitzung ist nicht ganz beendet. Er erkundigt sich über meine unmittelbaren Forschungspläne. Ich erzähle ihm, daß die Mittel über den Rückanpassungsprozeß noch nicht bewilligt sind, daß wir die Erhebungsinstrumente zum Thema „Aspirationen, Einstellungen und Wertvorstellungen der Studierenden und der Hochschullehrer“ an der Universität Rajasthan so gut wie fertig hätten und mit den organisatorischen Arbeiten beginnen wollen. Er zeigt sich an den Erhebungen in der Universität Rajasthan interessiert und schlägt mir einen Deal vor. Wir sollten die organisatorischen Arbeiten ihm überlassen und als Gegenleistung das Projekt von Singh und ihm über die „Gewaltlosigkeit“ unterstützen. Im Augenblick sei Singh hauptsächlich mit dem Doktoranden K. L. Sharma befaßt. Wenn ich mich daran beteiligen würde, könnte er, Unnithan, seine Beteiligung auf eine Stunde täglich, nachmittags, für gemeinsame Diskussionen beschränken und die so freigeschaufelte Zeit der Organisation unserer Untersuchungen widmen. Arglos stimme ich diesem Vorschlag auch deshalb zu, weil er sich auch um die Kosten für die Feldarbeit kümmern wollte.
Ich hatte bereits einen Überblick über das Projekt „Gewaltlosigkeit“ gewonnen. Meine Frau und ich beginnen schon am nächsten Tag, dem 30. September, intensiv daran zu arbeiten. Am 5. Oktober informiert Unnithan meine Frau, daß für ihre Mitarbeit im Projekt 1000,- Rs. bewilligt worden seien. Sie will eine schriftliche Vereinbarung. Unnithan meint, sie sollte dieses kleine Honorar nicht so offiziell nehmen. Sie möchte nur die Zusammenstellung der Tabellen überwachen und diese optimieren helfen. Meine Frau gibt sich damit zufrieden.
Die Redaktion des WDR–Mittagsmagazin benachrichtigt mich am 12. Oktober, daß für den 14. Oktober eine Studioleitung für ein Live–Gespräch bestellt worden ist. Unmittelbar danach bemühe ich mich, mit Unnithan Kontakt aufzunehmen, weil ich die Formalitäten für einen Kurzurlaub nicht kenne. Seit jenem Gespräch vom 29. September habe ich Unnithan nicht mehr gesehen, weil er sich an den vereinbarten täglichen gemeinsamen Diskussionen von einer Stunde nicht beteiligt hat. Das Treffen mit Unnithan ist unerfreulich, weil er auf meine Frage über den organisatorischen Stand unserer beiden Untersuchungen schlicht mitteilt, daß er noch nichts unternommen hat. Kein Wort einer Erklärung, keine Entschuldigung. Der Kurzurlaub wird problemlos genehmigt. Wir nehmen den Nachtzug am 13. Oktober und fahren für zwei Tage nach Delhi.
Wir kommen frühmorgens an. Ein ehemaliger „Research Scholar“ von Unnithan, Ravi Kapoor, holt uns vom Bahnhof ab und bringt uns zum „Hotel Marina“ in Caunaught Circus, ein sauberes und preiswertes Hotel, daß uns das junge deutsche Ehepaar Jansen empfohlen hat. Das Hotel ist zentral gelegen. Unter über hundert Gästen bin ich der einzige nichteuropäische Gast im Hotel. Das bemerkenswerte im Hotel ist, daß im Speisesaal keine Unterhaltung stattfindet, nicht einmal unter denen, die an einem Tisch sitzen. Meist sind es männliche Gäste. Unser Versuch beim Frühstück eine Konversation zu beginnen, scheitert kläglich. Später erfahren wir von der Hotelleitung, daß die meisten Dauergäste aus der UdSSR sind. Es sind Experten, delegiert für bestimmte Projekte. Jeder einzelne ist auch deshalb wortkarg, weil er nicht weiß, in welcher Funktion seine Landsleute in Indien sind. Es soll unter ihnen auch Spitzel geben. So reduzieren diese Experten ihre sozialen Kontakte auf den Arbeitsplatz. Es soll auch nicht so sein, daß sie Probleme mit der Sprache hätten. Die meisten würden fließend „Hindi“, die offizielle Landessprache Indiens, sprechen.
Wir kennen Delhi nicht. Statt einer „sight seeing“–Tour besichtigen wir einige historische Sehenswürdigkeiten mit Ravi Kapoor. Delhi ist eine Gründung der islamischen Mogul–Herrscher, die sich seit dem 16. Jahrhundert im Norden Indiens fest etabliert hatten. Als die East India Company, die die koloniale Ausbeutung von der Hafenstadt Kalkutta aus verwaltete, den kolonialen Besitz offiziell der englischen Krone übergab, bauten die neuen Herrscher eine neue Verwaltungsstadt im Süden der Mogulstadt Delhi, Neu–Delhi. Die Auslegung der Flächen, die breiten Straßen, die riesigen Gebäudekomplexe für die Verwaltung, die im unabhängigen Indien als Ministerien dienen, die Paläste und Wohnquartiere der hohen Kolonialbeamten, die heute als Residenzen der „neuen indischen Herren“ dienen, sollten die Überlegenheit der neuen kolonialen Herrscher augenfällig demonstrieren. Neu–Delhi hat aber so gut wie keine Sehenswürdigkeiten. So gut wie keine. Aber die Dinge, die sehenswert sind, stammen allesamt aus der Zeit vor der britischen Kolonialherrschaft. Neu Delhi ist eine sterile Stadt mit allen „modernen Anschlüssen“, unwirtlich, aber attraktiv für die neureichen Inder. Nicht so Alt–Delhi. Alt–Delhi ist eine historisch gewachsene Stadt von etwa 600 Jahren, geprägt von der islamischen Kultur und Architektur. Die Bewohner von Neu–Delhi kennen Alt–Delhi kaum, abgesehen von ein paar touristischen Attraktionen und einigen Märkten.
Am späten Vormittag telefonieren wir mit der Deutschen Botschaft. Wir vereinbaren einen Termin für den späten Mittag. Nicht in der Botschaft, sondern in dem nobelsten Hotel in Neu–Delhi, „Hotel Ashoka“. Gastgeber ist der Kulturattaché, Dr. Klaus J. Citron. Die Leiter der Außenstelle des DAAD und des „Max–Müller–Bhawans“, so heißen die Goetheinstitute in Indien, sollen uns auch kennenlernen. Und natürlich Alfred Würfel, ein Faktotum in der Deutschen Botschaft, der schon immer in der Botschaft ist, und fast ein Inder geworden ist. Wir werden als gern willkommene, gute und werte Gäste behandelt und bewirtet. Die Rechnung ist weit höher als mein monatliches Einkommen in Jaipur. Trotz alledem fühlen wir uns wohl. Wir sollen wiederkommen, immer wenn wir in Delhi sind.
Die Sendung war in Ordnung. Für uns war sie eine willkommene Aufbesserung unserer mageren Kasse. Wir lernten Hans–Walter Berg kennen, den ARD–Korrespondenten, der einen Beinamen hatte: Maharaja von Whiskypur ob seines täglichen Whiskykonsums. Die Redaktion will mich bald wieder haben. Im Zug, auch wenn er nach Jaipur rast, sind wir immer noch in Delhi. Als wir am 16. Oktober 1966, frühmorgens, unausgeschlafen und erschöpft aus dem Zug steigen, ist für uns die Welt noch in Ordnung. Und immer noch kein Kulturschock. Ich nehme mir vor, Fritz Sack bezüglich seiner Assoziation mit Frau Meisterman–Seeger anzufragen, ob unsere Magenverstimmungen, zweifelsohne verursacht durch die in Jaipur wohlbekannten „Soldaten Akbar's“, doch auch von der Sublimierung unserer Frustrationen herrühren könnten.
Die „Indische Universität“ nimmt Gestalt an
Jaipur holt uns ein. Yogendra Singh wartet mit seinem Assistenten auf uns. Die Auswertung des Projekts „Gewaltlosigkeit“ geht nicht weiter. Unnithan hat sich nicht blicken lassen. Bis zum 22. Oktober 1966. Er hat nichts für die Organisation unserer Untersuchungen unternommen. Begründung: Die erzielten Übereinstimmungen von 29. September sind für ihn nicht mehr akzeptabel. Am 24. Oktober schlägt er neue Gespräche vor. In der gleichen Besetzung. Er kündigt auch eine Vorlage an. Wir ahnen nichts Gutes. Unser Beitrag zum Projekt „Gewaltlosigkeit“ ist bereits geleistet. Und nun widerruft Unnithan die Vereinbarungen von 29. September.
Unnithan hat uns nicht direkt aufgefordert, für ihn zu schreiben. Er ist listiger. Die taktische Niederlage müssen wir verdauen. Am 23. Oktober nehme ich mir Zeit für Briefe nach Köln. An Daheims schreiben wir einen längeren Brief. Darin auch: „Sie meinen, daß ich mich nach den Erfahrungen in Deutschland nicht darüber wundern sollte, daß die ausgebildeten Inder das größte Hindernis für die Modernisierung des Landes darstellen. Aber ich wundere mich doch. Sie machen sich keine Vorstellung, in welchem Umfang der sogenannte moderne Sektor tatsächlich traditionell ist. Vielleicht ist es nicht ganz richtig, diese Gruppe traditionell zu nennen, denn sie hat durch ihr Wissen viel größeres Geschick entwickelt, mit Wissen traditionell zu sein. Und da sie die ganze Verantwortung für die Modernisierung trägt, ist der Prozeß mehr als langsam. Das Studentenproblem interessiert mich auch. Ich habe bereits einen Fragebogen Aspiration, Einstellung und Wertorientierung entwickelt. Ich hoffe, nach meiner Rückkehr werde ich wenigstens einen Teil Ihrer Fragen beantworten können. Im Augenblick habe ich mit einem ganz anderen Problem zu tun, nämlich damit, wie ich es umgehen kann, ohne größere Komplikationen, daß meine Arbeit nicht unter dem Namen von Prof. Unnithan erscheint. Das ist in Indien die übliche Praxis. Wir haben verschiedentlich darüber diskutiert, wie wissenschaftliche Assistenten von manchen Professoren ausgenutzt werden. Die Situation ist hier um ein Vielfaches schlimmer.
Es ist wirklich sehr lustig, Ihren Bericht über den Kongreß zu lesen. Nun, alle diese Kongresse sind mehr oder weniger dasselbe. Interessant ist nur, daß Prof. Unnithan sehr begeistert berichtete, es war auch sein erster großer Kongreß.“
An Fritz Sack schreibe ich auch mehr privates, aber an König schon mit der Skepsis, daß eine Forschungszusammenarbeit wohl nicht zustande kommen wird. Ich berichte ihm, daß die Operationalsierung von Talcott Parsons‘ „pattern variables“ die kritischen Proben bestanden hat, daß die beiden Erhebungen zum Thema Aspiration, Einstellung und Wertorientierung der postgraduierten Studierenden an der Universität Rajasthan und der College– und Universitätslehrer in Jaipur auch ohne Unterstützung Unnithans durchgeführt werden können, wenn eine der deutschen Vertretungen in Neu–Delhi die Herstellung der Fragebögen übernimmt und wenn das Institut für die übrigen Sachkosten 2000,- DM bereitstellt.
In der Verhandlungsrunde vom 24. Oktober legt Unnithan ein Papier (eine Seite) als Grundlage für die neue Diskussion vor. Enthalten darin sind vier Punkte. Der 1. Punkt beschreibt (die halbe Seite) seine Philosophie über eine Zusammenarbeit (ich will sie nicht kommentieren), der 2. Punkt behandelt die Perspektiven der Finanzierung, der 3. Punkt seine alte Position über die Autorenschaft der beiden Institutsdirektoren und im 4. Punkt legt er die Zusammenarbeit auf die bekannten vier Personen fest.
Ich beharre inhaltlich auf der Übereinkunft vom 29. September, signalisiere aber meine Bereitschaft, meine geplanten Untersuchungen in die „Vereinbarung“ einzubringen. Als ich später das Protokoll von Unnithan lese, frage ich mich, ob ich in derselben Sitzung gewesen bin. Meine geplanten Untersuchungen sind als gemeinsam entwickelte Projekte vereinnahmt, die beiden Direktoren sind von jeglicher Arbeit befreit, Singh auch, weil er bis November 1967 in Kanada verweilen wird. Unnithan setzt noch eins drauf. Er will festschreiben, daß ich das bis zu den Tabellen aufbereitete Material als Kopie Singh und Unnithan zur Verfügung stelle. Damit sind die Gespräche gescheitert. Aber sie haben auch unseren Blick auf die „Indische Universität“ geschärft.
Am 26.10. beziehen wir den Bungalow von Dr. Chellia, C – 2. Wir packen alles aus. Wir kochen nun selbst. Schon sind die „Soldaten Akbars“ machtlos. Unser Arbeitsvermögen steigt, obwohl wir auf Bedienstete für den Haushalt verzichtet haben. Chellia hat uns nur seine Eßtischstühle verkauft. Sonst ist das Haus leer. Wir kaufen mit wenig Geld zwei einfachste Betten, zwei Tische, ein paar Hocker und einige Bretter als Bücherablage, gestellt auf Ziegelsteine. Kochutensilien und Haushaltsgeräte haben wir mitgebracht. Es ist erstaunlich, mit wie wenig man auskommen kann.
Unnithan ist immer für eine Überraschung gut. Mit Begleitschreiben übersendet er am 31. Oktober die Entwürfe des Manuskripts „Gewaltlosigkeit“ und bittet meine Frau um das Redigieren. Auf den Hinweis meiner Frau, daß sie nur für die Gestaltung der Tabellen zuständig gewesen ist, bittet Unnithan sie noch am 5. November, zumindest die Deutung der Tabellen zu überprüfen und mich zu bitten, das Manuskript zu redigieren. Ich soll ihm das Redigieren in Aussicht gestellt haben. Am 7. November teilt ihm meine Frau unzweideutig mit, daß für eine Zusammenarbeit zwischen ihm und uns keine Grundlage mehr besteht. Wir glauben, daß dieses Schreiben ein Schlußstrich unter eine lehrreiche Episode sein würde.
Wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit. Ich verweile im Department nur, um meine Veranstaltungen abzuhalten. Am 19. November schicke ich König einen ausführlichen Bericht über den Stand der Dinge:
„Sehr geehrter Herr Professor, ich hoffe, alle meine Briefe aus Indien haben Sie erreicht. Ich weiß nicht, warum ich bisher von Ihnen nichts gehört habe. Es kann auch sein, daß Ihr Schreiben hier nicht angekommen ist. Es ist wirklich zu empfehlen, Briefe nach Indien per Einschreiben zu schicken.
Mittlerweile müßte eigentlich die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine Entscheidung getroffen haben. Auch das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hatte versprochen, bis Oktober eine Entscheidung zu treffen, damit im Januar mit der Vorbereitung der Arbeit begonnen werden kann. Ich habe weder von der Forschungsgemeinschaft, dem Ministerium noch dem Institut diesbezüglich etwas gehört. Ich beginne, mich hier etwas verlassen zu fühlen, vor allem, weil ich langsam einsehe, daß ich ohne eine Unterstützung von irgendeiner Seite große Schwierigkeiten haben werde, das Geld für unsere Rückfahrt aufzubringen. Das ist in aller Kürze meine Situation. Ich erzähle Ihnen das, weil Sie mir vor meiner Abreise sagten, ich sollte Ihnen über alle Schwierigkeiten berichten, in die ich hier gerate.
Nun zu meiner Arbeit hier. Meine Vorstellungen über die Forschungsprojekte nehmen langsam konkrete Formen an. Wenn man keine 15 Stunden Vorlesung halten müßte, also tatsächlich ein Jahr Zeit hätte, könnte man mindestens 10 interessante und für die Praxis wichtige Forschungsprojekte durchführen. Ich habe mir vorgenommen, drei Forschungsprojekte auf jeden Fall durchzuführen, da ich wenig Hoffnung habe, daß die in Deutschland gestellten Anträge durchkommen. Prof. Unnithan hat endgültig erklärt, daß er keinerlei Unterstützung geben könne, da er mit seinen eigenen Arbeiten voll ausgelastet sei.
Die erste Untersuchung, für die ich den Pretest schon gemacht habe, befaßt sich mit den Aspirationen (akademischen, beruflichen, ehelichen, ökonomischen), Einstellungen (zu Kasten, Klassen, Berufen, Streiks, Auslandsstudium, Rückkehrern) und Wertvorstellungen (einschließlich pattern variables von Talcott Parsons und Empathie von Daniel Lerner) der Studenten aller Fakultäten im letzten Jahr ihrer Ausbildung.
Die zweite Untersuchung, für die ich den Pretest gerade mache, befaßt sich mit den Aspirationen, Einstellungen und Wertvorstellungen der Universitäts– und Collegelehrer aller Fakultäten. Sie werden ebenfalls an zwei Universitäten durchgeführt: University of Rajasthan und Benares Hindu University. In diesen beiden Untersuchungen werden viele Instrumente gleichbleiben, so daß sie auch miteinander vergleichbar werden.
Die dritte Untersuchung soll sich mit dem Problem der Modernisierung befassen. Ich habe den Eindruck, daß die Entwicklung in Indien nicht zuletzt deshalb stagniert, weil die Träger der Modernisierung trotz einer wissenschaftlichen Ausbildung einstellungsmäßig sehr traditionell sind, d.h. ihr Wissen in der täglichen Arbeit nicht anwenden. Dies hat zur Folge, daß in der Erziehung der jüngeren Generation genau die gleiche Einstellung weiter vermittelt wird. Mithin bleibt auch die Orientierung der jüngeren Generation so, daß die Modernisierung nicht weiterkommt. Ich habe bisher nicht feststellen können, abgesehen von der Arbeit von Lerner, daß Untersuchungen über Modernisierung auf der Ebene der Attitüde, bzw. auf der Ebene der Persönlichkeit, vorgenommen wurde. Die bisherigen Arbeiten über Modernisierung orientieren sich an wirtschaftlichen Zielen, und alle Attitüden, die für die Erreichung dieser Ziele günstig sind, werden als modern bezeichnet.
Auf diese Weise hat der Begriff der Modernität einen wirtschaftlichen Bias. Nur auf Grund dieses Bias wird der industrielle Sektor in Indien modern genannt, weil in absoluten Größen der Beitrag dieses Sektors zum wirtschaftlichen Wachstum größer ist als der Beitrag aus den anderen Sektoren. Und der Teil der Bevölkerung, der in diesem Sektor tätig ist, moderner als die anderen Teile der Bevölkerung definiert wird. Zwangsläufig kommt man dann zu Untersuchungen über den Modernisierungsprozeß, wie Lerner es gemacht hat, die Modernität einer Gesellschaft an Empathie, Ausbildung und Partizipation an Massenmedien der Bevölkerung zu messen. Diese Variablen zeigen zweifellos eine hohe Korrelation mit den Trägern des wirtschaftlichen Wachstums. Diese Definition hat aber auch zur Folge, daß alle Menschen in Europa oder in den USA modern sind, was natürlich nicht der Fall ist.
Ich versuche, den Begriff der Modernität von dem Ziel zu trennen, aber mit gesichertem Wissen in Beziehung zu setzen. Nach meiner Definition würde ein Individuum, das z.B. über l00 Einheiten Wissen verfügt und nur 50 Einheiten zur Anwendung bringt (= 50 %) weniger modern sein als ein Individuum, das über 20 Einheiten Wissen verfügt und 15 zur Anwendung bringt (= 75 %). Ich meine, die Ansammlung von Wissen allein reicht nicht. Das angesammelte Wissen kann unter Umständen nicht zur Änderung der Einstellung führen, wenn die Motivation fehlt. Es gibt sicherlich drei klar zu unterscheidende Phasen: die erste ist die Phase der Aneignung von Wissen, die 2. ist die Änderung der Einstellung entsprechend dem gesammelten Wissen und die 3. die tatsächliche Anwendung des Wissens, um das erklärte Ziel zu erreichen. Dieses Ziel kann unterschiedlich sein, aber wenn ein Individuum das Ziel auf eine rationale Weise auf dem kürzesten Weg unter Anwendung seiner wissenschaftlichen Kenntnisse zu erreichen versucht, so muß dieses Handeln als modern bezeichnet werden, moderner als jemand, der mit dem gleichen Wissen ein gleiches Ziel auf Umwegen zu erreichen versucht, da in diesem Fall nicht die effiziente Anwendung des Wissens zum Tragen kommt. Ich bin dabei, dies zu operationalisieren, was mir nicht einfach erscheint, aber auch nicht unerreichbar. Ich würde gern Ihre Meinung zu diesem Problem hören, bevor ich den Fragebogen hierzu endgültig abfasse.
Dann habe ich noch zwei weitere Probleme. 1. Da Unnithan mich nicht unterstützt, bin ich darauf angewiesen, mich als Angehöriger des Forschungsinstituts für Soziologie an der Universität Köln an die ‚Vice Chancellors‘ und ‚Heads of the Department‘ zu wenden, um ihre Erlaubnis für die Durchführung der Befragung zu erhalten. Ich habe früher nicht gewußt, wie hilfreich da Visitenkarten sein können. Um den einzelnen Personen schreiben zu können, brauchte ich etwa 100 Institutsbriefbögen mit Umschlägen. Ein Brief ohne entsprechenden Briefkopf wandert bei diesen Leuten sofort in den Papierkorb. Könnten Sie bitte veranlassen, daß mir die Bögen mit Umschlägen baldmöglichst zugesandt werden?
Mein 2. Problem ist finanzieller Art. Da ich Sampling und Interviews vermeiden möchte, habe ich für die erste Untersuchung die Klassenzimmerbefragung gewählt und für die zweite Untersuchung habe ich die Befragung aller Lehrer an den beiden Universitäten geplant. Die Fragebögen habe ich entsprechend entwickelt und gestaltet. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, daß ich bei den Studenten fast 100 % erreiche, abgesehen von denen, die an diesem Tag nicht anwesend sind, und bei den Lehrern kann ich mir einen relativ großen Ausfall leisten. Die Ausfallenden werde ich aufsuchen und feststellen, ob dem Ausfall irgendein System zugrunde liegt.
Der Nachteil ist der, daß ich eine ziemlich große Zahl von Fragebögen drucken lassen muß. Im ersten Fall um 2000 und im zweiten Fall zwischen 1200 und 1500. Für die dritte Untersuchung werde ich mich wohl oder übel auf Jaipur beschränken müssen. Aber ich werde mich bemühen, nicht die Interviewmethode anzuwenden, und ein Sample nach ‚Who is Who‘ ziehen und verschlüsselt numerierte Fragebögen verschicken. Falls sie nicht termingemäß zurückkommen, werde ich die einzelnen Personen aufsuchen. Es müssen also eine ganze Reihe von Fragebögen gedruckt werden. Und da meine finanzielle Lage schlecht ist, möchte ich Sie bitten zu eruieren, ob irgendeine Möglichkeit besteht, die Sachkosten kurzfristig zu decken. Ich bin sicher, wenn ich mit dem Material zurückkomme und wir zeitig einen Antrag an die Forschungsgemeinschaft stellen, daß wir dann ohne weiteres die Mittel bekommen können.
Es tut mir außerordentlich leid, daß ich Ihnen einen so langen Brief schreiben mußte. Was machen Ihre Pläne, nach Kabul zu kommen? Bitte, lassen Sie es mich zeitig wissen, damit ich Ihre Unterkunft im ‚University Guest House‘ sicherstellen kann.
Mit der Hoffnung, bald von Ihnen zu hören, verbleibe ich mit den besten Empfehlungen, auch von meiner Frau, Ihr ...“
Am gleichen Tag habe ich auch an Fritz Sack geschrieben und mich beklagt, daß ich zu wenig aus Köln höre, und von König noch gar nichts gehört habe. Das Schreiben von Dieter Fröhlich im Institut vom 24. Oktober ist schon unterwegs, bevor unsere beiden Schreiben dort ankommen. Von Fröhlich erfahre ich, daß das BMZ nach wie vor „grundsätzlich sehr positiv“ meinem Forschungsprojekt gegenübersteht aber immer noch nicht entschieden hat. Und:
„Die vielleicht bitterste Mitteilung dieses Briefes: Ende Oktober teilte uns die Deutsche Forschungsgemeinschaft in drei dürren Zeilen mit, daß Ihr Antrag nach eingehender Prüfung durch die zuständigen Ausschüsse abgelehnt worden sei. Es tut mir leid, Ihnen dies mitteilen zu müssen.
Diese Ablehnung hat unser soziales Gewissen in seinen tiefsten Schichten angesprochen, und ich hoffe, finanziell zumindest etwas für Sie tun zu können. ... Ich habe mit König vereinbart, daß wir Ihnen so schnell wie möglich 2000,- DM zur Deckung des dringendsten Sachbedarfs zukommen lassen, und zwar aus unserem Forschungsfonds für das Jahr 1967.“
Die Zusendung der Briefbögen mit Umschlägen kündigt er ebenfalls an. Fröhlich muß mir schon am 2. Dezember wieder schreiben:
„Lieber Herr Aich, eine Hiobsbotschaft jagt die andere: am 29. 11. war ich im BMZ. Dort gab es eine Diskussion mit Herrn Dr. v. Schott, Herrn Dr. Greif, einer Sachbearbeiterin des Ministeriums, einem Vertreter der Carl–Duisberg–Gesellschaft und mir über Ihren Antrag. ... Hauptargumente der Gegner dieses Projekts waren die kleine Zahl der zu befragenden Personen sowie die damit verbundenen hohen Kosten, die sich durch die Tatsache ergaben, daß diese Personen über ganz Indien verstreut leben. Es gelang mir, die Bedenken bezüglich der Zahl der Befragten zu zerstreuen mit dem Hinweis auf den sozialpsychologischen Charakter der Untersuchung. Dann jedoch brachte der Vertreter der Carl–Duisberg–Gesellschaft die entscheidende Information, nach der Ihr Projekt abgelehnt wurde, wenigstens für den jetzigen Zeitpunkt. Er berichtete, daß es sich bei dieser Gruppe von 25 Lehrern an polytechnischen Ausbildungsstätten um die erste Gruppe dieser Art in Deutschland handelte, deren Ausbildung nach seinen Aussagen in Deutschland ziemlich chaotisch verlaufen ist. ... Mein lieber Herr Aich, es tut mir außerordentlich leid, daß Ihre beiden Hauptprojekte an der Finanzierung gescheitert sind, wobei ich mir bewußt bin, daß auch Sie jetzt in finanzielle Schwierigkeiten geraten. ... Das einzige, was ich Ihnen im Augenblick versprechen kann, sind die bereits angekündigten 2000,- DM ... Effektvolle tröstende Worte fallen mir im Augenblick leider nicht ein. Ich kann nur hoffen, daß Sie in Ihrer bekannten Aktivität inzwischen weitere Geldquellen erschlossen haben bzw. erschließen werden.“
Am 13 Dezember schreibt auch Fritz Sack:
„damit Du das alte Jahr nicht mit der Klage abschließen kannst, ich würde mich nie aus Köln melden, möchte ich Dir doch vorher schnell einige Zeiten schreiben. Ich hoffe, daß Du inzwischen in den Besitz von Briefbögen und Umschlägen mit Institutskopf gelangt bist. Wir haben mehrere Sendungen davon auf den Weg gebracht ... Es ist ja bedauerlich und wirft wahrscheinlich Deine Pläne ziemlich um, daß Du eine derartig geringe Kooperationsbereitschaft in Deinem Department antriffst. Aber, wie fast überall, zeigt sich auch hier, daß die Lehrbuchwirklichkeit erheblich von der Feldwirklichkeit abweicht. ... Daheim hat habilitiert und hat damit seinen sozialen Aufstieg weiterhin fortgesetzt.“
Das war alles aus der Kölner Universität im Jahre 1966. Keine Zeile von König, nicht einmal zu meinem neu entwickelten Forschungsvorhaben. Auch uns bleibt keine Zeit über die neue Situation gründlich nachzudenken. Dafür sorgt Unnithan.
*****
Wir sind bei der endgültigen Fassung der beiden Fragebögen und ahnen nichts Böses. Eines Morgens gegen Ende November klingelt es bei uns. Ein lächelndes, freundliches Gesicht, eine Dame mit niederländischem Akzent, Frau Dr. C. Vreede-de-Stuers, Soziologin an der Universität Amsterdam. Sie würde mich aufgrund meiner Arbeit kennen, von „Farbige unter Weißen“ und aufgrund eines Vortrags, den ich in einem internationalen Seminar in Den Haag gehalten habe. Sie ist Mitarbeiterin von W. F. Wertheim, Professor für Soziologie für Südostasien an der Universität Amsterdam, auch ein guter Freund von König. Sie freut sich, uns in Jaipur, so fern von Europa, persönlich kennenzulernen. Sie ist auch eine gute Freundin von Mrs. Unnithan. Also sind wir auch mit Referenzen überschüttet.
Sie ist nicht auf einen privaten Besuch in Jaipur. Sie hätte einige Nachforschungen zu einem Forschungsvorhaben durchzuführen. Sie wird einige Tage in Jaipur bleiben. Wie klein doch die Welt ist. Vielleicht ist es auch der internationale Klüngel der Soziologen. Frau Vreede wohnt im Gästehaus. Unser Haus ist keine Minute vom Gästehaus entfernt. Also besucht sie uns jeden Tag. Sie interessiert sich für unsere Forschungsideen. Sie erzählt gern und erzählt viel. Einmal erzählt sie uns, wie zielbewußt Gerda (Mrs. Unnithan) Karriere gemacht hat. Heute hat sie die Gehaltsstufe eines Professors, obwohl sie nicht über die mittlere Reife hinaus gekommen ist. Als kleine Sekretärin hätte sie bei der indischen Botschaft in Den Haag angefangen. Der Botschafter, Mohan Sinha Metha, der spätere Vice Chancellor, hat sie gemocht. Sie stieg bis zu seinem Vorzimmer auf. Es war Metha, der ihre Heirat mit Unnithan arrangierte, als er zum Vice Chancellor gewählt worden war. Auch in Jaipur hatte Frau Unnithan klein angefangen als Verwaltungsangestellte. Als der erste ausländische Student nach Jaipur kam, wurde sie Beraterin und Betreuerin ausländischer Studierender. Eine bemerkenswerte Karriere, wie der Weg dazu auch gewesen sein mag.
Ein anderes Mal erzählt sie über das „International Institute of Social Studies“ in Den Haag. Das ist eine einmalige akademische Einrichtung in Holland, ein Auffangbecken für nicht so erfolgreiche Studierende aus Afrika und Asien im englischsprachigen Ausland. Diese bekommen eine zweite Chance zu einem akademischen Abschluß. Unterrichtssprache in diesem Institut in der niederländischen Hauptstadt ist ausnahmsweise Englisch. Die Studierenden dieses Instituts haben die Möglichkeit, in der Universität Amsterdam zu promovieren. So auch Unnithan. Wertheim hatte aber die Arbeit von Unnithan noch nicht ausreichend befunden und riet ihm deshalb, sich ein weiteres Jahr Zeit zu nehmen, um die Arbeit zu verbessern. Unnithan gelingt es nicht, Wertheim umzustimmen, nicht einmal mit dem Versprechen, daß er niemals im akademischen, sondern im Politikbereich arbeiten werde. Amsterdam ist „out“. Dann soll die Arbeit durch Methas Vermittlung bei einem unbekannten Soziologen in Utrecht untergebracht worden sein. Dieser unbekannte Soziologe soll bereits zweimal in Jaipur gewesen sein. Seine Bilder hängen nicht nur in dem Haus von Unnithan.
Wir gehen auch gemeinsam spazieren, immer wenn Zeit dazu ist. Wenn man den Campus von der Ostseite verläßt, ist man fast in der Wildnis. Nicht sehr dicht, aber unwegsam. Dornenreiche Wüstensträucher. Es ist hügelig und ohne feste Wege. Also spaziert man sehr gemütlich. Zeit zum unterhalten. Bei einem solchem Spaziergang möchte sie beiläufig von uns wissen, warum wir für das „Gewaltlosigkeit–Projekt“ kein Interesse gezeigt haben. Nichtsahnend erzählen wir über unseren Beitrag zu dem Projekt und alles was wir in diesem Zusammenhang noch erfahren haben. Am nächsten Tag kommt sie wieder auf das Thema zu sprechen, diesmal nicht so beiläufig. Sie hätte sich nach dem gestrigen Gespräch kaum beruhigen können und sie glaubte uns sagen zu müssen, was über uns im Campus von Unnithans verbreitet wird. Wir sind konsterniert und natürlich sauer.
Am 1. Dezember spazieren wir zu Frau Unnithans Büro. Sie ist nicht da. Wir hinterlassen ihr eine Notiz, in dem wir sie zu einer Tasse Kaffee nach dem „Dinner“ einladen. Sie kommt. Wir erkundigen uns, ob es zutreffe, daß sie und ihr Mann wegen unserer mangelnden Kooperationsbereitschaft über uns enttäuscht seien, wie Frau Vreede uns berichtet hat. Sie bestätigt ohne Umschweife, daß es so ist und rät uns eher patronisierend, daß es für uns besser wäre, diese Angelegenheit mit ihrem Mann zu besprechen.
Erst jetzt realisierten wir, daß es Frau Vreede um mehr gegangen ist als nur um Tratsch. Ich schreibe am 3. Dezember einen Brief an Unnithan, nehme Bezug auf das Gespräch mit Frau Unnithan, zähle die belegbaren Fakten von 27. September bis 7. November über unseren Beitrag zu seinem Projekt auf und erwähne die Nichteinhaltung der vereinbarten Gegenleistungen seinerseits. Ich fordere ihn auf, bis zum 14. Dezember die Verleumdungen gegen uns zu widerrufen. Ich stelle eine Kopie des Schreibens Yogindra Singh zu. Zunächst sind die Unnithans sauer auf Frau Vreede. Bevor sie Jaipur nach getaner Arbeit verläßt, schreibt sie am 5. Dezember einen langen Brief an Frau Unnithan und stellt mir offiziell eine Kopie zu. Die persönliche Beziehung der beiden Niederländerinnen hat Risse bekommen. Aus diesem Brief ergibt sich folgende Chronologie:
Am 16. November redet Frau Unnithan relativ lange (at some lenght) über uns mit Frau Vreede und erhebt viele Klagen gegen uns (made many complaints about them). Nach reichlicher Überlegung fragt sie uns schließlich erst am 29. November aus welchen Gründen wir uns geweigert hätten, uns mit dem Projekt „Gewaltlosigkeit“ zu befassen. Sie war gespannt, die Gründe unseres Desinteresses zu erfahren, erfährt stattdessen aber über die Menge von Arbeiten, die wir investiert hatten, wundert sich laut über die Klagen Frau Unnithans, bemerkt unsere Bestürzung (noticed that they became very much upset) und bittet uns, nichts zu unternehmen, bis sie sich vergewissert hat, daß sie sich nicht geirrt hat. Sie spricht ein zweites Mal über das Thema mit Frau Unnithan. Sie hatte sich nicht geirrt.
Trotz vieler Unannehmlichkeiten, auch für sie auf der persönlichen Ebene, hält sie es für richtig, daß wir die Angelegenheit nicht auf uns sitzen lassen (I feel that Dr. and Mrs. Aich, to whom I am sending a copy of this letter in which they are being mentioned more than once, were right in not accepting that things were smothered.) Am 5. Dezember hat Frau Unnithan mir einen unflätigen Brief geschrieben. In einen Brief am 6. Dezember bedankt sich Yogendra Singh für unseren Beitrag zum Projekt über die „Gewaltlosigkeit“ vorbehaltlos, erhebt aber eine Reihe von Vorwürfen bei den Gesprächen über die Zusammenarbeit. Am 7. Dezember kommt Singh uns besuchen, bedauert weinend den Brief, den er unter Druck von Unnithan habe schreiben müssen. Die Einzelheiten will er von Kanada aus schreiben. Am Vorabend habe er seinem Bruder, Rajendra, auch einer der „Research Scholars“ im Departement, gesagt,: „Dr. Aich will never speak to me. I have written him a very bad letter. (Dr. Aich wird nie wieder mit mir sprechen. Ich habe ihn einen sehr bösen Brief geschrieben.)“. Am 7. Dezember kommt auch Rajendra Singh zu uns und meint, sein Bruder sei sehr unglücklich, daß in meinem Brief an Unnithan sein Bruder namentlich erwähnt worden ist. Am nächsten Tag kommt Yogindra Singh uns wieder besuchen, entschuldigt sich abermals und bittet mich, ihm einen ebenso üblen Brief zurückzuschreiben und danach in der Sache nichts weiter zu unternehmen. Ich mache ihm das Angebot, ihm das Originalschreiben zurückzugeben. Er meint, Unnithan würde seine Kopie als Pfand behalten und nie herausrücken. Dafür würde er Unnithan gut genug kennen.
Am 8. Dezember schreibt mir Unnithan einen langen Brief, eine Mischung aus Entschuldigung und Verleumdung. Es sei leider alles unglücklich gelaufen. Daß die Verhandlungen über eine Zusammenarbeit just in dem Augenblick gescheitert waren, nachdem unser Beitrag bis zu Ende geleitet war, hätte nichts mit Ausbeutung zu tun, es geschah eher zufällig (It happend as a matter of coincidence). Er hätte nie schlecht über uns gesprochen. Er gibt sein Ehrenwort, daß weder er noch seine Frau dies tun werden (And I assure you and give you my word of honour that I or my wife shall not do so). Statt auf all das einzugehen, skizziere ich Unnithan folgende Alternative und bitte ihn bis zum 21. Dezember zu entscheiden:
1 Sie sorgen freundlicherweise für den Widerruf der Briefe von Frau Unnithan, von Dr. Singh und ihren vom 8. Dezember und versichern uns, daß kein Gerede mehr sein wird.
2 Ich werde Rechtsbeistand in Anspruch nehmen und alle Schritte zu unserem Schutz unter Verwertung all unseres bisherigen Wissens und unserer Informationen unternehmen, um die Angelegenheit zu einem Ende zu bringen.
Bis zum 21. Dezember liegt keine Reaktion vor. Ich weiß, daß Singh am 25. Dezember nach Kanada abreist. Ich werde unruhig. Bevor ich am 23. Dezember zu meiner Vorlesung gehe, hinterlasse ich ein Schreiben im Sekretariat von Unnithan, in dem erläutert wird, zu welchen Schritten ich nun gezwungen werde, nachdem er sich nun für die zweite Möglichkeit entschieden hatte: das Veröffentlichen aller Fakten. Mitten in der Vorlesung bittet mich der Sekretär Unnithans, zu seinem Büro zu kommen. Ich sage ihm, daß ich erst nach Beendigung der Veranstaltung kommen kann. Der Sekretär kommt zurück und sagt mir, daß Singh und Unnithan solange auf mich im Büro warten werden.
Im Büro werde ich von Unnithan mal mit Vorwürfen und mal mit Entschuldigungen überschüttet. Singh ist bereit, seinen Brief zu widerrufen. Unnithan auch. Frau Unnithan will ihren Brief widerrufen, wenn ich meinen Brief vom 3. Dezember widerrufe. Ich will gehen. Da bietet Unnithan mir an, seinem Sekretär eine Erklärung zu diktieren, die den Knoflikt beenden wird. Singh und er sind bereit, die Erklärung sofort zu unterschreiben. Den Sekretär schicke ich zurück, weil ich Skrupel bekomme, Unnithans Sekretär eine solche Erklärung zu diktieren. Unnithan registriert meine Skrupel. Er bedankt sich, verspricht, daß Singh und er die erste Alternative als ihre Erklärung sofort diktieren werden. Nur mit einer kleinen Ergänzung. Ich sollte damit einverstanden sein, bei eventueller Gerede im Campus ihm zunächst die Gelegenheit geben, die Sache in Ordnung zu bringen, bevor ich etwas unternehme. Ich stimme dem zu. Es ist 14.00 Uhr.
Die unterschriebene Erklärung, die ich bei etwas weniger Skrupel hätte mitnehmen können, kommt nicht. Statt dessen kommt Prof. Ghosh vom „Department of Philosophy“ um ca. 16.00 Uhr. Er ist von Unnithan um Vermittlung gebeten worden. Ich möchte doch meinen Brief vom 3. Dezember ebenfalls widerrufen. Eine Stunde später kommt der deutsche Lektor Jansen mit dem gleichen Vorschlag. Um 20.00 Uhr wieder Ghosh und um 22.00 Uhr das Ehepaar Jansen mit dem gleichen Vorschlag. Also bleibt die versprochene Erklärung aus. Singh reist am 25. Dezember von Jaipur ab. Am gleichen Tag erhebt Unnithan schriftlich den Vorwurf, ich hätte eine einvernehmliche Beilegung platzen lassen. Am 27. Dezember informiere ich den Vice Chancellor und bitte ihn um einen Termin. Bei dem Treffen am 30. Dezember übergebe ich dem Vice Chancellor ein Schriftstück mit einem Überblick der Chronologie. Ein Jahr, 1966, geht zu Ende. Mit zwei bemerkenswerten Schriftstücken: Dem Brief Königs vom 25. Januar und meiner Eingabe an den Vice Chancellor. Etwas weniger Skrupel würde mir viel Ärger erspart, aber auch viele Ein– und Durchblicke versperrt haben.
*****
Vom Kölner Institut sind wir wahrlich nicht verwöhnt worden. Über das Geschehen in Deutschland würden wir überhaupt nichts erfahren haben, wären da nicht mein alter Bridge–Freund Norbert Manne aus Hannover und die pakistanische Filmemacherin und Journalistin Roshan Dhunjiboy, die ich erst in der Runde des „Internationalen Frühschoppen“ kennenlernte, rührig bemüht gewesen, uns regelmäßig mit Magazinen und Zeitschriften zu versorgen. Freunde schreiben uns häufiger als die Kollegen. Und natürlich unser Fräulein Lehner. Sie verwaltet auch unser Konto in Bonn. Unser erster Wohnsitz in Deutschland ist nach wie vor Bonn, Weberstraße 96, obwohl wir in Köln wohnten.
Roshan Dhunjiboy hat einen pakistanischen Paß. Ihre Eltern sind Parsees. Parsees sollen bei der Islamisierung Persiens nach Indien eingewandert sein. Sie wohnen massiert um Bombay herum, halten zusammen, sind meist Händler und Industrielle. Ihr Vater war ein hoher Offizier in der Armee Britisch–Indiens. Nach der Teilung Britisch–Indiens in Indien und Pakistan optiert ihr Vater für Pakistan. So hat sie einen pakistanischen Paß. Sie ist in einem Internat in Darjeeling im Nordosten Bengalens (heute Westbengalen), in den östlichen Ausläufern des Himalajas zur Schule gegangen. Sie studiert Theaterwissenschaften in den USA, heiratet einen holländischen Kameramann, macht Dokumentarfilme vorwiegend für deutsche Sender, trennt sich von ihrem holländischen Mann in aller Freundschaft und lebt nun mit einem in Dresden geborenen deutschen Kameramann, Reginald Beuthner, zusammen. Wir sind befreundet.
Sie leben in Düsseldorf. Wir in Bonn. Werner Höfer mag uns beide gern. Wir sind nicht nur häufig zusammen im Frühschoppen, er bittet uns auch zu dem Termin, als das Titelbild für den Umschlag zu dem Buch „Welt im Doppelspiegel, Tübingen 1966“, von ihm herausgegeben, gemacht wird. Roshan und ich haben Autorenbeiträge in diesem Buch. Das Buch erreicht uns in Jaipur. Bücher dieser Art sind danach nicht mehr gemacht worden. Davor schon. Hermann Ziock, damals Pressechef im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, gibt 1965 ein Buch unter dem Titel „Sind die Deutschen wirklich so?“ im Horst Erdmann Verlag heraus. Alle Autoren sind Ausländer. Ich durfte darin über „Erfahrungen eines Inders in der Bundesrepublik“ unzensiert schreiben. Roshan und Reginald heiraten später. Meine Frau und ich sind beide Trauzeugen. Als sie beide ihren ersten Film als freie Produzenten machen, bringt unser Fräulein Lehner ihr Elternhaus, Bonn, Weberstraße 96, als Sicherheit für eine Bürgschaft ein.
Im Dezember kündigt uns Roshan Besuch aus Köln an: die Fernsehansagerin Gisela Claudius mit ihrem Mann indischer Herkunft. Sie bereisen Indien und wollen auf jeden Fall uns besuchen. Zwischen Weihnachten und Neujahr erleben wir einige ruhige Tage. Dieser Besuch macht uns erst bewußt, wie die Witterungslage sich verändert hat, die wir in der Hektik so nicht wahrgenommen haben.
Es ist Winter in Rajasthan. Als wir ankamen, war es tagsüber unerträglich heiß, aber trocken, abends draußen auf der gewässerten Wiese schön kühl, nachts aber ging es nicht ohne Ventilator. Nun im Winter sind nachts dicke Wolldecken nötig. Die Temperatur sinkt auf unter zehn Grad. Der Wüstensand, der steinerne Boden, auch die Steinwände werden schon vor dem Sonnenuntergang kühl und kühler. Es gibt keine Heizung. Unser Körper hat sich langsam daran gewöhnt. Aber unser Besuch, neu in Jaipur, erfriert beinahe. Sie kriegen ihre Füße nach dem Sonnenuntergang nicht mehr warm. Sie halten ihre Füße in einen Eimer mit warmem Wasser, bis sie ins Bett gehen. Vormittags ist es erst ab etwa 10.00 Uhr angenehm. Bis Mittag über 25 Grad. Die Sonne hat so viel Wärmekraft, daß innerhalb einer Stunde das Wasser im Eimer Badetemperatur erreicht. Ihr Leiden hat uns leid getan. Und wir realisieren, unter welchem Dampf wir in Jaipur leben.
Im neuen Jahr bekommen wir den Brief, den die Daheims noch am 28. Dezember 1966 geschrieben hatten. Darin lesen wir unter anderem:
„Am 14. November war der Probevortrag mit der Habilitation. 25 Minuten Vortrag und 25 Minuten Diskussion. Den Vortrag mußte ich ablesen, weil ich ihn falsch vorbereitet hatte (wie sich nachher zeigte) und ziemlich aufgeregt war. Das war, soweit ich weiß, der einzige Kritikpunkt der Fakultät.
Dann ging es gleich am nächsten Sonntag mit den Antrittsbesuchen los. Am ersten Sonntag war meine Frau noch mit. Wessels trafen wir unglücklicherweise an, so daß wir mit einem Gegenbesuch rechnen mußten (der dann doch ausblieb). Die weiteren Besuche habe ich dann in der Sprechstunde erledigt. Bis Mitte Dezember war ich damit fast jeden Tag beschäftigt. ...
Für den 15. 12. war die Einführungsvorlesung angesetzt. Die Vorbereitung kostete etwas Zeit, weil mir König sagte, daß ich da ‚rhetorisch etwas mehr zeigen müsse‘. Dazu kam die Jagd nach den erforderlichen Utensilien: Talar, Frackhemd usw. Die Vorlesung war dann ein Erfolg. Einziger Kritikpunkt: Frackschleife saß schief. Über Weihnachten habe ich die Vorlesung zu einem Aufsatz für die Zeitschrift umgeschrieben. (... )
In der neuesten Nummer der Kölner Zeitschrift steht u.a. ein Artikel von Prof. Unnithan über the teaching of sociology in India. Er rundet gewissermaßen das Bild ab, das Sie gaben. Sie kennen den Bericht sicher. Hier dürften sich die Verhältnisse an den Hochschulen weiter verschlechtern. Was z.B. aus der Hochschulplanung in Nordrhein–Westfalen wird, weiß keiner. Es wird sogar von einer Berufungssperre geredet.
Das wird Sie noch interessieren: Die Wähler der NPD setzen sich zu einem hohen Prozentsatz aus unzufriedenen Abiturienten und Hochschulabsolventen zusammen. 20 % dieser Leute wählen sie gegen nur 8 % im Bevölkerungsdurchschnitt. Scheuch spricht von Statusinkongruenz als Ursache dieser Unzufriedenheit: hohe Ausbildung bei relativ geringem Einkommen und umgekehrt. Relative Deprivation ist also nicht mehr typisch für die Selbständigen.
Wir melden uns wieder aus Berkeley, sobald wir dort das Hotel mit einer Wohnung vertauscht haben. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit und Erfolg bei der Arbeit.“
*****
Die beiden Forschungsanträge in Deutschland sind endgültig abgelehnt. Unnithan hat seine Gegenleistung verweigert. Wir müssen deshalb von den drei geplanten Untersuchungen die letzte, die über die Modernisierung, fallen lassen. Dieser Wegfall lenkt aber unseren Blick immer stärker weg von der Modernisierung und fixiert ihn hin zur Institution Universität. Wir wollen die Qualität der Universität durch ihre Produkte bestimmen. Wir befragen Studierende im letzten Halbjahr ihrer Ausbildung. Die Qualität der Ausbildung leiten wir aus ihren Äußerungen, Einstellungen und Lebenszielen ab. Die Annahme ist, daß die Aspirationen und Einstellungen maßgeblich durch die Universität geprägt worden sind. Natürlich werden sie auch durch die Familie und Gesellschaft beeinflußt. Diese zentrale Rolle der Universität schließt ein, solche Einflüsse, sollten sie der Gesamtgesellschaft entgegenwirken, durch die Ausbildung zu beseitigen oder zumindest auf ein Minimum zu reduzieren. Die Universität muß die Absolventen – fachlich wie mental – so ausstatten, daß sie die gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart bewältigen, künftige Entwicklungen einleiten und gestalten. Anders ausgedrückt, die Universität muß in der Lage sein, die Absolventen mit jenem Wissen auszustatten, zu jenen Einstellungen bzw. Verhaltensdispositionen zu führen, daß diese Absolventen sich das notwendige Wissen dafür aneignen und die Fähigkeit und die Bereitschaft entwickeln, das angeeignete Wissen in die Praxis umzusetzen.
Wir konzentrieren uns im neuen Jahr also auf die Durchführung der Befragungen der Studierenden und der Hochschullehrer. Die Operationalsierung der einzelnen Variablen, die Voruntersuchungen und die logische– und psychologische Struktur der beiden Fragebögen sind fertig. Wir haben uns für die standardisierte schriftliche Befragung entscheiden müssen: die Studierenden im letzten Semester ihrer Ausbildung im Vorlesungssaal und die Lehrenden durch die Zustellung über das Departement. Dieser erzwungene Weg hat Vor– und Nachteile. Die Feldarbeit verursacht keine weiteren Sachkosten. Ein umständliches „Sampling“ entfällt. Die Gesamtheit wird befragt. Bei den Studierenden fallen jene aus, die zufällig am Tage der Befragung nicht anwesend sind. Der Zeitpunkt der Befragung der Studierenden soll nicht vorher angekündigt werden. So bliebe der Ausfall zufällig.
Das Fehlen von Doppelstunden an der Universität hat den Umfang des Instruments für die studentische Befragung begrenzt. Alle Fragen müßten im Durchschnitt in etwa 50 Minuten beantwortet werden könnten.
Die Lehrenden hätten die Möglichkeit, den gesamten Fragebogen durchzustudieren, auch mit Kollegen über die Fragen zu beraten und erst danach die Fragen zu beantworten. So könnten die Antworten unkontrollierbar beeinflußt werden. Dieser Beeinflussung wirken wir durch Hinweise und Appelle entgegen, wie sie im Interesse der Untersuchung mit dem Fragebogen umgehen sollten. Wir sehen keinen anderen Weg. Im Vorlesungssaal können wir den optimalen Umgang mündlich übermitteln und für die gesamte Dauer im Saal bleiben. Für die Gestaltung der logischen und psychologischen Struktur der Fragebögen sind all diese Umstände berücksichtigt. Wir sind auch mit dem Fragebogen für die Studierenden zufrieden, weil wir ansonsten von jedwedem Zwang frei gewesen sind. Keine Drittmittel (wer bezahlt bestimmt bekanntlich auch die Melodie), keine Rücksichten, keine Abwicklung von vorgefaßten Hypothesen, kein mitgebrachtes Erhebungsinstrument, keine Gefahr einer „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“.
Graphische Gestaltung und Druck sollen für positive Stimmung sorgen. Nach intensiver Suche finden wir eine kleine preiswerte Einmanndruckerei. Der Drucker kann nicht englisch lesen oder schreiben. Er druckt sonst nur Visitenkarten. Das Korrekturlesen ist arbeitsintensiv. Das Druckergebnis ist aber erstaunlich gut. Das Deckblatt gestalten wir ansprechend und informativ. Der kleinere Fragebogen ist als Faksimile am Ende dieses Abschnitts angehängt.
Wir haben zusammenhängende, unmißverständlich formulierte Fragen zu weitreichenden und umfassenden konkreten Bereichen gestellt, die die Bildung von Skalen, also Meßlatten, ermöglichen. Die einzelnen Konzepte der Modernisierung Indiens als der definierte Bedarf der indischen Gesellschaft sind in Fragen aufgelöst.
Wir haben die Fragen mit einer optimalen Bandbreite und ohne eine mittlere Klassifikation der Antwortmöglichkeiten geschlossen. Nicht einfach mit der Möglichkeit Ja, nein, weiß nicht, keine Angabe. Fragen, die neben den konkreten Informationen auch zur Konstruktion von Meßlatten herangezogen werden sollen, vor allem die projektiven Fragen sind so geladen, daß sich die Antworten nicht auf eine Antwortkategorie häufen, sondern sich auf die vorgegebenen Kategorien annähernd gleichmäßig verteilen. Dies ist die Voraussetzung für eine sinnvolle Skalierung.
Ein Beispiel verdeutlicht, was gemeint ist. In der ersten Voruntersuchung lautete Frage Nr. 45k „Eine in früherer Zeit als Patriot anerkannte Person sollte nicht wegen Korruption kritisiert werden.“ Dies ist eine der drei Fragen zur Feststellung der Affektivität in der Verhaltensdisposition1. Die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten sind: starke Zustimmung, Zustimmung, Ablehnung, starke Ablehnung. Die Antworten häuften auf starke Ablehnung. Dann ist „Korruption“ relativiert worden durch das Quantifizieren „geringfügig“. Die Antworten häuften auf Ablehnung. Dann ist der Ort der Kritik durch die Zufügung „öffentlich“ differenziert worden. Die Antworten verteilten annähernd gleichmäßig. So ist die endgültige Formulierung dieser Frage: „Eine in früherer Zeit als Patriot anerkannte Person sollte nicht wegen geringfügiger Korruption öffentlich kritisiert werden.“
In den Voruntersuchungen ist auch überprüft worden, ob nicht die vorgegebenen Klassifikationen und Kategorien im Fragebogen die Antworten beeinflussen. Sie beeinflussen. Die jeweils an erster Stelle stehende Klassifikation wurde häufiger genannt. Die Fragebogen wurden deshalb in zwei Gruppen gesplittet. In einer Gruppe begannen die Antwortmöglichkeiten beispielsweise mit starke Zustimmung und in der anderen mit starke Ablehnung.
Dies hat uns veranlaßt, in der Hauptuntersuchung in allen Fragen die vorgegebenen Antworten in zwei verschiedenen Reihenfolgen zu drucken. Es sind praktisch zwei Fragebögen, an den Farben weiß und hellgrün erkennbar, hergestellt. Sie sind dann alternierend sortiert, damit bei der Herausgabe der Fragebogen „weiß“ und „grün“ zufällig verteilt wird.
Es hat jedoch Ausnahmen von diesem Phänomen gegeben. Ohne sie hätte behauptet werden können, daß durch dieses Splitting die Beeinflussungsmöglichkeit durch die vorgegebenen Kategorien neutralisiert worden sei. Die Frage 34a: „Angenommen, Sie könnten frei wählen. Welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie vorziehen? Ihr Ehepartner sollte zugehören: ‚zur gleichen Kaste‘; ‚zu einer höheren Kaste‘; ‚zu einer niedrigeren Kaste‘; ‚zu einer anderen Religion'; ‚andere Antwort‘...“ (entsprechender Platz für eine andere Antwort).
Im weißen Fragebogen beginnen die Kategorien mit: zur gleichen Kaste“, im grünen Fragebogen mit: zu einer anderen Religion, Die Häufigkeit im weißen Fragebogen in der Kategorie „zur gleichen Kaste“ beträgt 60 %, im grünen Fragebogen ist die Häufigkeit in der Kategorie zur gleichen Kaste 65 %. Hier hat also die Reihenfolge der vorgegebenen Kategorien einen in entgegengesetzter Richtung wirkenden Einfluß ausgeübt. Interessant ist auch das Ausweichen in die Kategorie „andere Antwort“ mit den Inhalt „nicht signifikant“. Im weißen Fragebogen taten das 28 %, im grünen 21 % der Befragten. Der Unterschiede sind statistisch signifikant.
Ein zweites Beispiel, Frage 49b. „Hier ist dieselbe Liste. Wer ist Ihrer persönlichen Meinung nach für die Gewaltanwendung während der Studentenstreiks am meisten verantwortlich? Bitte, stellen Sie eine Rangordnung von 1–7 wie in der vorhergehenden Frage auf.“ Durch die alphabetische Anordnung der Liste und ihrer Umkehrung befand sich die Kategorie Studenten jeweils in der Mitte. Dennoch ergibt sich in der Kategorie Studenten ein signifikanter Unterschied zwischen den weißen und den grünen Fragebogen.
Alles deutet daraufhin, daß eine veränderte Reihenfolge in den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten die Antworten in beide Richtungen beeinflussen kann, und dies selbst in einer scheinbar neutralen Situation und auch bei identisch formulierten Fragen. Um wie viel größer muß die Beeinflussung erst sein, wenn die Fragen relativ unbekümmert formuliert und für die Befragung noch verschiedene Interviewer eingesetzt werden? Wir wissen, daß Befragungen immer Ergebnisse bringen. Nur wie viel sind solche Ergebnisse wert?
Fragen dieser Art haben wir früher nicht gestellt. Es gab keine Veranlassung. In der Not haben wir uns viel mehr Gedanken zum Erhebungsinstrument gemacht. Ja, machen müssen. Welche Lehren daraus zu ziehen sind? Wir haben keine Zeit, uns darüber Gedanken zu machen. Wir sind auf unser gelungenes Instrument stolz. Der Abdruck des studentischen Fragebogens folgt.