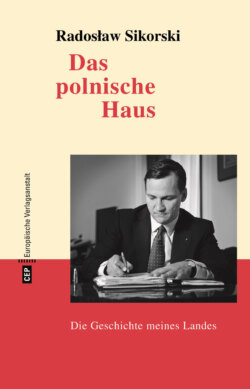Читать книгу Das polnische Haus - Radosław Sikorski - Страница 8
KINDHEIT UNTER DEM KOMMUNISMUS
ОглавлениеWEIL DER KOMMUNISMUS versuchte, die Vergangenheit abzuschaffen, entwickelte ich eine Leidenschaft für alte Gegenstände. Und gerade weil man mir beigebracht hatte, daß die Gutshäuser ein Relikt aus feudalistischen Zeiten darstellten, war ich so erpicht darauf, irgendwann selbst in einem dwór zu wohnen. Wie jede Art von Weltreligion verordnete der Kommunismus nicht nur eine neue Politik, eine neue Moral und eine neue Sprache, sondern auch eine neue Ästhetik, nicht zuletzt in der Architektur. Die Grundschule, die ich besuchte, war ein typischer Betonklotz aus den späten sechziger Jahren, nach einem Modellentwurf erbaut im Rahmen der Regierungskampagne »Eintausend Schulen für das Neue Polnische Jahrtausend«. Wir lebten damals in einem typischen kommunistischen Wohnkomplex, einem Le-Corbusier-Abklatsch in sozialistischer Bauweise. Um ehrlich zu sein, war unser Haus, das ebenfalls aus den Sechzigern stammte, bei weitem nicht so schlecht wie spätere Bauten: Es war ein Backsteingebäude, jede Wohnung verfügte über zwei Balkone, und zwischen den verschiedenen Blocks blieb genügend Raum für einen Kinderspielplatz. Das beruhte keineswegs auf Zufall. Meine Eltern hatten die Wohnung ergattern können, weil sie in einer Baugenossenschaft arbeiteten. Da die beteiligten Architekten auch Wohnungen für sich selbst bauten, umgingen sie die geltenden Regelungen, um den Blocks mehr Platz einzuräumen, und die Bauarbeiter gaben natürlich ihr Bestes. So triumphierte die menschliche Natur über den staatlich verordneten Altruismus.
Dank dieser Umstände stehen die Blocks immer noch, während zahllose andere in der ehemalig kommunistischen Welt von Tag zu Tag weiter zerfallen oder beim geringsten Anzeichen eines Erdbebens oder einer Gasexplosion in sich zusammenbrechen. Ja, man kann die jeweilige Lebendigkeit des kommunistischen Glaubens an den Gebäuden ablesen, die das Regime über die Jahre errichten ließ: Mussoliniähnlicher Heroismus in den glatten Fassaden der fünfziger Jahre, nüchterne Ziegelsteinbauten in den Sechzigern, schäbige Plattenbauten in den Siebzigern und rein gar nichts in den Achtzigern.
Ein Rebell wurde ich jedoch nicht einfach nur aufgrund der Häßlichkeit, die uns umgab, sondern wegen der kruden Methoden der Gehirnwäsche, die an uns ausprobiert wurden. Mein erstes politisches Erlebnis hatte ich im Alter von fünf Jahren; es war meine erste Maidemonstration. Eine riesige Menschenmasse hatte sich in der Hauptstraße unserer Stadt, der Allee des 1. Mai, gesammelt. Um alles besser sehen zu können, kletterte ich auf die Schultern meines Vaters und dann auf einen Baum. Unter mir sah ich ein Meer von lächelnden Zuschauern. Es war ein Festumzug; es machte Spaß. Orchester spielten Marschmusik, Lieder erschallten aus Lautsprechern, Festwagen fuhren vorbei, und überall gab es Blumen. Ich bekam ein paar Lutscher, Zuckerwatte und ein rotes Fähnchen zum Schwenken. Am Vormittag hatte ich im Fernsehen Bilder von der Maiparade in Moskau gesehen, komplett mit Panzern und Raketen, die über den Roten Platz rollten. Per Direktschaltung wurde auch über die jeweiligen Paraden in anderen befreundeten Ländern berichtet, und man erzählte uns, daß die Arbeiter im kapitalistischen Ausland zu eingeschüchtert seien, an Maikundgebungen teilzunehmen. Dazu wurden Bilder von der kapitalistischen Polizei gezeigt, die unter Einsatz von Tränengas Demonstrationen auflöste.
Die Politik fehlte auch in der Grundschule nicht. Die Indoktrination begann spätestens im Alter von sechs Jahren. Ein Schulbuch aus der damaligen Zeit lehrte uns die sozialistische Solidarität mit den Unterdrückten in der Dritten Welt. Im Rückblick mutet der darin abgedruckte Reim ziemlich rassistisch an:
In Afrika lebt ein Negerlein,
Ein Genosse mit schwarzer Haut.
Fleißig lernt er im Sonnenschein,
Die Lektion liest er deutlich und laut.
Doch wenn er aus der Schule kommt,
Denkt er nur ans Spielen und Tollen,
Da schimpft mit ihm die Mutter prompt,
Und Bambo fängt an zu schmollen.
Komm, sagt sie, dein Brei wird kalt,
Doch da ist Bambo schon längst im Wald.
Später spielte ich oft die kommunistische Version von Trivial Pursuit. Das Buch mit den Quizfragen steckte in einer glitzernden bunten Schachtel. Gefragt wurde bei dem Spiel nach den Kenntnissen, die man über die sozialistischen Bruderländer und ihre Produktionszahlen hatte. Eine der Aufgaben bestand darin, zu einem Land, zum Beispiel Rumänien, oder auch zu dessen Flagge das passende Staatsoberhaupt, in diesem Falle Nicolae Ceaușescu, zu finden. Bei anderen Fragen ging es darum, die Erfolge der sowjetischen Raumfahrt aufzuzählen oder das Volumen der polnischen Stahlproduktion zu erraten.
Mein Lieblingscomic war Die Abenteuer des Zickleins Matolek, die Geschichte von einem kleinen Ziegenbock, der auszog, die Stadt Pacanów zu suchen, im festen Glauben, dort Ziegenhufe erstehen zu können. Der klassische Kindercomic aus der Vorkriegszeit bildete später die Vorlage für einen Zeichentrickfilm. Matolek heißt buchstäblich »kleiner Trottel«, und das Zicklein mit dem naiven Gesicht und den kurzen Hosen ist gerade deshalb so liebenswürdig, weil es sich so tolpatschig anstellt. Erst viel später wurde mir bewußt, wie sehr die Geschichte von den Zensoren den neuen Zeiten angepaßt worden war. Nachdem sich Matolek während seiner abenteuerlichen Reise plötzlich auf dem Mond wiederfindet, fliegt er auf dem kometenartigen Schweif eines Sterns wieder zur Erde zurück. In der Vorkriegsfassung des Comics handelt es sich dabei um einen sechszackigen Stern – den herkömmlichen Weihnachtsstern. In der Fassung, die ich zu lesen bekam, hatte der Stern eine Zacke eingebüßt und glich nun dem Symbol der russischen Revolution.
Auf seinem Weg zurück zur Erde schaute der ursprüngliche Matolek hinunter auf das Zentrum von Warschau mit dem alten Königsschloß, dem Denkmal für König Sigismund III. und einer Kirchturmspitze. Meine neue Fassung zeigt von der Warschauer Skyline lediglich den nach Josef Stalin benannten Kulturpalast, einen gräßlichen Wolkenkratzer, den die Sowjets in den fünfziger Jahren gebaut haben. Wo die Polizisten der Vorkriegszeit in lange Regenmäntel gehüllt waren und Matolek mit dem Schlagstock drohten, weil er gegen die Verkehrsregeln verstieß, zeigten ihm jetzt freundliche Vopos den Weg. Auf seiner Fahrt durch die USA findet Matolek einen Goldschatz, den er der polnischen Botschaft mit der Bitte anvertraut, ihn »armen Kindern in Polen« zukommen zu lassen. In der neuen Fassung heißt es nicht mehr »polnische Botschaft«, sondern schlicht »die Botschaft«, während sich das klassizistische Gebäude der Vertretung in eine Kopie des Lenin-Mausoleums verwandelt. Matoleks Schenkung wird nicht mehr armen polnischen Kindern übergeben – der Sozialismus hat ja die Armut beseitigt –, sondern den »lieben« polnischen Kindern.*
Die Fernsehserie, die ich am meisten liebte, hieß Czterej Pancerni i Pies – »Vier Panzerkameraden und ein Hund«. Sie lief Sonntag morgens – damit, so vermuteten wir, die Eltern es nicht leicht hatten, ihre Kinder mit in die Messe zu zerren. Zusätzlich zur Serie gab es eine Quizsendung und eine wöchentliche Preisfrage, die sich um die Schlachten der polnischen Armee an der Front drehte. Unter den Einsendern der richtigen Antwort wurde als Hauptpreis jeweils ein echter Helm der Panzertruppen verlost, komplett mit Futter, Kopfhörer und einem Verbindungskabel, das man lässig herunterbaumeln lassen konnte. Ich weiß noch, wie ich vor Neid erblaßte, als ich eines Tages einen Jungen in meiner Nachbarschaft mit so einem Helm herumstolzieren sah. (Später erfuhr ich, daß sein Vater Oberst war und den Helm wahrscheinlich aus Armeerestbeständen »organisiert« hatte.)
Die Geschichte der Panzergrenadiere begann mit Janek, dem Jüngsten des Quartetts, der im Jahre 1943 in Sibirien lebte. Weil er oft auf Bärenjagd ging, war er ein Superschütze. Eines Tages las er in seiner entlegenen Hütte eine Zeitung: In der Sowjetunion wurde ein polnisches Heer gebildet. Ohne zu zögern, meldet er sich als Freiwilliger, und nach vielen Abenteuern nimmt er zusammen mit seinen sympathischen sowjetischen Kameraden an der Befreiung Polens teil. Erst viele Jahre später, als ich schon in London war und die Bücher polnischer Emigranten las, fragte ich mich, was Janek überhaupt nach Sibirien verschlagen hatte. Die Fernsehserie verschwieg, daß Janeks Familie, zusammen mit etwa einer Million anderer Polen, nach Osten deportiert wurde, als 1939 die Sowjetarmee und die Wehrmacht Polen besetzten und unter sich aufteilten.
In den Polnischstunden lasen wir Kurzgeschichten und schrieben Aufsätze über Lenin: Lenin als Musterschüler, Lenin der Revolutionsführer, Lenin während seiner Verbannung nach Ostsibirien, von wo er Briefe an die Mutter schrieb und ein Tintenfäßchen aus Brot verwendete. Bis in ein gewisses Alter hinein muß die Indoktrination offensichtlich funktioniert haben, denn mit elf Jahren schrieb ich folgende Zeilen zum Thema »Beschreibe Lenin«:
Wladimir Iljitsch wurde 1870 geboren und stammte aus proletarischen Verhältnissen. Nach dem Abitur studierte er an der Kaiserlichen Universität von Kasan. Von 1917 bis 1918 leitete er die Große Oktoberrevolution. Lenin war eine zurückhaltende, bescheidene Person. Oft lief er nachdenklich herum. Er ist Autor vieler Bücher über Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen. Er war ein begnadeter Anführer der Revolution. Schon als Jugendlicher war er ein Patriot. Er haßte den Zaren. Er hatte immer ein Herz für die Schwachen und Leidenden. Er war sehr väterlich. Er war ein edler und guter Mensch, und deshalb wurde er von den Handlangern des Zaren umgebracht.
Lenin spielte auch eine Rolle im obligatorischen Russischunterricht. Das Schulbuch brachte uns dieses Gedicht nahe:
Wenn die Sonne aufgeht
und ins Klassenzimmer schaut,
erstrahlt hell
ein Porträt an der Wand.
Wie zum Gruß
für einen schönen Tag
schaut mich Iljitsch
wie leibhaftig an.
Majakowskijs revolutionäre Gedichte lernte ich auswendig. Ich weiß noch, wie ich einmal vor der ganzen Klasse eins aufsagen mußte: »Das Individuum ist nichts, das Individuum ist nichtig. Die Partei ist alles«, so oder ähnlich lautete der Text. Es hing einiges davon ab, es besonders gut vorzutragen, denn so konnte ich gerade noch meine Note für das bevorstehende Zeugnis verbessern. Aus demselben Grund sang ich brav die Internationale im Gesangsunterricht.
Mit zwölf Jahren war ich immer noch formbar. Ja, mein altes Schulheft aus jener Zeit läßt tief blicken, was meinen damaligen Opportunismus anbelangt. Für den 30. April 1975 mußte zum Beispiel eine Hausaufgabe zum Thema »Der 1. Mai in K.I. Gałczynskis Gedicht ›Ein Marsch durch die Straßen der Welt‹ « geschrieben werden. Wir Schüler sollten anhand von Versen aus dem Gedicht die jeweiligen Maifeierlichkeiten in den sozialistischen bzw. kapitalistischen Ländern miteinander vergleichen. Ich erfüllte die Aufgabe vorbildlich:
IN SOZIALISTISCHEN LÄNDERN
Golden strahlt das Rot im Licht der Sonne;
Fahnen flattern auf den Straßen und auf Brücken;
die Parade schreitet voran und mit ihr – der Frühling.
Die Parade ist glanzvoll und feierlich;
Genossen aus allen Berufen sind gekommen;
alle feiern sie den großen Tag.
IN KAPITALISTISCHEN LÄNDERN
So jedoch schreitet die Welt einem neuen Zeitalter entgegen. Jahr für Jahr wächst die Bewegung. Wie an einem Lagerfeuer wärmen sich die Unterdrückten die Hände an der roten Fahne.
In den kapitalistischen Ländern sind die Feiern verboten. Demonstrationen werden von Polizei und Armee aufgelöst. Am 1. Mai kämpfen wir für Gleichheit und Brüderlichkeit.
In den Schulpausen beteiligten wir uns an »Friedenskampagnen«. Man konnte spezielle Auszeichnungen und bessere Noten bekommen, wenn man mithalf, Plakate für das Schwarze Brett der Schule zu machen. Darauf waren dann Vietnamesen mit großen Strohhüten zu sehen, auf die amerikanische Bomben herabregneten, oder vielleicht auch nur amerikanische Bomben: dicke, bedrohliche schwarze Dinger, die mit einem großen roten X durchgestrichen und einem »Nein!« überschrieben waren. Andere Plakate zeigten Kinder aus friedlichen sozialistischen Ländern Hand in Hand oder beim Gruppentanz, über ihren Köpfen eine weiße Taube.
Die jährlichen Schulwahlen waren ein weiteres wichtiges Ereignis. Die Mitglieder des Klassenrats, unser »Schülerselbstverwaltungskomitee«, wurden durch angeblich freie Wahlen bestimmt. Die Schulwahlen, so erzählte man uns, wären nur ein kleines Beispiel für die Funktionsweise der sozialistischen Demokratie – was auch tatsächlich zutraf. Es gab keine Wahlwerbung, keine Wahlreden, keine Versprechungen (nicht einmal leere), sich zum Beispiel um das miese Essen in der Schule zu kümmern, und auch kein Gremium, das für die Aufstellung der Kandidaten zuständig gewesen wäre. Irgendwie prangte an der Spitze der Wahlliste immer der Name Jacek W., der wohl unbeliebteste Junge der ganzen Schule. Jacek W. war ein typischer Streber, der für gewöhnlich mit einer roten Krawatte angab und bei Versammlungen das Wort ergriff, um linientreue Sprüche nachzuplappern. Wir mochten ihn alle nicht; niemand hat jemals zu erkennen gegeben, daß er für ihn gestimmt hätte, und doch gewann dieser Jacek immer wieder. Es war wie ein Ritual, das wir über uns ergehen ließen, so wie auch die Parlamentswahlen für unsere Eltern eine rituelle Veranstaltung mit vorab bekanntem Ausgang waren.
Trotz der unübersehbaren Heuchelei wurden alle patriotischen Veranstaltungen – Wahlen, Versammlungen, Paraden – mit dem Ernst einer religiösen Zeremonie begangen; und nach jedem solchen Ereignis mußte irgendein armer Teufel nachsitzen und das Ganze in unserer Schulchronik festhalten. Die Chronik meiner Grundschule (ich konnte mir die dicken Kunstlederbände vor kurzem einmal anschauen) fängt mit Zeitungsausschnitten an, die über die Schuleröffnung im September 1967 berichten. Das Band wurde feierlich zerschnitten vom Genossen W. Soporowski, dem ersten Sekretär des Stadtkomitees von Bydgoszcz, und dem Genossen T. Filipowicz, dem Direktor der Propagandaabteilung des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei. Kaum einen Monat später, als die Straßenarbeiten vor dem Gebäude noch nicht einmal abgeschlossen waren, feierte die Schule schon den fünfzigsten Jahrestag der Oktoberrevolution. Unter einem roten Stern, einem Porträt von Lenin und einer Zeichnung von zwei Gewehren hatte jemand einen Text eingetragen, der so unbeholfen ist, daß man dem Verfasser wohl Absicht unterstellen muß.
Vor fünfzig Jahren triumphierte die Große Oktoberrevolution. Ihr Sieg brachte vielen Ländern die Freiheit. Leider wollte die reaktionäre Regierung Polens nicht zulassen, daß auch unser Vaterland befreit würde. Erst nach den schlimmen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs wurde unser Vaterland von der Sowjetunion aus der Niederlage und Armut gerettet. Seit dreiundzwanzig Jahren sind wir frei; wir atmen die Luft der Freiheit, und dies verdanken wir unseren Freunden aus dem Osten.
Wie die Kirche hatte auch die Kommunistische Partei ihren offiziellen Kalender mit Höhepunkten wie dem Jahrestag der Revolution, dem Tag der Polnischen Volksarmee, dem 1. Mai, dem Tag des Sieges, dem Internationalen Frauentag, dem Tag der Miliz und der Staatssicherheit usw. Zudem wurden in der Schule – angeblich auf freiwilliger Basis – besondere Festveranstaltungen organisiert. So feierten wir zum Beispiel das vierzigjährige Jubiläum der Gesellschaft für Polnisch-Sowjetische Freundschaft (die Chronik verzeichnet unter den Anwesenden keinen Geringeren als den Direktor vom Sowjetischen Haus der Kultur in Gdańsk), das Lenin-Jahr, fünfzig Jahre Sowjetunion, vierzig Jahre Internationale Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg und, aus welchem Grund auch immer, den zweiundzwanzigsten Jahrestag der Gründung der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei. Jedes dieser Ereignisse gipfelte in einer großen Versammlung. Wir organisierten auch ein Festival für russische Lieder, und unsere Pioniere erhielten ein Fähnchen vom Veteranenverband. Wir sandten Grüße an den Genossen Wojciech Jaruzelski, der damals erst ein bescheidener Verteidigungsminister war, um ihm zu seiner Beförderung zum Drei-Sterne-General zu gratulieren. »Der 25. Kongreß der KPdSU hat auf unsere Schule einen großen Eindruck gemacht«, vermeldet die Chronik. »Jede Klasse hat Schaukästen geschmückt, und die Selbstverwaltung der Schule hat der sowjetischen Botschaft ein Telegramm geschickt. Junge Pioniere haben vor dem Denkmal für die heroische Sowjetarmee Blumen niedergelegt und eine Ehrenwache gehalten.« Für eine andere Versammlung fertigten wir ein großes Transparent an, das an die Wand der Sporthalle gehängt wurde: »Das Parteiprogramm ist unser Programm.«
Einmal schickten wir den Kindern in Vietnam 1379 Schulhefte. Der Begleitbrief lautete:
Liebe vietnamesische Brüder,
wir, die Kinder von Grundschule Nr. 20 in Bydgoszcz ... wünschen Euch den Sieg über die amerikanischen Aggressoren, die Euer Land und Euer Volk zerstören. Euer Kampf ist unser Kampf, und deshalb wird er zum Sieg führen ... Wir möchten, daß die Sonne der Freiheit über Eurem Land aufgeht und Eure Gesichter strahlen vor Glück. Wir wünschen allen Kindern der Erde ein so friedliches und glückliches Leben, wie wir es in Polen haben.
Aus einem anderen Anlaß verabschiedeten wir eine spontane Resolution.
Wir, die Kinder von Grundschule Nr. 20 in Bydgoszcz, erheben gemeinsam unsere Stimmen gegen die Neutronenbombe. Wir wollen lernen und arbeiten und unserem Land dienen. Wir wissen, daß wir ohne Frieden nichts erreichen können. Aus diesem Grund widersetzen wir uns jenen Kräften, die die Sicherheit und Zusammenarbeit zwischen den Nationen der Welt sabotieren wollen ...
Im Alter von zehn Jahren, als ich – laut Schulchronik – diese Resolution mit Beifall beklatscht haben soll, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was eine Neutronenbombe ist.
Die weitaus größte Veranstaltung – und die weitaus größte Lüge – meiner Schulzeit fand jedoch 1974 statt, als wir das dreißigjährige Jubiläum der Miliz und der Staatssicherheit begingen. Da der Gatte unserer Direktorin ein hohes Tier bei der Staatssicherheit war, wurde der Tag der Miliz jedes Jahr ausgiebig gefeiert, wobei die jährlichen Berichte in der Schulchronik mit unfreiwillig komischen Zeichnungen von zähnefletschenden und bluttriefenden Schäferhunden gespickt waren. Diesmal sollte der Schule eine große Ehre erwiesen werden: Sie wurde nach dem heldenhaften Genossen Zdzisław Wizor benannt, einem engagierten jungen Leutnant der Staatssicherheit aus unserer Region, der 1946 im Kampf gegen eine konterrevolutionäre Bande – d.h. eine antikommunistische Widerstandsgruppe – ums Leben gekommen war. In der Schule lasen wir Zeitungsartikel über ihn, zum Beispiel diesen aus dem lokalen Parteiorgan, der Gazeta Pomorska:
Das Gedenken am dreißigsten Jahrestag der Gründung der Volksmiliz und des Staatssicherheitsdienstes gilt Menschen, die sich mit hohem Einsatz dem Aufbau unseres Vaterlandes gewidmet haben. In den ersten Jahren nach dem Krieg, in einer Zeit, da die Fundamente der polnischen Volksdemokratie gelegt wurden, griffen Offiziere der Volksmiliz und des Staatssicherheitsdienstes zu den Waffen, um ihre sozialistischen Ideale zu verteidigen. Viele von ihnen opferten ihr Leben im Kampf gegen reaktionäre Banden. Heute ist das Andenken an sie erfüllt von der Achtung des ganzen Volkes.
In der Polnischstunde schrieben wir Geschichten über den Helden und beschrieben die Vorbereitungen für den denkwürdigen Tag: »Die Poesiegruppe und der Chor arbeiten an einer künstlerischen Veranstaltung mit Worten und Musik«, heißt es in einem meiner Schulhefte. »Alle Schüler studieren ihre Rollen ein. Das Schulgebäude wird herausgeputzt. Die Außenmauern und die Wände wurden neu gestrichen, die Klassenzimmer werden geschmückt. Eine Auswahl aus Schülerzeichnungen über die Volksmiliz ist im Saal im ersten Stock zu besichtigen. Eine Gedenktafel zu Ehren unseres Helden wurde in der Halle aufgehängt.« Die Schülerzeichnungen entstanden im Rahmen eines Wettbewerbs zum Thema »Dreißig Jahre Volksmiliz aus der Sicht eines Kindes«. Die zehn besten Zeichnungen sollten im Warschauer Innenministerium ausgestellt werden.
Am Gedenktag war die Versammlung auf dem Schulhof größer als üblich. An der Fassade des Schulgebäudes prangte die Parole: »Er lebt weiter in unseren Herzen.« Alle trugen Uniform und Halstuch – jede Klasse hatte ihre eigenen Farben. Unter den Gästen waren einige hochgestellte Persönlichkeiten: der Ortskommandant der Polizei, die Witwe unseres Helden und seine Tochter, ein Sekretär des örtlichen Parteikomitees, der Bezirksleiter des Bildungsressorts, der Vorsitzende des Veteranenverbandes der Kommunisten und die komplette Lokalprominenz. Die Milizkapelle spielte die Internationale, und wir leisteten den feierlichen Eid, in Leutnant Wizors heroische Fußstapfen zu treten.
Während die Lehrer sich auf das andächtige Geschehen konzentrierten, waren wir heimlich damit beschäftigt, Münzen in einen Spalt zu werfen, der sich im Pflaster aufgetan hatte. Man mußte versuchen, seine Münze zunächst mit einem Wurf so nah wie möglich an den Spalt heran zu bekommen und dann mit dem Daumen immer näher und schließlich hinein zu schnippen. Wer dazu die wenigsten »Würfe« benötigte, hatte gewonnen und durfte die Münzen der anderen einsacken.
Noch befinden sich die Fotos von der damaligen Zeremonie in der Schulchronik, und die Gedenktafel hängt nach wie vor an derselben Stelle. Doch bald wird die Schule ein weiteres Mal umgetauft, und die Tafel soll entfernt werden. Es hat sich mittlerweile herausgestellt, daß Leutnant Wizors heroischer Lebenslauf zu großen Teilen gefälscht war. Wahrscheinlich hatte er nicht einmal einen Schulabschluß, und – wichtiger noch – langsam kommen Zweifel an seiner revolutionären Gesinnung auf. Es hat sich herumgesprochen, daß sein Eifer vielleicht weniger mit seinen kommunistischen Überzeugungen zu tun hatte, sondern vielmehr dazu dienen sollte, von seiner Kollaboration mit den Nazis zu Kriegszeiten abzulenken. Davon hat uns 1974 natürlich niemand etwas erzählt.
Was die Indoktrinationsversuche anbelangt, war die »Freiwilligenarbeit« wohl die entlarvendste Aktivität, die uns die Schule zumutete. Freiwillig war die Teilnahme daran natürlich keineswegs. Normalerweise wurden wir für die Kartoffelernte zu landwirtschaftlichen Genossenschaften abgeordnet. Die Ausflüge wurden von der Schule organisiert und sollten uns, der zukünftigen Intelligenzija, Respekt vor der Mühsal unserer Genossen Arbeiter und Bauern einflößen. Tatsächlich hat man uns die sozialistische Arbeitsmoral beibringen können. Wir mußten hinter einer Maschine herlaufen, die die Kartoffeln aus dem Boden hob; unsere Aufgabe bestand darin, sie in Körben aufzusammeln, die auf die Ladefläche eines Lastwagens auszuschütten waren. Nach ein paar Stunden, als wir schon Kreuzschmerzen vom Bükken und Heben bekamen, drückten wir jedoch jede zweite Kartoffel mit einem ordentlichen Tritt zurück in den Boden. Am Ende unserer Schicht war zwar das Feld leer, aber der Laster erst halb voll. Die Bauern wußten natürlich, was los war, und ließen dasselbe Feld durch verschiedene Schulklassen wieder und wieder abernten. Ich zweifle sehr daran, ob unser Beitrag das Benzin wert war, das für unsere Busfahrt aufs Land aufgewendet wurde.
In den Fabriken stahlen wir alles, was nicht niet- und nagelfest war. Einmal wurden wir in einen Tochterbetrieb von Romet, Polens größtem Fahrradhersteller, entsandt. Nachdem wir uns einen Tag lang um die Arbeit herumgedrückt hatten, verließ jeder die Fabrik mit einem Haufen Ersatzteile für sein Fahrrad, die man in den Läden oft nicht bekommen konnte.
Als wir schon etwas älter waren, wurde die Gehirnwäsche unter dem Titel »Staatsbürgerliche Erziehung« in einem speziellen Kurs durchgeführt. Dort wurden wir über die sozialistische Verfassung, das Einmaleins des Klassenkampfs und das Übel des Kapitalismus informiert. Ein Jahr lang hatten wir in diesem Kurs eine Lehrerin, die ungewöhnlich groß war und ständig rosa, orange und violette Klamotten trug. Sie glaubte wirklich an die Dinge, die sie uns lehrte. Wir nannten sie Skarpeta, auf deutsch »Socke«, weil sie einmal eine Socke aus ihrer Tasche nahm, um sich damit die Nase zu putzen. In ihrem Unterricht setzten wir uns nie in die vorderen Bänke, denn ihr fehlte ein Zahn, und wenn sie sich aufregte, was häufig vorkam, spuckte sie die armen Schüler in der ersten Reihe an. Wenn man sich mit ihr anlegte, egal, um welches politische Thema es ging, wurde sie wütend. »Wie kannst du das sagen? Meine Eltern waren Bauern, ich bin Lehrerin. Sieh doch, was wir alle dem Sozialismus verdanken!«
Mein Gymnasium befand sich im Zentrum von Bydgoszcz und war ebenfalls nach einem Kommunisten benannt worden, einem Aktivisten aus dem 19. Jahrhundert namens Ludwik Waryński. Dort schrieb ich auch die Prüfung in Geschichte, die meine Mutter im Schrank versteckt und für die Nachwelt aufgehoben hat:
1 Erörtere das Problem des privaten Landeigentums von 1947 bis 1956; nach 1956; heute.
2 Erörtere die sozialpolitischen Neuerungen für die Landbevölkerung in den Jahren 1971 bis 1980.
3 Durch welche Regierungsmaßnahmen können die Situation der Landwirtschaft und die nationale Nahrungsversorgung verbessert werden?
4 Erörtere die Organisationsformen der landwirtschaftlichen Selbstverwaltung.
Meine Antwort auf die erste Frage begann folgendermaßen: »Nachdem die Exilregierung in London am 1. August 1944 eine Bodenreform beschlossen hatte, sah sich die kommunistische Regierung aus politischen Gründen gezwungen, ihrerseits eine Bodenreform anzukündigen ...«
Der Hinweis auf die Londoner Regierung, die absolut tabu war, ist mit dickem Rotstift angestrichen; darunter steht der Kommentar: »Dies ist eine absolut lächerliche Bemerkung!«**
Rückblickend wunderte ich mich, wie ich überhaupt zu meinem Wissen über die polnische Exilregierung kam, die im Unterricht als ein belangloses Intermezzo abgetan wurde. Denn was wußte man schon? Als ich 1990 einige Kolchosen in der Sowjetunion besuchte, fragten mich die Leute allen Ernstes, wo das Leben besser sei: dort oder im Westen. Doch als ich mich an meine Jugend erinnerte, wurde mir bewußt, daß die offizielle Erziehung nur einen Teil – und zwar den kleineren Teil – meiner Entwicklung ausmachte.
Anders als mein erstes politisches Erlebnis der Maidemonstration, das ich zeitlich nicht genau einzuordnen vermag, kann ich das zweite Erlebnis, das im Gedächtnis haftengeblieben ist, genauer datieren, und zwar auf den Dezember des Jahres 1970. Ich war damals siebeneinhalb Jahre alt. Eines Tages kam mein Vater mit ein paar Zeitungen nach Hause, die dicker als üblich waren. Sie enthielten lange Listen mit neuen Preisen, die die Regierung für alles mögliche – von Zahncreme über Kartoffeln und Klopapier bis hin zu Traktoren – festgelegt hatte. »Das wird Ärger geben«, sagte mein Vater. »In den fünfziger Jahren hätten sie es anders gemacht. Da hätten sie die Preise für Verbrauchsgüter angehoben und die für Lokomotiven und Panzer gesenkt, so daß sie sagen konnten, unterm Strich sei alles beim alten geblieben.«
Damals lebten wir in einer Zweizimmerwohnung. Ich schlief mit meiner Mutter in einem Zimmer, mein Vater schlief fast jeden Abend im anderen Zimmer ein, während er Radio Free Europe hörte. Von meinem Kinderbett aus konnte ich die Stimmen hören, die hin und wieder durch das pochende, pulsierende Geräusch des Störsenders drangen, um bald wieder abzuflauen. Zwar sprach sich herum, daß immer eine Frequenz des Senders nicht gestört wurde, damit für die Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei eine Transkription hergestellt werden konnte, aber diese Frequenz war nur schwer zu empfangen, und unser primitives Hörfunkgerät war nicht viel mehr als eine große Holzkiste, ein Produkt aus den Tagen vor der Erfindung des Transistors.
Kurze Zeit, nachdem die Zeitung die Preiserhöhungen veröffentlicht hatte, bekam ich mit, daß Radio Free Europe schlechte Nachrichten zu verkünden hatte. Mein Vater bemühte sich noch eifriger als sonst um die richtige Abstimmung der Frequenz. Als wir den Sender endlich hören konnten, meldeten die polnischen Nachrichtensprecher in München, daß in mehreren Städten Polens Arbeiteraufstände ausgebrochen waren, wobei es auf der Werft von Gdańsk sogar Tote gegeben hatte. Tagelang schwiegen sich die offiziellen Medien über die Zwischenfälle aus, bis plötzlich das Fernsehen über die Ereignisse berichtete: Schwarzweißaufnahmen von Krawallen und von Menschen, die Geschäfte plünderten. Die örtliche Parteizentrale stand in Flammen, Soldaten gaben Schüsse ab. Als wir den Bruder meines Vaters in Gdańsk anrufen wollten, stellten wir fest, daß die Leitungen abgestellt worden waren.
Die Krise dauerte an. Władysław Gomułka, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, trat »aus gesundheitlichen Gründen« zurück. Nach Weihnachten hielt Edward Gierek, der neue Parteiführer, eine Rede an das Volk. Ich sagte meinem Vater, daß jetzt die Fotografen bestimmt viel zu tun hätten. Denn Porträts des Parteiführers hingen in Schulräumen, Büros, einfach überall, und jetzt mußten alle ausgetauscht werden. Mein Vater lachte, als ich ihn fragte, wie lange das wohl dauern würde.
Radio Free Europe war aber nur eine unter vielen Informationsquellen, die dem widersprachen, was man in meiner Schule und in den offiziellen Medien verbreitete. Im privaten Umfeld hat niemand versucht, meine politischen Ansichten zu beeinflussen, noch hat jemand mich dazu ermutigt, mich der Untergrundbewegung anzuschließen, illegale Zeitungen zu drucken oder gegen die Regierung zu agitieren. Doch auf vielerlei Weise habe ich durch verschiedene Familienmitglieder und durch ihre Erzählungen schon im jungen Alter erfahren, daß das Leben mehr zu bieten hatte als Staat, Schullehrer und Zeitungen.
Der liebste unter den Verwandten war und ist mir Onkel Klemens, der ältere Bruder meines Vaters, der als Büchsenmacher in Gdańsk lebt. Wir sahen ihn höchstens ein paarmal im Jahr, aber jeder Besuch war ein Fest. Er hatte eine Werkstatt an der Mariackastraße, Gdańsks Prachtstraße in unmittelbarer Nähe der gotischen Kathedrale und des mittelalterlichen Rathauses. Häuser, die mit ihren gemeißelten und vergoldeten Fassaden an Amsterdam erinnern, zeugen immer noch davon, daß die Stadt einst so reich war wie Venedig. Die Werkstatt meines Onkels befand sich im Erdgeschoß eines solchen Patrizierhauses, das über einen Vorhof und eine steinerne Treppe verfügte. Den Vorhof bewachten zwei Geschütze, zwei Hellebarden umrahmten den Eingang. Drinnen waren die Wände von oben bis unten vollgehängt mit Jagdmessern, Pistolen, Schwertern und Rapieren, Pulverbehältern, Signalhörnern, Geweihen und Gewehren. Es roch nach Leder, Öl, Metallspänen und Poliermittel. Nach langem Streit mit der Stadtverwaltung hatte Onkel Klemens einen tiefen Keller unter dem Haus gegraben, um dort einen kleinen Schießstand einzurichten. Eine schmale Treppe mit einem Geländer aus Geweihstangen führte hinunter in die Höhle, wo meine Neffen und ich mit den Luftgewehren meines Onkels wahre Schützenfeste veranstalteten.
Zu Zeiten, als man es für schick hielt, alte Holzmöbel durch Einrichtungsgegenstände aus Resopal zu ersetzen, sammelte mein Onkel haufenweise altmodischen Trödel. Nach traditioneller Gdańsker Art dunkelgebeizte Eichenkommoden und -tische füllten jede Ecke seiner Wohnung. An den Wänden hingen gekreuzte Schwerter auf Orientteppichen, von Hand gehämmerte Zinnteller und -kannen standen reihenweise in den Regalen. In den Kellerräumen bewahrte er allerlei Gerümpel auf: Säbel, Trommeln, kaputte Statuen, Stierhörner, Mühlensteine. Er war kurz nach dem Krieg nach Gdańsk gezogen, als die Stadt noch in Trümmern lag. Wie ihre Schwesterhafenstadt Königsberg war auch Gdansk im Frühling des Jahres 1945 von der Roten Armee unnötigerweise unter Beschuß genommen und gestürmt worden, als die Schlacht um Berlin längst entbrannt war. Anders als Königsberg wurde Gdańsk jedoch nicht dem Erdboden gleichgemacht, sondern wiederaufgebaut. Einen Großteil seiner Sammlung fand mein Onkel auf Spaziergängen durch die Altstadt. Die Kanäle wurden nach und nach ausgebaggert, und die Arbeiter stießen dabei hin und wieder auf Dinge wie einen mittelalterlichen Taufteller, einen Silberlöffel oder Münzen, die mein Onkel meist im Tausch gegen eine Flasche Wodka ergattern konnte. Die Arbeiter wußten freilich nicht, daß die Deutschen, als die Stadt schon in Flammen stand und die letzten Schiffe den Hafen verließen, ihre Wertgegenstände aus den Fenstern in die Kanäle geworfen hatten, in der Hoffnung, sie nach ihrer Rückkehr wiederzubekommen.
In den Händen meines Onkels wurden die Gegenstände zum Leben erweckt. An kleinsten Kennzeichen und Merkmalen konnte er ablesen, aus welcher Gdańsker Werkstatt oder manchmal sogar von welchem Meister der Zunft sie jeweils stammten. Aus einer einzigen Schramme konnte er ihre komplette Geschichte ableiten oder wenigstens erdichten. »Die Handwerkskunst!« schwärmte er dann. »Früher hat sie dieser Stadt einmal zu Reichtum verholfen, aber heutzutage können die Leute nichts anderes als quatschen.« Onkel Klemens muß allerdings etwas von seinem Handwerk verstanden haben, denn aus dem ganzen Land strömten die Kunden in seine Werkstatt. Mit seinen Jagdgeschichten vermochte er Kunden und Freunde zu fesseln, auch wenn wir wußten, daß sie stark übertrieben waren.
Onkel Klemens’ politisches Interesse galt einzig und allein der Altstadt von Gdańsk. Statt der Schaufenster mit Bernsteinnippes für Touristen sollten seiner Meinung nach hämmernde und schnitzende Handwerker den Ton angeben. Er setzte sich für die Wiederbelebung eines alten Schützenvereins ein, suchte die Lokalbehörden zu bewegen, das Zeughaus wiederzueröffnen, und war immer bereit, während des historischen Handwerksmarkts im Sommer in einem traditionellen kontusz herumzulaufen. Nur wenn man ihn ausdrücklich danach fragte, erzählte er, wie die große Politik sein Leben beeinflußt hatte. Er hatte zwanzig Jahre lang in der Armee gedient, wo er Kurse veranstaltete und Büchsenmacher ausbildete. Die meisten Offiziere waren Parteimitglieder, aber er gehörte zu einer kleinen Minderheit ohne Parteibuch. Zunächst entstanden ihm daraus keine Nachteile, denn Fachkräfte waren rar. Im Jahre 1968 kam es aber zu Säuberungen und einer Welle antisemitischer Hysterie, die von der Partei angefacht wurde, um Gegner in den eigenen Reihen loszuwerden. Gleichzeitig wurden jedoch auch andere Unerwünschte unter Beschuß genommen. Onkel Klemens wurde vor die Wahl gestellt, entweder Parteimitglied zu werden oder zu kündigen – er verließ die Armee ein Jahr vor seiner Pensionsberechtigung. Seine Verwandten mahnten ihn, seinen Mund zu halten und realistischer zu werden. Ohne Erfolg. Einige Jahre später, nachdem er es gewagt hatte, sich über Parteiführer zu beschweren, die in seinem Revier von Hubschraubern aus auf Rehe schossen, wurde er als Jagdführer abgesetzt. Aber trotz dieses Unrechts wurde mein Onkel noch nicht zum Dissidenten. Er kehrte der kommunistischen Gesellschaft einfach den Rücken und beschränkte seine Bestrebungen auf die Werkstatt und die Antiquitätensammlung. Er ist das beste Beispiel dafür, daß man unter einem kommunistischen Regime leben und trotzdem eine reine Weste behalten konnte.
Ein anderer Onkel, mein Großonkel Stefan, hat 1920 noch im glorreichen Krieg gegen die Bolschewiken gekämpft. Zunächst diente er unter dem großen polnischen Feldherr Józef Piłsudski, der mit seinem Gefolge bis nach Kiew vorstieß. Als später die Rote Armee Polen überfiel und der UdSSR einverleiben wollte, kämpfte Onkel Stefan in der Nähe von Warschau. Über seine Erlebnisse hat er nie besonders viel erzählt, doch die bloße Tatsache, daß er an einem Krieg gegen die Rote Armee teilgenommen hatte, machte es mir schwer zu glauben, was man mir in der Schule beibringen wollte: daß die Rote Armee der beste Freund der polnischen Kinder sei.
Meine Kindheit fiel in eine Periode ungewöhnlichen Wohlstandes. Politische Zugeständnisse wie die Genehmigung von Westreisen für Millionen polnischer Bürger dienten als Sicherheitsventil, um Frustrationen abzubauen. Edward Gierek, Parteichef während der siebziger Jahre, sah sich allerdings in der Erwartung getäuscht, daß die Bürger sich für das Entgegenkommen mit sozialem Frieden und politischer Anerkennung revanchieren würden. Auf den künstlich herbeigeführten Aufschwung folgte schließlich Ende der siebziger Jahre die Pleite, und Gierek wurde durch eine Welle gewalttätiger Proteste aus dem Amt gezwungen. Heute muß Polen immer noch die damals großzügig gewährten Milliardenkredite abstottern; gewiefte Banker aus dem Westen gingen davon aus, daß die sozialistische Wirtschaft nicht weniger kreditwürdig sei als die kapitalistische, da es den Planökonomen freistand, beliebige Ressourcen per Dekret für die Schuldentilgung aufzuwenden.
Durch Edward Giereks Leichtsinn kam meine Generation jedoch in den Genuß von Dingen, die zuvor der westlichen Jugend vorbehalten waren. So galt der Jazz nicht länger als zersetzende bürgerliche Musikform, und in den Läden tauchten Marlboro-Zigaretten und Coca-Cola auf. Wer Devisen hatte, konnte sich sogar den Traum der Träume verwirklichen und Original-Bluejeans kaufen. Meine Eltern arbeiteten beide bei staatlichen Baufirmen und verdienten überdurchschnittlich gut, doch nach dem Wechselkurs auf dem Schwarzmarkt belief sich ihr Monatseinkommen trotzdem nur auf eine Handvoll Dollar. So erlangte jedwede Westware den Status einer Reliquie, ähnlich wie bei den Angehörigen gewisser Cargo-Kulte Gegenstände angebetet werden, die von irgendwelchen Schiffsmannschaften achtlos über Bord geworfen und an Land geschwemmt wurden. Alle träumten davon, zu Weihnachten ein paar Jeans geschenkt zu bekommen. Einige Monate lang beneidete mich die ganze Schule, weil ich als erster eine elektronische Armbanduhr besaß – ein klobiges, primitives Teil, das nur nach festem Drücken der Tasten die Zeit anzeigte. Bis auf den heutigen Tag kann ich mich für unnütze technische Kinkerlitzchen begeistern, jederzeit bereit, mein Geld für Gummilatschen mit Lämpchen oder eine sprechende Zahnbürste auszugeben.
Wir veranstalteten Partys, auf denen es cool war, richtigen Wermut zu trinken. Jedes neue Album von Pink Floyd – mit einem Beschaffungswert von mehreren Monatseinkommen – wurde begrüßt, als handelte es sich dabei um einen authentischen Überrest des Heiligen Kreuzes. Wir lernten Englisch, indem wir die Texte auf der Plattenhülle übersetzten, und glaubten, dasselbe Unbehagen zu empfinden, das unsere Popidole umtrieb. Erst später verstand ich, daß unsere westlichen Zeitgenossen dabei etwas ganz anderes im Sinn hatten: Sie hatten die Schnauze voll von der Konsumgesellschaft, während wir sehnsüchtigst dessen banalste Manifestationen vergötterten. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an meinen sechzehnten Geburtstag; meine Eltern verschwanden netterweise fürs Wochenende und überließen mir die Hausschlüssel; ein Raum war abgedunkelt, im Kerzenlicht tanzten Pärchen engumschlungen zu den Klängen von »Dark Side of the Moon«; ich saß auf dem Sofa, legte zaghaft einen Arm um Beata, eine Blondine, auf die ich schon seit Monaten scharf war, hielt ein Glas Wermut in der freien Hand und dachte zufrieden: »Superschick. Das ist ja wie im Westen!«
Noch subversiver als Wermut und Pink Floyd war, daß die Polen als einzige Ostblockstaatler in den Westen reisen durften. Die Schwierigkeit war nur, die nötigen Devisen zu beschaffen. Jede polnische Familie konnte einmal jährlich eine Dollarzuweisung beantragen, zu einem Wechselkurs, der zwar über dem rein fiktiven offiziellen Wert, aber immerhin unter dem Schwarzmarktpreis lag. Jeden Frühling aufs neue warteten wir gespannt, was uns die Sommerferien bringen würden: einen Monat entweder in sonniger Ferne oder im durchnäßten Zelt an irgendeinem pommerschen See. Es war immer wieder eine Zeit des Bangens. Hatte vielleicht jemand meinen Vater angeschwärzt, weil er politische Witze erzählt hatte? Vielleicht gingen »ihnen« die Dollars aus und würden die Zuweisungen drastisch gekürzt? Oder vielleicht wollten »sie« meine Eltern bestrafen, weil sie an den letzten Wahlen nicht teilgenommen hatten? Die Behörden verbreiteten mit Absicht das Gerücht, Willfährigkeit in politischen Dingen stehe in engem Zusammenhang mit der Zuteilung von Devisen, und dies war wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, daß die meisten gebildeten Familien bei den offiziellen Parteiritualen mitmachten.
Die Tage im Frühling, an denen jeweils die briefliche Bestätigung der Zuweisung eintraf, waren die glücklichsten meiner Kindheit. Meine Eltern und ich holten dann den Atlas und die Landkarten hervor, um jeden einzelnen Tag der Sommerferien aufs genaueste zu planen. Zu jener Zeit galt jedes beliebige Land der nichtkommunistischen Welt für uns schon als »der Westen«. Wir entschieden uns in der Regel für die Türkei oder Griechenland. Diese Reiseziele waren nicht ohne Hintergedanken gewählt, denn wir konnten sie leicht mit dem Auto erreichen, indem wir durch die Sowjetunion, Rumänien und Bulgarien fuhren und billiges sozialistisches Benzin tankten. Noch wichtiger war jedoch, daß wir in beiden Ländern nicht nur mit unseren Devisen auskommen, sondern auch ein bißchen Handel treiben konnten, um am Ende mit einem Teil der kostbaren Dollars zurückzukehren.
Vor der Abreise bemühte sich die ganze Familie, ausstehende Gegenleistungen für frühere Gefälligkeiten einzutreiben und so geeignete Handelsware zu sammeln. Meinen Eltern war das peinlich, aber in mir erwachte der wahre Handelsinstinkt. Wenn der Urlaub nahte, häuften sich in unserer Küche die verschiedensten Güter an. Es hatte sich herumgesprochen, daß in der Türkei rege Nachfrage nach polnischen Elektrogeräten wie Mixern, Bügeleisen und Staubsaugern bestand. Außerdem kaufte ich einige Sachen aus geschliffenem Kristall: Aschenbecher, Vasen, Zuckerdosen. Dem Zoll machte man weis, daß die ersteren zu unserer Campingausrüstung gehörten, die letzteren wurden als Geschenke für alte türkische Freunde deklariert. (Wie bei so vielen Dingen wurden unter dem Sozialismus die normalen Zollbestimmungen in ihr Gegenteil verkehrt: Die Zöllner versuchten zu verhindern, daß etwas aus dem Land geschmuggelt wurde.) Noch gewinnbringender waren Güter, die man in der Sowjetunion absetzen konnte: Kaugummi, Nagellack, Parfüm, Jeans, Bettwäsche und, aus unerfindlichen Gründen, Perücken. Ebenso wie wir waren die Sowjets ganz erpicht auf alles, was nach Luxus roch, nur stand Giereks Polen aus ihrer Sicht schon mit einem Bein im Paradies. Andererseits lagerten in den sowjetischen Geschäften Bedarfsartikel, die in der Türkei gefragt waren oder auch bei uns Polen fehlten: Kameras, Autozubehör und vor allem ganz schlichte Heimwerkerutensilien. Man konnte zudem versuchen, Rubel aus der Sowjetunion zu schmuggeln (ein heimtückisches Verbrechen, das mit der Beschlagnahmung der involvierten Summe sowie des benutzten Vehikels – des Familienwagens – geahndet wurde), um sie später gegen bulgarische Lewa zu tauschen, die bei den Schaffellhändlern in der Türkei hoch im Kurs standen. Um unsere Reisekosten möglichst gering zu halten, nahmen wir auch kiloweise Wurst, Packungen mit passierten Tomaten, Suppendosen und Gemüse mit; dazu die Grundausstattung: Zelte, Matratzen, Gaskocher und Ersatzteile für den Wagen. Mein Vater hatte meist schon an mehreren Wochenenden geprobt, um schließlich alles im Kofferraum, auf dem Dach und auf dem Rücksitz unseres Polski Fiat 125 verstauen zu können. Ich durfte es mir jedesmal zwischen den Zeltstangen und Reservestoßdämpfern auf dem Rücksitz gemütlich machen.
Der Geselligkeit halber, aber auch wegen der gegenseitigen Hilfe bei den unvermeidlichen Pannen, reisten wir immer zusammen mit zwei oder drei anderen Familien, deren Autos ebenfalls durch eine schwere Last tief in die Federung gedrückt wurden. Unangenehm wurde es gleich an der polnisch-sowjetischen Grenze bei Medyka. Nach einer kursorischen Kontrolle durch die polnischen Zöllner – die höchstens mal eine Kristallschale oder einen Staubsauger für den Eigengebrauch konfiszierten – landeten die Wagen in einem von Wachtürmen und Stacheldraht umgrenzten Niemandsland. Es war nicht ganz die »vereinigende Grenze«, über die ich in Schulbüchern und Zeitungen so viel gelesen hatte. Die Wartezeit betrug jedesmal mehrere Stunden, wenn nicht gar Tage. Häufig wurde der Grenzübergang ohne Vorwarnung geschlossen; dann ging gar nichts mehr, außer Fluchen und Abwarten. Es gab keine Läden, keine Cafés, keine Toiletten – nur eine Einöde mit hier und da ein paar Gräben und Büschen. Wir schliefen im Wagen und ließen wegen der Heizung den Motor laufen.
Endlich auf der sowjetischen Seite angekommen, begann der Zirkus erst recht. Offiziell waren wir zwar internationalistische Brüder und Schwestern, doch der sowjetische Zoll und die Einwanderungsbehörde behandelten uns mit größtem Mißtrauen. Das Verfahren war immer das gleiche. Zuerst wurden uns die Pässe abgenommen, die dann für mehrere Stunden im Büro der Einwanderungsbehörde verschwanden. Anschließend mußte jedes Fahrzeug auf einer Hebebühne untersucht werden; jemand klopfte dazu mit einem Hammer den Wagenboden ab. Ein anderer Grenzsoldat prüfte mit einem langen Stab den Benzintank. Wir mußten unser gesamtes Gepäck ausladen, damit die Zöllner feststellen konnten, ob wir im Wageninnern nicht einen Spion versteckt hielten. Oft verlangten sie irgendwelche kleinen Geschenke: die gelbgetönte Sonnenbrille meines Vaters oder eine Packung Rasierklingen. Wenn man es sich mit ihnen verscherzte, folgte unausweichlich eine Sonderkontrolle, bei der das Auto nahezu komplett auseinandergenommen wurde – zusammenbauen mußte man es hinterher selbst. Also hatten wir uns daran gewöhnt, einige der mitgeführten Handelsartikel einladend auf dem Armaturenbrett liegenzulassen. Am Ende der Kontrollen waren sie immer verschwunden.
Manchmal gab es heikle Situationen. Als wir eines Tages zur Reise aufbrachen, klebte hinter der Windschutzscheibe ein Farbporträt vom neuen Papst – aus patriotischem Wagemut hatte mein Vater es dort hingesteckt.
»Wer soll das sein?« schnauzte ein Zöllner und deutete auf die in Weiß gekleidete Figur, die segnend die Hand hob.
»Das?« Meinem Vater fiel jetzt plötzlich ein, daß die Zollbestimmungen die Einfuhr von religiösen Objekten in die Sowjetunion ausdrücklich untersagten. »Das ist einer unserer Generäle«, erwiderte er mit einem matten Lächeln.
»Ein General?« Der Grenzer starrte meinen Vater durchdringend an.
»Eigentlich ein Admiral. Er ist Kommandeur unserer Ostseeflotte«, sagte mein Vater, ohne eine Miene zu verziehen.
»Verstehe. Tolle Uniform!«
Die Strecke durch die Sowjetunion war von hohen Bäumen gesäumt – wahrscheinlich als Schutz gegen Schneestürme, obwohl alle munkelten, daß die Sowjets den Blick der Durchreisenden auf ihre brachliegenden Felder verstellen wollten. Wir durften nur der vorgeschriebenen Route folgen, die an jeder größeren Kreuzung von düsteren Wachtürmen aus Beton gesichert war. Wir bemerkten, daß die Wachmannschaften die Nummernschilder aller ausländischen Wagen registrierten. Die Straße zu verlassen, war nicht ratsam: Bald würde man von einer Streife gestoppt und in ärgerliche Dispute verwickelt werden.
Die Strecke führte uns durch die Stadt Lwów (Lemberg), die einst der östlichste Vorposten Österreich-Ungarns gewesen war und davor (bis 1772) sowie zwischen den Weltkriegen zu Polen gehört hatte. Die Geschichtslehrer in unserer Schule versuchten, die Annexion Lwóws durch die Sowjetunion im Jahre 1939 zu rechtfertigen: Der Osten Polens sei von jeher ein russischer Landstrich (von der Ukraine war erst gar nicht die Rede), in den jetzt die Sowjets nur einrückten, um die Bevölkerung vor den Deutschen zu schützen. Doch wie immer bei solchen Grenzstreitigkeiten in ethnisch vielfältigen Gegenden war auch dieser Fall äußerst kompliziert. Während die Landbevölkerung mehrheitlich aus Ukrainern bestand, wurde in Lwów selbst seit Jahrhunderten hauptsächlich Polnisch gesprochen. Jedes polnische Kind wußte, daß unser glückloser König Kasimir in der Kathedrale von Lwów geschworen hatte, das Schicksal der Bauern zu verbessern, nachdem sie ihm wieder zum Thron verholfen und die 1655 eingefallenen Schweden vertrieben hatten. Und auch jetzt, nach mehreren Jahrzehnten sowjetischer Verwaltung, machte die Stadt kaum einen russischen Eindruck. Die beiden Löwenstatuen, die in polnischen Liedern besungen werden, standen immer noch vor dem klassizistischen Rathaus. Der Rathausplatz stammte aus der Renaissance, ein angrenzendes Haus gehörte einst Johann III., der 1683 Wien von den Türken befreite. Der Markuslöwe bewachte den Eingang eines weiteren Hauses, in dem wahrscheinlich das venezianische Konsulat einmal untergebracht gewesen war, und zeugte von Lwóws herausragender Bedeutung und strategischer Position an einer der wichtigen Handelsstraßen nach Asien. Auf den Stufen des Denkmals zu Ehren des Dichters Adam Mickiewicz legten wir Blumen nieder. Damals fand ich es nicht weiter komisch, daß hier für einen Mann, der im heutigen Weißrußland geboren wurde und der Encyclopedia Judaica zufolge ein Jude war, der in Paris in polnischer Sprache sein bekanntestes Gedicht verfaßte, dessen Anfangszeile lautet: »Litauen, du meine Heimat, du bist wie die Gesundheit«, daß hier für diesen Mann ein Denkmal errichtet wurde, und zwar zu einem Zeitpunkt, als die heute ukrainische Stadt zu Österreich-Ungarn gehörte.
Wir schauten uns auch das Lenin-Standbild auf der gegenüberliegenden Seite desselben Platzes an. Es hieß, das Monument sei aus den Trümmern einer Marienstatue errichtet worden, und man könne noch erkennen, wie unter Lenins Mantel die Lilien auf dem Kleid der Jungfrau Maria hervorlugten. Ich habe angestrengt hingesehen, aber nichts davon entdecken können. (Jahre später, es war 1991, erlebte ich mit Genugtuung, daß Lenin vom Platz entfernt wurde, und die Mär bewahrheitete sich irgendwie doch, wenn auch auf unerwartete Weise. Es stellte sich heraus, daß für den Sockel des Standbilds Grabsteine vom jüdischen Friedhof verwendet worden waren.)
Überhaupt schienen viele Gebäude in Lwów der offiziellen Geschichtsschreibung zu widersprechen. So prangte an der Fassade des Jesuitenklosters ein großes Wappen der alten Union – mit dem polnischen Adler und dem litauischen Ritter. Unter dem bröckelnden Putz von Jugendstilwarenhäusern kamen polnische Namen zum Vorschein. An einem Haus in der Rosa-Luxemburg-Straße hing immer noch ein verrostetes Schild mit der Hausnummer und dem polnischen Straßennamen Kanonia. Wahrscheinlich waren die sowjetischen Arbeiter zu faul gewesen, es herunterzunehmen – es hing zu hoch, als daß man mit einer einfachen Leiter herangekommen wäre. Manche alte Männer, die uns Polnisch sprechen hörten, grüßten uns oder zerrten uns zwecks einer heimlichen Unterredung in einen Hauseingang. Sie gehörten zu den Leuten, die Polen nicht rechtzeitig vor den »ethnischen Säuberungen« der vierziger und fünfziger Jahre verlassen hatten. »Haben Sie polnische Briefmarken?« fragte mich einmal ein gekrümmter alter Mann mit weißem Haarschopf. Er schaute mich, einen pubertierenden Teenager, untertänig an. »Ich möchte nur etwas haben, was aus Polen kommt.« Das Wort »Polen« sprach er mit einer fast religiösen Ehrfurcht aus.
Die offiziellen Lügen waren im Falle Lwóws besonders kraß, da die Stadt, anders als weite Flächen Ostpolens, niemals zu Rußland gehört hat, nicht einmal während der polnischen Teilungen des 18. Jahrhunderts. Die Stadtmauern stammten aus dem Mittelalter, es gab Kirchen aus der Renaissance, dem Barock und dem Klassizismus sowie eine armenische Kathedrale mit einem Friedhof, wo armenische Adelige ruhten und die Gräber mit dem polnischen Wappen geschmückt waren. Eine prunkvolle unierte Basilika überragte auf einem Hügel die Stadt. Ein leerer Platz markierte die Stelle, wo einst die Synagoge stand. Lwów, seit dem Mittelalter eine Handelsstadt, war schon immer reich gewesen und hatte im 19. Jahrhundert noch einen kleinen Öl-boom erlebt. In der Stadt war ein amerikanisches Konsulat angesiedelt, ein vornehmes Hotel (das George, das einem Franzosen gehörte) und ein Opernhaus, das der Scala in verkleinertem Maßstab nachgebildet war. Die Straßen von Lwów hatten immer noch ein starkes bürgerliches Flair. Wenn ich die Augen schloß, sah ich noble Automobile über das Kopfsteinpflaster rollen, promenierende Damen in Pelzmantel und geschäftige Herren in Zylinder. Wenn ich die Augen wieder öffnete, sah ich die neuen sowjetischen Bewohner, die seltsam mit der Architektur der Stadt kontrastierten, keinen Sinn für ihre mondäne Vergangenheit zu haben schienen: Bäuerinnen mit Kopftüchern und groben Gesichtszügen, stämmige Männer, die billige Aktentaschen mit sich herumschleppten.
Lwóws gotische Kathedrale wurde von Kasimir dem Großen errichtet, demselben König, der auch meiner Heimatstadt Bydgoszcz das Stadtrecht verliehen hatte. In den Seitenschiffen der Kathedrale befanden sich Marmorgräber von polnischen Adeligen. Fresken und Gemälde erinnerten an Szenen aus der heroischen Stadtgeschichte: die Verteidigung gegen die Tataren, die Brandschatzung durch die Schweden. Doch trotz aller historischen Größe war die einst so bedeutende Kathedrale durch die Willkür der Sowjetbürokraten mit Schließung bedroht. Wir besuchten die Kathedrale jedesmal auf unserer Reise in den Süden, so auch 1979, nur Monate, nachdem Karol Wojtyła zum Papst gewählt worden war. Nach der Messe bahnte ich mir einen Weg zum Altar und zu einer Seitentür im Presbyterium, durch die man in die Sakristei kam. Jacek, der Sohn von Freunden meiner Eltern, die zusammen mit uns reisten, begleitete mich. Wir hatten ein Paket bei uns, dessen Inhalt ich meinen Eltern erst nach der Überquerung der sowjetischen Grenze verraten hatte, weil er uns Ärger hätte einbrocken können: Es handelte sich um mehrere Hundert Bilder vom neuen Papst. Sie bildeten einen Teil meiner Handelsware, und eigentlich hoffte ich, sie verkaufen zu können. Jetzt jedoch, in der Kathedrale, schien es mir richtiger, sie zu verschenken. Die Sakristei war mit dunklem Holz getäfelt. Eine alte Frau, die sich womöglich nicht nur an die polnischen, sondern auch an die österreichischungarischen Zeiten erinnern konnte, saß an einem großen Schreibtisch und machte Eintragungen in einem Hauptbuch. Sie schaute hoch, und ich übergab ihr das Paket.
»Ich habe sie aus Polen mitgebracht, weil ich dachte, daß sie hier vielleicht schwer zu bekommen sind. Ich hoffe, Sie können sie gut gebrauchen.«
Sie öffnete das Paket, breitete ein paar Bilder auf der Tischplatte aus und schwieg eine Weile, während sie auf die Bilder starrte. Dann blickte sie wieder hoch: Sie machte ein ernstes Gesicht, aber ihre Augen leuchteten. Sie weinte. »Der Herrgott hat euch gesandt. Es sind schon viele Menschen von weither gekommen. Sie hatten von unserem neuen Papst gehört, aber noch nie sein Gesicht gesehen, weil die Zeitungen und das Fernsehen es nicht zeigen. Wir konnten ihnen nichts geben, denn wir hatten selbst keine Bilder. Jetzt haben wir welche. Viele Menschen werden noch lange für euch beten.«
»Keine Ursache, ich habe nur meine Pflicht getan«, murmelte ich, und Jacek und ich schlichen gerührt, aber etwas beschämt zur Tür.
»Panowie!« Ihre Stimme klang plötzlich laut und deutlich und schreckte uns auf, als wir gerade zur Tür hinausgehen wollten. Wir standen sofort stramm; es war das erste Mal, daß jemand uns als »Herren« anredete. »Wann werden Sie wieder nach Lwów kommen?« fragte sie.
»Nächstes Jahr wahrscheinlich, wenn wir wieder in die Türkei fahren«, erwiderte ich.
»Nein, ich meinte: in Uniform, meine Herren. Wann werden Sie in Uniform nach Lwów kommen? Wir wünschen uns nichts lieber.«
Wir alle betrachteten Lwów mittlerweile als sowjetische Stadt und nahmen an, daß sich daran so bald nichts ändern würde. Und doch erfuhr ich durch Lwów einen tiefen Respekt für die polnische Vergangenheit. Die Erfahrung einer verbotenen Wahrheit, die dort mit Händen zu greifen war, immunisierte mich gegen die offiziellen Lügen. Als ich später im Exil über die Massaker las, die dort stattgefunden hatten, nachdem die Rote Armee 1939 in die Stadt einzogen war, mußte ich an den alten Mann denken, der mich um polnische Briefmarken gebeten hatte. Ich versuchte mir vorzustellen, was er alles durchgemacht haben mußte, daß er sich sogar nach dem kommunistischen Polen sehnen konnte.
Unseren nächsten Zwischenstopp nach Lwów machten wir normalerweise im Süden Bulgariens auf einem Campingplatz namens Nestinarka, der am Schwarzen Meer gelegen war. Unser Sprungbrett für die Weiterreise in die Türkei verfügte über ein Gebäude mit furchtbar verschmutzten öffentlichen Toiletten, das wir das »Weiße Haus« nannten, doch dafür entschädigte die gute Lage direkt an einem goldgelben, kilometerlangen Strand. Die meisten Campingbesucher waren Touristen aus anderen kommunistischen Ländern: Ostdeutsche, Ungarn und Tschechoslowaken – die alle auf uns Polen neidisch waren, da wir als einzige unsere Reise über die Grenzen der Bruderstaaten hinaus fortsetzen durften. An beiden Enden des Campingstrands befanden sich Felsen aus Vulkangestein, die jeweils einen kleinen Nacktbadestrand umgrenzten. Dort tummelten sich zwar auch ein paar ortsansässige Gigolos auf der Suche nach ausländischer Kundschaft, aber die meisten FKKler waren wohl deutsche Familien – von schrumpeligen Großmüttern bis zu dicklichen Enkeltöchtern –, die sich unbekümmert gaben, ob beim Sonnen, Windsurfen oder Schnorcheln. Die Polen waren dagegen ziemlich verklemmt. Allerhöchstens entblößten die Frauen ihre Brust, um sie jedoch sofort wieder einzupakken, wenn sie die Stimmen von Teenagern vernahmen, die in ihrer eigenen Sprache Kommentare abgaben.
Manchmal machte sich die politische Wirklichkeit Bulgariens auch in unserem Urlaub bemerkbar. Auf einem Streifzug mit Freunden wagte ich mich einmal weiter vor als sonst, bis der Strand völlig menschenleer war. Hoch oben auf einem Felsvorsprung, der weit ins Meer hineinragte, entdeckten wir ein faszinierendes Bauwerk. Es war schon fast dunkel, als wir einen steilen Pfad hinaufkletterten, wobei wir uns an kleinen Steinbrocken hochhangeln mußten. Das Gebäude war von unbestimmtem Alter und bestand aus demselben Felsmaterial, auf dem es errichtet worden war. Eine schwere Holztür war mit einer rostigen Eisenkette verschlossen, doch wir rukkelten solange daran herum, bis die Kette schließlich weit genug nachgab und wir durch die Öffnung hindurchschlüpfen konnten. Drinnen war es stockfinster; nur durch zwei Schlitze direkt unter der Decke drang ein wenig Licht. Bevor unsere Augen sich an das Dunkel gewöhnt hatten, stolperte ich über ein großes Stück Holz. Plötzlich wurde ein Goldschimmer sichtbar. Große Kreise, Ovale und Quadrate leuchteten an den Wänden, am Boden lagen Goldbarren. Allmählich konnten wir sehen, wie rosa Gesichter sich in den vergoldeten Rahmen abzeichneten. »Es ist eine Kirche«, flüsterte einer von uns. Auf einmal bekamen wir es mit der Angst. Barfuß und in Badehosen blieben wir wie angewurzelt stehen und staunten beim Anblick der Dinge um uns herum. Die Kirche war entweiht worden. Das Stück Holz, über das ich gestolpert war, entpuppte sich als eine kaputte Bank, und die Goldbarren waren in Wirklichkeit Reste eines Altars, die zusammen mit anderen Trümmern des Kircheninventars über den Boden verstreut lagen. Die meisten Gemälde waren zerrissen oder – wahrscheinlich mit Bajonetts – zerschnitten worden. Das riesige Deckengemälde, das Christus mit Heiligenschein und Schwert darstellte, wies eine Reihe von Einschußlöchern auf, die quer über das byzantinische Gesicht verlief. Als wir uns vom ersten Schrecken erholt hatten, sagte einer, wir sollten gucken, ob wir Ikonen finden könnten.
Einen Moment lang stellten wir uns vor, wir wären Tom Sawyer und Huckleberry Finn und würden mit reichen Schätzen zurückkehren. Aber die Begeisterung hielt sich in Grenzen, der Anblick der Zerstörungen war eher furchteinflößend. Wir schlichen davon und machtenuns mit einem traurigen Gefühl auf den Rückweg. Es war spät und dunkel geworden, als wir den Campingplatz erreichten, wo unsere wütenden Eltern längst auf uns warteten. Wir versuchten, sie zu beschwichtigen, indem wir von unserer Entdeckung erzählten, und forderten sie auf, am nächsten Tag mit uns zur Kirche zu gehen. Vielleicht handelte es sich bei den Gemälden um verlorengeglaubte Meisterwerke, deren Wiederentdeckung uns berühmt machen würde. Die Erwachsenen hatten allerdings andere Ansichten. Wir erhielten eine deftige Standpauke, und der Strand hinter den Felsen wurde für die restliche Dauer unseres Aufenthalts zum Sperrgebiet erklärt.
In Istanbul schlugen wir unsere Zelte auf einem weiten Feld am Fuß der römischen Stadtmauer auf – wie eine Belagerungsarmee. Die Campingplatzverwaltung hatte ein großes Schild in polnischer Sprache aufgestellt, das jeden Handel auf dem Gelände untersagte. Aber niemand schien sich darum zu kümmern. Ständig strömten Besucher vorbei, die unsere Ware zu sehen wünschten. Mittlerweile waren wir jedoch geschäftstüchtig genug, um zu wissen, daß es besser war, gleich in den Basar zu gehen, als sich mit den kleinen Zwischenhändlern abzugeben.
Wir schauten uns die Sehenswürdigkeiten wie die Hagia Sophia, die Blaue Moschee und die unterirdische römische Zisterne an, doch am meisten beeindruckte mich die NATO-Basis in einem der Vororte Istanbuls. Wir hatten eine falsche Abzweigung genommen und gerieten versehentlich auf ein Kasernengelände. Plötzlich fuhren wir an langen Panzerkolonnen vorbei. Wir hielten an und fürchteten schon, daß man uns verhaften oder zumindest vernehmen würde. Statt dessen wurden wir von einem schwarzen Soldaten – dem ersten Schwarzen, den ich überhaupt mit eigenen Augen sah – mit einem breiten Lächeln begrüßt. Dadurch ermuntert, stieg ich aus dem Wagen und bestand darauf, daß er sich mit mir vor einem der Panzer fotografieren ließ. Die Erwachsenen fragten sich nur, wie der Westen bei solchen Sicherheitsvorkehrungen den Kalten Krieg zu gewinnen gedachte.
Der Höhepunkt der Reise war der Besuch im Basar. Hier entschied sich, ob wir einen Gewinn von ein paar Hundert Dollar einfahren, nur die Reisekosten ausgleichen oder einige Hunderter draufzahlen würden – entweder konnten wir ein Polster für den nächsten Urlaub anlegen, oder meine Eltern müßten ein ganzes Jahr sparen, um den Verlust wieder wettzumachen. Unser armseliger Vorrat war alles, was wir hatten, also ließen wir ihn keine Sekunde aus den Augen. Nicht nur unsere Kristallschalen, Elektrogeräte und Brieftaschen hätten langen Fingern zum Opfer fallen können, sondern freundliche Händler warnten meine Eltern, daß mancherorts in Kleinasien immer noch große Nachfrage nach hellhäutigen Jungen wie mir bestand. »Nehmen Sie ihn lieber die ganze Zeit an die Hand«, empfahlen sie.
Die Geschäfte, die mit polnischer Ware handelten, waren leicht zu erkennen, da an ihren Fenstern gefälschte Empfehlungsschreiben von berühmten polnischen Fußballspielern klebten. Das waren noch Zeiten, als unsere Nationalelf ihre großen Triumphe feierte. Die Regierung stellte den Spielern damals großzügige Siegesprämien in Aussicht – in ganz Polen machte das Gerücht die Runde, daß die Spieler für jeden Sieg einen Fiat bekämen. Der Regierung kam es wohl nicht ungelegen, wenn die Leute sich so sehr mit Fußball befaßten, daß sie darüber die Lebensmittelknappheit und die Politik vergessen würden. Womöglich dank dieses kapitalistischen Ansatzes war die polnische Nationalmannschaft während der siebziger Jahre sehr erfolgreich; sie gehörte zu den besten Teams bei der Weltmeisterschaft und gewann Medaillen bei den Olympischen Spielen. Immer, wenn wir Bekanntschaft mit Türken machten, wurden deshalb erst einmal die Namen der polnischen Fußballer abgespult:
»Lubánski – gut, oder?«
»Nein, Gadocha besser.«
»Lato o.k.?«
»Ja, Lato o.k.«
Zu dieser Zeit, Anfang bis Mitte der Siebziger, war dieser Handel eine harmlose Nebenbeschäftigung, mit der Tausende von Familien aus der Mittelschicht nur versuchten, ihr Einkommen ein wenig aufzubessern. In den achtziger Jahren wuchs er sich aber zu einem eigenständigen Wirtschaftszweig mit professionellen Händlern aus, die das ganze Jahr über zwischen Polen und den östlichen Märkten hin und her pendelten. Für Millionen von polnischen Familien bedeuteten die Basargeschäfte, in denen man Kristallvasen und Küchengeräte aus Polen gegen harte Devisen oder Gold tauschte, eine Einführung in den angewandten Kapitalismus. In den neunziger Jahren gründeten dieselben Leute oder deren Kinder die kleinen Firmen, die die treibende Kraft unseres wirtschaftlichen Aufschwungs bilden. Doch es war in jenen Tagen, in Istanbul und später auf den Märkten von Westberlin und Wien, daß die Polen den Kapitalismus fürs Volk entdeckten.
Durch die Erfahrung des realexistierenden Kapitalismus bekam mein Bild des realexistierenden Sozialismus seine ersten Risse. Ein noch wichtigeres Gegenmittel stellten aber Bücher dar, nicht notwendigerweise illegale Schriften von Emigranten, sondern sogar frei zugängliche Jugendbücher. Unser großes nationales Epos aus dem 19. Jahrhundert, Henryk Sienkiewicz’ Trilogie, habe ich bestimmt fünfzehn Mal gelesen. Es spielt in der dramatischen Zeit von 1648 bis 1684, als das polnische Reich einen abrupten Niedergang erlebte. Nach dem Willen der Kommunisten sollten wir uns mit toter Ideologie identifizieren, nach Zielen wie höheren Produktionszahlen streben und stumpfsinnige Fanatiker bewundern. Sienkiewicz vermittelte ganz andere Werte und einen anderen Verhaltenskodex: Mut, Ehre, Ritterlichkeit. In Gedanken versetzte er mich zurück in eine Zeit, da die Polen sogar in größter Not zuversichtlich und stolz bleiben konnten. In der Trilogie wurden die Helden der Kriege gegen Kosaken, Tataren und Schweden zum Leben erweckt: unerschrockene Edelmänner, treue Diener, gewitzte Bauern und jungfräuliche Damen. Wenn ich heute die Trilogie wieder lese, fallen mir freilich ihre Schwächen auf. Die meisten von Sienkiewicz’ Figuren sind klischeehaft, oberflächlich und unglaubwürdig. So wissen wir von vornherein, daß Pan Zagłoba, der dicke, schlitzohrige Stutzer, in Wahrheit ein goldenes Herz hat, seinen Freunden immer treu bleiben und jede Krise souverän meistern wird. Jan Skrzetuski, streng und unbeugsam wie ein Römer, weicht dagegen niemals vom Pfad der Tugend ab und wird am Ende wieder mit seiner totgeglaubten Braut vereint. Und es muß so kommen, daß Pan Wołodyjow, ein kleiner Ritter und ausgezeichneter Schwertkämpfer, den Heldentod wählt und sich lieber selbst in die Luft jagt, als die Burg von Kamieniec Podolski den türkischen Belagerern zu überlassen. Meine Lieblingsfigur war Andrzej Kmicic, eine der wenigen Gestalten, die zwischen Gut und Böse hin- und hergerissen sind. Er ist ein Schelm, der während der schwedischen Invasion von 1655 durch eine List dazu getrieben wird, dem Verräter Prinz Janusz Radziwił zu dienen. Seine wunderschöne Verlobte Oleńka, eine von Sienkiewicz’ absurden, vor Vaterlandsliebe schmachtenden Frauenfiguren, will aber eher ins Kloster gehen, als einen Kollaborateur zu heiraten. Der Bruch zwischen ihnen wird noch vertieft, als sie von einem weiteren abtrünnigen Aristokraten erfährt, daß Kmicic versucht hat, den legitimen Fürsten umzubringen – obwohl Kmicic zu diesem Zeitpunkt wieder zum Pfad der Tugend zurückgefunden hat und täglich sein Leben riskiert, um das Kloster von Jasna Góra, wo sich die geheimnisvolle Ikone mit der schwarzen Madonna befindet, zu verteidigen. Schließlich finden die beiden natürlich wieder zueinander.
Die Trilogie mit ihrem altmodischen Patriotismus taugte kaum für den Lehrplan in den Schulen, war aber in den Buchhandlungen immer erhältlich (bis heute ist sie Polens bestverkaufter Titel aller Zeiten). Sie auf den Index zu setzen, wäre etwa genauso undenkbar gewesen wie ein Shakespeare-Verbot in England. In Übersetzung, zum Beispiel in der neueren englischen Ausgabe von W. S. Kuniczak, unterscheidet sich die Trilogie nicht nennenswert von anderen historischen Epen. Wäre Polen zur Zeit ihrer Entstehung ein freies Land gewesen, hätte man sie schlicht als die polnische Antwort auf Sir Walter Scott werten können. Statt dessen ist sie jedoch ein geradezu heiliges Buch, die Bibel des polnischen Patriotismus. Jeder polnische Jugendliche identifiziert sich insgeheim mit einem ihrer Helden; ihre Namen dienten sogar vielen Widerstandskämpfern im Zweiten Weltkrieg als Pseudonyme. Eine Idee, aber auch eine Nation, muß, damit Leute zu ihren treuen Anhängern werden können, nicht nur wahr oder gerecht, sondern auch attraktiv sein. Die Trostlosigkeit des Kommunismus sah gegen den Elan von Sienkiewicz’ altem Polen natürlich ziemlich alt aus.
Das andere große Epos aus dem 19. Jahrhundert, Pan Tadeusz (deutsch: Herr Thaddäus oder Der letzte Einritt in Litauen), stand dagegen sehr wohl auf dem Lehrplan. Es dreht sich um ein Landgut in Litauen, wo Angehörige des niederen und des Hochadels sich zum Diner treffen, auf die Jagd gehen, flirten, sich zanken und ihre Komplotte schmieden. Es endet damit, daß polnische Freiwillige die Russen verjagen und – was im weiteren Kontext etwas unmotiviert erscheint – Napoleon als Befreier bejubeln. So passierte es, daß uns in der einen Klasse von der unverbrüchlichen polnisch-russischen Freundschaft erzählt wurde, wir in der nächsten Klasse aber ein Gedicht auswendig lernen sollten, das nahelegte, ein sich selbst respektierender polnischer Aristokrat könne mit den Russen nur eins machen, und zwar das Schwert gegen ihn ergreifen. Nur einem Schwachkopf wäre der eklatante Widerspruch entgangen.
Ein Anhänger totalitaristischer Theorien hätte zu Recht monieren können, daß Polen nie ein wirklich totalitaristischer Staat war, da die Partei es versäumte, alle organisierten Autoritätsformen, die zu ihr in Konkurrenz traten, restlos auszumerzen – das galt besonders für die katholische Kirche. Die beiden letzten Jahrzehnte der kommunistischen Herrschaft, die siebziger und achtziger Jahre, während derer ich aufwuchs, werden womöglich einmal als das Goldene Zeitalter der katholischen Kirche in die Geschichte Polens eingehen. Die Unterdrückung durch die Kommunisten war damals nicht mehr so stark, als daß sie eine wirkliche Bedrohung für die Kirche dargestellt hätte, sie war aber immerhin noch drastisch genug, um die Kirche als Opfer erscheinen zu lassen und als einzige Institution, um die herum sich die Menschen versammeln konnten. Für mich bedeutete sie ein weiteres Gegenmittel gegen die Propaganda des Regimes.
Zunächst einmal waren zwei meiner Großonkel Priester. Der eine, Onkel Władek, arbeitete in der Bibliothek der Kathedrale von Gniezno als Konservator für alte Handschriften. Seine Amtsbezeichnung war Kanonikus in der Erzdiözese von Gniezno. Gniezno (Gnesen) war die Wiege des polnischen Christentums und die erste Hauptstadt Polens; das Erzbistum von Gniezno ist das älteste des Landes, und sein Name, abgeleitet von gniazdo (»Nest«), geht auf eine uralte Kultstätte zurück. Die Bibliothek befand sich in der Kathedrale selbst; sie verteilte sich über die Hohlräume direkt über dem Hauptschiff. Wenn ich ihn besuchte, nahm mein Onkel seinen schweren eisernen Schlüsselring und öffnete die Türen zu den Kammern, um mir ihren Inhalt zu zeigen. Dabei gingen wir auf schmalen Stegen über die gewölbte Decke der Kathedrale. Ich erinnere mich an illustrierte Pergamenthandschriften in Ledereinbänden, die ordentlich gestapelt in den Regalen lagen; an Blätter mit mittelalterlicher Kirchenmusik; Kirchenregister aus der Vorkriegszeit; Gebetbücher; theologische Schriften in fremden Sprachen. Mein Onkel beschwerte sich immer wieder darüber, daß für jeden Złoty, der für Restaurationsarbeiten ausgegeben wurde, eine Steuer von anderthalb Złoty an den Staat abgeführt werden mußte. Infolgedessen war ein Großteil der Sammlung dem Verfall ausgeliefert, was ich sehr bedauerte.
Nach unserem Besuch in der Bibliothek spazierten wir dann zur Wohnsiedlung, die zur Kirche gehörte. Die Gebäude waren jüngeren Datums – wahrscheinlich aus der Nachkriegszeit –, verkörperten aber einen traditionellen Baustil. Mit ihren spitzen Dächern, roten Ziegeln und Stuckarbeiten unterschieden sie sich jedenfalls himmelweit von den Bauten, die die Kommunisten schätzten. Das Mittagessen nahmen wir im gemeinsamen Speisesaal ein, wo Heiligenbilder die Wände schmückten und weiße Tücher die Tische bedeckten. Die Nonnen brachten uns fröhlich lächelnd eine wäßrige Suppe und zerkochte Knödel, und wir sprachen ein Gebet vor und nach der Mahlzeit.
Nach dem Essen begaben wir uns in die hübsche kleine Wohnung meines Onkels, die mit gediegenen alten Holzmöbeln eingerichtet war. Die Nonnen hielten alles sehr sauber. Mein Onkel kochte einen Tee und zeigte mir seine Alben mit Familienfotos. Es gab alte Porträts von meiner Großmutter in langem Pelzmantel und Hut; Fotos von meinem Onkel in langen Gewändern zusammen mit anderen jungen Männern des Priesterseminars und sogar Fotos aus der Zeit, als er als Zwangsarbeiter in Deutschland war. Er wurde dort jedoch gut behandelt und verbrachte einen Großteil des Krieges in einer Universitätsbibliothek. Auf den Fotos sahen die Leute irgendwie anders aus. Sie schienen fröhlicher und lebendiger als die Leute, denen man in den Straßen von Bydgoszcz begegnete.
Später sollte Onkel Władek den Auftrag erhalten, Kardinal Wyszyńskis handschriftliche Memoiren zu transkribieren. Der 1981 verstorbene Kardinal war in den fünfziger Jahren von den Kommunisten inhaftiert worden und hatte nach seiner Freilassung den heimlichen Widerstand der katholischen Kirche geleitet. Zwei Nonnen halfen meinem Onkel bei dieser Arbeit. Alle mußten sich zu absoluter Verschwiegenheit verpflichten. Die Tagebücher sollen erst im Jahr 2011, dreißig Jahre nach Wyszyhskis Tod, veröffentlicht werden.
Onkel Władeks Bruder, Onkel Roman, war ein engagierter Pfarrer in Inowrocław. Nach zwanzig Jahren hatte er die halbe Stadt dazu bewegen können, ihm bei der Instandsetzung der romanischen Kirche zu helfen, die seit dem Mittelalter eine Ruine gewesen war. Sogar mein Vater, ein unverbesserlicher Atheist, erklärte sich bereit, unentgeltlich die Pläne für eine Heizanlage zu zeichnen – »einfach um die Roten zu ärgern«, wie er meinte. Zusammen mit meiner Großmutter habe ich Onkel Roman oft besucht. Wir wohnten dann im Pfarrhaus, wo seine Haushälterin sich um uns kümmerte. Morgens verschwand mein Onkel in aller Frühe, um die Messe vorzubereiten. Später am Tag sahen wir ihn dann wieder, wenn er in seinem Ornat am Altar der großen Kirche im Zentrum der Stadt stand. Anschließend besichtigten wir die romanische Kirche, deren Restauration damals bereits im Gange war. Über dem Eingang zur Sakristei waren Teufelsfratzen mit Hörnern in den Granit gemeißelt; eine von ihnen sah genauso aus wie meine Lehrerin Skarpeta, die Socke.
Mein Vater war vor dem Krieg Meßdiener gewesen. Er hatte sich aber von der Kirche abgewandt, nachdem er Zeuge geworden war, wie ein Priester sich an der von der Gemeinde gespendeten Kollekte bedient hatte. Sonntags fuhr er gerne zum Angeln an einen der Seen, die rings um Bydgoszcz lagen. Meine Großmutter kümmerte sich um meine religiöse Erziehung. Von ihr lernte ich, mich zu bekreuzigen, und das tägliche Morgen- und Abendgebet. Während mein Vater mit einem Hecht oder einem Karpfen kämpfte, schlossen wir uns oft den Kirchgängern an.
Unsere Pfarrkirche war die Basilika von Bydgoszcz. Vor dem Krieg hatten nach Amerika ausgewanderte Polen ihren Bau durch großzügige Spenden ermöglicht; sie gehörte zum Orden vom hl. Vinzenz von Paul. Das Kreuz auf der riesigen Kuppel war kilometerweit zu erkennen. Tausende von Menschen fanden in der Basilika Platz; jede Messe zog Hunderte von Familien an, die im Sonntagsstaat aus allen Himmelsrichtungen in die Kirche strömten. Väter schoben Kinderwagen vor sich her, während die Mütter mit verstohlenen Blicken prüften, ob Freunde und Bekannte ihr schmuckes Aussehen oder ihre neuen Kleider auch gebührend würdigten. Jedesmal schien es, als hätte sich die ganze Stadt versammelt. Man hätte eher den Eindruck gewinnen können, Zeuge einer nationalen Rückkehr zum Glauben zu sein, als in einem kommunistisch regierten Land zu leben. Obwohl die Kirche groß genug war, um die ganze Gemeinde aufzunehmen, fanden neben den Hauptgottesdiensten am Vormittag auch Frühgottesdienste um fünf Uhr dreißig oder sechs Uhr statt. Meine Großmutter erklärte mir, daß diese Messen für Mitglieder der Kommunistischen Partei gedacht waren, die ungern gesehen werden wollten. So früh am Morgen war es ihnen möglich, heimlich hinter einer Säule dem Gottesdienst beizuwohnen.
Die Basilika war zwar sehr groß – neben dem Säuleneingang befanden sich zwei mehrstöckige Seitenflügel –, doch die Außenmauern aus nacktem Backstein waren genauso karg wie das Innere der Kirche mit der weißgetünchten Kuppeldecke und einem Boden aus rohem Beton. Gigantische Heiligenstatuen aus Gips verharrten unter Rundbögen im kreisförmigen Hauptschiff. Meine Großmutter hatte eine besondere Vorliebe für den hl. Judas, den Schutzpatron der Verzweifelten und der hoffnungslosen Fälle, vor dessen Statue ich unzählige Stunden mit dem Beten von Rosenkränzen verbracht habe. Mein Gewissen rang mehr als einmal mit meiner Habsucht, als ich Münzen vom mühselig – mit dem Sammeln von Pfandflaschen – verdienten Taschengeld abzwackte, um sie in den dunklen Opferstock neben dem Judasaltar zu werfen.
Während die Schule unermüdlich ihren Hirnwäscheversuch betrieb, wurden mir nach Schulschluß im Kommunionsunterricht traditionelle moralische Werte nahegebracht. Der Fußweg zur Basilika dauerte eine gute halbe Stunde, und wir wurden dort in kleinen Räumen zusammengepfercht, doch das war alles nicht schlimm. Unsere Schullehrer lehnten den Kommunionsunterricht ab, und schon deshalb gab uns die Teilnahme daran ein wunderbar rebellisches Gefühl. Wir warteten geduldig auf dem Flur im vierten oder fünften Stock in einem der Seitenflügel der Kirche, bis ein Priester oder eine Nonne uns auf altmodischen Schulbänken Platz nehmen ließ. Wir lauschten vielen Bibelgeschichten, doch aus der Schrift selbst wurde nicht gelesen. Außerdem lernten wir den Katechismus in einer Fassung für Kinder aus der Zeit um 1590. Intellektuell gesehen wurde ich in diesem Unterricht nur ein einziges Mal wirklich angeregt. Unser Priester, den wir wegen seiner unnatürlich roten Backen den »Säufer« nannten, lehrte uns Beweise für die Existenz Gottes, die vor allem den Sinn hatten, uns gegen den in der Schule verbreiteten darwinistischen Unfug zu immunisieren. Besonderes Gewicht legte er auf das Argument der zweckgerichteten Ordnung der Welt (die Welt sei so komplex, daß sie einen zwecksetzenden Geist unterstelle). Der Säufer fügte an dieser Stelle einen schlagenden Beweis hinzu. »Seht her«, rief er begeistert, stellte sich hin und breitete die Arme aus, »Gott beweist uns seine Existenz sogar durch die Form unserer Körper«, und er strahlte uns triumphierend an. »Bedenkt, daß euer eigener Körper die Form des Kreuzes hat!«
Wie die meisten meiner Freunde ging ich im Alter von zehn Jahren zur ersten Kommunion. Für diesen Anlaß bekam ich meinen ersten Anzug. Vorher wurden wir noch über die Todsünden aufgeklärt, die die Teilnahme an der Kommunion ausschlossen, und über die läßlichen Sünden, die verzeihlich waren und nicht erforderten, daß man vorher noch einmal zur Beichte ging. Eine Woche vor dem großen Tag bildeten wir von zwei Seiten eine Schlange vor dem neobarocken Beichtstuhl, in dem sich sowohl links als rechts neben dem Priester eine Kabine befand. Während auf der einen Seite jemand seine Reue bekundete und sein Schlußgebet sprach, konnte sich der Beichtvater auf der anderen Seite bereits einer weiteren Sündenlitanei widmen.
Wie alle anderen auch bereitete ich mich auf meine erste Beichte vor, indem ich meine Vergehen auf einem Zettel auflistete und dazu die passenden Abbitteformeln schrieb, nur für den Fall, daß mich mein Gedächtnis im Stich ließ. Das Notieren seiner Sünden war zwar genauso verpönt wie das Abschreiben in der Schule, aber die Beichte war ja anonym, und sollten wir rein zufällig auf einen unserer Priester aus dem Unterricht stoßen, so hätte er uns an unserem Flüstern sowieso nicht erkennen können. Auf dem Weg in die Kirche umklammerte ich den Zettel fest in der Hosentasche, denn ich hatte schreckliche Angst, daß er herausfallen und von einem Klassenkameraden gefunden werden könnte, der meine Schrift kannte. Würde Gott mir vergeben, daß ich während einer Pause auf der Schultoilette geraucht hatte? Und was war mit dem Schuleschwänzen in mehreren Fällen? Wenn Gott mir nur erlaubte, einen neuen Anfang zu machen, wollte ich fortan ein guter Junge sein! Ich wollte mich wirklich bessern. Ich hörte ein Klopfen an der Wand des Beichtstuhls und lateinische Worte, die für mich gesprochen wurden. Nach einer sanften Ermahnung sagte der Priester mir, wie ich Buße zu tun hatte. Ich stand zitternd auf und taumelte aus dem Beichtstuhl mit einem Gefühl von Glückseligkeit und Reue, das so stark war, daß ich fast vergessen hätte, das Zertifikat mitzunehmen, das mich zur Teilnahme an der ersten Kommunion berechtigte. Ich würde sagen, daß eine ordentliche Beichte den Geist wirksamer befreit als eine monatelange Psychoanalyse.
Die Zeremonie war ein spektakuläres Ereignis. In langen Reihen schritten wir – Jungen in identischen Anzügen und Mädchen in weißen Kleidern, alle mit einer großen Kerze in der Hand – auf die Balustrade zu wie ein Ensemble von Tänzern in einer riesigen Ballettproduktion.
Für die meisten Leute war nach der Grundschule Schluß mit dem Religionsunterricht, aber ich machte aus eigenem Antrieb weiter. Während unsere rebellischen Zeitgenossen im Westen sich anarchistischen Gruppierungen anschlossen oder Drogen durchprobierten, äußerte unser Protest sich darin, daß wir Pilgerfahrten unternahmen, einen Straßenaltar für die Corpus-Christi-Prozession bastelten oder die Kapelle kehrten. In einer feierlichen Zeremonie wurde ich mit vielen anderen Jugendlichen firmiert, indem uns der Bischof der Reihe nach heiliges Öl auf die Schläfe rieb. Ich besuchte auch die übliche voreheliche Beratung, die allerdings für mich zum damaligen Zeitpunkt rein theoretischen Charakter besaß. Dort bekamen wir einige nützliche Ratschläge. Zum Beispiel sollte man nach einem Streit mit seinem Ehepartner niemals schlafen gehen, ohne sich vorher zu versöhnen. Das Kapitel Empfängnisverhütung kam jedoch etwas zu kurz, sowohl in der Schule als auch in der Kirche, und als ich mit achtzehn Jahren in England eintraf und zum ersten Mal von der »Temperaturmethode« hörte, mußte ich wohl annehmen, daß es sich dabei um besonders heißen Sex handelte.
Die Kirche behielt immer die Oberhand im Kampf um meine Seele. Wo die Schullehrer versuchten, uns den Kommunismus in die Köpfe zu hämmern, und einen abstrusen Jargon benutzten, gespickt mit Begriffen, die sie selbst kaum verstanden, dort sprachen die Priester ein einfaches Polnisch und Wörter, die eher auf das Herz zielten als auf den Kopf. Die Lehrer verkündeten Theorien, die Priester erzählten Geschichten von Menschen, auch wenn es sich um Menschen handelte, die seit langem tot waren. Die unbeholfenen Bemühungen der Schule waren nichts gegen die bedingungslose Hingabe und die geschickten Methoden meiner Großmutter. Sie löste in mir pawlowsche Reflexe aus, indem sie mir jedesmal ihre Anerkennung spendete – oder eine Tafel Schokolade, zu der Zeit eine seltene Delikatesse –, wenn ich zur Beichte gegangen war oder die gewünschte gute Tat vollbracht hatte.
An einem Tag im Jahre 1978 stand die Hegemonie der Kirche über meine Seele ein für allemal fest. Ich war in meinem Zimmer und wollte schnell meine Hausaufgaben machen, damit ich später einen Fernsehfilm sehen durfte. Plötzlich hörte ich, wie meine Mutter nebenan einen Schrei ausstieß. Ich eilte ins Wohnzimmer, wo meine Eltern am Schwarzweißfernseher klebten. Wie die meisten Menschen in Polen guckten sie die Abendnachrichten um halb acht. Der Nachrichtensprecher, der Tag für Tag die immergleichen Lügen herunterleierte, war feierlicher gekleidet als sonst und hatte neben sich auf seinem Pult einen Blumenstrauß. Normalerweise las er die Nachrichten mit versteinerter Miene, doch diesmal schien er durch irgend etwas gerührt zu sein. In seiner Stimme klang ein gewisser Stolz durch, daran bestand kein Zweifel, auch wenn sich nicht sagen ließ, ob er echt oder nur geheuchelt war. Jedenfalls wußte ich immer noch nicht, was passiert war, als auf einmal Bilder aus Rom eingespielt wurden, vom Balkon am Petersplatz und dann von einem Geistlichen, der sich an die gigantische Menschenmenge auf dem Platz wandte.
Der Geistliche verkündete: »Habemus Papam«, und die Menge schwieg. Er schielte auf einen Notizzettel und gab sich Mühe, den Namen des frischgewählten Papstes richtig auszusprechen: »Karol Wojtyła.« Die Menge zögerte einen Moment lang – offenbar überrascht durch die getroffene Wahl –, doch dann entbrannten ein Beifallssturm und ein Blitzlichtgewitter. Nur Sekunden später erschien das wohlvertraute Gesicht des Erzbischofs von Krakau, der die Zuschauer auf dem Platz segnete. Meine Eltern, sogar mein Vater, weinten vor Freude. Bis spät in die Nacht riefen Freunde und Verwandte an, um sich über die großartige Nachricht zu unterhalten.
Am nächsten Morgen, als ich mit der Buslinie 52 zur Schule fuhr, spürte ich zum ersten Mal die himmelweite Kluft zwischen »uns«, dem Volk, und »ihnen«, den Herrschenden. »Wir« bildeten die Mehrheit der Passagiere auf der normalerweise trostlosen Fahrt; doch diesmal lächelten wir fröhlich, sprachen wildfremde Leute an und tauschten uns über das freudige Ereignis aus. »Sie« waren ein paar finster dreinblickende Gestalten im hinteren Teil des Busses, die an einer Haltestelle vor dem protzigen weißen Hauptquartier der Staatssicherheit ausstiegen.
Als der Papst im Jahr darauf nach Polen kam, reiste ich zum Flugplatz von Gniezno, um ihn zu sehen. Sein weißer Hubschrauber landete vor den Augen von weit über einer Million Menschen, die ihm begeistert zujubelten. Freiwillige Ordner mit Armbinden in päpstlichem Weiß-Gelb wiesen uns auf unsere Plätze. Die Polizei ließ sich nicht blicken, wahrscheinlich, um keine politischen Demonstrationen zu provozieren, und doch gab es keinerlei Zwischenfälle. Nach der im Freien abgehaltenen Messe marschierte die Menge in die wenige Kilometer entfernte Altstadt von Gniezno. Auf halber Strecke kletterte ich mit meinem Freund Wojtek auf einen Baum. Soweit das Auge blicken konnte, war es schwarz von Menschen. Wir fühlten die enorme Macht der Masse, ohne daß sie bedrohlich gewirkt hätte. Hier waren gänzlich unaufgefordert mehr Menschen zusammengeströmt, als ich je bei den Maiparaden gesehen hatte. Uns wurde zum ersten Mal bewußt, daß »wir« zahlreicher waren als »sie«.
Später standen wir jubelnd auf dem Platz vor dem Sitz des Erzbischofs und warteten darauf, daß der Papst sich der Menge zeigen würde. Es war ein Treffen mit der Jugend vorgesehen; Schüler- und Studentengruppen spielten Gitarre und sangen Lieder. Dann erschienen zwei Gestalten auf dem Balkon: der Papst und, im purpurroten Gewand eines Kardinals, Primas Wyszyński, der Mann, dem es gelungen war, sogar während der schlimmen Verfolgungen der fünfziger Jahre die Unabhängigkeit der Kirche zu bewahren. Der Papst machte ein fröhliches Gesicht; es war ihm anzusehen, daß er am liebsten zu uns heruntergekommen wäre. Wyszyński war dagegen einer von der alten Schule. Wie ein römischer Kaiser grüßte er mit erhobener Hand die ausgelassene Menge, die augenblicklich verstummte. Was Wyszyński sagte, weiß ich nicht mehr, aber die unerschütterliche Autorität, die er ausstrahlte, hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck.
Als wir nach Hause kamen und von den riesigen Menschenmengen beim Papstbesuch erzählten, glaubten unsere Eltern, daß wir maßlos übertrieben. Im Fernsehen waren Bilder gezeigt worden, nach denen nur Nonnen und Rentner der Messe in Gniezno beigewohnt hatten. Diesmal gingen die Lügen einfach zu weit. Für Millionen Menschen, die sich sonst kaum Gedanken über die Manipulation der Medien machten, war der Schwindel jetzt unübersehbar. An diesem Tag mit seiner friedlichen Versammlung fühlten Millionen Polen, daß sie zusammen stark waren – ein Gefühl, das sicherlich zur Gründung von Solidarność im Jahr darauf beitrug.
* Den Hinweis auf die Geschichte von Matolek und auf die Eingriffe der Zensur verdanke ich einem Artikel von Violetta Bukowska aus der katholischen Zeitung Słowo (August 1994).
** Dies war nicht der einzige Aspekt des Zweiten Weltkriegs, der im kommunistischen Geschichtsunterricht der Zensur zum Opfer fiel. Im Rückblick ist es kaum zu glauben, aber in der Schule haben wir nichts darüber erfahren, daß Juden im besetzten Polen gezielt verfolgt und in den nationalsozialistischen Lagern ermordet wurden. Unsere Lehrer durften uns nur erzählen, daß sechs Millionen »polnische Bürger« im Krieg umgekommen sind. Daß die meisten der Opfer Juden waren, erfuhr ich erst aus Büchern von antikommunistischen Emigranten und aus Samisdat-Schriften. Allerdings sind wir nicht die einzigen, die schlecht informiert wurden. In Polen bin ich meines Wissens nach nie einem Juden begegnet – die jüdischen Gemeinden waren in Westpolen nie besonders umfangreich gewesen, auch nicht vor dem Holocaust. Als ich 1983 in Oxford zum ersten Mal einen Juden traf, war der erste Satz, den er mir entgegenschleuderte: »Ihr Polen seid doch alle Antisemiten!«