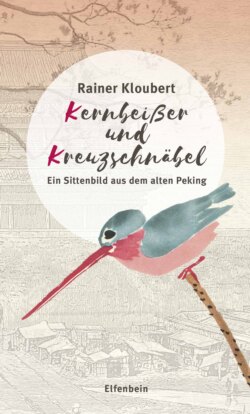Читать книгу Kernbeißer und Kreuzschnäbel - Rainer Kloubert - Страница 5
ОглавлениеVorbemerkung
Auch ich bekam eine Einladung nach China, als das Land sich wieder zu öffnen begann. Schon mein Großvater und mein Großonkel waren dort gewesen, eine Familientradition. Ich nahm die Einladung an und flog hin – über Bukarest, den Himalaja und Urumtschi, die Ohren voll vom Dröhnen der Motoren und von alten Geschichten.
Dem Land waren nach der Kulturrevolution die Wörter zur Verständigung mit den Barbaren ausgegangen: Mit den alten allein ging es nicht mehr, die Welt hatte sich weitergedreht. Und die Wörterbücher waren Makulatur geworden, weil Mao Zedong die alten Schriftzeichen abgeschafft und neue eingeführt hatte.
Das Fremdspracheninstitut (外语学院), wo sich die Redaktion befand, in der ich einen Platz bekam – mir gegenüber saß ein mongolischer Prinz, dem in der Kulturrevolution die Zähne ausgeschlagen worden waren; er hatte in Schlesien sein Abitur gemacht –, lag nicht weit entfernt vom »Park zu den Duftenden Bergen« (香山公园), einer Pekinger Hügelkette, von der ich schon als Kind geträumt hatte: Zu meinen frühen Leseerinnerungen zählte ein Buch über die Abenteuer eines deutschen Jungen während des Boxeraufstands. Die Abenteuer habe ich vergessen, nicht aber die bunte Karte eines von Mauern umgebenen Parks. Das Innere bestand aus Dutzenden von Anwesen, jedes einzelne wieder von Mauern umschlossen. Eine große Welt und in ihr viele kleine – achtundzwanzig, ich zählte sie mit dem Finger, um sicherzugehen: genau achtundzwanzig. Ich konnte mich an ihnen nicht sattsehen. Das Buch hatte ich aus der Stadtbibliothek, und ich lieh es mir immer wieder aus, nur um die Karte zu studieren und mir auszumalen, wie es wohl gewesen wäre, hätte ich zur Zeit der Boxer in Peking gelebt.
Ein zweites Mal stieß ich auf die Karte unter den Papieren meines Großonkels, ein drittes Mal auf einer Anschlagtafel vor dem »Park zu den Duftenden Bergen« (香山公园) selbst. Es musste wohl etwas bedeuten, war mir durch den Kopf gefahren, als ich davorstand. Ein kommendes Unheil, das seinen Schatten vorauswarf? Unwillkürlich trat ich drei Schritte zurück.
In den nächsten Monaten und Jahren durchstreifte ich an Wochenenden die »Duftenden Berge«: Verfallene chinesische Tempel, eingestürzte europäische Sommerresidenzen, Reste eines tibetischen Klosters, zusammengefallene Mauern, hinter denen sich nur noch Fundamente verbargen; Pagoden aus glasierten Ziegeln mit zugemauerten Eingängen. Steinerne Schildkröten blickten mich höhnisch an, als ich vor Freitreppen stand, die jäh aufhörten; abgerutschte Terrassen dahinter, und dazwischen, wie Zeugen, denen man kein Wort glaubt: Kiefern, Fichten, Föhren, Lärchen, Pappeln und Buchen, die meisten von ihnen vernarbt, verwundet oder verkrüppelt. Hin und wieder kam mir ein Zug von Kamelen entgegen, die Säcke voller Kohle aus den Westbergen in die Kompressorenfabrik Nr. 23 brachten, ein ehemals buddhistischer Tempel am Fuße der Westberge. Sie schritten gemächlich aus, Schritt für Schritt, man hörte die Tritte nicht – nur das »dang dang dang« (当当当) des Glöckchens am Nacken des Leitkamels. Eilig schienen sie es nicht zu haben, nur manchmal, wenn sie einem Auto ausweichen wollten, was selten geschah, setzten sie sich für ein paar Schritte in Trab: ein unziemlicher Anblick, wie eine alte würdevolle Tante, die auf einmal zu rennen beginnt. Die Kohle, die sie in die Fabrik brachten, von braunschwarzer Farbe und wächsernem Glanz, gab weder Rauch noch Flammen von sich. Sie hatte früher, zu Kaisers Zeiten, in Becken angezündet ausschließlich zur Beheizung der Räume der Verbotenen Stadt und des Sommerpalastes gedient.
Im Hof der Fabrik blieben die Kamele stehen und warteten stumm auf das Kommando ihres Führers; er trug einen Mantel aus Schaffellen, deren haarige Seite nach innen gekehrt war, und sah genauso zottelig aus wie seine Kamele. Wenn das Kommando erklang – »sssssssss« – knieten sie sich hin, zuerst mit den Vorderbeinen, dann mit den Hinterbeinen. (Beim Aufbruch war es umgekehrt: zuerst die Hinterbeine, dann die Vorderbeine.) Ich hatte oft dabei zugesehen. Erst wenn sie sich niedergekauert hatten, nahm der Führer seine Pelzmütze ab; von seinem kahlen Schädel stieg ein Dampfwölkchen auf, das sich sofort in der kalten und trockenen Luft auflöste. Weiße Eiszapfen klimperten an den Kinnladen. Was für zottelige Köpfe, hatte ich gedacht, was für lange, gelbe Zähne. Die oberen Zähne mahlten nach rechts, die unteren nach links, dann wieder umgekehrt; man hörte keinen Ton, sie kauten so geräuschlos, wie sie auch gingen. Ich war so fasziniert von dem Mahlen der Zähne, dass ich es unwillkürlich nachahmte.
Eines Tages, als ich wieder einmal, den Kopf voll von chinesischen Zeichen, in den »Duftenden Bergen« spazierenging, begegnete ich mitten im Wald einem Mann, der einen Käfig trug, in dem ein Vogel saß. Ein Kanarienvogel, dachte ich, wie sie auch in meiner Heimat in Käfigen gehalten wurden – aber es war kein Kanarienvogel, sondern ein Rotkehlchen. Es war auch sonst ein Tag voller merkwürdiger Begegnungen gewesen, jede hatte mit der anderen in einem wunderlichen Zusammenhang gestanden.
Ein schmaler Ziegenpfad hatte entlang eines ausgetrockneten Bachbetts durch Geröll und Gebüsch steil nach unten geführt. Die Erde war noch feucht und glitschig von einem Sommerguss, man musste aufpassen, dass man nicht ausrutschte: die Füße quer setzen und sich von Baum zu Baum hangeln (wie es viele vor mir getan hatten, die Rinde an den Bäumen war glatt und abgewetzt), Schritt für Schritt, der Schweiß rann mir über das Gesicht.
Ich war nicht allein. Ein Spaziergänger, der hinter mir den Pfad herunterschritt – in China ist man nie allein –, sang schallend ein Lied. Nicht »Der Osten ist rot« (东方红), das einem überall in Peking entgegenschallte, sondern (ich horchte auf): »Dort in der weiten, weiten Ferne, wo ein Mädchen auf mich wartet …« (在那遥远的地方/有位好姑娘 …) Eine Volksweise aus Chinas Westen. Ich blieb stehen und lauschte der Melodie, irgendwie kam sie mir vertraut vor, die weiche und volle Stimme brachte das Lied trefflich zum Ausdruck.
Am Wegesrand stand ein Pavillon, von dessen Säulen die rote Farbe abblätterte; das braune Leinwandgewebe, auf das die Farbe aufgetragen worden war – eine traditionelle Mischung aus Schweineblut und Klebemitteln –, kam darunter zum Vorschein. Ein Mann und eine Frau saßen jeder für sich zwischen zwei Säulen, beide starrten schweigend in die Landschaft, mit dem Rücken zu mir wie auf einem Gemälde von Caspar David Friedrich: Wanderung in den Westbergen. Ich setzte mich dazu, um dem Lied weiter zu lauschen, irgendwo hatte ich es schon einmal gehört. Die Säulen waren übersät mit Graffiti, die Rote Garden mit Schraubenziehern eingekratzt hatten. Es waren die von Mao Zedong eingeführten verkürzten Schriftzeichen – die langen waren für Graffiti zu kompliziert.
Es stank zum Himmel, ich senkte meinen Blick: Fäkalienhaufen, einer neben dem anderen, dicke Fliegen schwirrten darüber, der Boden war bedeckt mit weißen Papierknäueln.
Das Lied kam langsam die Kurve hinunter: »Dort in der weiten, weiten Ferne …« Ich blieb sitzen und summte die Melodie mit, jeder von uns dreien blickte gedankenversunken in eine andere Himmelsrichtung: »Dort in der weiten, weiten Ferne …«, das Lied näherte sich und wurde lauter, »wo ein Mädchen auf mich wartet …«
Ich stand auf und setzte meinen Spaziergang fort. Das Volkslied wurde wieder leiser und verstummte, an seine Stelle traten andere Klänge. Koloraturen der Pekingoper, immer wieder dieselben, so als würde jemand »solfeggieren« (唱名法, sich warm singen). Ungewohnte Klänge, damals, am »Schwanz der Kulturrevolution« (文化大革命的尾巴), genauso aus der Zeit gefallen wie das Volkslied, das ich eben noch gehört hatte. Ich blieb stehen, lauschte und ging der Stimme nach. Plötzlich setzte sie aus, ein grunzendes Räuspern ertönte, ein klatschendes Spucken, ein erneutes Räuspern, dann wieder die Koloraturen. Ich ging schneller, die Stimme kam näher, eine biegsame, die Tonhöhe des Falsetts mühelos festhaltende Stimme. Der Pfad krümmte sich, und ich stand auf einmal vor der Ruine einer Kirche. In den Westbergen gab es eine ganze Reihe von ihnen, Hinterlassenschaften der vielen Missionare, die es einmal überall in China gegeben hatte. Nur die Wände standen noch, ein längliches Viereck, unterteilt in Mittelschiff, Vierung und Apsis. Neben dem Eingang lag, umgeben von Dattelbüschen, ein umgestürzter Grabstein mit einer lateinischen Inschrift, deren Buchstaben zum Teil verblichen und nicht mehr zu entziffern waren:
A L M
N E A M E T E L –
Hollande
LE 28 NO V E M B R T
1877
D E C E E A
H E S H A N H U
LE 26 A O U T 1047
R. I. P.
1047? Das Sterbejahr konnte es nicht sein, das war 1877 – aber wofür sonst stand die Zahl? Vielleicht sollte es 1847 heißen, das Geburtsjahr; er wäre dann nur dreißig Jahre alt geworden.
Ich bückte mich unwillkürlich, und der Gesang brach ab, erneut das grunzende Räuspern, gefolgt von dem schleimigen Spucken, in dem Chinesen Meister sind. Neugierig machte ich ein paar Schritte auf das Gebäude zu. Ein Mann in einer blauen Schlossermontur mit langen abstehenden Armen, die wie die eines Gorillas aussahen, blickte mich an. Er war unrasiert und trug eine Brille mit dicken Gläsern. Seinen Oberkörper nach vorne biegend, ging er in die Knie, als wollte er im nächsten Augenblick zum Sprung auf mich ansetzen. Der Planet der Affen? Vor ihm stand auf einem steinernen Aufbau, der wohl einmal ein Altar gewesen war, der Vogelkäfig mit dem Rotkehlchen. Ein eleganter Käfig, der purpurviolett lackiert war und vorher einem chinesischen Pensionär aus der Kaiserzeit gehört haben mochte, einem Mandschu mit langem Zopf und flatternden Ärmeln.
Nachdem wir uns eine Weile wie Erscheinungen angestarrt hatten, fragte ich ihn, ob er Sänger sei. Zögernd antwortete er:
»Ich singe nur für mich allein, eigentlich bin ich ein Arbeiter.«
»Ein Arbeiter – kein Sänger?«
Der Mann nickte, und ich fragte, wie und von wem er das Singen gelernt habe.
»Von Vögeln.« Er zeigte auf den Käfig mit dem Rotkehlchen. Dann, als wären wir immer noch in der Kulturrevolution, wieder die Beteuerung, dass er wirklich nur ein Arbeiter sei.
»Wo, ein Arbeiter?«
»In der Kompressorenfabrik Nr. 23.«
Wohin die Kamele Kohle brachten. Ich machte wieder ihre mahlenden Kiefer nach, ohne dass ich mir dessen bewusst wurde. Seine Augen wanderten hin und her, er wirkte verstört. Um das Gespräch nicht abbrechen zu lassen, fragte ich ihn nach dem Vogel. Ein Rotkehlchen? Er wandte sich ab, ohne eine Antwort zu geben, griff nach dem Käfig, schritt den Berg hinauf, den gleichen Weg nehmend, den ich nach unten gekommen war. Ab und zu bückte er sich, pflückte eine wilde Dattel und steckte sie in den Mund.
Ich ging weiter. Nach ein paar Schritten drehte ich mich um. Der Mann, der wie ein Gorilla mit Brille ausgesehen hatte, war wie vom Erdboden verschwunden.
Aus dem ausgetrockneten Bachbett war eine Schlucht geworden, ich bahnte mir vorsichtig einen Weg. Die Gegend war früher ein kaiserlicher Jagdpark gewesen.
Die Kaiser von China?
In den Westbergen waren sie immer noch gegenwärtig, überall stieß man auf kaiserliche Wegmarken.
Ein Stein an einer Wegbiegung war mit einer Inschrift und dem großen, viereckigen Siegel des Kaisers Qianlong (乾隆) versehen. Ich trat näher. Ein Gedicht auf den Sonnenaufgang, eingerahmt von Weisheiten, die das einfache Leben verherrlichten: »Zu großer Pomp in den Palästen der Herrscher, Armut und Elend in den Hütten des Volkes!« In seinem Leben hatte er vierzigtausend Gedichte geschrieben. Auch sein Nachfolger Mao Zedong hatte unablässig Gedichte produziert: Berge im Nebel, Sonnenaufgang, Wildgänse, fallende Blätter, Flussufer, eine Pagode, Abschied von einem Freund, eingestreute Sentenzen über Vergängliches und das Leben im Volk – und immer wieder Berge und das Wolkenmeer unter den Gipfeln, oft mit einer Widmung an einen Kampfgenossen. Freunde hatte er nicht.
Nach ein paar Minuten holte mich das Volkslied wieder ein: »Dort in der weiten, weiten Ferne …«
Auf einmal fiel mir ein, woher ich das Lied kannte. Ich hatte es oft in Taiwan gehört, als ich dort Chinesisch lernte. Wang Luobin (王洛宾, 1913–1996), der es populär gemacht hatte, war ein Sammler von alten Weisen, Liedermacher, Gitarrist und Sänger gewesen, ein chinesischer Bob Dylan, beide hatten das gleiche langgezogene, von Falten und Furchen gezeichnete Gesicht – Spuren von immer wieder gesungenen Liedern? Bei Wang Luobin eher Zeichen einer langen Lagerhaft. Ihm war vorgeworfen worden, zur Ermordung Mao Zedongs aufgerufen zu haben. Ein absurder Vorwurf in einer absurden Zeit. Einem seiner Lieder hatte er in der »Hundert-Blumen-Kampagne« (百花齐放) den Titel gegeben: Salaam (der moslemische Gruß) dem Vorsitzenden Mao (萨拉姆毛主席: »salamu Maozhuxi«): In Shanghai oder Kanton gesungen, klangen die Worte wie »Tötet den Vorsitzenden Mao« (杀了毛主席: »shale Maozhuxi«).
Etwa um die gleiche Zeit, als in China die hundert Blumen blühten und der Liedermacher Wang Luobin der versuchten Ermordung Mao Zedongs bezichtigt wurde, ging ich in die Sexta des Kaiser-Karls-Gymnasiums in Aachen, wo ein Lehrer uns mit den Grundlagen der lateinischen Grammatik vertraut machte. Ein Koloss, unter dessen weicher Schale sich ein noch weicherer Kern verbarg. Spitzname: »Flohmatsch«. Er war es gewesen, wurde gemunkelt, der für die lokale Brauerei den Werbespruch verfasst hatte:
Für ein lebenslanges Deputat, hieß es weiter, von Spöttern, die einen zweiten Vers dazu dichteten: »Oma wurde hundertzehn, � hatte Degraa nie gesehn.«
Er war nicht nur Lateinlehrer, sondern auch ein Linguist (Fachgebiet Phonologie) und Mundartforscher (Öcher Platt, i. e. Ripuarisch). Den staunend lauschenden Sextanern erzählte er die Geschichte eines Kongresses, zu dem Vertreter der Vogelwelt eingeladen worden waren, um die Regeln eines geordneten Umgangs miteinander (Grammatik) festzulegen. Sperling, Schwalbe, Amsel, Fink und Star, auch seltene Arten wie Rabe, Pirol, Neuntöter etc., jede Art hatte eine Abordnung geschickt. (Aus den einzelnen Vogelarten wurden im Verlauf der nächsten Stunden Wortarten wie Substantive, Adjektive, Verben etc.). Je kleiner die Vögel, desto größer ihre Abordnung, sagte »Flohmatsch« und zeigte mit dem Zeigestock auf die Sperlinge, die er mit bunter Kreide auf die Tafel gemalt hatte. Er machte sie nach: Er war ein Freizeitornithologe und Vogelstimmenimitator, ungeahnt zarte Klänge entfuhren seinem schweren Körper. Dann ließ er ein »sssssssssss« ertönen. Der große Laubenvogel aus Papua-Neuguinea, erfuhren wir, eine Paradiesvogelart (der dritte in der vorletzten Reihe von oben, der wie ein Indianer aussah), »ein Irrgast«, sagte er, ein Wort, das er mit rollendem »r« wiederholte.
Was ein Irrgast war, erklärte er nicht, sondern zählte stattdessen die Federn des Krönchens. »Genau sechs«, sagte er, drei auf jeder Seite, »ssssssechs«, zischend wie die beiden großen schwarzen Kobras in Kiplings Geschichte Rikki-Tikki-Tavi, die er uns in der nächsten Stunde vorlas – er unterrichtete auch Deutsch. Einmal machte er den Mungo nach, dann wieder die Schlangen. (Man merkte es ihm an, dass er lieber eine Schlange war.)
Als das »sssssssssss« des sterbenden Schlangenweibchens ausgeklungen war, kam ihm eine Idee (jedenfalls tat er so, als sei sie ihm gerade gekommen): Wir sollten das »sssssssssss« zeichnen – mit Papier und Bleistift, das Zischen der Schlangen im Kampf gegen den Mungo Rikki-Tikki-Tavi – ein gleichbleibend hohes »sssssssssss«. Was er nicht wissen konnte (ich damals auch noch nicht): ein in China sehr geschätzter Laut von Blaukehlchen (蓝点颏, Luscinia svecica), gleichzeitig (色色色, »sssssss sssssss sssssss«) das bereits erwähnte Kommando für Kamele, sich niederzukauern, wenn ihnen abends die Lasten abgenommen wurden.
Inspiriert von den beiden Schlangen in Kiplings Geschichte, ein Männchen und ein Weibchen, präsentierte ich als Einziger zwei Versionen. Ich wurde »entzückt« nach vorne gerufen und zärtlich getätschelt (damals durften Lehrer das noch). Meine Lösung für das Männchen: ein langer durchgehender Strich:
____________________
Für das Weibchen: eine gezackte Linie (von der Lichtenberg sagte, dass ihn eine solche an Pfeffer erinnerte):
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ob mir noch eine Lösung einfallen würde, fragte er, als er mir den Zettel zurückgab. Eine Eingebung durchfuhr mich, ich nahm den Zettel und – zerisssssssssssssssss – ihn.
»Bemerkenswert, bemerkenswert«, sagte er, und tätschelte mich noch einmal. Trotz seines massigen Körpers hatte er kleine, dicke und weiche Patschhändchen. »Schweigen wir«, er zwinkerte mir zu und – »sssssss« – legte den Zeigefinger an seine Lippen. Ich durfte mich setzen.
Das »sssss«, das er im rheinischen Singsang von sich gegeben hatte, ähnelte einem »sssss« im dritten Ton der chinesischen Ausspracheskala: nach unten fallend und nach oben aufsteigend – so ausgesprochen hieß es u. a. »sterben« (死): was »Flohmatsch« tat, als er uns gerade den Konjunktiv Plusquamperfekt Passiv beigebracht hatte – ein anderer Kongress, zu dem ihn der liebe Gott abordnete. Es war kalt, als ihn die ganze Schule auf dem Waldfriedhof zu Grabe trug, so bitter kalt, dass Vögel erfroren und ich anfing zu weinen; der Wind war ein chinesischer: Er pfiff im ersten, gleichbleibend langen Ton vor sich hin, um dann immer wieder im vierten Ton abrupt nach unten zu fallen.
Manchmal stehe ich im Traum vor seinem Grab:
Flohmatsch
R. I. P.
Sehet die Vögel unter dem Himmel:
sie säen nicht, sie ernten nicht […]
und der himmlische Vater ernähret sie doch.
Matthäus 6,26
»Sssssssss …« Eine Hand fährt aus dem Grab (der himmlische Vater?) und tätschelt meine Wange. Auf dem Grabstein war eine Taube mit einem Heiligenschein abgebildet: eine Friedenstaube – oder symbolisierte sie den Heiligen Geist?
Jede Welt, in der ich mich zu Hause gefühlt habe, war stets bevölkert gewesen von Tauben und anderen Vögeln und angefüllt mit Gerümpel aus fernen Ländern: Welten, die nicht von Müttern und auch nicht von Vätern, sondern von Großvätern beherrscht wurden; das Haus, in dem ich einen Teil meiner Kindheit verbrachte und wo auch meine Liebe zu China erwacht war, obwohl von außen nichts darauf hingedeutet hatte; Café Weller, eine Konditorei mit angeschlossener Landwirtschaft in einem hohenlohischen Flecken; mein Großvater – ich nannte ihn nach seinem Familienamen Lorenz, manchmal auch »Lorenz Lorenz Lorenz«, dreimal, wie seine Freunde es taten, in gespielter Verzweiflung, was ihm sehr gefiel: dreimal wie der Ruf eines Vogels.
Lorenz Lorenz Lorenz hatte nach dem Krieg in den von zwei Schwestern geführten Betrieb eingeheiratet. Es war seine zweite Ehe gewesen, seine erste Frau – meine Großmutter – war lange vor dem Krieg gestorben. Seine Freunde hatten über die Heirat nur den Kopf geschüttelt. Lorenz Lorenz Lorenz war Absolvent der preußischen Kadettenanstalt in Berlin-Lichterfelde gewesen, Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, Spion in Belgien, Pilot der Eurasia-Fluggesellschaft, Agent der Abwehr in Shanghai, schließlich Direktor der Junkers-Werke in Leipzig. Der Krieg war verloren, kein Zweifel, zu beschönigen gab es daran nichts – so seine Freunde –, aber deswegen gleich hinter der Theke eines Cafés (mit angeschlossener Bäckerei und Landwirtschaft) Pflaumeneis verkaufen?
»Was denn sonst?«, hatte er sich verteidigt, Pflaumeneis aus chinesischen Essigpflaumen (酸梅汤冰淇凌), eine Spezialität, die er aus Peking mitgebracht hatte.
In China war er nicht nur Flugzeugpilot und Abwehragent gewesen, ein Gebirgspass in der Nähe von Kalgan war nach ihm benannt worden. (»Vorübergehend«, wie er sagte, als könnte der Pass gehen.) Wie es dazu gekommen war? Die Lufthansa, Mutter der Eurasia, war einer der Förderer der letzten Forschungsreisen von Sven Hedin gewesen. Lorenz Lorenz Lorenz hatte nicht nur den Nachschub organisiert, sondern war für die Expedition eine Art Fährtensucher aus der Luft gewesen. Sven Hedin und er hatten nach einer Notlandung – der »vorübergehende« Pass war glücklicherweise unter ihnen stehengeblieben – Freundschaft geschlossen und sich seitdem nicht aus den Augen verloren, selbst nach dem Krieg nicht, als mein Großvater zum Schrecken seiner Freunde im Café Weller Pflaumeneis anzurühren und zu verkaufen begann. Aber das war längst nicht alles, was ihn umtrieb. Nach und nach hatte er auf einer grünen Wiese, die den Weller’schen Schwestern gehörte, eine Fabrikhalle errichtet, wo er mit Hilfe eines schwedischen Industriellen, der mit Hedin befreundet war, Nachbauten des Fieseler Storchs herzustellen plante. (Es ist ihm nicht gelungen, die Bestimmungen der Alliierten standen dem entgegen.) Manchmal nahm er mich zu seinen geschäftlichen Terminen mit, in einem Buckelford, der von einem rätselhaften Leiden heimgesucht wurde: Beschleunigte er zu schnell, wurde das Auto plötzlich von einem wilden Krampf geschüttelt, dessen Epizentrum irgendwo im Getriebe lag. Einmal in der Gewalt dieses Anfalls, blieb Lorenz Lorenz Lorenz nichts anderes übrig, als den Motor abzuschalten, das Auto zu stoppen und erst dann wieder anzulassen, wenn der Motor sich beruhigt hatte.
Die Fahrten führten zu Forstämtern, die als Holzlieferanten für die Flugzeuge in Frage kamen. Ich wartete derweil im Auto. Um mir die Zeit zu vertreiben, trug ich auf den Landkarten, die ich den Hedin’schen Werken entnahm, mit Bleistift Karawanenwege ein, die Pfade der »kleinen« und »großen Nachdenklichkeit«, wie mein Großvater sie nannte, prägte mir ihren Verlauf ein, um sie vor dem Schlafengehen an den Würfen und Falten meiner Bettdecke nachzuwandern.
Das großväterliche Haus war verwinkelt, voller versteckter Stuben und Stiegen. In einem Vorbau des Dachgeschosses befand sich ein Taubenschlag, vom Speicher selbst abgetrennt durch ein Drahtgitter. Im Haus knarrte und ächzte es ständig, nachts war ein Flüstern zu hören, das die Treppe hinaufging, vor einer bestimmten Tür stehenblieb – es war jede Nacht eine andere – und dann wieder hinabging. Der Speicher war gefüllt mit Hinterlassenschaften vergangener und vergessener Zeiten, darunter Koffer voller Spielzeug aus der Kinderzeit meines Großvaters und seines Zwillingsbruders, der ebenfalls Paul hieß, aber »Paulchen« gerufen wurde: Er war als Zweiter auf die Welt gekommen. Paul und Paulchen, zusammen hatten sie mit den Spielsachen gespielt, mit denen ich es nun tat, manchmal mit verteilten Rollen, einmal als Paul (Lorenz Lorenz Lorenz), dann wieder als sein Bruder Paulchen: Zwei braune Zirkusakrobaten mit pailettenbesetzten Hosen; ein melancholischer Clown mit Mühlsteinkragen und langen roten Schuhen; drei welpengroße Elefanten aus blankpoliertem Holz mit beweglichen Kniegelenken; sie machten auf einem Vorderfuß einen Handstand oder balancierten auf einem rotweiß gestreiften Fässchen; eine zierliche Seiltänzerin im Reifrock mit Schirmchen; ein singender Brummkreisel, eine Eisenbahn von Märklin, ein Zopfchinese aus Blech mit einer Schubkarre und einem Schlüssel zum Aufziehen; ein Anker-Steinbaukasten mit roten, blauen und gelben Bauklötzen, aus denen sich Brücken bauen ließ, die ich dann wieder zum Einsturz brachte. (Welcher Klotz würde, wenn man ihn wegnahm, das bewirken?) Die Verkündigung des Abbruchs war Sache von Luzifer: ein roter Flaschenteufel, der in einer wassergefüllten und mit einem Gummipfropfen verschlossenen Glasröhre auf und ab schwamm: Drückte man auf den Pfropfen, sank er nach unten; ließ man los, stieg er wieder hoch; tippte man auf ihn, begann er zu tanzen: das Zeichen zum Abbruch: »London Bridge is falling down, falling down, falling down«, sang Lorenz Lorenz Lorenz, wenn ich ihm das Schauspiel vorführte. Hinterher gab es zur Abwechslung Pflaumeneis.
In einem Regal lag ein Album mit exotischen Briefmarken, dreieckige aus Dschibuti mit Kamelmotiven. Und auf der nächsten Seite chinesische mit der Aufschrift: EXPED. SCIENT. (zu Ehren einer großen Expedition Sven Hedins in China, erzählte Lorenz Lorenz Lorenz).
Daneben und darüber lagen Stöße von Abenteuerromanen: Karl May, Friedrich Gerstäcker, James Fenimore Cooper, Daniel Defoe, Rudyard Kipling, Frederick Marryat (»Sigismund Rüstig«) Johann David Wyss (»Der Schweizerische Robinson«), und wie sie sonst noch hießen, unter ihnen ein zerlesener gelber Leinenband von Georg von der Gabelentz: »Chinesische Grammatik«, mit dem geheimnisvollen Zusatz: »Mit Ausschluss des niederen Stils und der heutigen Umgangssprache.«
Gab es nicht nur eine chinesische Sprache, hatte ich mich gefragt, sondern mehrere?
Die Schränke an den Wänden öffneten sich nur, wenn man gleichzeitig an beiden Türflügeln zog, sie taten es seufzend und widerstrebend: In ihnen hingen Kleider, die wie alte Tanten einen stechenden Geruch nach Kampfer und Mottenkugeln von sich gaben. Eine Schublade war voll von Schattenrissen, gepressten (immer noch duftenden) Blumensträußchen, Taschenkalendern der Junkers-Flugzeugwerke und Bündeln von braunen Geldscheinen aus der Inflation; in einer anderen Schublade lagen Brettspiele: Mensch-ärgere-dich-nicht, Halma, Dame, Mühle und das Würfelspiel »Durch die Wüste Gobi«.
Auf dem Deckel der Schachtel war inmitten weiter Sanddünen ein lamaistisches Kloster abgebildet, davor eine Karawane mit Kamelen, auf denen bewaffnete Europäer saßen. Ein Rudel von Wölfen folgte ihnen, einer der Europäer hatte sein Gewehr auf sie gerichtet. Im Vordergrund stand vor einer Jurte ein Mongole, der die Hände zu einem Willkommensgruß erhoben hatte. In der Schachtel lag eine Karte der Wüste Gobi, sie ähnelte derjenigen des »Parkes zu den Duftenden Bergen«. Anstatt der Pagoden, Pavillons, Tempel, Türme, Wandelgänge, Teiche und Geistermauern waren Pfade, Sanddünen, Karawanen, Lamas, Räuber und Wölfe abgebildet. Die Regeln besagten: »Die Spieler werfen der Reihe nach den Würfel und gehen so viele Felder vor, wie sie Punkte geworfen haben.« Bestimmte Felder waren Unglücksfelder (Sandstürme, verschüttete Brunnen, Räuber und Banditen, Wölfe etc., was Aussetzen, Zurückgehen oder Ausscheiden bedeutete; gelangte man auf Glücksfelder – Oasen, Jagdglück (wilde Esel), Regenfälle, siegreiche Gefechte mit Räubern etc. – durfte man ein paar Felder überspringen.
Im Speicher spielte ich am liebsten: Durch die Luken fielen Sonnenstrahlen, in denen Myriaden von winzigen Partikeln tanzten; unter dem abgeschrägten Dach herrschte ein wohliges Halbdunkel, das Nicken, Picken, Gurren und Flattern der Tauben füllte den Speicher mit Leben.
Alles in allem eine Welt von derselben Art, wie ich sie zwanzig Jahre später auf der »Straße der Acht Tugenden« (八德路) in Taipeh wiederfand: ein Bücher- und Trödelmarkt, auch hier mit Verschlägen, aus denen Tauben hinein- und hinausflogen, als brächten sie geheime Botschaften von Taiwan zum Festland und umgekehrt. (Wer weiß, vielleicht taten sie es wirklich.) Der Großvater meiner Frau, ein ehemals kleinerer Warlord der abgetanen Republik China, hatte mich dorthin mitgenommen.
Es war mir, als wäre ich in den Speicher meiner Kindheit zurückgekehrt – nach China ausgewandert und dort ins Riesenhafte angewachsen. Berge von Plunder und Siebensachen – Möbel, Hausrat, Kleider, Vogelkäfige, Schirme, Uniformen, Rückenkratzer aus Elfenbein, Fotoalben, Schallplatten, längst vergessene Jahrbücher des Marionettenstaates Mandschukuo (满洲国) mit dem Konterfei seines Kaisers Pu Yi (溥仪), Künstlerpostkarten mit der chinesischen Anna May Wong (黄柳霜), zerfledderte Illustrierte (»Young Companion« (良友), »Readers Digest« auf Chinesisch, Romane, Spiele (Ma-Jongg, Domino etc.) und auch hier Bündel von Inflationsgeld (Bank of China, gefälscht, wie ich später herausfand: wer außer einem Chinesen fälscht selbst noch Inflationsgeld?). Überall Berge von Büchern: weiche, flexible und fadengeheftete Bücher ohne Interpunktionszeichen, die vom Leser erst hinzugedacht und dann mit einem Pinsel dazugesetzt werden mussten: kleine Kringel mit roter Tusche, an denen entlang der Leser wie ein Reisender in der Wüste von Wasserstelle zu Wasserstelle wandert. Dazwischen chinesischer Plunder: Bambuskoffer, Rollbilder, Vasen, Truhen, Schnitzereien, Kostüme der Pekingoper, Pantöffelchen für verkrüppelte Frauenfüße (ich roch verstohlen daran), blaue Roben, alte Münzen: mit einem Wort Habseligkeiten, die keinem mehr und daher jedem gehörten, Habseligkeiten an sich: Die Standbesitzer – unter ihnen ehemalige Untergebene des Generals (in jedem chinesischen Soldaten steckt ein Händler) – hatten es sich in der Hitze auf flachen Bambusliegen bequem gemacht, die Augen geschlossen, neben sich surrende Ventilatoren, die sich nach rechts drehten und dann nach einem energischen Ruck wieder nach links. Sie träumten wohl von ihren Kriegszügen, dachte ich. Nachts trugen sie Laternen, hatte Lorenz Lorenz Lorenz mir erzählt, damit ihre Feinde sie sehen konnten; bei Regen spannten sie Schirme auf. Die Seite gewann, deren Gongs am lautesten waren.
Manchmal erwachte einer der Schläfer, gähnte, griff nach einem geriffeltem Maxwell-Glas, das mit grünem Tee gefüllt war, schraubte den Verschluss auf, trank einen Schluck, spuckte ein Teeblatt aus, schraubte das Glas zu, gähnte und lehnte sich zurück. Ein Jahrzehnt schien zwischen dem Auf- und Zuschrauben ins Land gegangen zu sein. Es roch nach Staub, Tabak, Papier und Taubendreck.
Taubendreck?
Ich überlegte: Ließ sich daraus nicht eine unsichtbare Geheimtinte herstellen – aus Taubendreck? Eine, die anfangs sichtbar war, später unsichtbar wurde, dann grün hervortrat, wenn man eine Flamme an das Papier hielt. Lorenz Lorenz Lorenz, der Pilot, Spion, Flugzeughersteller und Pflaumeneisanrührer hatte es mir erzählt. In dem Café, in das er eingeheiratet hatte, pflegte er bisweilen einen Mann mit Jägerhütchen zu treffen, den er Gehlen nannte, einfach »Gehlen«, ohne Vornamen und ohne »Herr«. Die beiden gingen in ein Nebenzimmer, wo amerikanische Besatzungsoffiziere sonst um viel Geld (grüne Dollarnoten) spielten, Pokerspiele, bei denen Lorenz Lorenz Lorenz sachverständig zuschaute, um hinterher dankend das Trinkgeld einzustecken, das die Spieler glaubten ihm schuldig zu sein. Die beiden tranken Feldafinger Bier – Gehlen steckte den Zeigefinger in den Schaum und sagte: »Fehlt a Finger.« Beide lachten, um dann über Russland zu sprechen. Oder war es China gewesen? Aus einem Schallplattenapparat erklangen Schlager von Hans Albers. »Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein …« Ich war von dem Apparat fasziniert gewesen: War eine Platte zu Ende, drehte sich der Tonarm zur Seite, machte eine Verbeugung, ruckartig wie die Ventilatoren auf der »Straße der Acht Tugenden«, wenn sie die Seite wechselten, eine neue Platte fiel nach unten, der Tonarm schwang zurück, hob und verbeugte sich wieder und setzte erneut auf: Zuerst erklang ein Kratzen, dann ein Rauschen, schließlich ein Schlager. In der »Straße der Acht Tugenden« waren es die von Zhou Xuan (周璇), der Nachtigall aus Shanghai, Weisen voller Sehnsucht, die schon ein paar Schritte weiter im Lärm der anderen Lautsprecher untergingen: Englischunterricht von Kassetten, auf denen die Golden Gate Bridge von San Francisco abgebildet war, nicht die Freiheitsstatue, die Einwanderern aus Europa vorbehalten war: neunhundert Sätze zum Nachsprechen für das TOEFL-Examen – die Fahrkarte ins ferne Amerika, das Land chinesischer Sehnsüchte.
In einer Ecke des Speichers meines Großvaters war ich auf ein Bündel von Briefen und Postkarten aus China gestoßen, die von meinem Großonkel Paulchen stammten. Auch er hatte einen Teil seines Lebens in China verbracht – kein Wunder, die beiden waren eineiige Zwillinge gewesen. Zuerst war er in Peking, wo er Chinesisch gelernt und seine Liebe zu Vögeln entdeckt hatte, dann, als die Japaner die Stadt okkupiert hatten, war er über Shanghai nach Macao weitergewandert – die einzige Küstenstadt in China, die die Japaner nicht besetzt hielten. Auf dem Schreibtisch seines Bruders, meines Großvaters Lorenz Lorenz Lorenz, stand eine Fotografie von ihm, eine Atelieraufnahme aus Macao. Auf der Rückseite hatte mein Großvater vermerkt: »Paulchen vor seinem Tod 1952«. Tod? Ich grübelte darüber nach – damals war mir der Tod ein Rätsel (eigentlich auch heute noch).
Im Speicher entdeckte ich in einem exotischen Bambuskoffer ein weiches, blau eingebundenes und fadengeheftetes Buch: »Swinhoe’s Catalogue of the Birds of China«, 1871.
Robert Swinhoe (1836–1877) hatte als Ornithologe einer Vielzahl chinesischer Vögel seinen Namen gegeben. Auf einem Bild, das ich mir später von ihm besorgte, sah er nicht wie ein Ornithologe aus, sondern wie ein Falschspieler (»worked the Mississippi«: Ich habe damals oft vor einem Spiegel mich genauso verwegen hinzustellen versucht).
Er war in Kalkutta geboren und hatte in China als Dolmetscher und Konsul Karriere gemacht, sich aber weniger mit Handel und Wandel, als mit der chinesischen Vogelwelt befasst. Selbst während des Zweiten Opiumkriegs, an dem er als Dolmetscher teilnahm, hielt er auch im dicksten Kampfgetümmel nach Vögeln Ausschau: Sie waren die Hauptsache, alles andere nur ein lästiges Drumherum, das manchmal Sinn ergab, meistens aber nicht. Nebenher verfasste er einen Bericht über den Krieg: »The North China Campaign« – dessen Ablauf so verschlungen, unklar und unübersichtlich war, dass man ihn wie ein nasses Stück Seife in der Badewanne nur dann in die Finger bekam, wenn man gerade nicht danach griff. (Ich hatte ein Buch darüber geschrieben.) Der Krieg endete mit der Brandschatzung des Yuanmingyuan (圆明园), des alten Sommerpalasts in Peking. Swinhoe wurde zum Konsul in Taiwan ernannt und publizierte in nicht endender Folge ornithologische Artikel. Seinen Amtsgeschäften, die er schon vorher auf die leichte Schulter genommen hatte, kam er immer weniger nach; einmal desertierte er sogar von seinem Posten, der ständige Regen in Taiwan hatte ihn zur Verzweiflung getrieben. Er starb 1877 im frühen Alter von 41 Jahren an Syphilis, einer Krankheit, die keiner der vielen Amtsärzte, die ihn untersucht hatten, zu diagnostizieren in der Lage gewesen war.
Ich schlug das Buch auf. Auf der ersten Seite standen in der winzigen, dünnen Zackenlinie meines Onkels – auch meine Handschrift sieht so aus – neben den zwei chinesischen Zeichen 百灵 (»Lerchen«, wie ich später lernte): »Können Lerchen sich erinnern?«
Lerchen? Natürlich können sie das, hatte ich gedacht, wie auch alle anderen Vögel, Tauben und Zugvögel, was für eine Frage! Wie fänden sie sonst den Weg zu ihren Nestern und Brutplätzen zurück – bei Zugvögeln waren es immerhin Tausende von Kilometern.
Mir fiel eine Geschichte ein, die mir nicht aus dem Sinn gegangen war, weil ich an den Paradiesvogel gedacht hatte, den »Irrgast«, den Flohmatsch in der Sexta an die Tafel gemalt hatte. Auch die Geschichte hieß so: »Ein Irrgast« (damit war ein Vogel gemeint, so eine gelehrte Fußnote, der sein Gedächtnis verloren hatte und nicht mehr zurückfand). Ein »Großes Sturmtaucherweibchen« namens Ernestine war auf dem Weg zu ihrem Brutplatz auf der Nachtigalleninsel im Südatlantik vom Weg abgekommen und erschöpft auf einem Bananendampfer notgelandet, der Ernestine nach Montevideo mitgenommen hatte, von wo sie beim Versuch, den Rückweg zu finden, an Heimweh und Entkräftung zugrunde gegangen war.
Ich blätterte weiter. Über die lateinischen Namen hatte Paulchen nicht nur chinesische Zeichen gesetzt (sie fehlten bei Swinhoe), sondern auch die genauen Umstände (Ort und Zeit) notiert, in denen er sie beobachtet hatte. Gelegentlich hatte er Swinhoe korrigiert, vor allem seine Wahl lateinischer Namen. Ich zeigte das Buch meinem Großvater. Sein Bruder Paulchen, erfuhr ich, hatte in Peking an einer Überarbeitung und Ergänzung des Swinhoe’schen Werkes gearbeitet; auch Swinhoe war lange in Macao gewesen.
In der Ecke des Speichers stand ein lederbezogener Großvaterstuhl. Ich setzte mich hinein und blätterte in dem Vogelkatalog, dann in der gelben »Chinesischen Grammatik«. Jedes Zeichen sah wie ein Irrgarten aus, angelegt nach einem Plan, der sich mir nicht erschloss, so oft ich auch den Strichen mit meinem Zeigefinger nachging. Wie prägte man sie sich ein, wie behielt man sie? Eine Welt lag hinter ihnen, die mir verschlossen war. Es musste einen Schlüssel dafür geben. Mein Entschluss stand fest: Chinesisch zu lernen und in China nach Vögeln zu suchen. Ich schlug die »Birds of China« wieder auf.
Können Lerchen sich erinnern? Was hatte er wohl damit gemeint? Ein Rätsel. Warum gerade Lerchen?
Unter dem Sessel lag das verstaubte und zusammengerollte Plakat des Filmes »Macao«. Warum ausgerechnet hier – in einem hohenlohischen Speicher? Der Regisseur hatte meinem Onkel Paulchen – erfuhr ich von meinem Großvater – eine Rolle als Stuntman verschafft. In einer Szene hatte er am Steuer eines Automobils in einer rasanten Verfolgungsfahrt hart entlang des Kais zu kurven. Obwohl die Szene einige Male geprobt worden war, hielt er sich, als die Kamera zu laufen begann, erst zu jedermanns Verblüffung, dann zum blanken Entsetzen aller nicht an das Drehbuch, sondern steuerte direkt auf den Landungssteg zu, wo gerade von Hongkong kommend ein kleiner weißer Raddampfer mit zwei schmalen Schornsteinen festgemacht hatte. Der Wagen überschlug sich und landete im Wasser, wo er gluckernd versank. Mein Großvater machte den Satz über die Wellen und den Fall nach, mit seiner Hand – so wie er manchmal auch einen Flug beschrieb. Nach einer Weile stieg eine riesige Luftblase auf und platzte an der Oberfläche: blub … Ich starrte auf meinen Großvater. Paulchens Seele? Ob er es mit Absicht getan hatte, fragte ich ihn (ich kam mir dabei sehr erwachsen vor). Er schüttelte den Kopf. Aus unerklärlichen Ursachen habe sein Bruder immer wieder unter Halluzinationen gelitten, dabei oft sein Gedächtnis verloren und dann nicht mehr gewusst, wer und wo er gewesen sei.
Ich wusste damals noch nicht, dass auch ich später von solchen Anfällen heimgesucht werden würde. (Das »Charles-Bonnet-Syndrom«, wie man mir heute weismachen will, an der beispielsweise auch der englische Historiker Trevor-Roper gelitten haben soll. Er wollte einmal in Paddington in einen gerade eingelaufenen und abfahrbereiten Zug einsteigen; dieser war jedoch nur in seiner Einbildung eingelaufen und wartete nur dort auf ihn. Trevor-Roper stürzte auf die leeren Gleise und verletzte sich schwer. Ursache war eine krankhafte Sehschwäche gewesen, die das Gehirn veranlasst hatte, Nervenzellen neu zu verschalten, was nicht ohne Halluzinationen abgegangen war. – Der kleine weiße Raddampfer meines Großonkels – auch eine Halluzination? Um auf mich zurückzukommen: Ich leide nicht an einer Sehschwäche. Die Diagnose erklärt zudem nicht den Verlust des Gedächtnisses.) Sie hatten sich nur Zeit gelassen, bis ich erwachsen geworden war, um dann über mich herzufallen, aus heiterem Himmel wie der Einsturz einer meiner Brücken aus Anker-Steinen, wenn ich einen Klotz wegnahm. Für einen kurzen Augenblick wird mir schwarz vor Augen, ein Singen wie von Zikaden erklingt in meinen Ohren, ein kaltes und gleichzeitig warmes Gefühl steigt in mir hoch, eine Aura des Außermirselbstseins, dann ist alles wieder so, wie es vorher war – nur dass ich nicht mehr weiß, wer und wo ich bin.
Das erste Mal war es in Taipeh geschehen, wo ich mit dem Geld, das mir Lorenz Lorenz Lorenz hinterlassen hatte, Chinesisch lernte. Ich war eines Abends die Chung Shan North Road (中山北路) entlanggeschlendert, hatte »Cave’s Bookshop« betreten, dort einen Band der »Chinese Superstitions« des Jesuiten Henry Dore vom Regal genommen und in den Seiten geblättert und war auf die Abbildung einer Mutter gestoßen, die mit einem Jäckchen in der Hand nach der Seele ihres in Ohnmacht gefallenen Kindes rief.
Als ich einen Kniff in die Seite machte – es war die Seite 473 –, hörte ich ein Singen in meinen Ohren, und ein heiß-kaltes Gefühl stieg in mir hoch. Dann meinte ich, ins Bodenlose zu fallen, stürzte, nachdem ich hastig die »Superstitions« zurückgestellt hatte, nach draußen und wanderte dann ohne Gedächtnis im Schein der kalten Neonreklamen die Straße immer wieder hinauf und hinunter. Ich fühlte mich ausgestoßen – aber von wo? Von meinem Zuhause? Ich wusste beim besten Willen nicht mehr, wo mein Zuhause war. Nicht dass ich auf der Suche danach gewesen wäre, ich wusste nicht, dass ich überhaupt irgendwo zu Hause war. Es war meine Erinnerung, nach der ich suchte, aber selbst das war mir zu Beginn nicht klar gewesen, da ich auch nicht wusste, wer ich war.
Es war eine lange Suche gewesen, bevor mir überhaupt bewusst wurde, dass ich etwas suchte. Einmal war ich vor einem Haus stehengeblieben, in dessen erstem Stock ich früher einmal gewohnt hatte: ein altes japanisches Holzhaus, in dem sich unten ein kleines japanisches Restaurant befand. An das fassungslose Gesicht des Besitzers, der mir die Tür zu meiner ehemaligen Wohnung öffnete, als ich ihm sagte, ich hätte meinen Schlüssel vergessen, erinnere ich mich bis heute.
Ab und zu wechselte ich die Straßenseite, durch schiefe und schräge Unterführungen, die so listig als Labyrinthe angelegt waren, dass ich jedes Mal
garantiert
au
f
der falschen Straßenseite zum Vorschein kam und für ein paar Augenblicke nicht nur ohne Gedächtnis, sondern auch ohne Orientierung war. »Ein Theaterstück in einem Theaterstück« (戏里有戏), wie es auf Chinesisch heißt. Einmal kletterte ich die enge Treppe eines europäischen Cafés hinauf. Eine blonde Ausländerin schritt aus der Toilette die Treppe herunter, in der Hand eine Straßenkarte von Taipeh. Sie blieb auf einer Stufe stehen und schaute mich fragend an. Ich schüttelte den Kopf, drehte mich um und rannte die Treppe wieder nach unten.
Ein paar Stunden vergingen, bis ich schließlich den Weg nach Hause fand – in einem völlig anderen Stadtteil als dem, in dem ich so lange herumgeirrt war. Was zurückblieb, waren fast fotografische Erinnerungsbilder an die Begebenheiten, die sich mir eingeprägt hatten, als ich erinnerungslos hin und her geirrt war: ein Film, den ich nach Belieben anhalten konnte, wollte ich ein Bild genauer betrachten. Das japanische Haus beispielsweise, das früher einmal meine Bleibe gewesen war, hatte sich mir bis auf die hier und da fehlenden Dachschindeln eingeprägt. Eigentlich hätte man es schon längst abreißen müssen, war mir noch durch den Kopf gegangen.
Aber hatten sich die Begebenheiten wirklich so zugetragen? Als ich die Straße am nächsten Tag noch einmal entlangspazierte, stellte ich fest, dass das japanische Holzhaus, an das ich mich so genau zu erinnern glaubte (Besitzer, fehlende Dachschindeln), gar nicht mehr existierte. Ich stand vor einer Baulücke, es war vor geraumer Zeit abgerissen worden. Ein zweites Beispiel: Ich suchte in Cave’s Bookshop nach den »Chinese Superstitions«, dem Band, den ich einen Tag vorher in der Hand gehabt hatte. Eine antiquarische Originalausgabe. Ich fand jedoch nur einen billigen Nachdruck. Ich fragte den Manager nach der Originalausgabe, in der ich gestern noch geblättert hätte. Eine solche habe er nie gehabt, gab er mir kopfschüttelnd zur Antwort, nur einen Nachdruck. Er zog ihn heraus: ausgerechnet der eines Verlages, der »Forgotten Books« hieß.
Hatte ich zu träumen begonnen, als mir mein Gedächtnis abhandengekommen war? Mir fiel ein, dass ich die Originalausgabe im letzten Jahr in einem Antiquariat auf der Kanda (神田) in Tokyo in der Hand gehabt hatte. Vielleicht war das die Erklärung. Aber irgendetwas stimmte nicht: Ich schlug die Abbildung auf Seite 473 auf und fand den Kniff wieder, den ich in die Seite gemacht hatte.
Also doch keine Einbildung.
Der Manager war hinter der Theke verschwunden. Ich steckte das Buch ein und machte mich auf und davon.
Mein Gedächtnis zu verlieren und zu halluzinieren, ist nicht die einzige Veranlagung, die ich geerbt habe: Im Unterschied zu dieser sind die anderen aber nur bloße Marotten und dumme Gewohnheiten, sieht man einmal von meiner winzigen Handschrift ab. Wenn ich mir beispielsweise eine Zigarette anzündete – ich habe das Rauchen inzwischen aufgegeben –, steckte ich das abgebrannte Streichholz automatisch zurück in die Schachtel – eine Angewohnheit von Piloten aus der Generation meines Großvaters, die es nicht zu Flugzeugbränden und Schlimmerem kommen lassen wollten. Sie waren augenscheinlich alle Kettenraucher. Ein Wort zur Warnung aus leidvoller Erfahrung: Steckt man das Streichholz im Eifer des Gefechts nicht mit dem abgebrannten Kopfende nach unten in die Schachtel zurück, explodiert sie in einer Stichflamme – phhhhusch –, wie es Richthofen passierte, als er abgeschossen wurde. (Man fand eine ausgebrannte Schachtel neben dem Steuerknüppel, so mein Großvater.) Auch mir ist es immer wieder passiert, ich weiß ein Lied davon zu singen.
Eine andere Marotte, die von meinem Großvater auf mich übergegangen ist – ich habe sie oben bereits angedeutet –, ist das Stehlen von Büchern. (Ob sie mit der Veranlagung zusammenhängt, das Gedächtnis zu verlieren? Ich sollte einmal einen Fachmann konsultieren – oder steht es vielleicht bei Lombroso?) Erwischt wurde mein Großvater nie, obwohl die Hälfte seiner Bibliothek aus entwendeten Büchern bestand. Auch ich selbst wurde nur einmal ertappt, und auch das eigentlich nicht wirklich. Ich stahl meine Bücher mit Vorliebe aus Bahnhofsbuchhandlungen, wo wie in Taubenverschlägen immer ein reges Kommen und Gehen herrschte und keiner auf den anderen achtete. Die »rororo«-Taschenbücher waren mir am liebsten gewesen: Sie waren so biegsam, dass man sie leicht im Ärmel verstecken konnte. (Die drei Silben: »ro ro ro« – als ob es Chinesisch sei! – untereinandergeschrieben; »ro« ist übrigens gleichlautend mit »Fleisch« (肉), wie ich später lernte, also:
肉
肉
肉
aber das nur nebenbei.) Es fiel nicht weiter auf, wenn ich längere Zeit hinter einem Drehgestell stand (eine vorzügliche Deckung), selbstvergessen in ein Buch vertieft, und mich dann allmählich von dem Gestell entfernte, nach jedem Umblättern einen gedankenverlorenen Schritt weiter, bis eine unsichtbare Grenze erreicht war, wo das Buch nicht mehr der Buchhandlung gehörte, sondern dem, der es in der Hand hielt – bzw. in seinen Ärmel geschoben hatte.
Die meisten warf ich hinterher weg. Ein paar aber habe ich bis heute aufbewahrt, das (billige) Papier ist braun und fleckig geworden. In den Büchern waren noch Reklamen für Zigaretten abgedruckt, die man ebenfalls in den Bahnhofsbuchhandlungen kaufen konnte, Lesen und Rauchen gehörten damals zusammen. Manchmal ritt mich der Teufel, ich kaufte – das gestohlene Buch in der Manteltasche – noch eine Packung »Juno«-Zigaretten, neben »Gold Dollar« die Lieblingsmarke von Lorenz Lorenz Lorenz. Das Gefühl, für das Buch bezahlt zu haben, war die Belohnung.
Einmal war meine Beute ausgerechnet »Auf der schiefen Ebene« von Evelyn Waugh gewesen. Ein Mann, der mich die ganze Zeit beobachtet hatte – er sah fast so aus wie Waugh: ein Pfannkuchengesicht mit Zigarre (war er es vielleicht wirklich?) –, sprach mich an und machte mich auf das Verwerfliche meines Tuns aufmerksam. Er zeigte auf den Titel des Buches. Seine Frau neben ihm schaute mich vorwurfsvoll an. War ich ihr aufgefallen? Frauen haben einen Blick für jugendliche Delinquenten. Er werde dem Besitzer der Buchhandlung nichts sagen, sagte Evelyn Waugh, während er an seiner Zigarre zog, wenn ich das Buch zurückstellen würde. Seine Frau nickte – also mit ihr abgesprochen. Ich gehorchte mit reuevollem Gesichtsausdruck, was blieb mir auch anderes übrig? Als die beiden durch die Sperre gegangen waren, nahm ich das Buch wieder an mich. War es nicht schon vorher in meinen Besitz gelangt? Als ich es am anderen Morgen während des Religionsunterrichts neben mir auf die Bank legte, um darin zu lesen, wurde ich ertappt: zum Gaudium der in der nachfolgenden großen Pause im Lehrerzimmer versammelten Studienräte. Der Mathematiklehrer in der nächsten Stunde – Mathematik war nicht gerade meine starke Seite – nahm mich gleich zu Beginn dran. Noch bevor ich seine Frage beantworten konnte, was ich denn eigentlich einmal werden wollte, verfiel er in ein prustendes Lachen: Schiffschaukelbremser? Ich ging nach Taiwan und verlor dort zum ersten Mal mein Gedächtnis.
Eine Hinterlassenschaft dieser Anfälle waren, wie gesagt, die fast fotografischen Bilder, die mir aus der Zeit verblieben, in der mein Gedächtnis auf Wanderschaft gegangen war. Ein Film, den ich jederzeit anhalten konnte, wenn ich mir ein bestimmtes Bild genauer ansehen wollte.
Eine andere mir zugewachsene Fähigkeit, die mir erst nach und nach aufging, war das Vermögen, in gleicher Weise auch Klänge anhalten zu können. Sie blieben stehen, und ich konnte sie noch einmal hören und in Buchstaben nachmalen. Eine keineswegs alltägliche Fähigkeit, gewöhnlich vergisst man Klänge sofort, vor allem, wenn sie aus dem Alltag kommen; man überhört sie und nimmt sie nicht zur Kenntnis.
Ein Beispiel: Ich saß ein paar Tage nach dem Vorfall wieder einmal in einem Nudelshop – »Noodle King Home Cooking« – und trank eine Limonade. Ein Stammgast nahm Platz und bestellte eine Nudelsuppe. Die Besitzerin stellte die dampfende Suppe und ein Glas Wasser vor ihm hin. Er sperrte seinen Mund weit auf, griff mit langen Fingern hinein, zog sein Gebiss heraus – biatsch – und legte es in das Glas. Sprudelnd schwebte es nach unten. Erst als es auf dem Boden angelangt war, machte sich der Gast schlürfend über die langen
shlickshleruzz shlickshleruzz
msch msch msch msch msch
zuzu u u zuzu uu zuuu u u
shlickshleruzzruzzuzzuuuzzuuzuuzuuzzuuzzuuu
msch msch msch msch msch msch
zuzuuuzzzuzzzuuuu
Nüdelchen her. Als er sie aufgegessen hatte, fischte er das Gebiss aus dem Glas, setzte es wieder an seine alte Stelle – biatsch –, steckte eine Zigarette dazu, zündete sie an, inhalierte den Rauch, stülpte den Mund fischmaulartig auf, stieß den Rauch aus, um ihn mit der Nase – n nnn ffffffff – wieder einzufangen.
*
Ich hielt die ganze Zeit nach einem Lehrer Ausschau, der mir Chinesisch beibringen konnte; aber es musste das Chinesisch sein, wie man es in Peking sprach: ein nasaler Singsang wie der von Hans Albers auf den Schallplatten meines Großvaters: »Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein …«: ein Tanz von Tönen.
Der Zufall brachte mich mit einem Exilchinesen aus Peking zusammen, der sich in Taipeh mit Wahrsagungen durchs Leben schlug. (Wahrsagungen sind umgekehrte Erinnerungen.) Wo er mir über den Weg gelaufen war – oder ich ihm? Es war im Astoria Café (明星咖啡馆) in Taipeh gewesen, auf der Wuchang Road (武昌街) gegenüber dem Tempel des Stadtgottes (台北霞海城隍庙): »A famous café where writers and artists meet for relaxation and prolonged discussion of art and life.«
Der Wahrsager, der mich dort schon erwartete, ohne dass ich es wusste – ein kinnloser Mann mit einem knochigen Gesicht –, schlief auf dem einzigen Sofa des Hauses vor sich hin. Seine Haare waren straff nach hinten gekämmt und glänzten wie Lackschuhe.
Auf dem Tisch vor ihm lag ein Schulheft, ein dicker Kugelschreiber steckte in der Brusttasche seiner Jacke. Links und rechts von ihm spielten zwei Frauen, die wie Zwillingsschwestern aussahen, Karten, ohne sich um den Schläfer zu kümmern, der die Hände so vor dem Bauch aufeinandergelegt hatte, als steckten Karten darin, die er vergessen hatte auszuspielen, als ihn der Schlaf – oder der Tod? – übermannte, auf Ewigkeit dazu verdammt, zwischen zwei kartenspielenden Frauen zu sitzen: Angels of Death. Oder war er selber der Tod? Ich hatte ihn immer gerne kennenlernen wollen.
Ein Monteur betrat das Restaurant, um einen neuen Sicherungskasten für die Airconditioning – oooomemememeppp – einzubauen. Bohrer, Hammer und andere Werkzeuge waren in einem Pappkarton verstaut, den er mit den Füßen vor sich herschob, langsam und gemächlich, einmal links und dann wieder rechts
shit shit shit shit shit
shot shot shot shot shot
Er schaltete den scheppernden Kasten aus
omememememememe
der langsam zur Ruhe kam
e e eme e e e e …
und machte sich an den Sicherungen zu schaffen. Eine Frau drückte von außen gegen die scheppernde Eingangstür und wanderte mit einem Bauchladen von Tisch zu Tisch. Der Tod hob müde den Kopf, erblickte mich, stand auf und hinkte mit dem Schulheft in der Hand zu mir:
»De fu’tur«, sagte er in einem Mischmasch aus Englisch und Deutsch, »fo’ you.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, setzte er sich zu mir und überreichte mir eine rosa Visitenkarte, die er aus einer Packung »Long Life«-Zigaretten herausgefischt hatte. Er schlug das Heft auf und zeigte auf die Sätze:
Das selbstlose Allselbst
Ist sich selbst genug
(The selfless Allself
is sickself Genough)
Ein polyglotter und philosophischer Wahrsager? Er schaute mich lange an – ein Arzt der einen Kranken betrachtet, hätte es nicht sorgfältiger tun können – und schrieb rasch ein paar Worte in das Heft:
Long Life
Hundred Years
Wealth
Ten Million
Die Frau mit dem Bauchladen blieb vor mir stehen:
Happy Family
Marriage
Love
Girl Friend
Erwartungsvoll schaute er mich an.
»Hund’et dollah.« Die Ärmel seines viel zu langen Mantels waren hochgekrempelt. Er hielt die Hand auf, steckte den Geldschein ein, den ich ihm gab, und zog eine Broschüre aus seiner Tasche. Auf dem Umschlag war ein Rheindampfer abgebildet, an dessen Reling er in seinem viel zu weitem Mantel stand.
»Le’ein le’eise«, sagte er leise auf Deutsch, »Lolelei«, und überreichte es mir. (Woher wusste er, dass ich aus Deutschland kam? Ein Wahrsager, sagte ich mir, natürlich wusste er es! Wer, wenn nicht er?) Er stand auf und setzte sich wieder zu seinen beiden Frauen. Die rechte zog einen Rosenkranz aus der Tasche und ließ die schwarzen Perlen – Oooooomitooooofooo – wie die Reihen der »ooooo« durch die rotlackierten Finger gleiten. Der Wahrsager nickte mir freundlich zu.
»She eve’y day«, rief er, zeigte auf die rechte Schwester und faltete die Hände zusammen. »P’lay Omitofo.«
Das Telephon klingelte, er hinkte zur Theke und hob den Hörer an sein Ohr.
»Lu?«, fragte er und schaute in die Runde. War das nicht mein chinesischer Name? Unsere Blicke trafen sich.
»Lebt nicht mehr«, sagte er.
Also so sah der Tod aus, dachte ich, als er auflegte und wieder auf mich zukam.
War ich gestorben?
Er schüttelte den Kopf, und wir kamen ins Gespräch.
Wahrsager Wang (王算命) war der Spross einer alten Pekinger Apotheker-Familie, die am »Gemüsemarkt« (菜市场) ein großes Geschäft besessen hatte: das »Kranichjahr« (鹤年堂), so sein Name. Vor dem Krieg war er einige Jahre in Europa gewesen, hatte dort Englisch und Deutsch gelernt und sprach ein wunderschönes Peking-Chinesisch, wie es nur waschechte Pekinger von sich geben: rollende und gleichzeitig nasale Lautfolgen, eingebettet in einer Tonlage, die sich wie das Schnurren eines gestreichelten Katers anhörte. Hans Albers, wenn er Chinesisch gesprochen hätte.
Er suchte eine Beschäftigung, ich einen Sprachlehrer. Wir vereinbarten ein Honorar und trafen uns von da an jeden Nachmittag für eine Stunde in einem Hinterzimmer des Astoria, wo er Klienten empfing und mit der Niederschrift einer Wahrsagelehre beschäftigt war: ein Almanach von tausend illustrierten Schlüsselszenen – Fahrt mit dem Motorrad, Hausbau, Reissaat etc. –, die über Begriffe und Zahlen miteinander kombiniert werden konnten und so Aussagen über zukünftige Ereignisse ermöglichten.
Also ein Wahrsager und Apotheker, verwandte Berufe. Ich vertraute ihm das Rätsel meiner Anfälle an. »Dämonische Besessenheiten« (鬼魅邪狂), diagnostizierte er, zu den Symptomen gehörten Selbstvergessenheit (不识自), Gehwut (狂走) und Halluzinationen (幻觉). Ich nickte: ja, Halluzinationen, Trugbilder. Guter Rat sei jetzt teuer, sagte er und runzelte die Stirn. In Peking hätte er mir »Dämonen-Austreibe-Pillen« (杀鬼丸) verschrieben, fuhr er fort, die Ingredienzen wären hier jedoch nicht zu bekommen, vor allem »Gu« (蠱) nicht, ein Insekt, das sich selbst erzeugt: man füllt ein Gefäß mit allem möglichen Kleingetier, verschließt es und öffnet es nach einem Jahr: »Gu« sei das Insekt, das nach Einverleibung aller anderen als einziges noch am Leben sei.
Die Ursache der Anfälle? Möglicherweise ein Fuchsgeist (狐精), sagte er. Sei ich in Taiwan einer Frau begegnet, zu der ich mich rätselhaft hingezogen gefühlt hätte – »gar schöne Spiele spiel ich mit dir«?
Ich überlegte. Ja, dachte ich, Spiele, eine Tante meiner chinesischen Frau, hatte mir welche beigebracht: Gevatterin Yin (尹妈妈).
Auch sie war vom Festland nach Taiwan geflohen, von Kalgan (张家口), der Grenzstadt zur Mongolei, wo sie erst Mama-san eines Bordells gewesen war, dann Konkubine eines Warlords, der nach ein paar Monaten das Zeitliche gesegnet hatte. Seitdem galt sie als »Füchsin« (狐狸请), aus chinesischer Sicht keineswegs eine böse Hexe, sondern auf ihre Weise eine ebenso geachtete Standesperson wie früher eine Klosterfrau in Europa. In Taiwan lebte sie zusammen mit einem ehemaligen Zuhälter, der sich mit ihrer Hilfe einen Namen als Wunderheiler gemacht hatte. Auch er war vor der Machtergreifung der Kommunisten in Kalgan ansässig gewesen, als Chauffeur des verblichenen Warlords. Ich dachte: Hatten beide ihn umgebracht?
Sie war eine Meisterin im Fadenspiel (翻绳儿): Durch gegenseitiges Abnehmen einer zwischen den Fingern gespannten Schlinge werden immer neue Figuren gebildet. Auch »Greifen« (挝子儿) hatte sie mir beigebracht, gelangweilte Konkubinen vertrieben sich in Kalgan damit die Zeit. Gespielt wurde es mit Stoffbällchen. Man platziert eine ungerade Anzahl (gewöhnlich fünf) von ihnen auf einen Tisch, den man vorher mit einer weichen Unterlage bedeckt hat. Die Regeln: Der Spieler Nr. 1 ergreift mit der rechten Hand das erste Bällchen, wirft es in die Höhe, fängt es mit der linken Hand auf, während er zur gleichen Zeit mit der rechten Hand ein zweites Bällchen ergreift und hochwirft, es mit der linken auffängt und so weiter, bis alle fünf Bällchen geworfen und wieder aufgefangen sind. Wer nicht alle wieder auffängt, scheidet aus. Bei den folgenden »Runden« (单元) wirft man gleichzeitig erst zwei, drei, dann vier usw. Bällchen in die Höhe und fängt sie wieder auf. Im letzten Durchgang wirft man alle fünf Bällchen auf einmal.
Wir spielten es, ich weiß nicht, wie viele Male. Ich schied schon bei drei Bällchen aus. Sie schaffte immer noch fünf. Ihre Augen waren dabei geschlossen, der Mund leicht geöffnet, ganz links blinkte ein Goldzahn auf; die Grübchen in ihren Wangen waren tiefer geworden. Ein Orgasmus?
Ich wäre gerne ein Kunde von ihr in dem Kalganer Bordell gewesen.
Wang brachte mir den Peking-Dialekt bei; die Zeichen lernte ich mithilfe eines ornithologischen Wörterbuchs und Swinhoes »Chinese Birds«, beide Bücher hatte ich in einem Rucksack stets bei mir. Im »Swinhoe« hatte ich auf der ersten Seite, für den Fall, dass ich wieder mein Gedächtnis verlieren sollte, meinen Namen und meine Adresse geschrieben. Aber würden sie mir etwas sagen?
Einmal saß ich mit meinen Büchern im Astoria Café auf meinem Lieblingsplatz am Fenster mit Blick auf den Tempel des Stadtgottes und einer daneben liegenden Autoreparaturwerkstätte: beides nach chinesischer Vorstellung Instandsetzungs- und Ausbesserungsbetriebe. Am Eingang des Tempels befand sich der Stand eines Wahrsagers, ein Kollege meines Sprachlehrers: ein älterer Herr in einem chinesischen Gewand, mit einem Jadeamulett an einem dünnen Goldkettchen um den Hals und einer blauen runden Sonnenbrille auf der Nase, der stolze Besitzer einer auf dem Rücken grasgrün gefiederten Kohlmeise – Parus cinereus var. monticolus insperatus (绿背山雀), so Swinhoe in seinem Katalog, »Rückchen« (子子背儿) war die landläufige Bezeichnung. Die Vögel gaben nur zwei Laute von sich: »hihi« (唏唏) und »haha« (哈哈), man verlor daher bald die Lust, ihnen zuzuhören. In Taiwan galten sie als bösartige »Vogelkobolde« (鸟精): Unglücksvögel, die mit bösen Mächten in Verbindung standen und dumme Zufälle und Pannen zu gefahrvollen Verwicklungen verknüpften.
Der Vogel zog gerade auf einen Wink des Wahrsagers aus einem Kasten einen dünnen rosa Zettel mit einem Horoskop hervor und überbrachte ihn seinem Herrn. Praktische Anweisungen standen darauf: heute besser nicht mit dem Motorrad fahren, einen Hausbau beginnen, Reisschößlinge setzen etc. Der Klient, ebenfalls mit einer Brille auf der Nase, saß auf einem Schemel neben dem Stand, während der Wahrsager, die Weissagungen auf dem Zettel erläuterte und mit seinem Pinsel ergänzte, derweil der drollige kleine Vogel, nachdem er ein paar Körner zur Belohnung bekommen hatte, trällernd und flötend – hihi (唏唏) – Kreise um den Stand und die benachbarte Autoreparaturwerkstätte flog. Vom Torraum des Tempels aus hatten zwei überlebensgroße und mit Lanzen, Schwertern und Knüppeln bewaffnete Torgötter ein wachsames Auge auf Wahrsager und Klient – der mit grimmig zusammengebissenen Zähnen hieß »Heng« (哼), der mit weit aufgerissenem Mund »Ha« (哈). Auf einem hohen und langen Tisch lagen die Opfergaben, die der Klient des Wahrsagers, um den Stadtgott gnädig zu stimmen, eben dort noch deponiert hatte: eine Pyramide polierter Äpfel, eine Flasche Sorghumschnaps und ein »Kentucky Fried Chicken«. Geister darf man nicht hungern lassen, sonst werden sie ungemütlich.
Der Wahrsager legte den Pinsel beiseite, der Klient erhob sich mit dem Zettel in der Hand und steckte, das Gesicht in nachdenkliche Falten gelegt, seine Brille zurück in die Brusttasche seines Hemdes, was aus Ungeschick oder Sorge über die Zukunft auf eine Weise geschah, dass ein Bügel der Brille außen heraushing. Ein böses Omen, der Wahrsager zeigte vorwurfsvoll darauf. Als der Klient die Brille wieder hervorzog, um sie aufs Neue in die Brusttasche zu stecken, kam ihm ein Motorradfahrer entgegen, vor sich auf dem Benzintank ein riesiges Bündel mit bedruckten Faltkartons, das dem Fahrer fast die Sicht nahm. Er bremste, als ihm der Vogel des Wahrsagers, der keine Furcht vor Menschen zu kennen schien – haha (哈哈) –, vor die Nase flog, und stellte fluchend den Motor ab, kurz vor dem Klappstuhl, auf dem der Wahrsager saß, der gleichmütig wie einer, der schon alles gesehen hat, das Kommen und Gehen auf der Straße verfolgte und dabei den Fächer in seiner Hand hin und her bewegte. Als der Motorradfahrer auf den Anlasser trat, um wieder anzufahren, und sich auf seinem Sitz nach oben hob, da er so besser über das Bündel hinwegschauen konnte, kam ihm der Wahrsagevogel – haha (哈哈) – erneut in die Quere, dem Anschein nach wieder mit voller Absicht. Der Fahrer prallte vor dem Vogel zurück, geriet ins Schwanken, das Motorrad machte einen unkontrollierten Satz nach vorn und fiel krachend um – hihi (唏唏) – in gefährlicher Nähe des Wahrsagers, der erschrocken auf seinem Klappstuhl nach hinten fuhr, die Balance verlor und gegen den Stand mit dem Kasten kippte, der mitsamt den Horoskopen darin umstürzte. Der Klient von eben, schon im Fortgehen begriffen, hielt inne, blieb unschlüssig stehen und wandte sich dann dem Wahrsager zu, wobei ihm (dem Klienten), während er sich vor jenem bückte, um ihm aufzuhelfen, die Brille aus der Brusttasche fiel, ihm zwischen die Füße geriet, wo er sie knirschend zertrat, da er nicht mehr in der Lage war, seinen Schritt nach vorne abzubrechen, ohne selbst das Gleichgewicht zu verlieren, das er nun dadurch zurückzugewinnen trachtete, dass er sich beim Bücken, was jedoch bereits ein halbes Fallen war, mit der linken Hand unwillkürlich an dem Jadeamulett des Wahrsagers festkrallte, der gerade im Begriff war, sich wieder aufzurappeln, mit dem Ergebnis, dass das dünne Goldkettchen, an dem das Amulett befestigt war, riss und der Klient, nun vollends den Halt verlierend, auf den Wahrsager stürzte, gerade als ein Arbeiter mit einem zweirädrigen Schubkarren, auf dem zwei lange Eisblöcke wie Särge ruhten, um die Ecke bog und entgeistert über das Bild, das sich ihm bot, den Karren losließ, worauf dessen Ladefläche kippte und die beiden Eisblöcke in Richtung des Tempeltores rutschten und zwei große Blumenkübel, in der hier eine Palme und dort ein Gummibaum eingetopft waren, zu Fall brachten. Die Topfpalme rollte polternd gegen einen Kanister mit Öl, der vor der Autoreparaturwerkstatt stand, stieß diesen um, wobei sich der Verschluss löste und das Öl aus dem Kanister gluckernd auf die Straße floss, in die gerade ein weiterer Motoradfahrer einbog, ebenfalls mit einem Bündel von bedruckten Faltkartons vor sich – es musste eine Fabrik hierfür in der Nähe sein –, welcher durch das Öl auf der Straße, das er nicht sah, aber auch durch den Wahrsagevogel, der nun an ihm vorbeiflatterte, unversehens seine Richtung verlor, wobei er, bereits schlitternd, unwillkürlich noch einmal Gas gab, was er nicht hätte tun sollen, da er damit nur bewirkte, dass die Räder in der Öllache durchdrehten und er mitsamt seinem Motorrad krachend umfiel, nicht weit entfernt von dem seines Vorgängers, der sich gerade von Faltkartons freizuschaufeln im Begriff war, nur um erneut von einer Ladung verschüttet zu werden, während der Wahrsager, dem der Klient immer noch am Leib hing, in dem Bemühen, diesen von sich zu stoßen und sich aufzurichten, mit der Hand in der Luft herumfuhrwerkte, was der Vogel als Aufforderung verstand, einen Zettel aufzupicken – sie lagen überall zwischen den Faltkartons herum –, den er in die Hand seines Herrn und Meisters fallen ließ, bevor er sich flügelschlagend und schwanzwippend – haha (哈哈) – im grimmig aufgerissenen Mund des Torgottes »Ha« (哈) niederließ.
Was mir keine Ruhe ließ, je mehr ich über die Begebenheit nachdachte, war der Umstand, dass der Ablauf mir so klar und deutlich vor Augen stand, wie sonst nur dann, wenn nach einer »dämonischen Besessenheit« mein Gedächtnis wieder zurückgekehrt war. Hatte ich es eben verloren, und war die Begebenheit wie bei meinem ersten Anfall nur eine Halluzination gewesen? Panik erfasste mich, ich wagte kaum, einen Blick auf den Tempel zu werfen. Schließlich tat ich es doch.
Eine Welle der Erleichterung überkam mich. Der Wahrsager, sein Klient und die beiden Motorradfahrer richteten sich gerade auf, der Vogel saß immer noch, als hätte er dort sein Nest, im Mund des Torgottes. Ich hatte weder meinen Verstand noch mein Gedächtnis verloren, es war auch keine Halluzination gewesen, die Begebenheit hatte sich so ereignet, wie sie vor meinen Augen abgelaufen war. Es war der Wahrsagevogel gewesen, der das Meleé heraufbeschworen hatte, nicht mein Gehirn.
Ich bezahlte, überquerte die Straße und schritt in den Tempel. Der Unglücksvogel saß inzwischen auf dem Altar und pickte an dem »Kentucky Fried Chicken«, das eigentlich dem Stadtgott zugedacht war. Kerzen flackerten qualmend und blakend vor dem Altar. Darüber erhob sich dunkel wie die Nacht das schwarze Gebälk des Daches.
Alles ist Rauch. Die ganze Welt ist Rauch.
Aus dem Inneren des Tempels ertönte ein Gong:
Verzeihung: Schall und Rauch.