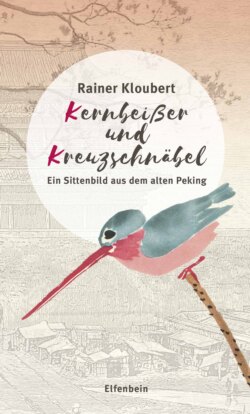Читать книгу Kernbeißer und Kreuzschnäbel - Rainer Kloubert - Страница 7
ОглавлениеKäfige, Gestelle und Paraphernalia
»Kleider: am besten neue; Käfige: lieber alte«
(衣不如新, 笼不如旧)
Vogelkäfige waren während der Kulturrevolution zu Brennholz kleingemacht worden, es sei denn, sie hatten sich in Häusern befunden, die für die »Roten Garden« (红卫兵) gesperrt oder zu abwegig gewesen waren: Anwesen von Prominenten oder solche in unzugänglichen Gegenden – den Westbergen beispielsweise. Bei meinem Spaziergang, bei dem ich den Opernsänger mit seinem Rotkehlchen getroffen hatte, war ich wenige Minuten später auf einen Bungalow gestoßen, wie sie verstreut überall in den Westbergen noch existierten: frühere Sommerresidenzen von Ausländern oder reichen Chinesen. Ein alter Mann saß strickend auf einem Gartenstuhl, in seinem Schoß lag ein rotes Wollknäuel, ab und zu zog er an dem führenden Faden und rollte das Knäuel mit einem gekonnten Ruck seines Ellbogens weiter auf. Ich ging neugierig auf ihn zu.
»Was ist das für ein Haus?«
»Die Lotosvilla (莲花墅).« Der Mann gab dem Garnknäuel wieder einen Ruck, um den Faden zu lockern, ich war ihm offensichtlich lästig.
In der weiten, weiten Ferne …, wieder der Sänger von irgendwoher, der hinter mir den Pfad herunterschritt.
»Die Lotosvilla? Was für ein schöner Name! Wer hat denn hier gewohnt?«
»Ah … wer schon!« Er machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Kann ich einen Blick hineinwerfen?«
»Ja … aber nur von außen!«
… wo ein Mädchen auf mich wartet …
»Nicht von innen?«
»Nein, der Mann mit dem Schlüssel ist nicht da«, sagte der Mann unwirsch.
Auf der weiten Veranda, die sich um das Gebäude zog, standen zwei Korbstühle am Fenster, zwischen ihnen ein Tisch, auf dem ein Aschenbecher und eine geöffnete Zigarettenschachtel der Marke Panda lagen. Einer der Sessel war nach hinten gerückt, als ob gerade jemand aufgestanden wäre. Ein Paar schwarze Stoffschuhe lehnte zum Trocknen am Geländer, rote Paprikaschoten und Knoblauchbündel hingen vom Dach herab. Der Raum neben der Veranda war vollgestellt mit verstaubtem Gerümpel (ein grünbespanntes Sofa mit Troddeln, ein staubiger Safe, Blumentöpfe mit vertrockneten Pflanzen etc.). An der Wand hing eine vergilbte Karte von China mit bunten Stecknadelfähnchen, an der Seitenwand eine andere, ebenfalls mit Fähnchen, dazwischen standen drei Vogelkäfige. Ich warf einen Blick an die Decke. Auch dort hingen Vogelkäfige, einer neben dem anderen in allen Größen und Gestalten.
»Zhu De«, rief mir der Mann vorwurfsvoll hinterher, als ich mich zum Gehen wenden wollte, »Zhu De hat hier gewohnt.«
Ich blieb überrascht stehen.
Dooooooort, wo ein Mädchen auf mich wartet …
»Zhu De (朱德) hat hier gewohnt«, sagte der Stricker noch einmal. Er spuckte aus und drehte seinen Kopf ab, als hätte er schon zu viel gesagt.
Zhu De also, der große und legendäre Marschall der Kommunisten, süchtig nach Opium, dem »Großen Rauch« (大烟), dem er schon als Warlord in Szechuan verfallen war, noch bevor er zu Mao stieß, der ihn zu seinem Marschall machte. Als er sich gegen Mao stellte, fiel er in Ungnade. (Er hatte zur selben Zeit in Deutschland studiert wie der Wörterbuchmacher Lin Yutang.)
»Hat er Vögel gehalten?«
»Man hat sie ihm alle weggenommen, nur die Käfige durfte er behalten.«
Auch eine Form der Tortur. Die Fähnchen in den beiden Karten an der Wand kamen mir wieder in den Sinn. Fähnchenspiele – hatte ein Kreuzschnabel (交嘴) sie herausgezogen und sie je nach Frontverlauf hin- und hergetragen; oder aufs Geratewohl zu neuen Fronten gesteckt, auf die die Gegner nicht vorbereitet waren; eine Spezialität des Generals? Ich warf noch einen Blick in die Veranda. In einem der beiden Korbstühle lag ein eingedrücktes Kissen, an der Rückenlehne war ein Polster befestigt, von der flachen, harten Sorte, auf die Opiumraucher ihren Kopf zu betten pflegten, bevor sie ihn in Träumen verloren. Nebeldunst stieg unten vom Tal auf. Hatte sich nicht auch der Marschall während des Bürgerkriegs mit Stricken die Zeit vertrieben?
Ich drehte mich nach ein paar Schritten noch einmal um. Der Mann, der auf das Haus aufpasste, gab dem Wollknäuel wieder einen Ruck und schaute mir unfreundlich nach.
War er es vielleicht selbst – Zhu De? Der legendäre Marschall als sein eigener Pförtner?
»Gute Vögel steckt man nur in gute Käfige« (好鸟配好笼). Käfig war noch lange nicht gleich Käfig. Jeder war hinsichtlich Gestalt, Form, Größe, Anzahl der Stäbe, Durchmesser, Inneneinrichtung (Sitzstangen, Ess- und Trinknäpfe etc.) auf eine bestimmte Vogelart zugeschnitten. (Keine Regel ohne Ausnahme: Drosselkäfige dienten beispielsweise auch zum Halten von Haubenmainas (八哥儿, Acridotheres cristatellus), einer asiatischen Starenart, und ihren aus Südostasien gebürtigen Schwestern, den Hügelmainas (鹩哥, Gracula religiosa, auf Chinesisch auch »Gelbohren« (黄耳朵) genannt), aber auch für die unsäglich dummen Seidenschwänze (和平鸟).) Es gab grobe Käfige von der Stange (行笼) und teure und feingearbeitete Maßarbeiten (定活笼), welche die individuelle Handschrift ihrer Hersteller trugen und ein Vermögen kosteten. Quadratische oder längliche Käfige waren nie erste Wahl, gleichfalls solche in ausgefallener oder barocker Gestalt wie Pavillons, Tempelchen, Pagoden, Lotoskelche, Dschunken, Lampions – sich über ihren Zweck erhebende Formen. Käfige für exotische Vögel, die menschliche Stimmen nachzuahmen verstanden – wahre Vogelliebhaber verschlossen vor solchen zur Respektlosigkeit neigenden Vögeln schaudernd ihre Ohren –, stammten gewöhnlich aus der Hafenstadt Tientsin (天津).
Für Käfigteile und Utensilien galt die Pekinger Philosophie, dass sich in den Requisiten einer Passion Kunstsinn und Selbstachtung des Besitzers widerspiegeln mussten. Warum sein Licht unter den Scheffel stellen und sich dadurch eines zusätzlichen Vergnügens an der Sache zu berauben?
»Käfigkappen« (顶棚盖布) und »-hüllen« (笼罩): Die Stäbe eines Käfigs fanden sich wie die Speichen einer Radachse oben zu einer Öffnung zusammen. Die »Kappe« darüber oder darunter hatte zwei Funktionen: erstens das unästhetische Loch zu schließen und zweitens dem Vogel den bedrohlichen Anblick der den Griff umfassenden menschlichen Hand zu ersparen. Maßgeschneiderte Käfige (定活笼), vor allem solche für Blau- und Rotkehlchen, Drosseln und Lerchen, hatten Kappen aus schwarzem, mit Rauten, Rhomben, Päonien oder anderen großblättrigen und -blütigen Blumen besticktem Satin (段). Beliebt waren auch schräggestickte Elefantenaugen (象眼). Bei einfachen Käfigen von der Stange (行笼) war es ein brauner oder purpurroter Lackdeckel (漆板). Ganz billige Käfige hatten Kappen aus weißem Wachstuch (漆布), oft bemalt mit drei blauen Blumen (三蓝花) – Gipfel ordinärer Geschmacklosigkeit, so Jin Shoushen (金受申), der Arbiter Elegantiæ der Pekinger Vogelwelt.
Die Kappen der Käfige für Sumpfmeisen (红子) pflegten in der Kaiserzeit aus fein getriebenem, glänzend geschliffenem oder mit Gravuren versehenem Eisen zu sein – billige Kappen waren aus Blech (马口洋铁). (Wörtlich: »Pferdemaul-Eisen«. »Pferdemaul« (马口, makou) war eine Bezeichnung, die auf Macao Bezug nahm, den Hafen, über den zum ersten Mal Blech seinen Weg nach China gefunden hatte, also eigentlich: »Macao-Eisen«.) Gegen Ende der Dynastie kamen Kappen aus Kupfer auf – bei gewöhnlichen Käfigen Rotkupfer (红铜), bei besseren eine Kupfer-Nickel-Legierung (白铜). Reliefartige Zeichen oder Bilder waren auf ihnen eingemeißelt oder eingeätzt: bei harten Eisenkappen eine mühevolle Angelegenheit, einer der Gründe, weshalb man ihrer immer seltener habhaft werden konnte.
Eine Geschichte hierzu: Zu den wenigen Liebhabern, die hartnäckig an Eisenkappen festhielten, gehörte ein entfernter Verwandter des Kaiserhauses, der sie für jeden einzelnen Käfig seiner zwölf Sumpfmeisen in der kaiserlichen Hofmanufaktur (内务府造办处) hatte anfertigen lassen, noch unverzierte Meisterstücke, in die er von einem berühmten Miniaturkünstler die Bilder der zwölf Blumengöttinnen des Jahres (十二月花神) ziselieren ließ, dazu passende Landschaften und Gedichte. Für seine Sumpfmeisen, die ihre Lieder unisono im Chor vortragen konnten, war ihm nichts zu teuer. Ein bezaubernder Anblick, etwas Besonderes, nichts Alltägliches, ein Schauspiel, das selbst Leute gefangennahm, die sich sonst aus Vögeln wenig machten: die exquisiten Bambuskäfige nebeneinander an der Decke seines Studios; das Herz lief einem über, stimmten sie ihren kunstvollen Gesang an; man blieb unwillkürlich stehen und vergaß alles andere, nur um ihnen zu lauschen. Aber auch eine traurige Geschichte: Jedes Mal wenn einer der zwölf starb, blieb ihrem Impresario, um den Käfig wieder mit Gesang zu füllen, keine andere Wahl – nichts ist ja trostloser als ein leerer Käfig, was nicht nur Marschall Zhu De (朱德) wusste –, als sich auf die Suche nach einem Nachfolger zu machen. Sein ganzes Leben verbrachte er so auf der Suche nach Sumpfmeisen – eine fehlte die meiste Zeit immer am Dutzend –, bis er eines Tages, kurz vor der Ermordung des deutschen Gesandten von Ketteler, mit welcher der eigentliche Boxeraufstand begann – den in seiner ganzen Grässlichkeit zu erleben, ihm erspart blieb –, in einem Laden an der »Himmelsbrücke« (天桥) wieder einmal auf der Suche nach Ersatz das Zeitliche segnete. Ein erfülltes Leben, ein glücklicher Tod und ein Himmel voller Sumpfmeisen.
Sein Sohn, der die Leidenschaft seines Vaters nicht geerbt hatte, dafür der Spielsucht verfallen war, verkaufte die Käfige bei Ausbruch des Boxeraufstandes an einen Curio-Händler. Ein kurzes Klackern des Abakus – drei nach oben, eins nach unten, geteilt durch zwei (三下五除二) –, und die Käfige hatten mitsamt der Sänger ihren Besitzer gewechselt. Nicht für lange: Peking wurde nach der Niederschlagung des Boxeraufstandes von den alliierten Armeen zur offenen Stadt erklärt. Plündernde Soldaten aus aller Herren Länder fielen über die Läden der Stadt her. Nach Vogelkäfigen stand ihnen nicht der Sinn. Goldene Käfige hätte man wenigstens noch einschmelzen können, aber die gab es nur im Märchen, so machten trampelnde Stiefel oder Säbelhiebe kurzen Prozess mit ihnen, wenn sie nicht gleich mit dem ganzen Laden lichterloh in Flammen aufgingen. Ein altes Seidengewand hineingezwängt, ein Schuss Lampenöl darüber, und aus Käfigen waren Brandbomben geworden. Für viele Liebhaber wäre ein einziger goldener Käfig schon die Erfüllung eines Lebenstraumes gewesen.
Die Hüllen oder »Mäntel« (笼罩), in denen sie steckten, dienten nicht nur dem Schutz vor Kälte, Ungeziefer, Katzen, Schlangen etc., sondern spielten auch eine Rolle bei der Gesangsausbildung, eine ebenso wichtige wie die Halsfesseln (脖索) für die Dressur von Spielvögeln. Singvögel lernten Lautfolgen am raschesten, wenn sie im Dunklen saßen, also bei über den Käfig gestreifter Hülle. Genaues Orts- und Zeitgefühl war ihrer Konzentration abträglich, es bedurfte der Orientierungslosigkeit und etwas Furcht, um die Sinne zu schärfen.
Eine Weisheit, die mir auf der Stelle einleuchtete, je mehr ich darüber nachdachte. Was in ihren Köpfen vorging, saßen sie im Dunkel ihres Käfigs, war im Grunde genommen nichts anderes als das Poltern, Dröhnen, Klopfen, Pochen, Schrillen, Schlagen, Tönen und Pfeifen, aus dem ich mir nachts auf meinen Zugreisen, zu denen ich mich bald nach meiner Ankunft in China aufgemacht hatte, einen Reim zu machen versuchte, wachgerüttelt aus Träumen, die noch vor meinen Augen geisterten. Geräusche und Laute, die ich zuerst nur im Halbschlaf wahrgenommen hatte, dumpf, als wäre ein Mantel über sie geworfen worden: Stimmen ertönten, Türen wurden zugeschlagen, eine Lok ließ pfeifend Dampf ab; eine Durchsage schepperte, erst laut, dann leise und entfernt auf einem anderen Bahnsteig, immer dieselbe schrille Frauenstimme mit immer der gleichen hysterischen Ankündigung. Leute liefen auf dem Gang hin und her, Quietschen, Pfiffe, wieder Türenschlagen, entfernte und dann wieder nahe Lautsprecherstimmen, trappelnde Schritte auf dem Bahnsteig, laute Rufe, Antworten, erneut das Pfeifen, mit dem Dampf abgelassen wurde, das Tuten von Schiffen (Teil eines Traumes?), noch einmal Türenschlagen und Pfiffe, dazwischen immer wieder Klänge, die ich nicht bestimmen konnte, obwohl sie mir vertraut vorkamen. Erinnerungen aus einem früheren Leben, dem mütterlichen Bauch oder kollektivem Menschenbewusstsein?
Wie weit reichen Erinnerungen eigentlich zurück – wann beginnen sie? Erst wenn man sich seines eigenen Ichs bewusst geworden ist. Ich wusste noch genau, wann das bei mir gewesen war: mit der plötzlichen Erkenntnis des Altersunterschiedes, ein Gewahrwerden, das über mich kam, als ich neben meiner Mutter vor der Wiege meiner drei Jahre jüngeren Schwester stand. Ich wusste auf einmal, dass ich jünger war als meine Mutter und älter als meine Schwester. »Ich bin ich«, war mir plötzlich durch den Kopf gegangen, »ich bin ich und kein anderer.«
Von solchen, in Selbstgewissheit ruhenden Erinnerungen zu unterscheiden sind bloße Bilder und Laute aus meiner frühen Kindheit: an- und abschwellende Sirenen, Mündungsfeuer am Himmel, der nächtliche Bahnhof meiner Heimatstadt, ein Mann mit einer am Jackenknopf befestigten Taschenlampe, an dem vorbei eine dunkle Masse von Gestalten zog, bewegt, wie es schien, vom rhythmischen Stampfen und Zischen einer Lokomotive. Die nächtlichen Bahnhöfe, in denen ich bei meinen Fahrten durch China jedes Mal aufwachte, beschworen diese längst vergangenen Bilder und Klänge wieder herauf. Wo war ich? Für einen kurzen Moment packte mich die panische Angst, mein Gedächtnis wieder verloren zu haben. An den Wänden des Abteils wanderten platonische Schatten hin und her, das Licht eines vorbeifahrenden Zuges löschte sie wieder aus, ein Pfiff ertönte. Ein paar Minuten vergingen. Als würden schwere Möbelstücke verrückt, setzte der Zug sich auf einmal wieder in Bewegung. Schatten liefen immer schneller über die Wände, Räder schlugen gegen die Schienen, auch sie immer schneller, bis das Schlagen schließlich ineinander überging, jäh unterbrochen von einem hellen rhythmischen »tamtam tamtam tamtamtam«, wenn der Zug über eine Brücke fuhr. Reisen zurück in meine Kindheit, eine Vorzeit, in der ich weder denken noch sprechen konnte und auch noch nicht wusste, wer ich war – ein erinnerungsloser Dämmerbrei, aus dem sich im Laufe der Zeit mein Bewusstsein und meine Sprache geformt hatte.
(Mit den Geräuschen, die mich bei meinen nächtlichen Zugfahrten durch China begleiteten, pflege ich heute als Klangimitator meine Gäste zu unterhalten: Hörszenen einer Zugreise durch China. Der Zug hält in einem Bahnhof, ein zweiter rattert vorbei:
tektektektektektektektektektektekt e e e e
Kurz danach auf der anderen Seite ein Zug in entgegengesetzter Richtung: toktoktoktoktoktoktoktok o e o e o
Hallende Lautsprecher macht man dadurch nach, dass man den Kehlkopf zwischen Daumen und Zeigefinger zwängt und schnell hin und her bewegt – auch die brüchige und scheppernde Lautsprecherstimme Mao Zedongs bei der Ausrufung der Volksrepublik am Platz des Himmlischen Friedens lässt sich so imitieren: Höhepunkt einer Nummer von mir über die chinesische Revolution, zu der auch das blecherne und ausgeleierte Glockenspiel »Der Osten ist Rot« (东方红) am Pekinger Hauptbahnhof gehört.)
Käfighüllen schützten die Vögel vor Kälte, Staub, Insekten etc. und verhalfen ihnen zu der für das Erlernen von Lauten unabdingbaren Konzentration. Aber das war nicht alles. Sie dienten auch als eine Art Theatervorhang, der aufgezogen und wieder heruntergelassen das Zeichen für Beginn und Ende einer Darbietung gab. Verzichtete man auf die Hülle, nahm den Vogel beispielsweise aus dem Käfig und platzierte ihn auf ein offenes Gestell (亮架), hatte dies unmittelbare und negative Auswirkungen auf seinen Gesangvortrag. Erst die »Hüllen« machten die Käfige zu tragbaren Theatern – Handbühnen gewissermaßen, auf denen die Sänger ihr Repertoire zu Gehör brachten.
Auch für Hüllen galt die Pekinger Maxime, Dinge, die man für eine Liebhaberei brauchte, nicht nur so vollkommen wie möglich zu machen, sondern das Spiel mit ihnen durch die Beigabe von Regeln noch abwechslungsreicher zu gestalten. Hüllen einfach nur überzustreifen und wieder abzunehmen wäre als allzu simpel dieser Lebensart zuwidergelaufen. Wie ein chinesisches Gewand auf- und zuknöpfen? Ja, aber wo aufknöpfen? Vorne, hinten, links oder rechts? Die Geister schieden sich daran. Ein anderes Beispiel: Peking wurde von Jahreszeiten zusammengehalten, nach ihnen richteten sich Familienleben, Essen, Festtage, Kleidung, Spiele, Sitten und Gebräuche und natürlich auch die Hüllen von Käfigen. Die für den Sommer bestanden aus drei Segmenten: ein ungefüttertes (单截) in der Mitte und jeweils oben und unten ein gefüttertes (夹截) Randsegment (贴边, i. e. »Saum« oder »Umschlag«). In den Hundstagen griff man zu leichten Hüllen aus Gaze. Im Winter waren die Hüllen von oben bis unten gefüttert (夹罩) oder bestanden aus doppelten Lagen (复层). Auch das Gesetz des Geldbeutels spielte eine Rolle. Teure maßgeschneiderte Hüllen – aus Baumwollsatin, fein gewirkt und eng genäht (缝口细密) – hatten breitere Randsegmente. Bei billigen Hüllen aus Baumwolle waren die teuren (weil gefütterten) Randsegmente sehr viel schmaler. Ein Blick auf sie genügte, und man wusste, was für ein Käfig im Zweifel dahintersteckte – und ob der Besitzer arm oder reich war.
»Mondweiße« (月白) oder tiefblaue (深蓝) Farben waren am verbreitetsten. Elegant, aber nicht jedermanns Geschmack, weil etwas gewagt, war schwarzer, mit kohlrabiblauen Mustern bestickter Satin. Für Lerchen, schreckhafte Wesen, die auf bunte und grelle Farben, die es in ihrem natürlichen Habitat, der Steppe, nicht gab, verstört reagierten, nahm man gedeckte Farben: ein mattes Blau, Grau oder Schwarz, wenn man es nicht vorzog, den Stier bei den Hörnern zu packen und den Sänger mit Gewalt ein für alle Mal ans bunte Stadtleben zu gewöhnen – mittels einer gelben oder roten Hülle. Aber das war etwas riskant. Die Farbe der Hülle musste, unnötig zu sagen, auch zu der des Käfigs passen.
Ein paar Worte auch hier wieder zu Drosseln. Bei ihnen bestanden die Hüllen oft aus doppelten Lagen, die innere war blau, die äußere schwarz. Über dem Käfigtürchen hing ein separat ausgeschnittener Vorhang (门帘). Öffnete man das Türchen, ohne den Vorhang zu heben, war eine wunderliche Slapstick-Einlage fällig: Das Vorhängelchen bewegte sich ruckartig hin und her, dann von unten nach oben in immer schnelleren Wellen und Schwüngen, bis schließlich alles in ein allgemeines Gewoge überging, das sich schließlich öffnete. Des Rätsels Lösung: die Drossel, die hinter dem Türchen mit wachsender Frustration, dann mit Panik nach einer Öffnung im Vorhang gesucht – oder vielleicht auch nur so getan hatte. Komiker unter den Drosseln vollführten, wenn sie sich durch den Vorhang geschlängelt hatten, vor dem Vortrag erst einen Kratzfuß.
Griffe (笼抓). Flach geschwungen sahen sie aus wie Schlangen, kurz vor dem Schnellen nach vorne, um wie in Kiplings Geschichte Mungos (Rikki-Tikki-Tavi!) totzubeißen.
Sie setzten sich aus zwei Teilen zusammen: einem geschwungenen Haken (钩) und vier, gewöhnlich doppelt geschwungenen »Beinen« (腿), in der Regel mit Schrauben am Käfig bzw. an der Kappe (盖布顶棚) befestigt. Haken und »Beine« waren meistens aus demselben Material: Messing (黄铜, »gelber Kupfer«) oder eine Kupfer-Nickel-Legierung (白铜, »weißer Kupfer«), schließlich Rotkupfer (红铜) und ein buntes Allerlei aus »rotem«, »gelbem« und »weißem« Kupfer (三镶铜), weiter Stahl (钢) und schließlich Eisen (铁) – wie auch bei Kappen eigentlich die praktischste, zweckmäßigste und eleganteste Wahl. Drittklassige Käfige, die Kindern gehörten, die wild damit herumschwenkten, oder armen Leuten, denen Besseres unerschwinglich war, hatten Griffe aus roh zusammengedrehten Eisendrähten (铁丝). Bei Drosselkäfigen waren Haken (Griff) aus Metall, »Beine« dagegen aus Bambus – besonders stabile Konstruktionen, da Käfige für Drosseln beim Ausführen der Vögel im Takt der Schritte schwungvoll nach vorne geschwenkt werden mussten. Um sie solide und strapazierfähig zu machen, waren Griff und Beine oft durch Zwischenstücke miteinander verbunden: ein sich nach oben verjüngender Sockel, ein knaufartig abgerundetes Vieleck, zwei aufeinandergetürmte wasserkastanienplatte (荸荠扁) Knollen etc.
Betuchte Kenner ließen ihre Griffkonstruktionen in der kaiserlichen Hofmanufaktur (内务府造办处) herstellen, Unikate, die nach dem Sturz der Dynastie zu Liebhaberpreisen gehandelt wurden. Eine Spezialität genoss einen nahezu legendären Ruf: Griffe aus sogenanntem Mokume (本目金, »Métaux forgés«), einer Legierung von Gold, Silber, Kupfer, Eisen und anderen Metallen, die nach einem Geheimverfahren derartig miteinander verschmolzen wurden, dass jede Komponente nur für sich patinierte und die Mischung gemasertem Holz glich. Die raren und aus dem Rahmen fallenden Stücke kosteten ein Vermögen.
Ein Paar von ihnen machte auf eine bizarre Weise Geschichte: Der vormalige Direktor der Hofmanufaktur hatte vor seiner Entlassung, die er übrigens einer Indiskretion der Kanonenfirma Krupp zu verdanken hatte, zwei dieser Exemplare dem opiumsüchtigen kaiserlichen Prinzen Zaiyi (载漪) zum Geschenk gemacht. Dieser, nicht nur nach Opium süchtig, sondern auch nach Pralinen, die seine Konkubinen ihm bei Imbeck (Kierulff), einem deutschen Warenhaus im Pekinger Gesandtschaftsviertel besorgten, war nicht nur ein verschworener Feind des Westens, General der »Tigergotttruppen« (虎神营), sondern auch ein bekannter Lerchenliebhaber, der seine Lieblinge überallhin mitzunehmen pflegte. Nach der Niederschlagung des Boxeraufstandes, für dessen Ausbruch er von den Barbaren mitverantwortlich gemacht worden war, hatte ihn die Kaiserinwitwe ins Exil nach Urumtschi (乌鲁木齐) geschickt. In den damaligen Wirren und Unruhen, die allmählich auch in das Innere des Landes vorgedrungen waren, verloren sich auf dem Weg ins ferne Turkestan seine Spuren. Verschluckt vom heißen Sand der Gobi wie andere vor und nach ihm? Einer der beiden Käfige, die er mitgenommen hatte – anhand einer eingravierten Inschrift auf dem Mokume-Griff eindeutig als sein Eigentum identifiziert –, fand sich nach dem Tod der Kaiserinwitwe zusammen mit einem Koffer voller verschimmelter Pralinen in einem Gasthof in Kalgan (张家口), von wo er zu seiner letzten Reise aufgebrochen war: der Eingangspforte zur Mongolei und Heimat der tanzenden Lerchen (hierzu später mehr). Der Fund erregte deshalb Aufsehen, weil man in dem Koffer das Tagebuch des Prinzen fand, aus dem, verklebt und verschmiert von Pralinenfüllungen, hervorging, dass es die Kaiserinwitwe selbst gewesen war, die ihm höchstpersönlich den Befehl zum Angriff auf das Gesandtschaftsviertel und zur Ermordung des deutschen Gesandten von Ketteler gegeben hatte – hinterher von ihr immer wieder vehement in Abrede gestellt.
Die Lüge war ihr deshalb so leichtgefallen, weil sie genau wusste, dass der Empfänger dieses Befehls und einziger Zeuge nicht mehr am Leben war und sie deshalb nicht Lügen strafen konnte. Sie konnte sich deshalb so sicher sein, weil sie ihn und seine Begleiter in Kalgan hatte ermorden lassen. Die Eskorte des Prinzen bestand aus wenigen Gefolgsleuten, die mongolischen Karawanenführer kannten die Gobi und ihre Pfade, Oasen und Wasserstellen wie ihre Westentasche. Keiner von ihnen tauchte jemals wieder auf. Was noch merkwürdiger war: Der zweite Käfig fand sich nach dem Ende der Dynastie in einem Abstellraum der Verbotenen Stadt. Merkwürdig deshalb, weil der »Tigergottgeneral« auch ihn auf seine Reise in den Westen mitgenommen hatte, wie aus einer Fotografie hervorging, die ihn mit beiden Käfigen vor den Toren von Kalgan zeigten: Die feingemaserten Mokume-Griffe waren deutlich zu erkennen.
Der Boxeraufstand und die Ermordung Kettelers gelten auch heute noch als Wendepunkte der chinesischen Geschichte. Die Regierung macht von ihnen zur patriotischen Einstimmung Gebrauch, vor allem in Filmen. In meinen ersten Jahren in China gab es außer Experten nur wenige Ausländer, mit der mir nicht unwillkommenen Folge, dass ich regelmäßig vom Sprachenamt, wo ich vor meinem Wörterbuch saß, für Filmaunahmen ausgeliehen wurde (Diener in der italienischen Gesandtschaft der zwanziger Jahre, Vertreter der Heilsarmee mit Kapelle, Flaneur mit Dackel auf dem Bund in Shanghai etc.) – Komparse wie auch mein Großonkel Paulchen in Macao. Einmal war es ein Film über den Boxeraufstand gewesen. Für die Dreharbeiten waren außer mir – Ketteler kurz vor seiner Ermordung – als Gesandtschaftswachen vier Halbchinesen engagiert worden. Alle vier hatten deutsche Väter gehabt, die nach dem Krieg repatriiert worden waren, deutsch geblieben waren die Vornamen und eine dahintersteckende unbestimmte Sehnsucht nach Heimat: Hans, Karl, Heinrich und Josef, stellten sie sich mir vor, deutsche Allerweltsnamen, Karl war ihr Anführer. Trotz der martialischen Kostümierung (Pickelhauben, Schnurrbärte) sanfte und fügsame Wesen, die ein Leben am Rande der Gesellschaft geführt hatten. Schon der Gedanke an ihr Schicksal in der Kulturrevolution machte einem das Herz schwer.
Die Szene: nach einer Audienz im Zongli Yamen (总理衙门), dem Außenamt des Kaiserreiches, trat ich in ihrer Begleitung, eine gewichtige Aktentasche in der Hand, durch das Tor des Amtes und blieb dort für einen Augenblick stehen.
Schnitt.
Die Szene wurde mehrere Male gedreht. Als sie für gut befunden wurde, lösten sich die vier von meiner Seite und postierten sich zu einem Erinnerungsfoto um den Regisseur – der in der nächsten Szene meinen (Kettelers) Mörder darstellen würde –, ohne mich, den sie kurz vorher ehrerbietig durch das Tor geleitet hatten. Ich blieb, alleingelassen mit meiner gewichtigen (mit Papier ausgestopften) Aktentasche und in Erwartung meiner Ermordung, an einer Kutsche stehen, vor der zwei Maultiere gespannt waren, die von einem Kosaken mit rotem Vollbart – auch er ein kostümierter Halbchinese – am Zügel gehalten wurden. In ihr war mein (Kettelers) Platz in der nächsten Szene, bei der ein Boxer (der kostümierte Regisseur) die tödlichen Schüsse auf mich abgeben würde. Aber noch war es nicht so weit. Karl – sein Vater war aus Berlin – winkte dem Kosaken zu und lud ihn ein, sich mit ihnen und dem Regisseur fotografieren zu lassen. Als dieser bereitwillig zu der Gruppe ging, gerieten die beiden Maultiere aneinander und bissen sich geifernd. Der Kosake lief mit wehendem Bart zurück, holte mit seinem Fuß aus und trat einem der beiden Maultiere mit voller Wucht in den Unterleib. Das Maultier knickte blökend ein. Hans, Karl, Heinrich und Josef standen schweigend in Betrachtung des Schauspiels um den Regisseur herum – meinen Mörder in der nächsten Szene und schon als solcher geschminkt und kostümiert. Der Kosake wartete, bis das Maultier sich hochgerappelt hatte, lief zurück und stellte sich wieder zu den anderen: vier deutsche Wachsoldaten, ein russischer Kosake und der Mörder Kettelers. Ich, der ermordete Ketteler, blieb außen vor. Alle sechs lächelten in die Kamera. Die Aufnahme wurde zweimal gemacht.
Nicht viel weniger gesucht als »Manufakturgriffe« waren Griffe des »Kleinen Guo« (小郭), des »Kleinen Zhao« (小赵) oder des »Kleinen Zhang« (小张; in Peking war es allgemeine Sitte, Familiennamen entsprechend der Generationenfolge entweder mit dem Zusatz »der kleine« (小) oder »der alte« (老) zu versehen, Lenkstangen gewissermaßen für das ganze Leben, auch wenn die Träger der Namen längst nicht mehr »klein« waren: der »Kleine Zhao« konnte in Wirklichkeit längst der alte »Kleine Zhao« sein). Der bekannteste unter den dreien war der »Kleine Guo«, in aller Munde nicht nur wegen seiner Griffe, sondern genauso aufgrund seiner Liebe zu Erguotou (二锅头), einem ordinären, aus Sorghum hergestellten hochprozentigen Schnaps, der von ihm nach des Tages Mühe und Arbeit Besitz ergriff. War er bei Kasse, rührte er keinen Finger mehr. Erst wenn er das letzte Geld vertrunken hatte, machte er sich wieder an die Arbeit – und schuf wahre Kunstwerke, nach denen die Leute Schlange standen. Als würdiger Nachfolger erwies sich der »Klein-kleine Zhang« (小小张), der Sohn des »Kleinen Zhang«, der nach dem Sturz der Dynastie eine eigene Werkstatt in der »Südlichen Mittelstraße der Pekinger Schleif- und Polierwerke« (打磨厂中间路南) aufgemacht hatte, Teil der ehemals kaiserlichen Manufaktur, wo sein Vater vorher beschäftigt gewesen war.
Sitz- oder Hüpfstangen bzw. Stege (鸟杠). Sie gehörten zur Standardausstattung eines Käfigs – nur in Lerchenkäfigen fehlten sie. Manchen Vögeln reichte eine einzige (单杠) – Sumpfmeisen und Rohrspatzen beispielsweise –, Rot- und Blaukehlchen wiederum legten Wert auf zwei (双杠). Die mit Abstand teuersten waren aus chinesischer Glyzine (紫藤, Wisteria sinensis), einer glasharten Holzart, der auch die schärfsten Krallen und Schnäbel nichts anhaben konnten; selbst Sumpfmeisen, notorisch ihres unentwegten Hackens und Pickens wegen, scheiterten an ihnen. Beliebt war ebenfalls spanisches Rohr, Rattan oder Rotang, bekannt für Härte, Elastizität, Leichtigkeit, gleichbleibenden Durchmesser, Glätte, Glanz und Fleckenresistenz. Leute mit schmalerem Geldbeutel griffen zu Stegen aus festen und zähen, äußerlich dem Holz der Glyzine ähnelnden Baumwurzeln (树根). Elegantere Käfige für Drosseln und Rohrspatzen hatten mit Haifischhaut überzogene Sitzstangen (鲨鱼皮, sogenanntes »Chagrin«, ein stahlgraues Leder mit kleinen, harten und sehr glatten Schuppen, das auch für Brillenetuis, Schwertscheiden und Schmuckkästchen Verwendung fand). Etwas wertvoller waren Stege aus chinesischem Blütenpfeffer (花椒木, Zanthoxylum bungeanum), den Wurzeln von Pfirsichbäumen (桃木根) und sogenanntem Peitschenstielholz (鞭子杠). Solche aus »Sechs-Wege-Holz« (六道木, Abelia chinensis), das im trockenen Klima von Peking rissig wurde und dann gekittet werden musste, galten als zweitklassig.
Essnäpfchen (食罐), Trinknäpfchen (水罐) etc. Die erste Regel lautete: »Fünf Näpfchen machen erst ein Gedeck« (五罐一堂), i. e.: zwei Essnäpfchen, zwei Trinknäpfchen, dazu für weiches Futter (软食) ein flaches Tellerchen oder Schälchen (抹儿, bzw. das »Flache«: 浅儿). Die zweite: »Zu einem Käfig mit einem Steg gehören zwei, zu einem Käfig mit zwei (Stegen) vier Näpfchen« (单杠双罐, 双杠四罐). Regeln, von denen es – wie bei allen Regeln in China – Ausnahmen gab. Einstegige Käfige etwa mit zwei Näpfchen und einem Tellerchen oder zweistegige mit nur einem Näpfchen und einem Tellerchen etc.: Es hing von den Vögeln, ihrer Ernährung, individuellen Vorlieben der Besitzer oder den wechselnden Umständen ab.
Teure Näpfchen waren aus Porzellan und wie Köpfe von Opiumpfeifen geformt: eine kleine Öffnung und ein großer Bauch. »Nasen« (鼻) am Rücken der Näpfchen dienten zum Befestigen am Käfig. Näpfchen für Drosseln (画眉) fielen etwas aus dem Rahmen: Sie waren größer als die anderen und hatten die Gestalt von Kissen (枕形) oder Bauchtrommeln (腰鼓); bei Drosselgedecken gesellte sich zu dem Tellerchen noch ein mit Sand (沙罐) oder Lössklümpchen (黄土块) gefülltes Näpfchen, in dem Drosseln nach dem Fressen der zuträglicheren Verdauung wegen zu picken liebten.
Rot- und Blaukehlchen (靛颏), die weiches Futter bevorzugten, hatten in der Regel keine vier Näpfchen (Ausnahme zur obigen Regel Nr. 2), obwohl ihre Käfige zwei Sitzstangen besaßen, sondern lediglich ein Näpfchen zum Trinken und ein Tellerchen zum Fressen (一罐一抹); diese wurden zwischen den beiden Sitzstangen platziert. Dasselbe galt für die ebenfalls weich fressenden Rohrspatzen (苇柞). Lerchen (百灵) mit ihrer Vorliebe für hartes Futter (Hirsekörner mit Eigelb) hatten zwei Futternäpfchen, ein außen angebrachtes Trinknäpfchen (gewöhnlich aus Kupfer, nicht aus Porzellan) und dazu in der Mauser – waren sie ihrem Besitzer besonders ans Herz gewachsen – noch ein Tellerchen für weiches Futter. Sumpfmeisen (红子) hatten die Auswahl zwischen einem Näpfchen für trockenes Eimehl (干蛋面), einem »Tellerchen« für nasses Eimehl (湿蛋面) und einem Näpfchen für Schwarznesselnüsschen (苏子): mit dem Näpfchen für Wasser also »drei Näpfchen und ein Tellerchen« (三罐一抹).
Muster bzw. Motive der Gedecke pflegten aufeinander abgestimmt zu sein, insbesondere dann, wenn das Ensemble aus vier Näpfchen und einem Tellerchen bestand. Die Malereien darauf, nicht selten auf feinem Craquelé (裂纹, Haarriss-Porzellan) berühmter Manufakturen, beruhten oft auf eigenen Entwürfen der Besitzer: Landschaften (山水), Menschen (人物), Blumen und Gräser (花卉), Vögel mit buntem Gefieder (翎毛) und korrespondierenden Gedichten (诗篇). Klassische Motive für Sumpfmeisen waren etwa: »Purpurrote Hirsche« (紫鹿), »Rote Krabben« (紫蟹), »Rote und blaue (Fische) mit wechselnden Köpfen« (红蓝截头鱼, i. e. rote Fische mit blauen Köpfen, blaue Fische mit roten Köpfen), »Rote und blaue Wolken und Fledermäuse« (红蓝云蝠; Fledermäuse waren in China anders als im europäischem Volkstum Glückssymbole), »Blaue Fledermäuse und Blätter« (蓝蝠叶), »Ineinander verschlungene Fledermäuse und Blätter« (勾连蝠叶) etc. Für Rot-und Blaukehlchen (靛颏) gab es: »Rot- und Blaufischnäpfchen« (红蓝鱼罐) – »Pu der Blaufisch« ließ grüßen –, violettrosafarbene »Rouge-Trinknäpfchen« (胭脂水罐) oder zartrosafarbene »Pfirsichblüten vor einer Schneegrotte« (桃花雪洞罐).
Wahre Kenner waren daran auszumachen, dass sie sich an subtile Konventionen hielten, was Motive anbetraf. Die Subtilität ging bisweilen so weit, dass sie rein gar nicht zueinander zu passen schienen – als sei ihre Wahl aus einer Laune des Augenblicks heraus erfolgt (was ein großer Irrtum war: Ihr lagen klassische Anspielungen zugrunde, die aber so versteckt waren, dass man schon ein Literat erster Ordnung sein musste, um ihrer gewahr zu werden). Solche »Stegreifnäpfchen« (现凑的罐), wie sie genannt wurden, waren ausgesprochen wertvoll und teuer und wurden immer mehr Mode, was zur Folge hatte, dass schließlich Pseudo-Stegreif-Ensembles auf den Markt kamen, die nur so taten, als hätten die einzelnen Stücke einen (versteckten) Bezug zueinander. Näpfchen für Schwarznackenpirole (黄莺) mit roten Krabben (紫蟹)? Entgleisungen, denen wahre Kenner nicht auf den Leim gingen. Krabben passten nun einmal nur zu Sumpfmeisen.
Wertlose Stücke waren auf den ersten Blick am Material (Steingut, Mörtel) und den banalen Farben zu erkennen (李红, »Pflaumenrot«, 桃花水颜色, »Pfirsichblütentaurosa« etc.). Die Regel: »Je billiger der Käfig, desto billiger das Geschirr« (粗笼粗罐) galt auch für die Befestigungsvorrichtungen. Ignoranten und Banausen klammerten die Näpfchen mit Hilfe von dünnen Bambushölzchen an den Käfigstäben fest. Liebhaber, die stolz auf ihren Käfig waren, benutzten hierfür konkave Bambusspangen (罐凹), die – extra dafür angefertigt und von derselben Farbe wie die Stäbe oder schwarz – glatt und plan mit dem Käfiggehäuse abschlossen. Unebenheiten, auch noch so geringe, wurden mit winzigen Bambuskeilchen, »Polsterscheibchen« (垫板) genannt, auf den Millimeter genau ausgeglichen.
Andere Utensilien, ohne die ein echter Vogelliebhaber nicht angetroffen werden wollte: Stäbchen (食插) und Löffelchen (食匙) zum Austeilen der Futterportionen, Ziegenhaarpinsel (羊毫笔) zum Einflößen von Milch oder Wasser, Obstgäbelchen (果叉), Vogeldreckschäufelchen (粪铲), Gießkännchen (水壶), winzige Bambusbesen (小扫帚), Käfigbürstchen (笼刷子), Mörser (研钵) zum Zerreiben von Futter und ein Sieb (帅子) für den Sand eines Lerchenkäfigs. Für Drosselliebhaber gab es noch eine Flöte (哨子) zum Imitieren der Laute eines Weibchens. Sie bestand aus zwei zusammengeschweißten Kupfer- oder Silberplättchen, von denen eines konvex (凹) und das andere konkav (凸) war; die Plättchen hatten auf beiden Seiten ein Loch, das auf der konvexen Seite kleiner war als auf der konkaven. Blies man durch die Löcher, ertönte der typische Ruf eines Weibchens: »di di di« (嘀嘀嘀). (Nebenbei bemerkt: Die Gaumenpfeifen meiner Kindheit beruhten auf dem gleichen Prinzip: gezackte, halbrunde und durchlöcherte Plättchen aus Karton von ca. zwei Zentimetern Durchmesser und eine darunter sitzende, ebenfalls halbrunde von einem Metallring gehaltene Membran. Sie funktionierten so wie das Pfeifen auf Grashalmen. Man legte das Blättchen mit der geraden Seite nach vorne auf die Zunge, wartete, bis die Spucke den Karton aufgeweicht hatte, hob das Blättchen dann mit der Zungenspitze an den Gaumen und ließ durch den geöffneten Mund Luft ausströmen, die man durch Lippe und Zunge so regulierte, dass ein vogelähnliches Zwitschern ertönte, mit dem wir miteinander sprachen: Verständigten sich die Chinesen untereinander nicht auch so?)
Gestelle. Die elegantesten waren die waagerecht gehaltenen sogenannten Stöckchen (直架), die den unter dem Arm geklemmten sticks englischer Offiziere glichen. Dort, wo der Vogel sozusagen seinen Nistplatz (栖止) hatte, befand sich ein wulstiger Kranz aus Zwirn (bei besseren Stöcken Seidenzwirn), der dem Vogel einen rutschfesten Halt bot. Noble Stöcke waren aus Quittenholz (花梨 bzw. 木瓜, Pseudocydonia sinensis) – das Material der Wahl für sticks oder »Krücken« aus blut- bzw. purpurrotem indischem Sandelholz (紫檀) oder blauschwarzem Ebenholz (乌木). Solche aus dem bereits erwähntem »Sechs-Wege-Holz« (六道木, Abelia chinensis), aus Dattelholz (枣木), aus dem auch die Stiele von billigen Opiumpfeifen gefertigt wurden, oder aus »braunem« oder »bitterem Sandelholz« (黄檀 bzw. 苦檀, Dalbergia hupeana) galten als weniger elegant.
Bei den senkrecht gehaltenen Stöcken für Spielvögel (insbesondere für Kernbeißer und Kreuzschnäbel), den sogenannten »Steckstangen« (戳干, hierzu bei Spielvögeln mehr), waren beide Enden eingefasst in Messing oder Kupfer, das obere zur Zierde, das untere zum Feststecken in Mauerlöcher – das grandios baufällige und verschlissene Peking war voll davon.
»Krücken« (曲架) waren rechtwinklige Ständer, die aussahen wie das chinesische Zeichen 可 ohne das kleine Quadrat im Inneren: ein gerade gewachsener Stock (架干), das »Rückgrat«, und ein kürzeres, oben abschließendes Querholz (架拐). Um das »Rückgrat« besser in den Erdboden feststecken zu können, war das untere spitze Ende, »Locher«, »Punzer« oder »Stecher« (戳子) genannt, in Metall gefasst: Eisen (铁), Stahl (钢), Kupfer-Nickel (白铜) oder Messing (黄铜). Die elegantesten »Krücken«, beispielsweise solche aus der Werkstatt von »Zhao dem Halbverrückten« (半疯子赵), der die seinige außerhalb des »Westtors« (西直门) hatte, waren aus glatt poliertem oder schwarz lackiertem Dattelbaumholz (枣木): ausgesuchte Äste, die man noch am Stamm in eine rechtwinklige Form gebogen und dann hatte weiterwachsen lassen. Kunden, an denen Zhao Gefallen fand, erhielten die »Krücken« zum halben Preis, deswegen der Beiname »der Halbverrückte«.
»Bühnen« (亮架, wörtlich: »helle (i. e. offene) Gestelle«, ein Terminus technicus aus der klassischen chinesischen Oper) hatten anders als »Krücken«, auf denen man die Vögel ausführte, als Stand- oder Hängegestelle einen festen Platz zu Hause.
Standgestelle bestanden in der Regel aus einem rechteckigen, ca. dreiunddreißig Zentimeter (一尺) langen und fünfzehn Zentimeter (五寸) breiten hölzernen Postament, das von einer ca. drei Zentimeter (一寸) hohen Leiste umrahmt war. Auf jeder der Breitseiten stand ein Pfosten, der mit dem auf der anderen Seite durch zwei übereinander angebrachte Querstreben verbunden war. Die obere Strebe gab dem Gestell Halt, die untere diente dem Vogel als Sitzstange und Laufsteg (鸟杠). An beiden Enden waren Fress- und Trinknäpfchen angebracht.
»Krücken« und »Bühnen« dienten vor allem der Dressur von Spielvögeln oder dem Halten von Südvögeln (南鸟), i. e. Ziervögeln. Aber auch bei Singvögeln kam man vielfach zu Beginn ohne sie nicht aus. Besonders Rot- und Blaukehlchen (靛颏) – von Natur aus etwas trotzig und renitent veranlagt – taten sich zu Anfang schwer. Man hielt sie erst für geraume Zeit auf »Krücken«, danach ebenso lange noch auf »Bühnen«. Setzte man sie gleich in einen Käfig, flatterten sie nur wild gegen die Stäbe (撞笼), als witterten sie dahinter die Freiheit – eine Unart, die ihnen später kaum noch auszutreiben war. Erst wenn sie sich auf den Gestellen endgültig mit ihrem Schicksal abgefunden hatten, bezogen sie den Käfig, ihr eigentliches Heim, das ihnen ein wenig mehr Freiheit gab. Bei den gefügigeren Sumpfmeisen (红子) genügten schon ein paar Tage auf der »Krücke«, um sie an das Leben in Gefangenschaft zu gewöhnen. (Vögel, die nur auf Gestellen gehalten wurden, hatten übrigens eine geringere Lebenserwartung.)
Auf Stöcken, Krücken oder Bühnen gehaltene Spielvögel trugen ein Halsband (脖索), das in einer gezwirbelten, von Kupferdrähten zusammengehaltenen Schleife endete, in die man den Haken einer am Gestell befestigten Leine einklinkte. Die Leine wurde abgehakt, wenn die Vögel Kunststückchen ausführten (kleine Bälle apportierten, »Schächtelchen öffneten« etc.) oder von Weitem »herbeigerufen« (叫远) wurden. »Tote« (死脖索), d. h. nicht abnehmbare, Halsfesseln waren für Vögel gedacht, die allenfalls auf ihren Gestellen hin und her spazieren (过架) oder »fliegendes (i. e. zugeworfenes) Futter« (飞食) aufschnappen konnten – läppische Tricks, kaum der Rede wert. Auch hierzu später mehr.