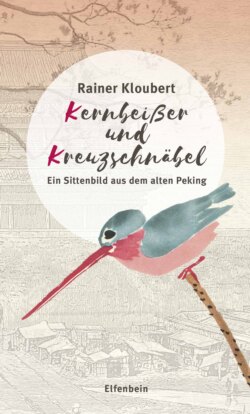Читать книгу Kernbeißer und Kreuzschnäbel - Rainer Kloubert - Страница 6
ОглавлениеPekinger Vögel (im Allgemeinen)
Ein Sprung zurück in das alte Peking, als Paul und Paulchen dort gewesen waren.
Vögel zu dressieren, ihnen zu lauschen, mit ihnen zu spielen oder sich an ihrem Anblick zu erfreuen, war damals einer der vier »Vernarrtheiten«, denen sich in Peking ein Mann von Welt, mochte er Geld haben oder nicht, traditionellerweise hinzugeben pflegte. Die Sitte war gegen Ende der Ming-Dynastie (明代, 1368–1644) aufgekommen und hatte in der Qing-Dynastie (清代, 1644–1911) immer mehr Anhänger gefunden – unter Kaisern, deren Namen selbst wie Rufe exotischer Vögel klangen: Qian (乾), Jia (嘉), Dao (道), Xian (咸), Tong (同), Guang (光), Xuan (宣). Die anderen drei Vernarrtheiten, oder besser: Lebenskünste (生活之术), waren Fische (鱼), Lautinsekten (虫) und Blumen (花) – Chrysanthemen in erster Linie, nicht Rosen wie im Westen. Kaum ein Pekinger, der nicht der einen oder anderen Passion verfallen wäre, nicht wenige sogar allen vieren. Diese Leidenschaft ging so weit, dass ein entfernter Verwandter der Kaiserfamilie, Züchter von Goldfischen und »Pu der Blaufisch« (蓝鱼溥) genannt, ein Mann, der immer geschniegelt und gebügelt daherkam, hohe Ämter, die ihm angetragen wurden, zurückwies – solche der vierten Pekinger Rangstufe (四品京堂) –, weil er schon den Gedanken nicht ertragen konnte, auch nur für ein paar Stunden von seinen blauen Fischen getrennt zu sein: Sie waren von allen Goldfischen die empfindlichsten und dünnhäutigsten. Ihre Aufzucht war so schwierig, dass man sie in normalen Goldfischläden nur selten zu Gesicht bekam, selbst in professionellen Zuchtstätten wie die im »Tempel des Prosperierenden Glücks« (隆福寺) suchte man sie vergebens. Stimmte etwa das Wasser nicht – nicht weich genug, zu lange oder zu kurz besonnt –, änderte sich auf der Stelle ihre Farbe. Als nicht minder wertvoll angesehen wurden solche mit »Wollknäueln« (绒球) über den Augen oder auch die »Elsterblauen« (喜鹊蓝) mit weißen Bäuchen, die sonst bei blauen Fischen tabu waren. Exzentrische Vorlieben waren bei Liebhabern von Vögeln ebenso die Regel wie bei denen für Goldfische. Als besondere Augenweiden galten beispielsweise die auf blauem Leib dunkelrot gesprenkelten »Tigerfell-Blauen« (虎皮蓝; auch die Terminologie von Goldfischen ähnelte der von Vögeln). »Pu der Blaufisch«, der in Peking mit zu den wenigen Züchtern zählte, die sich auf die Zucht von »Blauen« verstanden, zog nicht nur Fische auf, sondern auch Vögel, blaue, wie sich natürlich verstand – stadtbekannt war sein Japanschnäpper (石青, wörtlich: »Lasursteinchen«, Cyanoptila cyanomelana), ein ruhiger und friedlicher Geselle mit azurblauem Gefieder. »Lasursteinchen« waren an eine Diät von Heuschrecken gewöhnt und daher in Peking sehr selten, weil Heuschrecken die Pekinger kalte Jahreszeit nicht überlebten. Gleichwohl sah man Pu auch im Winter jeden Tag zur gleichen Zeit, geschniegelt und gebügelt, wie man es bei ihm gewohnt war, mit seinem himmelblauen »Lasursteinchen« einen Spaziergang machen. An den Käfig hatte er ein kleines Schildchen befestigt, auf dem trotz des leuchtenden Blaus des Vogels der Satz stand: »Einen grüneren gibt es nicht!« (此鸟无双名大绿). Jeder schüttelte den Kopf, nicht des Schildchens wegen: Farben – grün, blau, was auch immer – waren Ansichtssache. Nein, das Rätsel war, wie er im Winter an lebendige Heuschrecken kam – waren es etwa künstlich gezüchtete? Fragte man ihn, zeigte er nur auf das Schild: »Einen grüneren gibt es nicht!« Alle möglichen Theorien machten die Runde, bis sich eines Tages jemand verstohlen an seine Fersen heftete und herausfand, dass der verrückte Kerl seinen Vogel mit Küchenschaben (蟑螂) fütterte, von Europäern in verschimmelten Broten eingeschleppt.
Pu, ein tragisches Opfer seiner Leidenschaft – er ertrank in einem Weiher beim Einfangen von Wasserflöhen (Futter für seine Blaufische) –, war beileibe nicht der Einzige, der seiner Liebhaberei wegen Ämter ausschlug. Der »Alte Gui« (桂老头), ein Angehöriger des Blauen Mongolischen Banners (正蓝旗蒙古人) mit einer Wohnstatt unter den Surenbäumen der »Kanonengefilde« (炮局) am Lamatempel (雍和宫), besaß ein Blaukehlchen (蓝点颏), das wie eine Lerche (百灵) zu singen verstand. Ein Wunder, von dem ganz Peking sprach: ein Blaukehlchen aus dem Blauen Mongolischen Banner. Ein Minister offerierte ihm erst die Pfründe eines »Banneradjutanten« (印务大章京), ein Amt der dritten Rangklasse, dann, als er es ausschlug, eines der zweiten. Der »Alte Gui« weigerte sich, den Vogel herzugeben. Der Minister, im irrigen Glauben, nackte Habgier sei der Grund, bot nun einen Haufen Geld an. Der »Alte Gui« schlug auch dieses Angebot in den Wind. Das traurige Ende: Zwei Wochen später starb das Blaukehlchen. Der untröstliche Besitzer – untröstlich nicht der entgangenen Pfründe oder des ausgebliebenen Geldes wegen – bestattete seinen toten Liebling, den er wochenlang in einem Kästchen bei sich getragen hatte, im Pagodenhof des tibetischen Bailin-Klosters (柏林寺) am »Stillen Tor« (安定门) im Nordosten der Stadt.
Man unterschied in Peking zwischen Singvögeln, Ziervögeln, Spielvögeln und Beizvögeln.
Von allen vier erwähnten Vogelkategorien rangierten Singvögel (鸣鸟) in der Wertschätzung der Pekinger am höchsten, es gab sie für jeden Geldbeutel. Bei ihnen – um gleich zu Beginn kundzutun, was sie von europäischen Stubenvögeln unterschied – begnügte man sich nicht damit, dem Gesang zu lauschen, den ihnen der liebe Gott in die Wiege gelegt hatte, sondern brachte ihnen Klänge, Lieder und Melodien bei, die ihnen nicht von Natur aus zu eigen waren. Erleichtert wurde deren Aneignung dadurch, dass die allermeisten Singvögel kabarettreife Imitationskünstler und Komiker waren, die nicht nur die Laute anderer Vögel, sondern auch Alltagsgeräusche perfekt nachzumachen verstanden – vorausgesetzt man hatte ein Gehör für sie.
Die populärsten Singvögel waren Sumpfmeisen (红子), Kohlmeisen (黑子), Lerchen (白灵), Blaukehlchen (蓝点颏), Rotkehlchen (红点颏), Drosseln (画眉), Rohrspatzen (柞子) und Blauelstern (山喜鹊), aber auch »Dämmerhähne« (黎鸡儿) und Mainas (八哥 bzw. 鹩哥) hatten ihre Liebhaber. Schauspieler schätzten – sonst eher selten in Peking – Brillenvögel (粉眼, Zosteropidæ): schlanke Wesen mit dunkelgrünem Federkleid, einem spitzen und feinen Schnabel und weißen Augenringen, die sie wie Clowns der Pekingoper aussehen ließen. Männchen hatten einen purpurroten Streifen unterhalb der Rippen, in raren Fällen war er schmutzig weiß, ein Zeichen dafür, so der Wissensstand auf Vogelmärkten, dass er mit viel Gesangstalent gesegnet war: Für solche »Graurippchen« (青肋) wurden kleine Vermögen gezahlt. Mit seiner langgezogenen, dunklen, dann wieder hell zitternden Stimme konnte das Männchen das Blöken eines Esels und das Wiehern eines Pferdes (驴叫马唤) nachahmen. (Weibchen waren einsilbig und zugeknöpft.) Beliebt vor allem in Shanghai waren Japanbrillenvögel, auch »Stickereiäugelchen« genannt (绣眼, Zosterops japonicus), die einen fast hypnotischen Blick besaßen. Man pflegte sie in viereckigen Käfigen, die zur Vorderseite nicht verhüllt waren, morgens und abends spazierenzuführen. Ein wählerisches Völkchen, das vor allem auf Obst und in der Mauser auf frische Krabben versessen war und als besonders zutraulich und anhänglich galt: Freigelassen kehrten sie nach einer Weile von selbst zu ihrem Käfig zurück.
Und Nachtigallen – verewigt von Andersen in dem Märchen von des Kaisers Nachtigall? Fehlanzeige! Es gab sie nur im fernen, fernen Westen des Landes, nicht in Peking. Eine überraschende Entdeckung, ich war mir sicher gewesen, dass sie in Peking zu Hause wären, sie sangen ja dort dem Kaiser vor.
Das Märchen hatte mein Interesse an China noch vertieft. Ich war sieben oder acht Jahre alt gewesen, als ich es im Radio gehört hatte, unvergesslich bis heute, auch das Drumherum hatte ich immer noch vor Augen. Damals waren Radios noch Röhrenapparate, vierfüßige barocke Möbel mit grünen magischen Augen und elfenbeinfarbenen Zelluloidtasten, die klemmten und nicht wieder hochspringen wollten, drückte man aus Versehen noch die zweite Taste daneben. Die summenden, zirpenden, zwitschernden und pfeifenden Signaltöne klangen wie die Rufe eines prähistorischen Flugsauriers (Pterosauria).
Hörspiele gab es jeden Samstag um zwei Uhr nach dem »Suchdienst des Roten Kreuzes«, bei dem eine sonore Männerstimme langsam und zum Mitschreiben die Namen vermisster Kinder durchgab: wann und wo zum letzten Mal gesehen, besondere Kennzeichen etc.: »sachdienliche Hinweise erbeten an …« Manchmal stellte ich mir vor, ich sei einer von ihnen. Wie schön musste es sein, gesucht zu werden! Der Krieg war gerade erst vorbei, wir spielten Verstecken auf Trümmergrundstücken. In China holte mich diese Vergangenheit wieder ein, genauer gesagt: in Tientsin, einer Hafenstadt aus der großen Zeit des westlichen Imperialismus. Ein Teil der Innenstadt war 1976, dem Todesjahr Mao Zedongs, bei einem Erdbeben verwüstet worden, dessen Epizentrum die nahegelegene Stadt Tangshan (唐山) gewesen war. Ganze Häuserreihen hatten sich wie nach einem Luftangriff einer Bomberarmada in Schutt und Asche verwandelt, andere, nur ein paar Meter entfernt, standen immer noch mehr oder weniger unversehrt da: Firmensitze, Kaufhäuser, Hotels, Theater, Kinos, Restaurants – nun heruntergekommene, von politischen Parolen bedeckte Baulichkeiten, aus denen quer wie Fahnen Sträucher und Bäume herauswuchsen.
Die Trampelpfade dazwischen waren erfüllt von geschäftiger Betriebsamkeit. Auf den Tischen der Teehäuser standen Käfige mit Singvögeln. Ich blieb verwundert stehen. In Tientsin begegnete man Käfigen auf Schritt und Tritt. War hier das Halten von Singvögeln nicht verboten? Ich wanderte durch die Ruinen der ehemals deutschen Niederlassung, ein Wandern über Stock und Stein, begleitet vom »ack ack ack« fetter Elstern und dem »scheck scheck scheck« zerzauster Krähen. Wie in meiner Kindheit führten Wege durch die Schuttberge, vorbei an fassadenlosen, aber sonst intakten Häusern. Die Pfade verzweigten und vereinigten sich an früheren Knotenpunkten, wo wieder Garküchen und Teebuden aufgemacht hatten, alte Leute hockten vor ihnen, auf den Tischen auch hier Vogelkäfige. Der Schutt war von Sträuchern überwuchert, an manchen Stellen führten Treppen nach unten, in dunkle Höhlen, die einmal Keller gewesen waren.
Auf einem Treppenabsatz lag ein leuchtend rotes Blechauto. Ich hatte als kleines Kind ein solches Auto besessen, einen Zweisitzer mit Vierganggetriebe, Kupplung, Lenkung und Handbremse. Das Gehäuse war dunkelrot lackiert gewesen, die Ledersitze hellrot – damals mein kostbarster Besitz, ich träumte von ihm, wenn ich nicht damit spielte. Ich starrte auf das Auto, es sah so aus wie damals. Mein Auto, dachte ich, ich wollte es zurückhaben. Im gleichen Augenblick packte mich die Angst, mein Gedächtnis wieder zu verlieren. Oder hatte ich es schon verloren? Ich stieg die Stufen hinab – aus mir war wieder ein amoralischer kleiner Junge geworden. Ein modriger Geruch schlug mir entgegen, die Luft war mit einem Mal kühl, erst roch es brackig, dann süßlich nach Fäkalien. Der Nachbarschaftsabtritt: auf einem Pappschild stand das Zeichen für Frauen (女), daneben das für Männer (男). Ich bückte mich und hob das Auto auf. Auf dem Nummernschild stand der Name »Schuco«. Ich drehte des Auto um und las auf dem Chassis: Schefer-Prinz – Aachen – Holzgraben. Eine Halluzination? Ich schloss meine Augen. Als Kind hatte ich mir an dem Schaufenster die Nase plattgedrückt. Das am Dom liegende Geschäft war im Krieg kaum beschädigt worden, eine heile Kinderwelt inmitten von Trümmern. Ich zählte bis drei und öffnete meine Augen.
Das Schildchen war verschwunden. Ich blickte mich um. Kinder waren nirgendwo zu sehen. Was hatten wir damals in den Trümmern für Spiele gespielt? Wir hatten Krieg gespielt, was naheliegend war, Indianer im Wilden Westen, Räuber und Gendarm, hatten Jagd auf Spatzen gemacht und waren auf Schatzsuche gegangen. Was unterschied eigentlich die beiden zerstörten Welten voneinander, überlegte ich, die in meiner Heimatstadt und die nun hier in Tientsin? Eine Zerstörung von oben und eine von unten, die eine von Menschen-, die andere von Gottes Hand. Noch etwas anderes fiel mir ein, als ich wieder vor einem Vogelkäfig stand, eine mögliche Erklärung, warum die singenden und spielenden Hausgenossen trotz des Bannfluchs in Tientsin geduldet wurden: Mit ihnen war ein Stück Leben in die Stadt zurückgekehrt.
Wie Trümmergrundstücke waren auch Hörspiele Teil meiner Kindheit gewesen. Sonntags nach dem Mittagessen versammelten wir uns um den Radioapparat. Nach dem Zeitzeichen – fünf kurze Töne und dann ein langer Ton – war es endlich zwei Uhr, die Stunde, auf die wir schon ungeduldig gewartet hatten. Der Suchdienst war vergessen, ein anderer Kinderfunk begann: Des Kaisers Nachtigall. Ich lauschte hingegeben … Der lange Hall der Gongs, der unendlich weite Palast, chinesische Flötenklänge und wieder Gongs. Die Klänge verstummten, stattdessen ertönte der Gesang der Nachtigall, der so betörend war, dass dem Kaiser die Tränen kamen. Wieder erklangen Gongs. Der Oberhofmeister des Palastes (ein Eunuche) überbrachte ein Geschenk des japanischen Mikado: eine diamantenbesetzte künstliche Nachtigall, die noch süßer sang als die lebende. Als der Kaiser der lebenden Nachtigall nicht mehr zuhören mochte, verbannte der Oberhofmeister sie aus dem Palast. (Günther Lüders, den heute keiner mehr kennt, brachte mit seiner samtigen Stimme den Oberhofmeister zu Gehör.) Ein paar Monate vergingen. Erneut erklangen Gongschläge: Der Oberhofmeister, über die Jahre leicht vertrottelt, meldete dem Kaiser untertänig – man hörte die Verbeugungen förmlich –, dass sich die Rädchen und Zäpfchen im Inneren der künstlichen Nachtigall abgenutzt hätten und sie deshalb verstummt sei. Der Kaiser erkrankte vor Gram an Herzeleid, kalt und bleich lag er in seinem prächtigen Bett, der Tod kam und setzte sich zu ihm. Als er seine knöcherne Hand nach dem Kaiser ausstreckte, ertönte auf einmal vom Fenster her der Gesang der verbannten Nachtigall: Sie war gekommen, um den Kaiser zu trösten; so überirdisch sang sie, dass die Krankheit wich und der Tod sich geschlagen gab. Von da fand sie sich jeden Abend beim Kaiser ein, nicht nur, um ihm vorzusingen, sondern auch, um ihm Kunde zu bringen von dem, was sich tagsüber in seinem Reich zugetragen hatte und ihm bis dahin verborgen geblieben war.
So viel zu Singvögeln, nun zu den Spielvögeln (玩意儿鸟). Sie standen weniger hoch im Kurs. Zu ihnen zählten in erster Linie Erlenzeisige (黄雀), Spatzen (麻雀), Kreuzschnäbel (交嘴) und Kernbeißer (蜡嘴雀). Sie apportierten beispielsweise Bällchen, zogen Geldscheine aus der Tasche, hievten Eimerchen hoch etc. Auch Spielvögel waren gewöhnlich Männchen. Ausnahmen bestätigten die Regel: Auf »Schächtelchen oder Köfferchen zu öffnen« (开箱), Sächelchen herauszupicken und zu ihren Besitzern zu tragen – eine Domäne von Kreuzschnäbeln (交嘴) – verstanden sich die Weibchen sogar noch besser (auch menschlichen Weibchen soll ja das Kramen von Sächelchen in Handtäschchen in die Wiege gelegt sein).
(Die Schnäbel der Männchen kreuzten sich von links nach rechts, hieß es übrigens, die der Weibchen von rechts nach links.)
Ziervögel, um zu ihnen zu kommen, waren farbenfrohe, in den reichen Höfen der Stadt lebende »Südvögel« (南鸟), Vögel aus subtropischen oder tropischen Gefilden, auch hier meistens Männchen, sie waren bunter, schöner und alerter: Yin und Yang (阴阳), das alte Lied. Vielfach wurden sie in Pärchen gehalten. James Thurber hat über sie – »Unzertrennliche« oder lovebirds (Agapornis) – eine bezaubernde Geschichte geschrieben: »My Senegalese Birds and Siamese Cats«: Freigelassen flog das Männchen, so seine Beobachtung, voll stummer Verzweiflung immer wieder um den Käfig mit dem Weibchen. Und das Weibchen? Von einem reziproken Herzeleid konnte keine Rede sein. Im Gegenteil: Es lebte (weshalb Thurber es für das Männchen hielt) nach dem Tod des Männchens (von dem Thurber glaubte, es sei ein Weibchen) erst richtig auf und begann zu frohlocken und laut zu jubilieren. So weit Thurber. Aber wer weiß, vielleicht war es auch das Männchen, das nach dem Tod seines Weibchens zu jauchzen begann. Oder Thurber hatte versehentlich zwei Männchen (oder Weibchen) gekauft.
Nicht zu verwechseln mit diesen afrikanischen oder Thurber’schen lovebirds waren die chinesischen »Unzertrennlichen« (相思鸟, Leiothrix lutea, Sonnenvögel oder China-Nachtigallen), die ebenfalls immer nur als Pärchen gehalten wurden. Stirn, Kopf und Nacken waren olivgrün, das Kinn gelb, die Brust orangefarben, der Bauch grüngelb. Der Farbe ihrer Schnäbel wegen wurden sie auch »Rotschnäbelchen« (红嘴儿) genannt.
Wichtig beim Kauf, um nicht wie James Thurber womöglich mit zwei Männchen bzw. Weibchen dazustehen: Wie konnte man Männchen und Weibchen auseinanderhalten?
Sämtliche Farben waren beim Weibchen stumpfer und glanzloser, besonders das rötliche Gelb der Brust. Die Schnäbel hatten beim Männchen eine karmesin-, beim Weibchen eine dunkelrote, in Schwarz übergehende Färbung. Der Kopf des Männchens war größer und breiter, sein Leib schlanker und länger, der Schwanz gegabelter. Lauschte man ihnen, verflog der letzte Zweifel: Die Laute des Männchens waren zweisilbig und abwechslungreich, das Weibchen stieß nur ein monotones und einsilbiges »zhi!« (吱), »zhi!« (吱) aus. Junge Pärchen entwickelten nach ihrem Fang die vorübergehende Unart, gegen die Stäbe des Käfigs anzuflattern. Am besten verhüllte man ihn in den ersten Tagen. Drangen keine Lichtstrahlen hinein, verloren beide Vögel ihr Richtungsgefühl, was dazu führte, dass sie ruhig und geduldig auf ihrem Platz verharrten. Auch der obere Teil des Käfigs musste bedeckt sein, da sie sonst starr in die Höhe blickten, eine Rappelköpfigkeit, die, einmal eingerissen, kaum noch auszutreiben war. Hatten sie sich an ihre Besitzer gewöhnt, ließen sie sich auf seiner Hand nieder und verloren jede Scheu vor ihm – nur in der Paarungszeit wichen sie seinem Blick aus, als würden sie sich schämen. Die Pärchen, Symbole inniger Liebe – »unzertrennlich wie Körper und Schatten« (形影不离) –, hüpften und sangen den ganzen Tag munter und fröhlich herum.
Ein praktischer Hinweis: Führte man sie spazieren, was man hin und wieder tun sollte, um sie auf andere Gedanken zu bringen, schätzten sie vor allem Abwechslung: Ein unbekannter Bambushain oder ein Wäldchen mit fremden Blättern genügte, um sie völlig aus dem Häuschen zu bringen und fast närrisch vor Liebe zueinander zu machen. Man verschenkte sie auch gern zur Hochzeit, eine volkstümliche, alte Sitte, die sich auf dem Land bis heute erhalten hat. Ließ man das Männchen frei, flog es immerzu um den Käfig, stumm, als hätte das Getrenntsein von seinem Weibchen ihm die Stimme geraubt. »Eine Stummheit noch lauter als jeder Schrei« (无声胜有声). Anders als die Thurber’schen oder afrikanischen »Unzertrennlichen« überdauerte bei den chinesischen die Liebe auch noch den Tod. Starb das Männchen, verweigerte das Weibchen so lange die Nahrung, bis auch sie das Zeitliche segnete.
Einige Worte noch zu den Beizvögeln (抓生的鸟). Mit ihnen, den Habichten, Falken, Sperbern und Bussarden, gab sich nur die mandschurische Oberschicht ab, die chinesische Bevölkerung hatte nie sehr viel mit ihnen anzufangen gewusst. (Bestimmte Falkenarten waren übrigens in Peking schon so degeneriert, dass sie nicht mehr nach Beute jagten, sondern nur noch nach Erdinsekten und Würmern scharrten: das Schicksal gewissermaßen auch ihrer mandschurischen Besitzer, chinesische Samurais, aus denen im Laufe der Jahrhunderte alimentierte Müßiggänger und ewige Urlauber geworden waren.)
Vögel, Fische, Insekten, aber auch Blumen – ein symbiotisches Zusammenleben hinter den Mauern von Peking. Blickten die Pekinger auf ihre Stadtmauer, fühlten sie sich geborgen und sicher wie im mütterlichen Schoß. Außerhalb der Mauern, wo das Land braun war, rissig und hart und die Luft kalt und windig, wurde ihnen sofort bange ums Herz, als könnten die mächtigen Tore, die jede Nacht donnernd geschlossen wurden, sie womöglich nicht wieder hereinlassen. Auch das ein Grund, weshalb sich die chinesischen Bewohner der Stadt aus dem ritterlichen Spiel, Vögel zur Jagd abzurichten, Falken etwa, Sperber oder Adler, nicht viel machten. Anders mandschurische Adelige, für die es als Ehrensache galt, Beizjagden auf Wildkatzen, Hasen oder Karnickel zu veranstalten. Auf der Strecke gebliebene Beute wurde von Hunden apportiert, manchmal auch von einem Affen, der auf einem Schafsbock ritt und so dressiert war, dass er den Bock an Ort und Stelle lenkte, die Beute ergriff, sie ihm aufpackte, sich dann wieder in den Sattel schwang und zurückritt. Wie ihre Dressur aussah, ist nicht mehr bekannt – Geheimnisse chinesischer Abrichtungskunst.
Aber was war schon die Lust an der Beizjagd gegen das Vergnügen, den Lauten von Vögeln zu lauschen, neue für sie zu erfinden und ihnen Strophen oder »Touren« beizubringen? Die Paraphernalia für das Halten von Singvögeln – Käfige zum Beispiel, die Griffe daran, die Sitzstangen, Fress- und Trinknäpfe, Gestelle, Rahmen, Halsfesseln, Kästchen, Schächtelchen und »Sächelchen« etc. – würden so manche Vitrine eines Museums füllen. Viele dieser Requisiten und Accessoires sind längst verschwunden, bei nicht wenigen weiß man nicht mehr, wie sie ausgesehen oder welchem Zweck sie einmal gedient hatten. Einer der Gründe hierfür liegt in dem Umstand, dass sich die konfuzianischen Schriftgelehrten, denen die Leidenschaft für Vögel immer ein Dorn im Auge gewesen war, eigensinnig weigerten, ihnen (den Paraphernalia) Zeichen und dadurch Gestalt und Existenz zu geben. Die Energie, die man auf sie verwandte, ginge ernsthafteren Dingen verloren: Familie, Geschäft, Observanz, eine geordnete Welt, in der – anders als Laotse (老子) es gepredigt hatte – eben niemand frei wie ein Vogel sein durfte. Die Wörter, die ihre Liebhaber verwendeten, gehörten der Gassensprache (俚语) an, für die Zeichen eigentlich überflüssig waren. Sprangen die konfuzianischen Schriftgelehrten über ihren Schatten und stellten Zeichen zur Verfügung, taten sie es erst nach langem Zögern und Überlegen – nicht jedes Wort war schließlich ein Zeichen wert. In vielen Fällen verschwanden die Zeichen bald wieder in der Versenkung. Heute findet man sie, wenn überhaupt, nur noch in speziellen Wörterbüchern: Friedhöfe von Strichen, Klängen und Lauten, ein Schattenreich von Dingen, für die sie einmal standen: Vögel, Töne, Bewegungen, Rituale und Gesten.
Apropos Schriftzeichen: Zwischen chinesischen Schriftzeichen und den Lauten besteht – im Unterschied zu indogermanischen Sprachen – eine ganz andere Beziehung: Laute ergeben sich hier nicht aus Zeichen (Buchstaben). Anders gesagt: An den Zeichen selbst ist ihre Aussprache nicht zu erkennen. Man muss sie in einem Wörterbuch nachschlagen. Aber dort liegen Tausende herum, woher weiß man, wo die gesuchten stehen? Soll man sie etwa der Reihe nach durchgehen? Die Lösung, die – zugegeben – etwas vertrackt ist: Wie man auf einem Schiff im Meer anhand der Gestirne seine Position bestimmt, stellt man bei einem Zeichen anhand bestimmter wiederkehrender Merkmale seinen Standort im Wörterbuch fest – dem »Wortmeer« (辞海), so der chinesische Name dafür. Die für Veranlagung und Standortbestimmung ausgedachten Systeme – es gibt deren viele – sind ebenso komplex wie die Regeln zur Bestimmung von Pflanzen und Vögeln. Ein mühsames Suchen in Tabellen, für das ein fast fotografisches Gedächtnis erforderlich ist und die Fähigkeit, Zeichen und Laute für längere Zeit im Auge bzw. im Ohr zu behalten.
Ein Beispiel zur Illustrierung: Lin Yutang (林语堂) war ein kosmopolitischer und polyglotter Essayist, Romancier und Philosoph, der sich jedoch in erster Linie als Wörterbuchmacher verstand. Sein Promotionsthema in Leipzig: »Altchinesische Lautlehre«. Auch er hatte vor dem Problem gestanden, Zeichen so anzuordnen, dass man sie möglichst schnell lokalisieren konnte. Für sein »Chinese-English Dictionary of Modern Usage« erfand er eine Methode, mit der sie sich gewissermaßen topografisch vermessen ließen, die sogenannte »Vier-Ecken-Methode«: Er teilte jedes Zeichen in vier Sektoren ein, der Reihe nach in: oben links, oben rechts, unten links und unten rechts. Jedem Sektor wurde dann eine Ziffer von 0 bis 9 zugeordnet, die die jeweils dominierende Strichgestalt repräsentierte: (1) Horizontalstrich, (2) Vertikal- oder Diagonalstrich, (3) Punkt, (4) Kreuz, (5) zwei oder mehr sich kreuzende Striche, (6) Quadrat oder Rechteck, (7) Winkel, (8) zwei oder drei getrennte Striche und (9) Strich mit einem Punkt darauf. Man brauchte nur unter sich ergebenden Zahlenfolgen nachzuschlagen und hatte das gesuchte Zeichen gefunden – oder auch nicht.
Lin Yutangs Ehrgeiz ging noch über Wörterbücher hinaus: Er wollte eine chinesische Schreibmaschine konstruieren, die nicht viel weniger Raum einnahm als eine westliche. Die zu seiner Zeit in Gebrauch befindlichen chinesischen Schreibmaschinen waren schrankgroße Ungetüme und funktionierten wie Druckmaschinen: Zeichenmoloche, die sich nur von jahrelang geschultem Personal bedienen ließen. Lin Yutang – ein spleeniger Tüftler, der auch ein Schotte oder Schwabe hätte sein können – gelang es, einen auf der »Vier-Ecken-Methode« basierenden Prototyp herstellen und patentieren zu lassen: ein Unterfangen, das ihn Jahrzehnte seines Lebens kostete und bankrott machte.
(Sieht die Fig. 40 in der Zeichnung nicht aus wie eine gestreifte Krawatte?)
Als er die Maschine, mit ihren vielen Rollen weit komplizierter als eine Enigma, Geldgebern präsentierte, wollte sie jedoch nicht funktionieren – Erfinderpech.
Von Zeichen, Lauten und ihrer Zuordnung zurück zu Vögeln. Um sie heranzuziehen, war neben Geld, Zeit, Geduld und Mühe nicht nur Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen, sondern auch Sinn für Inszenierung und Dramatik erforderlich – und einer für Ironie und Komik; an beidem hatte in Peking nie Mangel geherrscht. Oder war es nicht etwa ein Gipfel an Ironie, wenn ein mandschurischer Falkner im verwegenem Aufzug dem Wind trotzend, auf der Schulter einen Greifvogel und an der Leine einen Jagdhund (oder einen Schafsbock mit aufsitzendem Äffchen), auf dem Weg zu den nahen Bergen beim Durchschreiten des Westtors (西直门), hinter dem die große Unwirtlichkeit begann, auf einen anderen Vogelliebhaber stieß, dem eine flötende Drossel auf der Schulter saß?
Wer es gewesen sein mochte, der Mann mit der Drossel auf der Schulter? Gut möglich, dass es der »König der Erzähler« (评书大王) war, Shuang Houping (双厚坪), der bekannteste Drosselliebhaber der Stadt. Ganz Peking hing an seinen Lippen, auch wenn er nie zum Schluss kam, weil er sich immer wieder in Kommentaren, Erlebnissen und Klatsch und Tratsch verstrickte. Die Stichworte seines Themenfundus (包袱, wörtlich: »Bündel«) – angekündigt durch ein Schnauben der Nase – standen auf Schildern, die er wie in einem Stück von Brecht hochhob und dem Publikum zeigte: Begräbnisrituale, Esssitten, Glückspiele etc. Kam etwa die Rede auf Drosseln, standen auf dem Schild die beiden Zeichen für »Drossel«: 画眉. Die Männchen zählten zu den talentiertesten Singvögeln, aber auch zu den eigenwilligsten. Führte man sie nicht jeden Tag aus, um sie in der freien Natur nach Herzenslust singen zu lassen, versanken sie in Schwermut (落性) und verstummten, nicht selten sogar für immer. Besondere Vorsicht war bei solchen Gängen jedoch angebracht. Erblickte ein Männchen ein Weibchen in freier Wildbahn, konnte es passieren, dass es, von unwiderstehlicher Sehnsucht ergriffen, wild gegen die Stäbe des Käfigs anflatterte, dann Blut spuckte, jäh von der Stange fiel und das Zeitliche segnete. Die passiveren und zurückhaltenderen Weibchen legten nur Gleichgültigkeit an den Tag, zum Liedermachen fehlte ihnen das Nachahmungstalent, zum Spielen das Gedächtnis.
Das zahme Drosselmännchen, das Shuang Houping bei seinen Vorträgen Gesellschaft leistete, flötete in den Pausen seinen Namen: ein langer gleichbleibender Ton (shuang: 双), gefolgt von einem nach unten fallenden (hou: 厚) und einem steigenden Ton (ping: 坪).
Die Geschichten seines Herrn gehörten einer Welt von gestern an. War in einer etwa von Wein oder Schnaps die Rede – Schild: 酒 –, ergab sich wie von selbst eine sachverständige Führung durch die Weinhäuser (黄酒馆) und Gassenkneipen (小酒铺) von Peking, insbesondere die berüchtigten »Achtzehn Kneipen« (十八家酒店) am »Ziviltor« (宗文门). Dann erläuterte er, wie sich unverzollter Schwarzgebrannter – euphemistisch »privater Schnaps« (私酒) genannt – mitten in der Nacht über die Mauer hinweg in die Stadt hineinbringen ließe. Die verschiedenen Stadien der Trunkenheit seiner Begleiter, von denen einige im Publikum saßen – vor seinem losen Mundwerk war keiner sicher –, demonstrierte er mit der Ernsthaftigkeit eines Clowns. Ratschläge für die Behandlung von Katzenjammer (撒酒疯) folgten, bevor er sich in eine Konkubine des Kaisers verwandelte, die sich die Wartezeit mit dem Trinken von Wein verkürzt, ein berühmtes Solo der Pekingoper: »Die Trunkenheit der Konkubine Yang« (贵妃醉酒).
Ein kleiner Schritt von hier zur »Farbe« (色), in China ein Symbol für sexuelle Begierde. Ein Gang durch das Bordellviertel der Stadt schloss sich an, die »Kleinen Liedkapellen« (清呤小班) auf den »Acht Großen Gassen« (八大胡同).
Fand in der Erzählung die Gesichtsfarbe des Helden Erwähnung, schlüpfte er in einen gelehrten Gesichtsdeuter (相面先生) oder einen Deuter von Knochenbau und Stimme (揣骨), um sich anschließend im Allgemeinen über Wahrsagerei (算卦) auszulassen, im Besonderen dann über die acht horoskopischen Zeichen (八字, u. a. Jahr, Monat, Tag und Stunde der Geburt) oder astronomisch-metaphysische Divination (奇门). Spielte irgendwo Geld oder Reichtum (财) eine Rolle, ließ er sich aus über Spielhöllen (赌局) und diverse Formen von Glücksspiel: Würfeln (押宝), Domino-Poker (推牌九), Ma-Jongg (麻将牌) etc.
Die Quelle seiner Geschichten, Parodien und Anekdoten war unerschöpflich, stockte aber auf der Bühne gelegentlich für ein oder zwei Minuten. In diesen Augenblicken der Abwesenheit starrte er vor sich hin und schien sich und alles um sich herum vergessen zu haben: Selbst das Klicken seiner Handkugeln (铁球), sonst Bestandteil seines Vortrags, verstummte – er konnte fünf Kugeln in seiner Hand kreiseln lassen, es half ihm, sagte er, sich zu konzentrieren. Er schreckte erst auf, wenn die Drossel neben ihm seinen Namen flötete: Shuang Houping – er kam wieder zu sich. Die Quelle seiner Beredsamkeit sprudelte wieder, auch das Klick-Klack der Handkugeln setzte erneut ein. Fragte man ihn, ob er Stimmen gehört habe, zeigte er auf die Drossel: Ja, sie würde ihm Satz für Satz alles soufflieren.
Sein loses Mundwerk wurde Shuang Houping schließlich zum Verhängnis. Einmal hängte er an den Namen des Dämonen »Ding« (定) ein schnalzendes »za« an (子), wie es Mandschus untereinander zu tun pflegten, was den Jargonausdruck für »Hintern«, »Gesäß« (定子) ergab. Eine längere Pause folgte – in der er auf eine innere Stimme zu lauschen schien. Anzüglich grinsend zog er dann sein Ohrläppchen in die Länge, machte sich also auch noch über den »Schlafenden Buddha« (卧佛) lustig, von dem gerade die Rede gewesen war (Buddhas haben besonders große Ohrläppchen, ein Zeichen ihres langen und frommen Lebens). Am nächsten Tag fiel er in eine tiefe Ohnmacht. Die gerechte Strafe, die auf den Fuß folgte? Erschrocken legte er, als er wieder aufgewacht war, das Gelübde ab, pietätlose Bemerkungen von nun an zu unterlassen. Ein paar Jahre später wurde er rückfällig – es war ihm einfach nicht gegeben, eine witzige Bemerkung, die ihm auf der Zunge lag, für sich zu behalten. Diesmal galt sie der »Göttin der Barmherzigkeit« (观音), die von hinten, sagte er, ohne sich auf die Zunge zu beißen, barmherziger sei als von vorne. Die Folge: Er fiel wieder in Ohnmacht, diesmal in eine so tiefe, dass er aus ihr nicht wieder erwachte.
Wo man in Peking Vögel erwerben konnte: Die populärsten Märkte waren in Tempeln angesiedelt: dem »Tempel des Prosperierenden Glücks« (隆福寺’), dem »Tempel des Vaterlandes« (护国寺) und dem »Erdtempel« (土地庙) – Tempel zwar, aber keine wie in der Bibel: Kein Menschensohn drehte hier aus Stricken eine Geißel, um die Händler aus dem Haus des Vaters zu vertreiben. Zwischen Jerusalem und Peking lagen Welten. Ein wandernder und eifernder Schreiner? Schallendes Gelächter der versammelten Götter wäre ihm entgegengeschlagen, hätte er sich in Peking an sein Reinigungswerk gemacht.
Das größte Gedränge herrschte in und um den »Tempel des Prosperierenden Glücks«, wo am neunten und zehnten jedes Monats regelrechte Vogelmessen abgehalten wurden. Der Tempel selbst war ein Irrgarten von Pfaden, die den Strichen eines komplizierten, riesenhaft vergrößerten chinesischen Zeichens glichen (»nang«, vornehm genäselt, wie es mein Wahrsager Wang tat), überlagert von einer ohrenbetäubenden Kakophonie aus tierischem und menschlichem Gelärme. Von Generation auf Generation vererbte Läden hatten hier ihren Platz, nur Schritte entfernt von den »Neunzehn Ständen für alte Bücher« (十九老书处) – gab es etwas Schöneres, als seinen Käfig mit der neuerstandenen Drossel abzustellen und in alten Büchern zu wühlen? Die Einbände hatten dieselbe Farbe wie die Hüllen der Käfige. Im Süden des Tempels warteten Papageien (鹦哥) und Haubenmainas (八哥) auf Käufer, im Westen Singvögel: Lerchen (百灵), Rotkehlchen (红点颏), Blaukehlchen (蓝点颏), Kohlmeisen (黑子), Sumpfmeisen (红子), Drosseln, (画眉, wörtlich: »Pinselbrauen«), im Osten des Tempels – man hörte es schon am gellenden Gekreisch – Greifvögel (抓生的鸟): Adler, Weihen, Sperber, Bussarde, Falken etc. – ein Zoo und Jahrmarkt zugleich. Im Norden nicht weit vom »Trommelturm« (鼓楼) gab es Spielvögel wie beispielsweise Kernbeißer (蜡嘴雀, 老西子, 胖雀, Eophona migratoria), Kreuzschnäbel (交嘴, Loxia) oder Seidenschwänze (太平鸟, wörtlich: »Friedensvögel«, Bombycilla garrulus centralasiæ).
Ein paar Worte zu den Letzteren – den Seidenschwänzen. In China gab es sie in einer normalen und einer frappierend gleichen, aber verkleinerten Ausführung (Bombycilla japonica). Die Japonicas hatten genau zwölf Steuerfedern, ihre Spitzen waren entweder gelb oder rot, so leuchtend, als wären sie gerade in Farbe getaucht worden. Die größer geratenen »Gelben« hießen die »Gelben Zwölf« (十二黄) oder »Älteren Schwestern« (姐姐), die etwas kleineren »Roten« die »Roten Zwölf« oder »Jüngeren Schwestern« (妹妹). Der hoch nach hinten abstehende Schopf bzw. die Haube des rötlichbraun gefärbten Kopfes gemahnte an die Hutspange (簪缨) eines chinesischen Galans aus alter Zeit. Die »Schwestern« pflegten ihre Hauben gegen den Wind aufzurichten und flattern zu lassen, ein possierlicher Anblick, vor allem wenn sie dabei noch wie Kakadus auf und ab wippten. Im Westen fraßen sie am liebsten »kreideblaue Wacholderbeeren … – auf eine weihevolle Art« (Nabokov: »Pale Fire«), in China waren es zuckerbestreute Maisbrötchen (窝窝头) oder schwarze, wie Gewehrkugeln aussehende Dattelpfläumchen (黑枣, Diospyros lotus), die sie auch zu apportieren lernten, obwohl sie weder besonders weit noch hoch fliegen, sondern eigentlich nur kurze unmotivierte Hüpfer vollführen konnten. Hielt man mehrere von ihnen, ließen sie im Chor und mit hochgestellten Hauben flach trillernde Laute vernehmen, die an das Quietschen schlecht geölter Türen erinnerten. Sie taugten nur zu simplen Spielen, komplizierteren stand ihre sprichwörtliche Beschränktheit entgegen, die durchweg auf den Umstand zurückgeführt wurde, dass sie kaum Jagd auf Insekten machten. Was auch immer Folge und Ursache war: Dummheit und fehlender Jagdeifer – manche hatten so wenig Verstand, dass sie ihre eigenen Ausscheidungen fraßen und daran zugrunde gingen. Tägliche Säuberung des Gestells – bzw. Käfigs, wenn sie darin gehalten wurden – war daher dringend geboten.