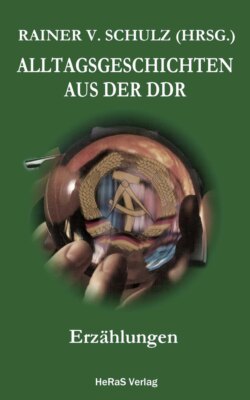Читать книгу Alltagsgeschichten aus der DDR - Rainer V. Schulz - Страница 4
ERHARD SCHERNER: Konstantin Mugele
ОглавлениеWie sehen das die Genossen in der Zentrale? Mugele ist zu einer Unterredung ins Hohe Haus geladen. „Guten Tag, Genosse“, begrüßt ihn Genossin Änne. Sie leitet die Kaderabteilung, der sich Mugele offenbaren soll. „Nun lernen wir dich einmal kennen, wo doch schon Gutes von dir zu hören war. In unsern Unterlagen fehlst du, hattest keine Funktion im Partei- und Staatsapparat, hast keine Parteischule besucht, auch nicht auf Kreisebene – wie sollen wir da von dir wissen?“
Genossin Änne erhebt sich von ihrer Schreibtischbarriere und bittet ihren Gast an ein Tischchen. Konstantin sitzt einer Frau in den 60zigern gegenüber, einer freundlichen, halb mütterlich, halb gestreng. „Wie bist du zu uns gestoßen?“, fragt sie. – Ui, die Antwort wäre ein Roman, denkt Konstantin. Sollte er vom Leben am Rand des Scheunenviertels berichten? Vom Krieg? Sollte er Heinrich Heine und Carl von Ossietzky nennen? Worauf lief das hinaus? „Im Prenzlauer Berg habe ich die neu entstandenen Parteien in ihren Versammlungen erlebt“, kürzt er ab. „Da war ich siebzehn. Richtig gut gefielen mir die Liberalen mit Papa Külz. Die hatten die geschmackvollsten Plakate. Alle mit dem Thema Freiheit. Das gefiel mir. Doch im Stadtbezirk? Zu den Gewerbetreibenden passte ich nicht. Ging auch noch zur Schule. Eingeprägt hatte sich mir, dass in der finsteren Zeit an manchen Hauseingängen ein einsames Lämpchen leuchtete, oft nur Glühbirne an einem Stück Kabel – das war in Berlin dem Vorschlag der KPD geschuldet. Die Kommunisten als Lichtbringer – Genossin Stengel, für einen gelernten Katholiken, der sich mit Luzifer auskennt, war das eine reizvolle Entdeckung.“
„Und heute besuchst du die Lichtzentrale und wunderst dich …“
„Was habt ihr vor? Um es gleich zu sagen: ich möchte nach China zurück, das passt zu meiner Familie …“
„Das dachte ich schon. Doch Genosse Bernhard Ziegler, Leiter der Kommission für Erleuchtung, fordert dich nachdrücklich an.“
„Davon verstehe ich nichts“, wirft Mugele ein.
„Das ist ihm klar“, sagt Genossin Änne. „Er hält es für einen Vorzug. Er will nicht, dass in seinem Vorzimmer Politik gemacht wird. Also nur Mut. Stoße dich nicht an dem hochgestochenen Namen der Kommission – es handelt sich keineswegs um abstrakt Spirituelles. Der Partei geht es um die Steuerung der Entwicklungsprozesse in Kultur und Künsten.“
„Wirklich, so was kann ich nicht.“
„Ist doch nicht schlimm. Begreif doch: Du kommst zu Bernhard Ziegler. Kein Kader hat so lange die russische Kulturentwicklung erlebt und begleitet wie er. Übrigens: Professor Ziegler lobt deine Findigkeit. Seid ihr euch mal begegnet?“
„Mehrfach, aber immer nur kurz. Nachdem er 1954 aus der sowjetischen Emigration heimgekehrt war, traf ich ihn auf der Wartburg. Er muss was mit den Burgen haben. Leuchtenden Auges sprach er vom Hohen Meißner anno 1913. Der ist ihm gegenwärtig wie der Kampf um den Kessel von Welikije Luki. Die frühe Jugendbewegung ist ihm nahe, insbesondere jener Flügel, der gegen den Krieg auftrat und 1918 in München Die Freie Sozialistische Jugend gründete. War zuständig, sagt er, ob bei den Demonstrationen durch die Stadt die Kommunisten die Kanone mitziehen oder nicht. Der Pazifist mit der Haubitze – das beeindruckt mich schon.“
„Na, siehst du“, merkt Genossin Änne an. „Nun sag auch, wie findig du bist …“
„So schlimm war das nicht. Die Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion hatte Professor Ziegler nach Hannover entsandt“, sagt Mugele. „Als Kenner des Neuen Russland sollte er über die Völker des Kaukasus sprechen. Das war sieben Monate vor dem Verbot der KPD, und die Regierung war schon recht hysterisch. Die Vortragsreise sollte um zwei Orte erweitert werden. Genosse Ziegler wusste nichts davon, ihm hätten auch Geld für Reise und Unterkunft gefehlt. Der Professor war schon unterwegs, und die Gattin, eine Kinderärztin, kannte nur eine vage Kontaktadresse in Hannover-Hemmingen, Haus einer Jugendfreundin, ihres Zeichens Anthroposophin. Die könne mir weiterhelfen.“
„Nun und?“
„Die Anschrift stimmte. Am Stadtrand gelegen, ein hübsches Häuschen mit gepflegtem Garten. Die ältere Dame, schlank, in langem Wollkleid, öffnete freundlich, stritt aber heftig ab, von einem Professor Ziegler gehört zu haben, gar zu wissen, wo der sich aufhalte …“
„Diese Situation kenne ich aus dem illegalen Kampf“, wirft Genossin Änne ein.
„Ja, meine Anthroposophin war recht bestürzt, hat aber schließlich einen kräftigen, ziemlich bärbeißigen Mann herbeitelefoniert. Während der mich in die Stadt geleitete, nahm er mich recht ins Gebet: „Und Sie kommen aus Ostberlin? Und wollen zum Ziegler-Vortrag - zum Thema …?“ – Ich sage: Kaukasus! – „Und Sie kennen Professor Ziegler?“ – Ich nicke. – „Und er kennt Sie?“ –. „Nun ja.“ – „Gut, ich bringe Sie hin. Aber wenn er Sie nicht erkennt – ich breche dir alle Knochen …“
So näherten wir uns den Völkern des Kaukasus. Im Hinterzimmer eines Gastwirts in Hannover-Linden löste mich der Professor aus. Der Bärbeißige murmelte: „Entschuldige, Genosse.“ – „Das will alles bedacht sein“, sagt Genossin Änne lächelnd, und glaubt, wenn nichts sonst dagegen spricht, für diesen Bernhard Ziegler den genau Richtigen gefunden, für die Kommission die Kaderlücke geschlossen zu haben. „Ich freu‘ mich“, sagt sie. „Ein Weilchen mag’s dauern, bis alles überprüft ist, und dann bist du, im Leninschen Sinne, Berufsrevolutionär. Das ist dann dein Parteiauftrag. Du hörst von uns.“
„Wie lange ist ein Weilchen?“, fragt Konstantin den Papagei und der weiß es auch nicht. Hast du im Hohen Haus nicht ein bisschen wirr gesprochen? Entwirren braucht Zeit. Doch die Deichsel steht wohl nicht nach China, mehr zum Rosa-Luxemburg-Platz. – Ist er traurig? Stolz? Konstantin spürt Vertrauen, das rare beglückende Gift.
Ein Weilchen, oh, das kann dauern. Peter ist froh, dass Papa für ihn Zeit hat. Der erzählt Märchen. Die schaurige Geschichte von Hänsel und Gretel und der Hexe möchte der Junge immer aufs Neue hören. Koko freut sich, aus dem Käfig zu dürfen. Er zieht seine Runde, lässt sich auf dem Ofensims nieder und hat keine Lust herunterzukommen.
Konstantin entschließt sich, die Arbeitssuche in die eigenen Hände zu nehmen. Sich bei diversen Verlagen, für die er Außengutachten geschrieben hatte, in Erinnerung bringen? Will er das überhaupt? Was ganz Neues anfangen! Er kramt einen Lebenslauf heraus und zwei alte Passbilder, die ihn jünger machen als er ohnehin aussieht. Mugele macht sich auf, in einem volkseigenen Betrieb anzuklopfen, und möglichst in der Nähe, sei’s eine Klitsche. Mit der Elektrischen fährt er zur Greifswalder, steigt um, fährt zur Ostseestraße. VEB Luftfilterbau steht über dem Werktor. Und es ist eine Klitsche. An einem Pfeiler hängt die Tafel mit den unbesetzten Stellen: Schweißer, Elektriker, Maler und so fort, wovon er nichts versteht. Beim Gang zur Kaderabteilung entscheidet er sich für Schlosser, wovon er auch nichts versteht. Eine resolute Mittvierzigerin empfängt ihn hoffnungsvoll, und er will sie nicht enttäuschen. „Ich möchte mich bei den Schlossern einarbeiten, als Anlerner.“
„Schlosser, Lohngruppe III, das bringt nicht viel. Freilich kommen Zuschläge dazu, Leistungslohn, bei Planerfüllung auch Prämie“, sagt die Kaderleiterin geschäftig. „Wo haben Sie bislang gearbeitet?“ Mugele nennt den Studenteneinsatz im Stahlwerk Riesa, der liegt ein Jahrzehnt zurück. Die letzten zwei Jahre habe er, entsandt von der DDR, in einem Pekinger Staatsbetrieb gearbeitet, der Auftrag sei nun erfüllt. „Liegt was Besonderes an?“, fragt die Kaderchefin besorgt und überfliegt den Lebenslauf, murmelt: „Abiturient, Neulehrer, Germanistikstudium … Sind Sie Genosse?“
Mugele bejaht: „Seit Mai 48.“
„Na dann bitte ich gleich mal den Parteisekretär hinzu“, nimmt den Hörer: „Alfons, kannst du bitte mal rüberkommen, eine etwas komplizierte Kadersache. Danke.“
Genosse Alfons, ein kräftiger grau melierter Mann in blauer Kluft, wird mit den Worten empfangen: „Das hier ist Genosse Mugele, knapp 30, hochqualifiziert mit Universitätsexamen, Wohnung braucht er nicht. Er will bei uns als Schlosser anfangen, aber Schlosser kann er nicht. Da denke ich …“
Alfons fällt ihr ins Wort: „Willkommen, Genosse. Das Feilen und Schleifen, das lernst du bei Tummatsch. Er ist unser bester Meister, parteilos, freundlich, sogar geduldig. Er wird dir alles zeigen. Aber unsere Schlosser, wie sag ich’s, sind nicht einfach. Ein wilder Haufen von Individualisten. Es ist gut, dass da ein Genosse hinkommt …“ Ein Arbeiter steckt seinen Kopf in die Tür, wird aber von der Kaderchefin noch mal fortgeschickt.
„Aber lass dich nicht unterbuttern“, sagt Alfons. „Klimper wird’s versuchen. Den erkennst du an seiner struppigen Mähne und der schwarzen Partisanenmütze. Aber er ist ein tüchtiger Arbeiter.“
Man sieht es der Kaderchefin an, dass sie diesen Neuling nicht gern einstellt. Während Alfons und Mugele ein paar Worte wechseln, dass das Parteilehrjahr recht im Argen liege, ist sie aufgestanden und macht einen Betriebsausweis zurecht. „Na ja“, sagt Mugele, „ich muss mich hier erst mal einfuchsen, hab ja was nachzuholen.“
„Du kommst aus China, Genosse! Da rechnen wir mit chinesischem Elan“, sagt der Parteisekretär und verabschiedet sich. – Die Kaderleiterin bringt den Ausweis, lässt Mugele unterschreiben. „Hier die Bons fürs Mittagessen. Lassen Sie sich im Depot einen Schlosseranzug aushändigen. Die Unterlagen von Ihrer vorletzten Arbeitsstelle lassen wir uns zuschicken. Na, dann bis morgen 7 Uhr. Ziehen Sie sich festes Schuhwerk an.“ Und Konstantin glaubt, nun eingestellt zu sein.
Ein Mann in blauer Bluse, drüber eine Joppe, Mugele, wird am Werkstor durchgewunken, geht zur Stechuhr. Meister Tummatsch weiß Bescheid und führt ihn zu zwei Blechgebilden, die wie riesige Zigarrenkisten aussehen, gäbe es da nicht Löcher und Ausbuchtungen. „Das ist die Außenverkleidung des Filters“, erklärt er. Er zeigt dem Neuling, wie man vom Stahlblech, die Schweißnähte entlang, die Huckel, alle Unebenheiten mit dem Schlackehammer vorsichtig abtrennt, dann, und so solle Mugele sich einarbeiten, mit dem Winkelschleifer nachbessert, bis die Fläche eben ist. „In der Nachbarabteilung wird dann Farbe aufgespritzt. Da darf kein Grat erkennbar sein. Das Blech muss glatt sein wie ein Kinderarsch.“ Er sagt es gütig, erklärt, wie die Schleifmaschine in den Händen gehalten und bedient wird. Kurz zur Seite blickend bemerkt Mugele, wie die Kollegen nebenan belustigt zuschauen. Und es klappt nicht. Immer wieder rutscht er ab, so sehr er sich müht. Immer wieder schreit der hohle Stahlkasten auf. „Vorsicht!“, ruft Meister Tummatsch, „das ist ein Schweinebraten!“ Mugele versteht nicht, und die Schleifhexe, anfangs passabel handlich, wird von Minute zu Minute schwerer. „Ach, das wird schon“, tröstet Meister Tummatsch, verspricht auch wiederzukommen. Noch nie hat Mugele sich so heftig nach einer Pause gesehnt.
Das wird keine ruhige Pause. Die Männer setzen sich auf die gewohnten Holzbänke, schieben ihm einen Klappstuhl zu und holen ihre Stullenbüchsen raus. Einer fragt den Neuen, ob er Orchestermusiker sei. Ein Schlanker, Dürrer will wissen: „Warum tust du dir diese Drecksbude an? Hast du was ausgefressen?“
So ruhig er kann, gesteht Mugele: „Ich will was ausfressen, Frau und Kind und mein chinesischer Papagei ebenso, und möglichst was Gutes und die ganze Woche über. Ich komme nämlich, vielleicht klingt’s komisch? – aus Peking. Im Moment bin ich blank. Aber einen Einstand wird‘s geben, wenn was in der Lohntüte steckt.“ Und beißt in seine Stulle.
„Was hast du denn in China gegessen“, will ein Dritter wissen, „faule Eier oder Hund?“
„Kann ich dir sagen: gallertartige Lehmeier sind erst mal ungewohnt, sehn auch merkwürdig aus, fast schwarz. Halbiere das Ei und mach‘ es mit geriebenem Knoblauch und Ingwer an, dann einen Spritzer Sojasauce drüber – eine Delikatesse. Mit Hundefleisch wollten sie in Peking nicht aufwarten. Seit dem Koreakrieg haben sie keine Hunde in der Stadt außer einem Airdale Terrier und einem Deutschen Schäferhund. Die gehören einem Schweden und einem Amerikaner. Zwei Hunde für drei Millionen Pekinger, das wäre ein bisschen wenig. Aber in Kanton steht Hund auf der Speisekarte. Ich hab’s nicht versucht.“ Mugele merkt, dass sich die Kollegen beim Kauen gern eine Geschichte auftischen lassen.
Da macht sich Klimper bemerkbar – Mugele hat ihn gleich erkannt mit seinem hohen schwarzen Barett voller Blechabzeichen und Orden ringsum, das er wohl Tag und Nacht nicht ablegt – wird es ernster: „Mich nennen sie Klimper, und wie heißt du?“
„Mugele“, sagt Konstantin.
„Also gut, Mugele, ich werde dir ein paar Tricks mit der Schleifhexe zeigen, jeder hier würde es tun, aber sag‘ uns erst mal, was der Parteisekretär von dir wollte gestern bei der Kadertante? Hat dich Alfons umgenietet?“ – Mugele ist überrascht, aber Klimper lässt nicht locker. „Du verstehst mich schon …“
„Ob ich Parteimitglied werden soll oder will? In meinem Fall ein bisschen spät gefragt: Genosse bin ich schon lange, das bin ich mir schuldig.“
„Soso. Und du hast einen chinesischen Papagei? Und kommst aus China?“, will Klimper bestätigt haben.
„Ja.“
„Haste auch‘n Mao-Abzeichen?“
Die Kollegen schielen zu Klimpers Mütze und grinsen. „Werde ich nachgucken und dir meins mitbringen“, sagt Mugele, „du kannst es besser gebrauchen als ich.“
„Das würdest du für mich tun, Muggi?“ – Jetzt hast du einen Spitznamen weg, denkt Mugele und ahnt zugleich: die Anstellung, nun ist sie perfekt.
Tummatsch kommt zur Pausenecke der Schlosser: „Könnt ihr nicht mehr? Jungs, es hat Eile. Und es ist ein Schweinebraten“, sagt der Meister. Klimper erhebt sich und die andern machen es ihm nach. „Ein Schweinebraten?“, fragt Konstantin leise. – Ein Lehrling flüstert: „Det saacht der Meester imma, wenn eene Prämie drin is. Mit die beeden Filter isset sowieso klar, die jehn nach Leipzig zur Messe …“ Konstantins Arme schmerzen, Rücken und Beine auch, und der Tag ist lang.
Am Abend zu Hause, todmüde, wirft Konstantin sich auf sein Bett und schläft. Wird wach nach zwei Stunden. „Hast dich überanstrengt?“, fragt Isa „Wie war’s denn? So sag‘ doch was.“
„Wo warst du, Papa?“, mischt sich auch der Junge ein. Konstantin lacht: „Ich war an der Schleifhexe.“ – Dem Jungen werden die Ohren heiß und rot. Anderntags wird Peter zum Kindergarten rennen und prahlen: „Gestern war mein Papa bei der Schleifhexe. Die hat ihn überanstrengt, sagt meine Mama.“
Von Tag zu Tag wird Mugele kräftiger, gelassener. Und so sind seine Tage: Straßenbahn, Straßenbahn; Schleifhexe, Pause, Schleifhexe, Mittagspause, Schleifhexe … Nach der Arbeit legt er sich ein, zwei Stunden hin. Alle wissen und respektieren das, auch der Papagei. Dann ist Mugele ausgeruht. Der Kopf ist frei. Er kann denken, lesen, schreiben. Er produziert – ein vergessenes Glücksgefühl. Die Straßenbahn. Die Lohntüte. Mugele bestellt Fachbücher, eins über Papageien, eins, ganz sinnlos, über Papageienzucht.
Am Sonntagvormittag klingelt es: Kokos Taufpate steht in der Tür. „Herein mit dir.“ Erbse bringt Blumen für die Examinantin. Erbse tobt mit dem Jungen herum. Erbse fragt Konstantin, wo sie mal in Ruhe was besprechen können. „Komm rüber zum Papagei. Er ist absolut verschwiegen.“ Erbse begrüßt Koko. Der Papagei wiegt sich auf seiner Stange, als wolle er tanzen. Erbse schlägt vor, demnächst einen Haken in die Zimmerdecke zu drehen, und verspricht, für den Kupferbügel mit den zwei Näpfen ein Stück Angelschnur mitzubringen. „Und wie hast du dich eingelebt?“, fragt Erbse.
„Gut. Womöglich mach ich das Richtige. Ich produziere Vorzeigbares. Den ganzen Tag über habe ich es mit vernünftigen Leuten zu tun, die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Und ich schone meine grauen Zellen. Sie kommen mir abends zugute … Und, Erbse, was machst du?“
„Kunstgeschichte hat mir gefallen“, sagt der, „die Renaissance, speziell die italienische. Nun nur noch Hobby, wenn mir Zeit bleibt. Es geht selten nach den eigenen Wünschen. Ich hab’s auch mit vernünftigen Leuten zu tun, aber die ahnen nicht, wie unvernünftig sie sind.“
„Biste bei die Jummiohren?“, fragt Mugele. – „Konstantin, Konstantin – noch immer das lose Maul? Aber ich will nicht streiten mit dir. Du kommst aus der Welt, hast deine Sache gemacht, du kommst mit Menschen zurecht, Fremdsprachen, nicht dein Problem – du gehörst in die Welt, nicht in die Blechbude.“
„Meinst du nach China?“
„I wo. Von den vier Himmelsrichtungen, na rate mal, meine ich die nach Westen.“
„Erbse, im Reich der Mitte kennt man seit ewig der Himmelsrichtungen fünf.“
„Willst du mich verkohlen? Wie sollte es eine fünfte geben?“
»Zu Süden, Norden, Westen, Osten, gibt es in China die Richtung Mitte.“
„Das ist merkwürdig. Nein, ich meine die andere Welt, die ziemlich mächtige alte. Nicht einen Erfolg gönnt sie uns, nicht den kleinsten, möchte uns am liebsten den Hals zudrehen, verstehst du?“
„Erbse, ich bin nich doof. Na klar wolln sie uns an den Kragen. Klauen uns die Kapazitäten weg, befreien uns von Landarzt, Ingenieur oder Chemieprofessor, weiß ich doch. Nennen uns Brüder und Schwestern hinter dem Eisernen Vorhang, aber trotz der riesigen Steinkohlehalden verkaufen sie keinen Krümel Kohle an die Ostzone. Nicht mal den Namen lassen sie uns.“
„Stimmt alles“, sagt Erbse, „ist aber nicht mein Gebiet. Ich bin, das bleibt unter uns, mit der westdeutschen Aufrüstung befasst. Was wir wissen müssen, und sehr schnell, sind, ich sag’s verkürzt: Truppenbewegungen, vor allem die geheime Planung.“
„Und das ist nicht mein Gebiet, Erbse. Ist aber auch nicht so schrecklich neu. Schon der alte Sunzi, Denker und Militärstratege im sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, hat da ein Traktat über die Kriegskunst geschrieben, sehr gescheit, auch über die Notwendigkeit von Spionen …“
„Konstantin“, Erbse sagt es mit Schärfe, „ich spreche nicht von Spionen, ich spreche von Kundschaftern.“
„Und wo, bitteschön, ist der Unterschied? Die eigenen, wie immer wir sie nennen, sind die Guten, sind sie auch – die anderen, ist doch klar, die Bösen. Daran wird sich nichts ändern. Wer obsiegt, wird richten. Ich bin vor fünf Wochen dank dieses Papageien dem Tod von der Schippe gehopst. Inzwischen, und es tut mir gut, befasse ich mich mit Stahlblech. Und übrigens mit Gedichten.“
„Nimmt dir doch keiner. Ist schön, wenn du das kannst. Uns interessiert: Sind die Wege offen?“ Ein Augenblick der Stille tritt ein. „Hast du Angst, Konstantin? Sprich dich aus … Meinst du, ich würde dich ins offene Messer laufen lassen? Mit niemandem habe ich so freiheraus gesprochen, offener als es jede Dienstvorschrift erlaubt. Wir kennen uns lange. Eine Tippeltappeltour gibt es auch bei uns. Die ersparen wir dir. Mit links erlernst du ein paar Verhaltensregeln speziell zum eigenen Schutz.“
„An was denkst du da?“
„Konspiration ist das A und O. Für das Operationsgebiet erhältst du eine andere Identität, auch einen neuen Namen.“
„Das heißt, du taufst mich um.“
„Wenn du’s so nennst … Du kannst dir den Namen auch aussuchen.“
„Will ich denn, Erbse? Vom Bahnhof hast du mich abgeholt. Das war lieb. Du hast meinen Papagei vier Treppen hoch geschleppt und ihm stante pede einen anderen Namen verpasst: Jakob – plauz war‘s Koko. Mit einem Papagei geht das. Ich hab’s hingenommen, weil du’s bist. Hatte keine Ahnung, das machst du immer so. Übrigens: Bei meinem Aufenthalt in Moskau hat mir ein fahrender, will sagen führender Sowjetbürger eingeschärft: Tschelowjek nje popugai.“
Gab’s Streit? Dazu ist Erbse zu klug. Er zeigte sein feines Lächeln. Und er hält, was er versprochen hat. Von der Decke der Wohnstube hängt die Angelschnur mit dem Kupferbügel. Das ist Kokos neuer Lieblingsplatz, schwebend. Und Konstantin muss mit einer alten Erfahrung zurechtkommen: Wer Vögel nähret, dem wird ihr Unflat zu Lohn.
Schnee ist gefallen, aber die Leute vom Prenzlauer Berg zertrampeln die Pracht. Der Wind bläst Ruß durch die Straßen. Heute kommt Mugele mit einem Gast nach Haus. „Zeigst du mir deinen Chinesen, Muggi?“, hatte Klimper am Ende der Schicht gefragt.
„Na klar, aber wann?“
„Am besten gleich, ich hab ein Geschenk für den Papagei.“
Kokos Verkündung durch alle Türen hindurch ist bis in den Treppenflur zu hören. Ein Hüne tritt in die Küche der Mugeles, struppig das schwarze Haar, das unter dem Barett hervorquillt. Er begrüßt das Kind, das am Tisch sitzt und tuscht. „Weißt du wer ich bin?“ fragt er den Jungen.
„Du bist ein Bär“, sagt Peter, und Klimper lässt es sich gefallen. „Ihr habt es gut in der Höh“, sagt der, guckt rundum und rühmt die Platane im Hof. Als Klimper das Wohnzimmer betritt, klopft Koko auf seine Schaukelstange. Isa legt das Chinesisch-Wörterbuch zur Seite. „Ich habe schon viel von Ihnen gehört, eigentlich jeden Tag“, gesteht sie.
„Hoffentlich Gutes“, meint Klimper, „ich bin der Schrecken des Luftfilterbaus, stimmt’s, Muggi?“
„I wo“, begütigt Konstantin, „du bist der Schrecken der Pfuscher.“
„Wenn schon, denn schon“, sagt Klimper, „machen wir nun Sozialismus oder nich? Aber es dauert viel zu lange. Die Leitungen sind faul, un wir Muschkoten tricksen und klaun. Das passt nicht zueinander.“
„Nun übertreib nicht, Klimper.“
„Aber es ist so«, bekräftigt der Gast und wendet sich dem Vogel zu: „Du bist hier, höre ich, der Wachhund. Hab dir ein Knöchelchen geschnitzt – nun schnitz weiter.“ Der Papagei greift nach dem Hölzchen – und schnitzt. Klimper rückt sich einen Stuhl heran, guckt dem Vogel ins Gesicht, guckt und staunt. Als sich Klimper vornüber beugt und einnickt, gehen Isa und Konstantin leise aus dem Zimmer und machen in der Küche ein Abendbrot zurecht. Konstantin holt Bier aus dem Fensterspind. Peter zeigt sein Bild: Die Gute Hexe reitet auf einem Besen in den Kindergarten. Später, beim Bier, sagt Klimper: „Mir gefällt dein Papagei, Muggi. Und dass du deine Meinung sagst. Auch wie gelassen du unsern Spott erträgst. Wir dachten doch …“
„Schon gut“, sagt Mugele. „Und mir hat es bei euch gefallen …“
„Schade“, sagt Klimper, „ich ahnte doch, du wirst wieder fortgehen.“
Wenn Mugele an die Zeit im Luftfilterbau denkt, wird sie ihm als eine glückliche vorkommen. Und nicht nur der Gedanken wegen, die ihm der Arbeitstag ließ. Die in blauer Bluse sind es, die die Welt voranbringen. Und weiß, das ist eine Metapher. Sie sind es, die den Reichtum schaffen. Gehen des Morgens müde ans Werk, schuften den langen Tag. Müde kehren sie am Abend nach Haus. Salz der Erde … Das war so, bleibt das so? Tief innen fühlt er sich den Genossen verbunden. Zu ihnen gehört er auf der ärmeren, der glückhaften Seite der Welt, zehn Jahre schon. Aber die erste Möglichkeit und Bitte, sich der feindlichen Seite offensiv entgegenzustellen, wirklich in den Kampf einzutreten, sei’s sich Beulen zu holen, die schlägt er aus. Und weist auch noch auf seinen Papagei. Nein, sehr mutig bist du nicht, Mugele.
Wenn der Papagei sich im graugrünen Wams plustert, fühlt er sich sicher und gut. Doch die Metallkette am Fuß, wiewohl sie den Freigang ermöglicht, ist keine so tolle Erfindung … Auch Mugele merkt das, denn unermüdlich sucht er eine Fußfessel aus leichtem Werkstoff herbeizuschaffen. Mit der Plastikkette für Ausguss- oder Badewannenverschluss glaubt er ihn gefunden. Ein Irrtum. So war es im Tagesablauf des Papageien gewiss ein erhebender Augenblick, als der die neue Kette durchbeißt und sich einen Ausflug gönnt. Am Einband von Uljanows „Empiriokritizismus“ erprobt er seinen Schnabel. Später wirft er vom Ofensims her Reste der Kette, Glied für Glied, dem heimkehrenden Konstantin vor die Füße. Die Lektion ist deutlich: Nie wieder Ketten.
Weihnachten und Neujahr sind vorüber. Der Kalender bezeugt das Jahr 1959. Da bricht Mugele zur neuen Arbeitsstelle auf. Mit der U-Bahn, Richtung Ruhleben, fährt er zwei Stationen, läuft an der Volksbühne entlang und steht vor der dem Hohen Haus zugeordneten Lichtzentrale. Am Einlass erhält er einen Passierschein und begibt sich zum Büro Ziegler. Der schmächtige Mann tritt zu der korpulenten, wortkargen Sekretärin, Genossin Gerda, stellt sich vor und wünscht gute Zusammenarbeit. Er bekommt sein Zimmer gezeigt. Es ist einfach und praktisch ausgestattet, an Möbeln zwei Bücherregale sowie eine kleine Besuchergarnitur, ein Panzerschrank. Wozu den? Auf dem Schreibtisch steht ein Blumengruß, mitten im Winter, am 15. Januar.
Der Chef sei ein paar Tage in Leipzig, bei den Malern. Er empfehle ihm, sich in Ruhe einzuarbeiten, die Post durchzusehen. „Morgen zeig ich dir alles. Du musst dich im Regierungskrankenhaus vorstellen – das hat ein paar Tage Zeit. Aber erst mal solltest du rüber ins Hohe Haus. Dort gibt Genosse Sindermann, grad aus China zurück, vor den Politischen Mitarbeitern seinen Reisebericht. Anschließend kannst du an Ort und Stelle die Formalitäten erledigen. Geh auch gleich zur Waffenkammer.“
Auf, auf zum Kampf. Mit China – das fängt gut an. Und ist ein bisschen verwirrend. Konstantin streift sich den Mantel über. Der Weg zum Hohen Haus in der Wilhelm-Pieck-Straße, das sind dreihundert Schritt. Du gehst der Straße deiner Kindheit entgegen, die einmal Lothringer hieß. Das große Eckhaus an der Prenzlauer Allee, damals Kaufhaus Jonas, das wird dein Winterpalais. Nun muss er doch lachen.
Der große Saal, den Mugele betritt, füllt sich rasch. Ein wenig hat er Zeit, sich die Gesichter anzusehen. Er merkt, wie er jenes besondere Leuchten in den Augen sucht, das Anna Seghers in den Augen der Revolutionäre entdeckt hatte. Er sieht, so sehr er sucht, gewöhnliche Leute, sauber und ordentlich angezogene. Schon tritt der Referent in den Saal, beginnt ohne Umschweife seinen Bericht über die so ferne Volksrepublik. Er ist hingerissen vom Elan beim Großen Sprung, dem er im November drei Wochen in Nord und Süd begegnet sei. Ein guter Redner, denkt Mugele, aber er reist hastig, guckt und notiert hastig. Die Puddelöfen fehlen nicht. „Und nehmt den Analphabetismus in Volkschina, Genossen, diese uralte Geißel – heute so gut wie ausgerottet. In Schanghai zum Beispiel …“ Es folgen aus einigen Küstenstädten staunenswerte Prozentzahlen. Aber Konstantin ist bereits von dem Gedanken abgelenkt, dass sie im Mittereich gar kein Alphabet haben. Sie haben die uralte Bilderschrift, die zu erlernen Anstrengung verlangt und den raschen Erfolg ausschließt. Beifall füllt den Saal am Ende der Ansprache, und der Redner, ein höflicher Mensch, lächelt und erkundigt sich, ob es Fragen an ihn gebe. Das scheint nicht der Fall … Aber es scheint nur so, denn Mugele meldet sich und benennt seine Verwunderung. Er sei zwar schon seit Oktober von dort zurück, und alles, alles in Fernost vollziehe sich stürmisch, aber abseits der Städte, bei den Millionen Dorfbewohnern, gar in den entlegenen Bergregionen, stehe im Lesen und Schreiben der Lernerfolg noch aus. „Jedenfalls im Oktober war es so.“ – Ob des reichlich Unüblichen gucken die bewährten Kader auf den Neuling neugierig und nicht ohne Sympathie. Horst Sindermann dankt für den Einwand und verspricht, sein Zahlenmaterial zu überprüfen. Sodann: Mugele erhält im Haus die schon bereitliegende rote Klappkarte. In der Waffenkammer wird ihm eine Makarow-Pistole, plus Munition ausgehändigt. „Wozu?“
„Zum persönlichen Schutz. Die Abteilungsleiter bekommen die Makarow. Du weißt mit ihr umzugehen? Schließ sie gut weg, Genosse. Zum Schießtraining draußen kriegst du Bescheid.“
Da steckst du nun, Mugele, Pistole, zwei Magazine, Putzlappen und ein Kännchen Öl in deine Tasche. Du bist Berufsrevolutionär. Oi, oi, oi. Er geht zurück in die Lichtzentrale und besichtigt aufmerksam seine Abteilung: Genossin Gerda sitzt hinter einer großen Adler-Schreibmaschine.
Was liegt an am ersten Arbeitstag? Wie der Teufel so spielt, sind Akten zu tilgen. Mugele geht mit einem Jutesack zurück ins Hohe Haus, begleitet von einem jungen Sicherheitsoffizier in Zivil. Muss tief in den Keller zu einer alten Kollermaschine. Der Haustechniker wartet schon, schmeißt nun Kollergang plus Wasserzufluss an, und Mugele wirft Papier, Papier, überholtes Zeug, Vorschläge vielleicht, Beurteilungen, Redeentwürfe, weiß der Kuckuck was, in einen gierigen grünen Trichter. Am Ende platscht aus einem Rohr eine dicke graue, mal mehr bläulich irisierende Pampe in eine Tonne. Denkt er, dass unter allen chinesischen Erfindungen das Papier die folgenreichste war? Ahnt er, in welchen Orkus irgendwann die eigene Lebensenergie glucksend verschwinden könnte? Durchaus! Mugele sehnt sich nach einem Blechgehäuse, das Meister Tummatsch einen Schweinebraten nennt.
Im Haus, im Freundeskreis spricht es sich herum, dass Koko, seinen Schnabel schärfend, viel Holz verschleißt. Man müsste im Wald wohnen, denkt Mugele, oder wenigstens einen Garten mit Gehölzen haben. Aber Nachbarn und Freunde springen ein. Sie schleppen Großmutters Wäscheklammern herbei, die pur hölzernen aus einem Stück. Mit Drahtklammer gefertigte nimmt Konstantin nicht. Niemand darf den Papagei gefährden. So kommt man, wenn man sonst kein Bewerbchen hat, mit dem Klammerbeutel zu Mugele. Eine lebhafte Runde ist garantiert, und Isa sehnt sich nach einem eigenen Arbeitszimmer.
Der Leiter der Kommission für Erleuchtung ist von seiner Inspektionsreise zurück. Er begrüßt seinen Assistenten und lädt ihn zum Mittagessen ins Hohe Haus, wie gesagt, 300 Schritte entfernt. Der persönliche Begleiter hätte den Professor, den Bestimmungen gemäß, lieber im SIM dorthin eskortiert, aber der rüstige Mann durchbricht gern einmal das Protokoll. An einem länglichen Tisch sitzt das halbe Zentralbüro, auch Walter Ulbricht, speisend. Bernhard Ziegler grüßt hinüber, und führt seinen Mitarbeiter an einen Einzeltisch. „Such dir was auf der Speisekarte. Doch zuvor: Was trinken wir? Ich empfehle was Gesundes, ein Glas Tomatensaft.“ Das kennt Mugele nicht, erfährt auch, dass die DDR das Getränk aus Bulgarien beziehe. Der Trank ist kühl und schmeckt würzig. Auch die Forelle ist gut, die eine Serviererin aus der Küche bringt. „Ich freue mich, dass alles überstanden ist“, sagt der Professor. „Von deinen Skrupeln habe ich gehört. Ich versteh sie gut. Alles, was wir machen, ist Neuland betreten. Der Kapitalismus hatte seine 400 Jahre Zeit, sich auszubilden und durchzusetzen. Der Sozialismus ist jung, hatte kaum 40 Jahre. Und unter was für Bedingungen! Das prägt auch die individuellen Schicksale. Fehler waren unvermeidlich. – Als Komintern-Mitarbeiter hatte ich mich 1924 in Moskau für ein tiefer gehendes Studium des Dialektischen Materialismus beworben, als mich Manuilski einbestellte und mir eröffnete: ‚Packen Sie Ihre Sachen. In zehn Tagen übernehmen Sie in Paris die Parteihochschule der KPF.‘ – ‚Aber ich wollte grade mein philosophisches Wissen …‘ – ‚Wir wissen schon, was Sie wissen‘, unterbrach mich Dmitri Sacharowitsch. Und so wurde ich für zwei Jahre Direktor der französischen Parteihochschule.“
Mugele guckt verdutzt von seiner Forelle auf. „Nur Mut“, meint Ziegler und fügt noch eine Anekdote über seinen Vater an. Der sei ein im Rheinland recht bekannter Arzt und Gelehrter gewesen. Als junger Mann habe er Etruskisch lernen wollen. Niemand war da, der es ihm beibringen konnte. So habe er eine Annonce in die Zeitung gesetzt: Junger Etrusker erteilt Unterricht. Über ein paar Tage hätten sich drei, vier Enthusiasten gefunden und seien das Problem angegangen. „Will sagen: Am besten lernt man lehrend. – Im Elternhaus verkehrten oft ausländische Gäste. Bei Tisch wurde mancherlei Sprache gesprochen. Ich lernte sie alle. Und welche Sprachen sprichst du, Konstantin?“
Konstatin murmelt: „Englisch wohl recht gut. Russisch leider nicht, noch nicht. Chinesisch für den Hausgebrauch. Hatte auch Latein.“ Der Professor sieht ihn ein wenig mitleidig an, erlaubt ihm auch, einen Sprachkurs Chinesisch an der Uni zu belegen. „Das wird schon alles. Nimm mir etwas Arbeit ab, ich hab da alte Skripte abzugleichen, verschiedene Fassungen. Geh bitte gleich morgens die Presse durch, West und Ost, streich das Wesentliche an. Vorträge, Lektionen – das mache ich selber. Halt mir ein bisschen den Rücken frei.“ Mugele sieht von der Seite einen graden, athletischen Rücken. Der Chef ist ein noch immer drahtiger Mann. Schaut dann aufmerksam in das Gesicht des Alten, der ihm zwei Generationen voraus ist und sich nun mit der Damastserviette sorgfältig den Mund wischt. Mugele dankt ihm für das Mahl. Der Professor verabschiedet seinen Sekretär für heute und begibt sich zu den Kollegen vom Zentralbüro. Wieder geht Mugele die dreihundert Schritte. Denkt an die bevorstehende Arbeit. Vielleicht geht‘s mit der Methode Junger Etrusker.
Aber was helfen Methoden, gar die besten, wenn mit dem scheidenden Winter das Streufutter alle wird. Da beginnst du dich überraschend für Ernteerträge und den Außenhandel zu interessieren. Ein Papagei ist mit Blattsalat, Eigelb, Apfel und Mohrrübe allein nicht zu ernähren, er braucht auch Sonnenblumenkerne. Im Osten gibt es – warum genau? – Mängel in der Versorgung, zeitweilige und anhaltende. Westberlin ist für Mugele tabu. Im Unterschied zum Scheuerlappengeschwader, das für 20 Pfennige pro Putzfrau vor dem Frühstück von Ost nach West aufbricht. Ebenso die Kohorte von Handwerkern jeglicher Couleur, Kellnern, Ingenieuren, Arbeitern, die gleicherweise ausschwärmt. Selbst viele Zehntausend Senatsangestellte, die in Ostberlin wohnen, wechseln so mit S- und U-Bahn im Zwölf-Minuten-Takt die Weltsysteme. Am Morgen bringen sie noch rasch die Sprösslinge in die Kindergärten des Ostens, abends, jedenfalls am Zahltag, kehren sie mit dem devisenträchtigen Geld des Westens heim, oder mit dem bereits getauschten Ostgeld (1:5). In den Taschen die raren Südfrüchte und andere Gaumenfreuden. Fröhlich kaufen sie im Osten die knusprigen Brötchen, ein Sechser das Stück, die übrigen staatlich subventionierten Lebensmittel gleicherweise, wenn’s sein soll, auch Kleidung und Schuhe, gehen kostenfrei zu jeglichem Arzt und für ein paar Märker zum Friseur, zahlen, monatliche Pflichtübung, für einen Spottpreis die Miete. In Festreden ruft Herr Adenauer den Deutschen zu, sie müssten sich entscheiden zwischen Freiheit und Barbarei – die Grenzgänger machen es partout nicht. Derweil läuft im amerikanisch-britisch-französisch besetzten Teil der Stadt eine Kampagne: Die CDU (West) bringt ein kleines gestanztes Brandenburger Tor aus Silberblech unter die Leute, Abzeichen mit der Aufschrift: Macht das Tor auf! – Die Grenzgänger, sie befürchten das genaue Gegenteil: eines Tages könnte das Tor geschlossen sein, das Langhans erbaut hat. Das kann sich niemand vorstellen.
Mugele wohnt acht Minuten von der Sektorengrenze entfernt, sie zu überschreiten ist ihm ein fremder Gedanke. Und doch läuft er, mit dem Sohn an der Hand, ein tüchtiges Stück in den Französischen Sektor hinein, wenn es gilt, einen eiligen Brief des Professors an einen Mitstreiter in München auf den Weg zu bringen. Sonnenblumensamen für den Papagei – aus der Quelle West kann er sie nicht schöpfen. Auch das abenteuerliche Anerbieten einer Moskauer Familie, die Mugele von Peking her kennt, einen Sack Sonnenblumenkerne einem Lokomotivführer der Strecke Moskau-Paris aufzudrängen – unmöglich! So ertappt er sich dabei, mal nach Potsdam oder nach Fürstenwalde fahren zu müssen, natürlich in höherem Auftrag, um für Koko, den Retter, Streufutter in den auswärtigen Zoohandlungen aufzutreiben. Oder – eben wegen der Streuung! – nach Jüterbog. Von dort bringt er seinem Professor die Nachricht, ein Dr. Falk habe ein vorzügliches Laientheater aufgezogen, in dem Schüler, Handwerker auch Arbeiter, zu eigenem Spaß und zur Freude der Stadt Theater spielen. Dienstreise mit doppeltem Erfolg: Die tiefe Überzeugung Professor Zieglers wird neu unterfüttert: In jedem, auch in den Jüterbogern, schlummern Talente, die die sozialistische Gesellschaft zu entfalten hat. Und: Der chinesische Papagei hat seine Kerne.
Inzwischen wird das Fachbuch über Papageienvögel geliefert. Konstantin studiert es aufmerksam. Sein grüner Papagei ist also eine Psittacula, gehört zu dem Dutzend der Edelsittiche. In dieser Gattung ist er der größte und farblich schönste, ein Wachsschnabelpapagei. Letzteres, sich früher Begegnungen mit dem Schnabel erinnernd, kann Mugele, der Laie, weder verstehen noch bestätigen. Ein Earl of Derby soll den Vogel erstmals in Europa vorgestellt haben. Ihm sei der Fehler unterlaufen, die rot- und die schwarzschnabligen Exemplare in getrennten Volieren gehalten zu haben, und sei zu der Feststellung gelangt: In Gefangenschaft vermehren sie sich nicht. Solchen Quatsch, Koko, wollen wir mal nicht glauben. Aber dass du edel bist, wir ahnten es immer.
Willkommen also in der neuen Würde, Koko – Lord Derby’s Parakeet, Psittacula derbiniana, Lord Derbys Edelsittich. Nun Näheres herauszukriegen, wer der zuständige Lord Derby war und worin sein Verdienst für die Vogelkunde besteht, macht Mühe. So gelangt Mugele auch in Spezialbibliotheken. Dann weiß er: Die Stanleys, britischer Hochadel, tragen väterlicherseits bis auf den heutigen Tag den Ehrennamen Lord Derby, egal ob sie große Schlachten geschlagen, geköpft wurden oder sich sonst hervorgetan haben: alles berühmte Politiker, Künstler, Wissenschaftler, Militärs, Müßiggänger, Kunstsammler, Parlamentarier, vom König, von der Königin ins Oberhaus berufene Lords, mit oder ohne Hosenbandorden. Ein uraltes Geschlecht, seitdem König Henry VII. 1485 Thomas Stanley mit dem Titel Earl of Derby bedachte.
Wer aber war der namensgebende Derby? Lord Derby XII. des verzweigten Clans, ein Pferdenarr, eher nicht, wiewohl er eine naturwissenschaftliche Bibliothek anlegte. Wiewohl er auf Knowsley Hall Gehege und Stallungen ausbauen ließ und in seiner Menagerie neben 94 Arten Säugetieren auch 318 Arten von Vögeln beherbergte. Tatsächlich war’s der Sohn, Edward Smith Stanley (1775 – 1851), Earl of Derby XIII., seines Zeichens britischer Politiker, Grundbesitzer, Baumeister, Landwirt, Kunstsammler und Naturforscher. Er hielt sich in größerem Stil Papageien, gelegentlich auch Künstler. So den berühmten Maler, Limerick- und Nonsensdichter Edward Lear in den Jahren 1832 – 1836. Der schuf ein vorzügliches Buch zoologischer Illustrationen von Papageien, bot dabei erstmals keinen Abklatsch ausgestopfter Vögel, sondern zeichnete nach lebendiger Natur. Auf dem Landsitz gab es viel zu entdecken – die letzte damalige Inventarliste zählt 1272 Vögel und 345 Säugetiere auf. Aber ob unser Lord Derby XIII. je in Indien oder China geweilt und in den Bergwäldern in 1500 bis 4000 Meter Höhe den Papageienschwärmen nachgestiegen ist, lässt sich verlässlich nicht sagen. Gewiss ist, dass er reich und hoch angesehen war. War generös. Man schmeichelte ihm, ja verzichtete ihm zuliebe auch auf eigenen Ruhm. Man brachte ihm als Ehrengabe exotisch fremdes Getier auf das Adelsgut Knowsley Hall. Aus drei Erdteilen stammten die Tiere, bei deren wissenschaftlicher Namensgebung man ihm die Patenschaft antrug – der afrikanischen Riesen-Elenantilope (Taurotragus derbinianus), einem südamerikanischen Hühnervogel, dem Zapfenguan (Oreophasis derbianus) und eben dem Chinapapageien, Lord Derbys Edelsittich, (Psittacula derbiniana). Wer hätte das gedacht, Koko.
Von den Sorgen, die Konstantins Familie betreffen, wiewohl er manchmal danach fragt, weiß der Professor nichts, allenfalls flüchtig. Dabei ist manches für die Mugeles nicht Sorge, was andere schon auf die Barrikade treibt, so der Engpass in der Fleischversorgung. Da scherzen Konstantin und Isa noch, wenn die Metzger statt Wurst und Schinken Blattpflanzen ins Schaufenster rücken. Was macht sie unempfindlich gegen Armseligkeit? Dass sie Kriegskinder waren, die gelernt hatten mit Not umzugehen? Dass sie sich Die Große Lehre vom Künftigen in Seminaren und Subbotniks zu eigen gemacht hatten? Es ist vor allem das Urvertrauen in die Zukunft, das die Mugeles erfüllt. Und: Budjet. Budjet. Isa, nun schon Aspirantin, erwartet ein zweites Kind. Hoffnungsvoll sind die Mugeles in eine Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft eingetreten, zahlen mit Geld und Arbeitsstunden. Die AWG baut im nördlichen Pankow, in Wilhelmsruh, und wieder an der Grenze. Nebenan der VEB Elektroapparatewerk Bergmann-Borsig. Baut Turbinen und, neuerdings, elektrische Rasierapparate, beide ziemlich laut. – Für die Mugeles bleibt fraglich, wer oder was zuerst fertig in die Welt gesetzt wird: Das Haus? Das Kind?
Das Kind. Familie Mugele nennt es Renate. War eine schwere, eine aufregende Geburt. Alle freuen sich, erregt ist der Papagei, der nun eine lebhafte Gefährtin in der Nähe hat. Es gefällt ihm, wenn das Baby nach dem Trinken aufstößt, recht geräuschvoll sein Bäuerchen macht, also hick! Da antwortet Koko der Kleinen, zur Freude der Familie, mit deutlichem: Hick! Nun wollen alle, wenigstens auf dieser Basis, mit dem Papagei ins Gespräch kommen, rufen Hick! Und hick! Vergeblich. Er missachtet Fälschungen. Sollen sie doch Hick! rufen, solange sie wollen. Er antwortet nur auf das, was inbrünstig aus unschuldiger Brust ertönt. Er ist ein Edelsittich.
Dem Genossen Ziegler gegenüber vom Papagei kein Wort. Der hat schon genug Vorbehalte. Er mag Balletttänzer nicht und auch nicht Germanisten. Was ist das eigentlich, Germanistik? – Mugele will es dem Professor nicht erklären und ist glücklich, nur in eine der zwei Kategorien zu gehören.
Mit dem alten Mann ist auszukommen. Wenn Mugele früh den Pack Tagespresse, und der ist riesig, überflogen und aufbereitet hat, kriegt er nachmittags, spätestens am Folgetag mit, was noch oder was vor allem beachtenswert war. Das Interesse des Professors ist weit gespannt, geht über die Künste, die Kulturtheorie bis in die Abgründe der Politik und der Börsenkurse. Aber der Professor gibt gern von seinem Wissen, auch von seinen Vermutungen ab, mal wie nebenbei, mal nimmt er sich richtig Zeit. Sein Secretarius soll nicht unbedarft durchs Leben taumeln. Da greift er auf die Erfahrungen in vielen Ländern zurück, begeistert sich neu am Volksleben in den italienischen Tavernen, rügt das französische Kleinbürgertum, das in den Zwanzigern um seine Baku-Aktien zitterte und nach deren Verlust nicht vom Antikommunismus ablassen kann. Über die Gewohnheiten russischer Bauern und Arbeiter gibt er Auskunft, über den scharfsinnigen Lenin, dem er begegnet war. Ihn schildert er im Vergleich zum beifallsüchtigen Trotzki. „Eine Szene, die mir vor Augen steht. Moskau, Kolonnensaal. Trotzki, ein guter Redner gewiss, lässt sich feiern, wie er vom Pult her durch die Reihen schreitet und die Honneurs entgegennimmt. Gleichzeitig Lenin, der Stratege, hockt vorn auf den Stufen, eine Kladde auf den Knien, nimmt letzte Korrektur für seine Rede vor …“ Über Stalin spricht Genosse Ziegler zu Mugele nicht, kein Wort.
Halt, das stimmt nicht ganz. Einmal, gut gelaunt, kommt Ziegler aus der Sitzung des Zentralbüros, sagt: „Dass zwischen der Sowjetunion und Polen die Grenze willkürlich gezogen worden sei – Stalin habe sich über die Landkarte gebeugt und seinen Arm auf die Karte gelegt, um den entscheidenden Strich zu ziehen, und es sei ob des Ärmelknopfes ein Huckel entstanden – das stimmt alles nicht. In Wirklichkeit sei eine hochrangig besetzte Russisch-Polnische Grenzziehungskommission die künftige Trennlinie abgeschritten und habe einvernehmlich alles regeln können. Aber irgendwann sei die Kommission auf ein Gehöft gestoßen, bei dem die Grenze später mitten hindurch verlaufen werde. Was tun? ‚Lassen wir den Bauern entscheiden!‘ Sie klingeln an der Haustür. Bäuerlein kommt. ‚Wir von der Russisch-Polnischen Grenzziehungskommission möchten Sie fragen, ob Sie für Polen oder für Russland optieren möchten?‘ – ‚Da muss ich meine Frau fragen‘, erwidert der Bauer und klettert die Stiegen hinauf. Kehrt zurück und sagt: ‚Zu Polen.‘ – Kurz vor Abschluss der Arbeit besinnt sich die Kommission des interessanten Falls und kehrt noch einmal zu besagtem Gehöft zurück. Klingelt. ‚Es bleibt, wie Sie entschieden haben‘, sagt der Kommissionsvorsitzende, ‚nur wüssten wir noch gern den Grund.‘ – ‚Da muss ich meine Frau fragen‘, sagt der Bauer und klettert die Stiegen hinauf. Kehrt zurück und berichtet: ‚Meine Frau fürchtet den russischen Winter.‘ So war das.“
Manchmal, sehr gelegentlich, darf Konstantin die Honneurs entgegennehmen, die Professor Ziegler zugedacht sind. So muss der Professor an einem 8. März den versammelten Verdienten Frauen des Landes Gruß und Dank von Partei und Regierung überbringen, ehe ein festliches Tafeln beginnt. In hohem Ton spricht er vom Menschen, der Schöpfer seiner selbst sei, gibt auch ein uraltes Rätsel zu bedenken: Am Morgen läuft er auf vier Beinen, mittags auf zweien, am Abend auf dreien … Da kommen sie, die Mugele aus der Arbeit kennen, und sagen erregt: „Heute hat dein Chef so interessant und zu Herzen gehend gesprochen …“ Mugele, für den sein Professor durchaus auch sphinxisch ist, ahnt, auf dem Zettel für das Grußwort stand womöglich ein einziges Wort. Und kaum jemand im Saal kennt es. Und die Beilage der richtungweisenden Tageszeitung titelt jede Woche: Die Gebildete Nation.
Nach ein paar Monaten im Haus am Rosa-Luxemburg-Platz wird das Hohe Haus mitsamt der Lichtzentrale in das Gebäude am Werderschen Mark verlegt. Einst hatte dort Hjalmar Schacht residiert. Für Mugele ein riesiges Labyrinth, in dem er sich noch oft verlaufen wird. Der zweite Stock, von einem Posten besonders abgeschirmt, ist dem engeren Kreis des Zentralbüros nebst Mitarbeiterstab reserviert. Dort sitzen Mugeles Kollegen, erfahrene Spezialisten, die ihren Chefs die Reden ausarbeiten. Die Richtung weist Walter Ulbricht. Wenn Bernhard Ziegler zu ihm geht, führt er eine kleine Kladde mit sich, die mit WU beschriftet ist. Er sammelt: Worte des Großen WU.
Zu Mugeles Obliegenheiten gehört Routinearbeit: Termine vereinbaren, absagen, vertrösten. Das macht keinen Spaß. Aber es gibt immer neu Anfragen, Beschwerden, Eingaben zu Plagen und Vorkommnissen, die eine Kommission für Erleuchtung möglichst umgehend klären möge. Das ist spannend, wiewohl manchmal auch abwegig und nicht zu lösen. So verlangt das Außenministerium dringlich abzustellen, dass in Zentralafrika das Buch über Nobi verbreitet werde, das von einem Afrikaner handele, dem die Tiere des Waldes, und freilich auch die Affen, Beistand leisten. Ein Einheimischer dort sucht oder erfährt Hilfe von Affen – das sei blanker Rassismus. Empörend das Buch, es störe die Aufnahme diplomatischer Beziehungen … Armer verkannter Ludwig Renn, Spanienkämpfer, was hast du dir nur mit diesem liebenswerten Kinderbuch gedacht! – Ähnlich schlimm eine Hiobsbotschaft aus dem Norden: das schwedische Königshaus unterhält zwar noch keine diplomatischen Beziehungen zur DDR, aber wie man die Veröffentlichung eines Tagebuchabdrucks von F.C. Weiskopf in der Literaturzeitschrift beanstanden kann, weiß es bereits. Weiskopf charakterisiere einen jüngst verstorbenen Prinzen als lieb, aber ein wenig dümmlich. Ja, wie soll man da dem ehrenwerten DDR-Außenministerium anderes sagen als: Es ist die Meinung des Genossen Weiskopf. Und: Er kannte ihn. – Der Erfinder einer elektronischen Orgel wünscht sich zur endgültigen Fertigung seines Meisterwerks nochmals eine Tranche Banknoten. – Ein bestallter Universitätsprofessor erbittet über die Kommission für Erleuchtung eine Entscheidung des Zentralbüros, das Wirrwarr bei der Transkription chinesischer Namen und Begriffe zu beenden. Das ginge schon mit der Hauptstadt los, solle man Peking oder Beijng sagen und schreiben, auch Peiping war schon zu hören. Gütiger Weise fügt er eine weitere, von ihm selbst erarbeitete Übertragungsmethode an. – Unbeschwert ist die Anfrage eines Goethe-Enthusiasten und Professors: Der große Dichter habe eine wunderbare Tagesaufgabe formuliert. Unser Professor habe sich den großartigen Text notiert, aber die Quelle sei ihm just entfallen. So wende er sich vertrauensvoll an die mit Erleuchtung Befassten und bitte um eine Nachricht. Auf dem Zettelchen stand:
Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte wechseln.
Man sollte. Man sollte. Er, Mugele, kommt zu gar nichts mehr. Ach lieber Koko, man sollte jeden Tag wenigstens einen Papagei kraulen, ihn sanft mit Wasser besprühen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte mit ihm wechseln.
Mit dem Professor raus in die Bezirke zu fahren ist ein ander Ding, vorn Fahrer und Begleiter von der Sicherheit, hilfsbereite Burschen. Der Chef hat Arbeit mit, Vorlagen, Berichte. Macht sich Notizen, streicht an, erteilt Aufträge. Mugele erstaunt das Arbeitspensum, das werden zehn und zwölf Stunden am Tag sein, wenn’s mal reicht. Die Landschaft wird lieblicher, der Professor entspannt sich, fängt zu singen an, wundert sich, wundert sich nicht, wie sein junger Begleiter einstimmt, Melodie und Text weiß. Sie fahren dem Zupfgeigenhansl entgegen, Wyneken, dem Hohen Meißner mit seiner Basaltkuppe. Und ist doch nur Burg Giebichenstein in Sicht, an der Saale hellem Strande gelegen, wenn’s nur so wäre. Später erreichen sie Thüringen. Ziegler singt eine melancholische Weise, die kennt Konstantin nicht.
Hier sitz‘ ich auf Rasen
mit Veilchen bekränzt;
hier will ich auch trinken
bis lächelnd am Himmel
mir Hesperus glänzt. …
Das menschliche Leben
ist schneller dahin
als Räder am Wagen.
Wer weiß, ob ich morgen
am Leben noch bin? …
„Das Lied höre ich zum ersten Mal“, sagt Mugele. „Es klingt wehmütig, korrespondiert gar mit dem Spruch alter Genossen: Kommunisten sind Tote auf Urlaub.“
„Mag sein“, sagt der Professor, „aber es ist sehr viel älter, stammt noch aus dem 18. Jahrhundert. Mal ist es fort und vergessen, mal taucht es hervor und will gesummt und gesungen sein. Im April 1919 hatte ich nach aufregender Fahrt mit Ludwig Kroeber aus München endlich Moskau erreicht – wir wurden im Kavalerski Korpus untergebracht. Hoch auf den Zinnen des Kreml habe ich das Lied gesungen. Der Abendstern war fern und niemand störte. Wir sollten bedenken und uns daran gewöhnen, wie weit Europa reicht.“
Moskau, ja dort müsste man einmal hin und ganz in Ruhe, denkt Mugele, aber das sagt er Bernhard Ziegler nicht. Der hatte in Moskau auch bittere Stunden erlebt und sich wieder aufgerappelt. „Fallen, das passiert. Zu den wichtigen Erfahrungen in meinem Leben gehört: Aufstehen lernen!“
Ob der Chef mit ihm und seiner Arbeit zufrieden ist, Konstantin weiß es nicht genau. Manchmal lacht er, manchmal stöhnt er auf. So lädt die Prinzipalin des Berliner Ensembles den Professor zu einer der sehr lustigen Flinz-Proben ein, merkt im Brief auch an, sie habe in Zürich ausführlich mit einem Agenten verhandelt – der sieht das erschrockene Gesicht des Sekretarius und lacht. – So hält Mugele dem Professor für die Wahlversammlung der Schriftsteller einen Platz in der Mitte frei, der aber strebt stracks zur Wand. Die Standpauke gibt es hinterher:
„Wenn du einen Saal betrittst, guck als erstes, wo die Türen sind und die Fenster. Begreif doch: Mit dem Rücken immer an die Wand!“ Das ist die Erfahrung des Illegalen, denkt Mugele, und sie leuchtet ein.
Auch ein Papagei ist ungern umstellt. Er sucht einen Platz, der Schutz verspricht. Drum sind runde Käfige völlig ungeeignet. – „In Pankow kenne ich eine Wohnparteigruppe“, sagt Mugele, „in der es nicht schwer fällt, auch betagte Genossen für eine Plakataktion zu gewinnen – aber zu dieser Aktion gehen sie nur nachts. Und im Januar wollen sie ihre LLL-Versammlung haben. Und kriegen sie auch. Und mitten in der Gedenkrede fällt der Strom aus, aber das macht einem LLL-Redner überhaupt nichts, er fährt einfach fort und würdigt sie alle, Lenin, Liebknecht, Luxemburg.“
„Manche Erfahrung der Illegalität“, sagt Ziegler, „ist einfach angeraten in einer Epoche der Klassenkämpfe – oder sind wir da schon raus? Wenn du zum Beispiel unterschreiben musst, sorg, dass der erste Buchstabe missdeutbar bleibt. Schon suchen sie in der falschen Spalte.“
Ach ja, die alten Haudegen, denkt Mugele. Und es ist ihnen ernst. Aber vertrauen sie uns Jungen oder tun sie es nicht? – Mugele fischt aus dem Packen der Tagespost, an den Leiter der Kommission für Erleuchtung gerichtet, eine Anfrage der Chefredaktion des Neuen Deutschland: Ob angesichts der aktuellen Kultursituation und der Kaderschwierigkeiten in der Redaktion die Möglichkeit bestehe, Genossen K. Mugele in absehbarer Zeit für eine feste Mitarbeit freizugeben. – O Gott, gegen dieses Angebot hat er sich schon vor sieben Jahren gewehrt. Immer mal hat er eine Rezension, eine Glosse für das Blatt geschrieben und weiß: Redakteure sind Getriebene, es peitscht sie die Zeit. Wortlos legt er das Schreiben dem Professor vor. Der überfliegt den Text, zieht die Stirn kraus und sagt: „Ja, warum eigentlich nicht? Da haben wir dann einen Mann drin.“ Augenblicke später überlegt er es sich anders. Mugele kommt ins Grübeln: einen Mann drin haben in jenem Zentralorgan, das dem Hohen Haus direkt untersteht … Oje, die alten Genossen, kominternerfahren … Aber Ziegler will ihn nicht hergeben. Da spürt er Vertrauen.
Und du selber, Konstantin? Traust du den Menschen? Oder auch nur dem Papagei? Die Zahl derer, die sich deine Freunde nennen und die dich um Rat fragen, steigt bedenklich. Denk nicht schlecht, von niemandem denk schlecht. Hilf, wenn du kannst. Auf deinen Schicksalsgefährten aber darfst du bauen. Machst du aber nicht, Mugele. Du hast ein Auge drauf, dass er dir nicht fortfliegt. Er darf auf deinem Kopf landen und mit dem Schnabel den Haarschopf kämmen – Ohr und Aug darf er nicht nahekommen, bislang. Mugele, du misstraust.
Beherzt setzt Konstantin den Papagei auf die linke Schulter – weiß er, was er anrichtet? Koko spürt Wohlwollen. Mit seinem Schnabel, der ist durchblutet und warm, streichelt er das Ohrläppchen. Von nun an, links auf Mugeles Schulter sitzend, beschaut ein Papagei die Welt. Jedenfalls die häusliche. Er ist ruhender Pol auf bisher ruheloser Gestalt. Ist jener so gelaufen, der die Eule nach Athen getragen hat?
Bittsteller stellen sich ein: der Demokratische Frauenbund vom Prenzlauer Berg wünscht sich zur Jahreshauptversammlung einen Vortrag zum Thema: Familie und Papagei. Aus dem Erfahrungsschatz eines alten Züchters. – Die Arbeitsgemeinschaft Freie deutsche Reiher der Jungen Pioniere trägt ihm die Ehrenmitgliedschaft an. – In der Uni Jena liegt eine Dissertation eines vietnamesischen Aspiranten an: Das Vogelmotiv in der vietnamesischen und der germanischen Mythologie. Divergenz und Übereinstimmung. Wir bitten Sie um das Außengutachten möglichst bis …
Nein, Mugele lässt sich nicht hinreißen. Er hat auch Sorgen: ringsum, im sandreichsten Revier der Republik – kein Vogelsand aufzutreiben. Die Streuung. Wie soll das weitergehen mit der häuslichen Hygiene ohne den feinen weißen Sand, mit Kalk, Sepia, Anisöl versetzt, Ingredienzien, die Mensch und Papagei gesund erhalten? Rettung erhofft Mugele von der Endmoräne, wie sie die letzte Eiszeit vor 12 000 Jahren im Brandenburgischen zurechtgerieben hat, so die Wanderdüne bei Woltersdorf. Aber ist die keimfrei? Auch überstehen Viren und Mikroben hohe Temperaturen. Er muss ein kräftiges Feuer machen, um den Sand wenigstens bakterienfrei zu kriegen. Hat am Sonntagmorgen, die Leute schlafen noch, im Hof aus alten Ziegeln einen offenen Brennofen gerichtet, setzt eine halb mit Dünensand gefüllte Eisenschüssel drüber. Das Buchenholz lodert – für Koko alles! Mutmaßt schon den Neustart für märkisches Glasbrennen – im Baruther Urstromtal sind sie seit 1716 dabei – da kippt der windige Brennofen in sich zusammen. Reflexhaft greift Mugele nach der Schüssel, schreit auf.
Zwei verbundene Hände sind am Montag nicht lange unter dem Tisch zu verbergen. Professor Ziegler schickt seinen Assistenten mit dem Dienstwagen unverzüglich in jenes Krankenhaus, in dem man auf Schritt und Tritt maladen Staatsdienern begegnet, auch kränklichen Künstlern, Schriftstellern von einiger Berühmtheit. In der Scharnhorststraße mangelt es nicht an erlesenen Ärzten und vorzüglichen Salben. Heute hilft ihm das. Er kehrt noch mal zur Kommission für Erleuchtung zurück, um sich krankzumelden.
„Was hast du Sand zu kochen?“ fragt Ziegler, und Mugele muss die Geschichte vom lebensrettenden Papagei preisgeben. Der Professor zeigt Verständnis. Auch auf diesem Gebiet hat er Kenntnisse. „Schau dir alte persische Poeme an – ohne Papagei geht es da nicht ab. – Gut, dass dich Engpässe nicht genieren“, sagt Ziegler. „Du weißt dir zu helfen. Muss man auch. Im Kaukasus, selbst in Moskau habe ich viel improvisieren, basteln und erfinden müssen. Übrigens: das Sekretariat im Hohen Haus hat eine Dienstreise nach Moskau beschlossen, um die Heimkehr von Kurt Sanderling perfekt zu machen. Den kennst du nicht? Du wirst ihn schätzen lernen. Sanderling ist ein großer Künstler, vormals Chefdirigent des Symphonieorchesters von Charkow, war 18 Jahre lang, bis heute, der zweite Mann am Dirigentenpult in Leningrad. Wir brauchen ihn dringend. Und du kommst mit mir. Beeil dich mit den Brandwunden. Es geht nicht an, dass du Moskau nur aus der Perspektive deines russischen Teeschaffners kennst. Moskau – dort schlägt das Herz der Welt. So, und nun schnell nach Hause mit dir. Und gründlich ausheilen. In zehn Tagen geht’s los. Inzwischen erkunde, welches Konzept die sowjetische Kulturministerin verfolgt, ackere die Rede vom Parteitag durch. Ich bin gespannt, was dir auffällt. Ist alles übersetzt. Ich schicke es dir morgen. Vor allem: Gute Besserung. Und nun greife nicht mehr. Begreife!“
Professor Ziegler und Mugele, mit Diplomatenpässen ausgestattet, steigen in die Maschine der Interflug. Sie werden zum VIP-Bereich geführt. Der Begleiter nimmt draußen seinen Platz ein. Zur Begrüßung wird Sekt gereicht. Ab geht’s nach Moskau-Scheremetjewo von Schönefeld her, dem von FDJ-Brigaden erbauten Rollfeld der Hauptstadt, der Dichter Karl Mickel damals dabei. Professor Ziegler greift nach der Frankfurter Allgemeinen, streicht sich was im Leitartikel an, sagt: „Der Flüchtlingsstrom nach Marienfelde beginnt ihnen lästig zu werden, für uns aber ist er fatal. Was suchen diese Leute, und zunehmend sind es Bauern, in dem bigotten Adenauerstaat?“ – Fragt, ohne eine Antwort abzuwarten: „Und wie war die Lektüre der Furzewa-Rede?“
„Chruschtschows Kulturministerin spricht einschläfernd, Genosse Ziegler, richtig trocken. Statistik, Statistik ihr ein und alles. Widersprüche sieht sie nicht. Also Probleme – kaum erkennbar.“
„Ich weiß. Dabei gibt es im sowjetischen Vielvölkerstaat und seinen Kulturen Probleme übergenug. Unsere Bruderpartei geht die Dinge eher pragmatisch an. Uns Deutschen, das wusste schon der alte Heine, liegt mehr das Grübeln und Philosophieren. Für morgen ist ein Besuch bei ihr im Ministerium verabredet.“ – Die Stewardess füllt den Sekt nach und bietet Kaffee und ein Frühstück an.
Hoch in den Lüften ist Zeit für ein ungestörtes Gespräch. Das geht von neuen Büchern in Frankreich und Italien bis zu Chancen der Skelettbauweise und wie man die Eintönigkeit neu erbauter Stadtviertel aufbrechen könnte. Was leistet eine gute Übersetzung und was kann sie nicht? „Schon ein einziges Wort deutsch dem ausländischen Pendant zugesellt, bietet Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung“, sagt der Professor und legt für einen Augenblick beide Handflächen zueinander, ehe er die Daumenballen gegenläufig leicht dreht. „Chleb – Brot“, sagt er, „das scheint identisch. Ein Russe aber hört zugleich Getreide. Das bietet Raum für Missverständnisse. Es ist doch ein Unterschied, ob ich aus der Periode des Kriegskommunismus berichte, den Kulaken wurde das Brot weggenommen oder die Getreidevorräte wurden beschlagnahmt?“ So kommen heikle Dinge zur Sprache. „Sag bitte, Genosse Bernhard, wie konnte es in unserer Bewegung zu solch verhängnisvollem Beschluss kommen wie dem Verdikt über die Sozialdemokratie als Hauptfeind?“
„Die Untaten der Noske und Zörrgiebel sind unbestreitbar, dennoch war dieser Beschluss sektiererisch. Er traf auf eine aus Erfahrung gespeiste Grundstimmung in der Arbeiterklasse. Ich nehme ein Beispiel: Ein Fabrikarbeiter, er muss nicht Kommunist sein, wehrt sich gegen die Kürzung seines Lohns, die Betriebsleitung entlässt den Mann, der den Arbeitsfrieden gestört hat. Der Betriebsrat stimmt zu – ein Sozialdemokrat. Der Arbeitslose geht auf die Straße und empört sich, der Polizist zieht ihm den Gummiknüppel über und nimmt ihn hopp – ein Sozialdemokrat. Ein Richter verknackt ihn. Wer schließt den Gefangenen ein? – Doch der Beschluss war grundfalsch.“ – Das Flugzeug verliert an Höhe. Im Landeanflug liegt Moskau. Dort wurde der Beschluss gefasst.
Denkt Mugele an die Dienstreise im Frühsommer 60, Reise im Schatten des Professors, sieht er draußen eine quirlige besonnte Stadt. In den Sälen geht es gedämpft zu. Professor Ziegler beabsichtigt, seinem Mitarbeiter den Stadtkern zu zeigen, wenn das offizielle Programm absolviert ist. Schwanensee im Bolschoi ist die Vorspeise. In seiner Erinnerung sieht Mugele eine energische, elegante Blondine auf Ziegler und ihn zutreten, rund fünfzig Jahre alt, Ministerin Furzewa. Eine mächtige Frau, die einzige in dem von Männern okkupierten Präsidium des ZK der KPDSU. Und Sekretär des ZK ist sie auch. Die deutschen Gäste bittet sie an einen grün betuchten Arbeitstisch. „Jekaterina Alexejewna“, sagt Professor Ziegler auf Russisch, „im Namen unserer Parteiführung und der Regierung möchte ich Genossen Chruschtschow und der KPdSU nochmals für das Verständnis und alle Unterstützung danken: Kurt Sanderling kehrt nach 24jähriger Emigration in sein Heimatland zurück und wird dort eine bedeutende Aufgabe übernehmen.“ – „Das geht schon in Ordnung“, sagt die Ministerin, was Mugele noch grad versteht. Und kein Wort mehr über Kultur, was Mugele nicht versteht. Vielmehr parlieren die Zwei über platte Politik, über die ansteigende Zahl der Flüchtlinge von Ost nach West. Und Ziegler zieht die FAZ aus der Tasche und gestikuliert heftig mit der Zeitung in der Hand.
Die Begegnung mit Kurt Sanderling war und bleibt für Mugele der Lichtpunkt, wiewohl sie im sterilen Ambiente eines Gästehauses stattfindet. Dumpfes Licht, das ist vornehm, tröpfelt durch Vorhänge. Kurt Sanderling ist gut aufgelegt und konzentriert zugleich. Sendbote und Dirigent umarmen sich mit russischer Herzlichkeit. Sanderling steht am Wendepunkt zweier Lebensepochen, das ist aufregend. Aber der Emissär macht es ihm leicht, nennt die Freude, die seine Zusage in Berlin geweckt habe, auch bei ihm, Ziegler. Die Entscheidung, das Pult in Leningrad aufzugeben, sei weitsichtig, sagt er. Ein Deutscher, so gut er sei, werde dort nie die erste Geige spielen. Und fragt nach den Wünschen und Erwartungen des Übersiedlers für sich und die Familie … Das alte Pankow sei eine angenehme Vorstadt. Vielleicht werden wir Nachbarn? – Es läge eine Einladung zu einem Gastdirigat beim London Philharmonic Orchestra vor, sagt Sanderling, solle er zusagen? – „Dagegen spricht nichts“, meint Ziegler, „aber antworten Sie besser nach der Übersiedlung, vom neuen Wohnsitz her.“
Mugele blickt fasziniert in das belebte Gesicht des Dirigenten. Er freut sich schon auf dessen erstes Berliner Konzert, möglicherweise ist eine Schostakowitsch-Symphonie dabei. – Zieglers Frage, ob Sanderling Wünsche gegenüber dem in Aussicht genommenen Berliner Sinfonieorchester hege, beantwortet der bescheiden: „Ich freue mich auf alle, die dort musizieren. Wir wollen von unten auf miteinander arbeiten.“ Das berührt Mugele sehr.
Der Gang durch Moskaus zentrale Straßen und Plätze an der Seite des Einheimischen ist ein Kontrastprogramm. Kreml und Roter Platz, das Denkmal für Majakowski, die alten Sperlingsberge längs über der Stadt mit der Lomonosssow-Universität – Mugele kann nicht genug davon gezeigt und erläutert bekommen. Auch dem jungen Begleiter vom Personenschutz macht der Stadtgang Spaß. Mugele zückt seinen recht primitiven Fotoapparat und schießt Bild um Bild, bis der Professor anmerkt: „Das alles ist oft und schon viel besser fotografiert worden, als dir das möglich ist. Die Menschen musst du sehen – ihnen musst du ins Gesicht blicken.“
Zu Dritt gelangen sie zu einer vormalig orthodoxen Kirche, die durch Umwidmung zur Bibliographischen Abteilung der Staatsbibliothek für Auslandsliteratur dem Zerstörungswahn früher Sowjetjahre entging. Hier, im Refugium seiner einstigen Strafversetzung, begrüßt Frau Margarita Rudomirowa, die Leiterin, den Professor aufs Herzlichste. Ein guter Tee wird gebrüht, Erinnerungen flattern herüber und zurück. Und Mugele entgeht nicht der Stolz, mit dem die Direktorin auf den Mann blickt, der ihr 1935 heikel als Mitarbeiter zugeteilt ward.
Später verabschiedet sich Bernhard Ziegler von den zwei jungen Wegbegleitern, um seine vormalige Gattin, eine Russin, zu besuchen. Dorthin müssen Mugele und die Sicherheit nun wirklich nicht folgen.
Frau und Kinder sollen ein Mitbringsel aus Moskau erhalten. Die Zwei machen sich auf ins GUM. Und was entdeckt Konstantin? Ein wunderschöner großer Papageienkäfig, Made in GDR, blitzt auf. Wie würde der Chinapapagei sich wohlfühlen, wenn er sich, nach des Tages Schabernack, da rein zur Nacht zurückziehen könnte! Und grad dieses Exportgut aus der Heimat kann er, Greenhorn in der Kommission für Erleuchtung, dem Vaterland aller Werktätigen nicht entziehen, wiewohl er ahnt, was Diplomaten der Welt im Dienstgepäck so alles fortschleppen.
Und wie leben die Papageien in der Hauptstadt der Sowjetunion? Mugele zieht es mit Macht in den Zoologischen Garten. Er wird dort nicht glücklich, verfehlt auch die Papageien. Ein alter Zoo. Gewiss, der russische Bär, er hungert nicht, aber hier fehlt ihm Hagenbeck’sche Freiheit.
Die Familie daheim erhält einen Beutel Pralinen aus der Schokoladenfabrik Rot Front. Auch Koko freut sich über die Rückkehr Konstantins, zuspelt am Ohr, guckt als frage er: Hast du auch mir was mitgebracht? Das sind Augenblicke, in denen Konstantin eine strapazierte Moskauer Auskunft in Zweifel zieht – denn Papageien sind den Menschen viel näher, als diese meinen.
Solche Exkursionen gehen zulasten Isas. Auch Peter und der Papagei leiden. Und immer dann fallen Entscheidungen, die Isa treffen und ausbaden muss. Kurz: der Möbelwagen ist schon bestellt, das fertig gebaute Genossenschaftshaus muss bezogen werden. Die beiden Kinder sind für einen Tag bei den Großeltern. Dass auch der Papagei von der Hektik des Räumens möglichst verschont bleibe, stellt ihn Konstantin mit dem Käfig auf den Kachelofen. Die Transportarbeiter klettern fluchend die hohen Stufen der engen Hinterhaustreppe empor und beruhigen sich ein wenig, als sie die Teller mit dem kräftigen Frühstück und auf dem Ofen den schönen Vogel erblicken. Fünf Mann haben plötzlich Zeit, klettern nacheinander auf einen Schemel und suchen dem klugen Tier ein paar dumme Wörter beizubringen. So kommt man ins Gespräch. Und dann flutscht es. Den Vogel aber unterschätzen alle, auch Konstantin. Als die Bude schließlich leer geräumt und gefegt, auch die peinliche Frage schroff beantwortet ist, ob Mugele ‚die olle dicke Bibel‘ noch brauche, als fast alle unter der Platane zur Abfahrt nach Wilhelmsruh versammelt sind, werden die Möbelräumer nun doch unruhig. Zeit ist Geld! – Der Papagei muss noch geholt werden. Doch den Vogel haben die ungewohnte Geschäftigkeit, danach die Leere und absolute Stille so verstört, dass er sich mit übergroßer Anstrengung durch die Käfigstäbe gezwängt hat. Nun will er sich nicht mehr einfangen lassen. Unten hupen die bibelfrommen Möbelfahrer, und man kann nicht einmal das Fenster aufreißen und hinunterschreien: „Geduld, ich werde den Bager schon kriegen.“
O Glück des Einziehens. Du hast eine neue Wohnung, hast sie mit erbaut! Wohnst im ersten Stock. Fontanestraße. Das Haus duftet nach Kalk und Ziegelstein. Trockenwohnen – lang aus der Mode. Du wohnst trocken. Anno 61 freust du dich, die ersehnte Bleibe auszugestalten. Wenn das Bohren und Hämmern ein Ende findet, wird jeder seine Ruhe haben wollen. Aber der Papagei wird durch die dünnen Wände zu hören sein. Augenblicklich ist er unerträglich, kreischt metallen auf, wenn nur in einer der Wohnungen gehämmert oder gebohrt wird. Was tun? – Renate krabbelt um die vollen Bücherkisten. Für maßgerechte Regale muss rasch ein Tischler gefunden werden. In der Nähe gibt es einen tüchtigen Altmeister, ortsbekannt ob seines Könnens und seiner Preise. Der Meister kommt, vermisst die Wände. Mitleidig betrachtet er die Tür des Kleiderschranks, die nur mit Hilfe eines eingeklemmten Stück Leders geschlossen bleibt, murmelt „russischer Verschluss“. – „Bei Gagarin im Weltraum haben sie‘s auch so gemacht“, höhnt Mugele, besinnt sich aber: Im Bauern-und-Handwerker-Staat sei lieb zu deinem Tischler.
Nein, Kindergeschrei wird im Haus nicht zum Problem werden. Die Einziehenden – manche haben zwei und mehr Kinder oder erwarten eins. Peter wird bald Freunde finden. Schon erkundet er das Terrain rundum und sucht nach der Schule. Dort wird er zum Herbstbeginn die Zuckertüte überreicht bekommen. „In der Schule ganz oben nisten Adler“, berichtet er aufgeregt. So ganz stimmt das nicht. Aber brütende Falken, wie sich erweist, im Giebel einer Zehnklassigen Polytechnischen Oberschule – das ist schon was.
Die Hausversammlung im Freien verspricht Gutes, obwohl oder weil der Antrag auf Umwandlung der Wüstung hinter dem Neubau in einen Parkplatz zugunsten eines Kinderspielplatzes abgeschmettert wird. Mugele nutzt die gute Laune der Runde und lädt die Versammelten zum Umtrunk beim chinesischen Papagei ein. Das hast du dem Ziegler abgeguckt, gesteht er sich: Den Stier bei den Hörnern packen! Erst neulich hat der, als heftig um die Nachtschicht gestritten wurde, einer Gruppe von Stahlwerkern in Hennigsdorf geraten: „Eure Frauen verstehen das nicht? Verfluchen das Werk und euch, wenn ihr morgens müde heimkommt? Ladet sie doch, mit aller Vorsicht, mal ein zu einem Abstich. Was meint ihr, wie das Eindruck macht! Sie werden stolz auf euch sein, jedenfalls werden eure Frauen euch besser verstehen.“ Und der Parteisekretär stimmt dem Gast aus dem Hohen Haus zu, natürlich stimmt er zu, der Betriebsleiter nickt und meint: „Wir können es mal versuchen.“
Und die Mitbewohner in der Fontanestraße 40 greifen sich eine Stulle mit Zwiebelschmalz, langen nach einem Gläschen Nordhäuser Korn, die Frauen nach Kirschlikör. Wie von allein gruppieren sie sich um den Papagei. „Also“, sagt Mugele, „seid willkommen beim größten Schreihals des Wohnblocks – Koko. Ich frage mich, ob ihr den grünen Chinesen aushalten werdet, den Lebensretter? (Zustimmung rundum.) Details erzähle ich ein andermal. Zum Wohl. Auf gute Nachbarschaft.“ Die Gläser klirren und es sieht so aus, als ob es wegen des Papageien niemals Ärger geben könnte. Der aber kommt schneller als gedacht.
Zwei Urlaubswochen am Ruppiner See stehen an. Die Mugeles überlegen, wem die Ehre angetragen werden kann, einen Lebensretter zu betreuen. Auf gut Glück entscheiden sie sich für das Ehepaar im Erdgeschoss, ruhige Leute mit zwei netten Mädchen, ermahnen die Familie auch, den Vogel nicht aus dem Käfig zu nehmen und frei fliegen zu lassen.
Die Atempause im Ruppiner Land tut gut. Vorsommer in Gildenhall. Es lockt der See. Klar konturiert die Liebesinsel. Daran rudert die Familie vorbei, zu genau erinnert sich Konstantin der insularen Mückenschwärme manchen Kindertages. Alt-Ruppin ist das Ziel. Guten Tag, lieber Rhin mit deinen lauschigen Angelplätzen.
Viel zu rasch geht es nach Berlin zurück. Die Familie parterre links ist verstört. Koko hat Schaden angerichtet: neun Büchern hat er den Rücken heruntergerissen und mit der scharfen Schnabelspitze nicht wenige Buchseiten gelocht - in Kügelgens Lebenserinnerungen eines alten Mannes, in zwei Bänden Brehms Tierleben, im Gedichtband Terzinen des Herzens und bei fünf weiteren Kostbarkeiten. „Regle du das, Konstantin“, sagt Isa, „es ist peinlich.“
Tatsächlich ist die Aufregung groß und legt sich erst, als die Tante von der Versicherung, sie wohnt in der Nachbarschaft, den Schaden in Augenschein nimmt. Mugele erläutert: „Hier, im Haushalt der Nachbarn, hat dieser Papagei ohne unseren Auftrag und unser Wissen Schaden angerichtet; Bücherschaden – die Zeugen sind anwesend.“ Flüchtig blättert die Frau in der Kladde mit den Vorschriften und entscheidet: „Die Pflegefamilie ist durch Sie rechtzeitig gewarnt worden. Für so viel Unachtsamkeit können wir nicht aufkommen, leider.“
Die zwei Mädchen stehen bedrippt. Mugele erbost sich: „Gute Frau, wissen Sie eigentlich, wen Sie da vor sich haben? Der Verursacher ist eindeutig Lord Derbys Edelsittich, aber Geld besitzt er nicht.“
„Das entscheiden wir ohne Ansehen der Person“, sagt die Versicherungsdame. Konstantin, die Police aus der Haftpflichtakte zottelnd, entgegnet: „Wegen dieses Papageien sind wir in Ihrer Versicherung, freilich egal aus welchem Geblüt. Wir kündigen, wir kündigen sofort.“
„Nun beruhigen Sie sich doch, Herr Mugele“, begütigt die Beauftragte der Deutschen Versicherungs-Anstalt. Sie entnimmt ihrer Tasche ein Formular. „Fülln se mal erst aus“, sagt sie, „vielleicht lässt sich wat machen.“
„Vielleicht, vielleicht!“ Missmutig nimmt Mugele das Blatt und beginnt auszufüllen, wobei sich seine Laune rasch bessert. Der Text ist logisch und verständlich – wann, wo, was (notfalls mit Beiblatt), Zeugen, voraussichtliche Schadenshöhe? „Schadenshöhe weiß ich nicht“, sagt Mugele. „Die Bücher müssen zum Binder. Die Terzinen des Herzens, Sie sehn es selbst, sind so durchlöchert, da hilft nur Schmerzensgeld.“ Zuletzt ist noch eine kniffliche Frage zu beantworten: Was wurde getan, damit der Vorgang sich nicht wiederholt? Die Versicherungsvertreterin, inzwischen hat sie sich neben Mugele gesetzt, guckt gespannt. Sie hat im Rahmen zweier interner Maßgaben zu agieren: 1. Abwimmeln zugunsten des Volksvermögens, aber keine Kunden vergraulen. 2. Sind die Fragen glaubhaft beantwortet, großzügig sein bei Lappalien. – Ja, was wurde getan, damit sich … Mugele trägt ein: Der Papagei wurde belehrt. – Die Firma ist es zufrieden und – zahlt.
Im Sozialismus ist niemand zufrieden, wenn er belehrt werden soll, und schon gar nicht, wenn sich die Königsebene betut. Auch sind grübelnde, gar philosophierende Parteiführer was Rares im Land. Da fällt Ziegler im Kreis der Pragmatiker auf. Auch in der überraschend angesetzten Diskussionsrunde des Sekretariats – diesmal ohne Thema und in erweitertem Kreis, die notorischen Raucher seitlich unter einer absaugenden Deckung versammelt – stört er mit seinen stolpernd vorgetragenen Thesen zu den Intentionen des jungen Marx. Es gibt Geraune, sodass der Vorsitzende Ulbricht mit einem Stift auf die Tischplatte klopft und Aufmerksamkeit verlangt. „Jeder Genosse hat das Recht, seine Überlegungen vorzutragen.“ Gemeint sind die Könige im Hohen Haus, es sind ja die Unterkönige. Sie kommen aus Bereichen wie Ökonomie, Landwirtschaft, Außenpolitik, mächtige Herrscher mit Hinterland. Die Künste haben, in den Augen der Unterkönige, ein schier ewiges Schicksal: sie bleiben zurück. Und die Zeitungen schreiben es so. Dabei hätten doch gerade die Künste voran zu preschen und Anstöße zu geben. Nein, sie stören nur und sind anstößig. Daran haben Dispute und Konferenzen, zumal die in den Chemieschwaden von Bitterfeld erfolgten, auch die Disziplinierungsversuche danach, nichts ändern können. Die Irrungen, die Missverständnisse wachsen.
Mugele geniert sich wegen des offen bekundeten Desinteresses, das schon beleidigend ist. Nach dem so ergebnislos verlaufenen Disput sagt Professor Ziegler. „Konstantin, es ist nicht so wie es ist.“ – Merkwürdiges Trostwort. Noch zu Haus geht es Mugele durch den Kopf. Wie sollte es anders sein als es ist?
Koko ist ihm zur Begrüßung auf die Schulter geflogen und will gekrault sein, heute ein wenig nur. Schon hört er auf, zärtlich zu sein. Mugele verweist ihn auf seine Schaukel. In Wirtschaft und im Militärwesen, überlegt Mugele, bei Staat und Recht, bei der Industrie, selbst im Sport, überall sind Fachleute gefordert – bei Künsten und Kulturpolitik? Jeder der Mächtigen redet mit, das ist schon in Ordnung. Aber jeder entscheidet auch, freilich nach persönlichem Geschmack, ob ein pikanter sowjetischer Spielfilm, der im ganzen Land läuft, auch in Leipzig gezeigt wird, oder was sich zu Bernau ein Leierkastenmann herausnimmt, auf seiner Drehorgel abzunudeln. Nun Kommission, erleuchte mal. Dabei kann sich der Kommissionsleiter nicht von den eigenen Prägungen freimachen.
Die Theoretiker in der Hauptstadt empfehlen den Autoren plötzlich, sich die Sicht der Königsebene zu erarbeiten. War bislang der Blick von unten gefragt, ja gefordert, zu gestalten, was die Künstler an der Basis, in Betrieben und Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gesehen und erlebt hatten, war nun mit den neuen Werken, die zu Tage traten, ob der Genauigkeit der Spiegelung der Schrecken groß. Selbst der Dichter KuBa wird wegen seines Theaterstücks Bauernkantate angezählt: er liebe die Bauern nicht. Das behauptet Genosse Ernst Wulf, Vorsitzender einer mecklenburgischen Muster-LPG. Er sagt es auf dem ZK-Plenum, das den Bauernkongress bewertet. Das lässt der dickköpfige Dichter nicht auf sich sitzen, und reicht dem Muster-LPG-Vorsitzenden sein Skript:
„Da, lies erst mal und streich an, womit du deine Behauptung begründen könntest.“ Und vor dem Gremium verlangt er eine Analyse des Stücks, und die wird ihm zugesagt. Aber die versammelten Funktionäre, obwohl manche von ihnen die Bauernkantate in Rostock-Marienehe gesehen hatten, können sie ihm nicht bieten. Der inkommodierte Schriftstellerverband vermag es auch nicht, selbst die unglücklich bemühte Akademie der Künste kommt mit dem Stück nicht zurande, findet zu keiner Verurteilung, und eine Analyse hat sie auch nicht. Und ging es überhaupt um Liebe? – Ein Dichter hat seinen Zeitgenossen den Spiegel vors Gesicht gehalten! Nun soll die Kommission für Erleuchtung den Fall abschließen. Der Vorsitzende lädt die berufenen Kommissionsmitglieder erst gar nicht ein, sondern nimmt die Angelegenheit selbst in die Hand, stößt aber auf beharrlichen Widerspruch des Dramatikers. Besessen, wie Shylock sein Pfund Fleisch verlangt, fordert der: „Versprochen ist eine Analyse des Stücks. Ich will die Analyse haben.“ Lautstark. Bis der Professor entnervt resümiert: „Jedes Ding muss doch ein Ende finden, Genosse KuBa. Man muss auch mal eine Kröte runterschlucken.“
„Wenn du das kannst, Kröten schlucken“, sagt der, „dann schluck. Ich kann es nicht.“
Männerstolz vor Königsthronen? Konstantin ist es von KuBa gewohnt. Und er bewundert ihn. Er selber – ein Lernender. Aufmerksam genug? Gut zwei Jahre ist er jetzt beim Ziegler. Den Professor sieht er kritischer als zuvor.
Der Alte macht aber auch Fehler. Statt angesichts der notorisch geist- und literaturfeindlichen Attacken der Adenauer, von Brentano und Erhard gegen die Schriftsteller eine Bresche für mehr Libertät, mehr Experimentierfreude einzufordern, kommt er dem versammelten Sekretariat mit Marxens Philosophisch-Ökonomischen Manuskripten. Die hat der geschrieben, so was weiß man doch, da war Marx noch gar nicht Marxist.
Der Alte gilt als einfühlsam, wenn er mit jungen Schriftstellern über deren Manuskript disputiert, denkt Mugele, aber wenn er dabei auf eine Textstelle trifft, die er als feindlich empfindet, wird er urplötzlich kiesig. „Du bist verantwortlich für das, was aus dir herausquillt.“ Er beginnt also, mit Fritzing Reuter gesagt, herut zu untersäuken. „Wie kommt so was in deine Feder? In dir muss es doch stecken, wie käme es sonst heraus?“ Und das sagt einer, der frei spricht, anregende Gedanken vorbringt und manchmal Hanebüchenes.
Statt mit dem Werk des viel zu früh verstorbenen Bertolt Brecht zu wuchern, der sich als kommunistischer Künstler die DDR erwählt hatte, um gegen die Alte Welt anzutreten, und nicht eben ein bürgerlich-antifaschistischer Mitstreiter war, verhält sich Ziegler wie alle Moskowiter in der Parteiführung, zaudernd. Aber wie Brecht ist Ziegler der Meinung, dass die Bibel in den Schulstoff gehört. Und ganz praktisch: Die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden – spar sie dir, wenn du keine Ahnung vom Alten Testament hast. Mugele hat Ahnung. Das mit der Bibel plaudert Konstantin, da ist er gern Papagei, bei den jungen Dichtern aus.
Was zwischen den Kontrahenten an Ressentiments lief – da bist du zu jung zu, Mugele, das kriegst du nicht raus. Und überhaupt ist 1961 ein Jahr, da weiß niemand so recht, was die Weltgeschichte bereithält - Jahr des Eisenbüffels. In einer Kapsel umkreist der erste Mensch den Erdball, die Vereinigten Staaten zeigen sich tief getroffen. Im Fernsehen: Eichmann im Glaskasten. Hat immer nur seine Pflicht getan. Die Chruschtschow-Note zur Entmilitarisierung Westberlins mahnt an, bis Weihnachten solle der Hort der Freiheit Freie Stadt werden, ohne Geheimdienste, ohne Besatzer. Die Welt schreckt auf. Es kommt keine Ruhe in den Sommer, wiewohl alles läuft, wie es läuft.
Am Müggelsee gibt es ein kleines Sommerfest. Professor Ziegler ist entspannt und fröhlich. Die Urlaubsreise in den Kaukasus ist unter Dach und Fach, beschlossen also. Arme Personenschützer, an den Bergen wird euch der Alte davonklettern. In heiterer Laune auch Otto Gotsche, Sekretär Walter Ulbrichts, schlendert am Tisch Zieglers entlang und sagt: „Bernhard, ich glaube, dass du zeitlebens ein Wandervogel geblieben bist.“
Wieder ein Sonnabendnachmittag. Vom Hohen Haus fährt ein Bus mit den Abteilungsleitern in den Niederbarnim. Es wird kein Ausflug in die Sommerfrische. Am südlichen Eingang der Gemeinde Basdorf biegt der Bus in das Objekt der Kasernierten Bereitschaftspolizei ein. Der Kommandeur wartet schon am Eingang. Er führt die Gäste in die Problematik ein: Schnell mit voller Kampfstärke das Objekt verlassen und Kampfpositionen einnehmen. Er zieht die Stoppuhr, löst Alarm aus. Ein gemächlicher Tag bricht weg, wird Geschrei, Geknatter und Rauch. Mögen einstmals Ritter, Knappen und Knechte bei Gefahr zur Burg gestürzt sein – hier eilen bewaffnete Männer, sich hastig den Rock knöpfend, zu Schützenpanzern und Mannschaftswagen, um aufs Rascheste die Burg zu verlassen. Motoren heulen auf. In einer Staubwolke verschwindet ein Bataillon. Der Kommandeur blickt auf die Stoppuhr: „Sechs Minuten. Das geht“, verkündet er stolz. Es gibt nachdenkliche Gesichter. Mugele denkt sich nichts Böses, hat sich den versauten Nachmittag auch nicht gewünscht, fragt also: „Genosse Kommandeur, was kostet der Probealarm?“
Der Offizier, den Unwillen einiger nicht beachtend, antwortet er doch dem Hohen Haus, rechnet, überschlägt die Einzelposten, sagt: „Die heutige Übung kostet etwa 26 000 Mark der Deutschen Notenbank.“ Nun sind es alle zufrieden. Konstantin versteht nicht.
Auch Irene D., eine Freundin, ist verwundert. Sie ist Slawistikstudentin an der Humboldt-Universität. Hat ein Praktikum am Frauensee in der Dubrow, 30 Kilometer südlich von Berlin. Ein Ferienlager ist zu betreuen mit deutschen Kindern, mit russischen Kindern aus den Waldsiedlungen in der Sperrzone. Deutsche und russische Kinder kommen bald gut miteinander aus, spielen, singen, tanzen. Die schön gebundenen Haarschleifen der russischen Mädchen werden bewundert und stören nicht, nur beim Baden. Alle tummeln sich, an 14 Tage ist gedacht, am Strand des Frauensees. Wo es Verständigungsschwierigkeit gibt – Irene behebt sie. Zum Mittagessen verlangen die russischen Jungpioniere Chleb – und die Küchenfrauen, den Brauch nicht gewohnt, schaffen Brot herbei und schneiden es zurecht. Soll ein wunderschöner Kindersommer werden. Bis eine russische Offiziersfrau im Wolga vorgefahren kommt, um ihren Pjotr in einer Familienangelegenheit aus dem Lager zu holen. Da hilft kein Gezeter des Jungen. Eine andere Offiziersfrau eilt auf dem Fahrrad herbei, Jewgenia müsse ihr nun doch im Garten helfen. Hilft keine Träne. Eine dritte, vierte russische Mutter, mal ein Vater in Hauptmannsuniform, verlangen ihr Kind zurück, bedanken sich artig und murmeln irgendwas. Binnen zweier Tage leert sich der russische Part des deutsch-sowjetischen Ferienlagers. Irene versteht nicht.
Professor Ziegler verabschiedet sich in den Kaukasus. Er beauftragt Mugele, die DDR-Anden-Feuerland-Expedition, wenn erforderlich, zu unterstützen, eine Berliner Bergsteigergruppe, demnächst mit einem nagelneuen S 4000 und anderem Testgerät unterwegs. Für den Brockhaus Verlag solle ein Chileporträt entstehen – dafür fahre der Schriftsteller Fritz Rudolph mit; der Laster und die übrigen DDR-Geräte sollen sich im tropischen und im Hochgebirgsklima der Anden bewähren. Man werde in Südamerika, Ziegler schmunzelt, auch etwas über unser Land erfahren. Die Schiffsreise beginne vom Hafen Gdynia. Leiter der Seilschaft sei Percy Stulz, Historiker, nebenbei der künftige Schwiegersohn des Außenministers. Das Patronat habe der Kulturbund. „Aber man weiß ja nicht, wie es kommt …“, sagt Ziegler.
Ach, der Percy, ein großer, blonder, hochbegabter Bursche. Dem ist Mugele im September 48 vor einer riesigen Tafel in der Alma mater erstmals begegnet, auf der die Professoren der wieder eröffneten Berliner Universität und ihre Vorlesungen verzeichnet waren, nach Fakultäten geordnet. Und was machen die zwei Neulinge? Sie stehen und rätseln und suchen aus dem riesigen Angebot traditionell-bürgerlicher Gelehrsamkeit die zwei Handvoll marxistischer Lehrer herauszufischen, die sich an Marxens alter Uni mit der neuen Denkmethode auskennen. Die wollen sie von den alten Hasen abkupfern und dann dreist auf die Wissenschaften losgehen. Ja, unter Hunderten braver Leute lass es ein Dutzend marxistischer Gelehrter sein – das war damals die kommunistische Humboldt-Universität in Ostberlin.
Nun aber, seit den frühen Morgenstunden, läuft ein kommunistisches Bubenstück. Und keiner will’s gewusst haben. Macmillan, der britische Premier, unterbricht nicht einmal die sonntägliche Jagd. Kennedy sieht den status quo nicht gefährdet. Er kalkuliert kühl: Better a wall than a war. In Jeeps werden die Späher an die Grenze der Westsektoren geschickt. US-Soldaten fotografieren von West nach Ost, wie bewaffnete Arbeiter, Kampfgruppen genannt, presumebly Germans, Drahtbündel ausrollen und, von Soldaten unterstützt, ihre Grenze befestigen. Die Jeeps fahren unkontrolliert durch die ihnen zugewiesenen Übergänge in den Soviet sector und knipsen Gleiches von Ost nach West. Sie finden keinen Gesprächspartner. Sowjetische Truppen – nicht zu erblicken. Das macht die Niederlage noch bitterer. Die Vereinigten Staaten schicken eine Protestnote an N.S. Chruschtschow, aber die Aufhebung der getroffenen Entscheidung des Warschauer Pakts wird gar nicht erst gefordert. Maurer, auch Soldaten mit Ziegeln und Mörteleimern, errichten eine Mauer.
Von der Schließung der Grenze erfährt Mugele am Sonntagmorgen aus dem Radio. Es wird ein warmer, sonniger Tag werden. „Mit dir, mein grüner Papagei, hat das alles nichts zu tun. Hier, nimm Nüsse und Kerne, solange wir sie haben.“ Mugele macht eine Katzenwäsche, greift sich eine Schrippe und fährt ins Hohe Haus. Unterwegs: nachdenkliche Leute, Menschen, die ein Na endlich! bekunden, andere wütend und gereizt. Lebensplanungen zerstieben.
Ein Sonntag also im Hohen Haus, und alle sind da. Nur ein paar Angler fehlen. Eine kurze Absprache. Planungsstäbe entstehen, Verantwortliche der Ministerien treffen ein. Was wird heute gebraucht, was morgen und danach? – Viel und von allem! Mehl und Brot, Fleisch, auch Zucker. (Die Bruderländer springen ein.) Und Opernsänger. (Der Minister für Kultur ordnet an, das vorzüglich ausgebildete Nationale Dorfensemble zweckgebunden aufzulösen.) Überhaupt, über Nacht wird alles verlangt sein, auch Arbeitsplätze für Hunderttausende Grenzgänger. (Was macht man mit Kommerzialräten?) Konstantin fällt der Papagei ein, wiewohl man sich in seinem Fall durchaus ein paar Wochen behelfen kann. Aber wie steht es um die Wellensittiche? Berliner sind ein tierliebendes Volk. Was knapp war oder fehlte, holte der gemeine Mann aus Quelle West. Konstantin eilt zu den Wirtschaftsleuten, spricht von den Wellensittichen. „Bist du wahnwitzig, Genosse Mugele, siehst du nicht, was hier los ist?“ – „Ich sehe es genau“, sagt der, „ihr wollt uns vierhunderttausend Berliner zum Feind machen …“ (Der Kaufauftrag nach Syrien – Hirse, wird aufgestockt und vorverlegt.) Mit dem Wellensittich, Konstantin, da hast du deine Königsebene.
Mugele jubelt nicht, Mugele trauert nicht. Er liest die eingehenden Nachrichten: schroff ablehnende, wägende, skurrile. Er wird sie alle vergessen, vielleicht die eine nicht, weil sie so fern aller Wirklichkeit erscheint:
Der Chef einer Kleiderfabrik in Westberlin wandte sich an die eine, ihm bekannte kommunistische Arbeiterin im Werk: Was machen wir, wenn die Russen kommen? – Sie dachte einen Moment nach und schlug vor: Dann nennen wir uns VEB Rote Nadel.
(Auszug aus „Konstantin Mugele erzählt“, Erstmals veröffentlicht 2013, HeRaS Verlag, Göttingen)
Redefin, Kutschfahrt für Rentner, 1986
Berlin, 1. Mai 1960
Karl-Marx-Stadt, Dienstleistungskombinat 1975