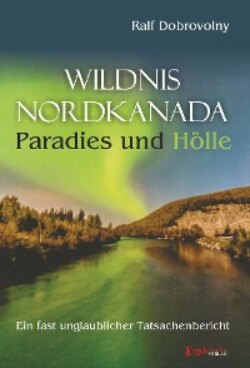Читать книгу Wildnis Nordkanada - Paradies und Hölle - Ralf Dobrovolny - Страница 9
Der Busch
ОглавлениеUm etwas besser zu verstehen, in welcher kanadischen Region der Hauptteil dieses Buches handelt, sollen einige Worte zu Geografie, Flora, Fauna und Menschen gewidmet werden.
Wenn auch der Kanadier das Wort Busch ganz allgemein für alle weiten Waldlandschaften gebraucht, so bedeutet es dem Menschen im hohen Norden des Landes etwas völlig anderes. Er meint nicht die tiefen schwarzen Wälder des Kontinents insgesamt, er denkt im engeren Sinne an die raue Taiga seiner subarktischen Heimat in den sog. Northwestterritories (NWT), die selbst für eine Überzahl der kanadischen Bevölkerung immer noch einem Buch mit sieben Siegeln gleicht. Der Busch ist, westlich abgrenzend, das Land des indianischen Kutchin-Stammes, entlang der hier noch etwas dichter bewaldeten Ausläufer der Mackenziekette und Franklin Mountains. Im Norden, die zur Beaufortsee hin baumlose Ecke, siedeln die Inuit (Eskimo). Der südlich anschließende, allmählich dichter werdende Busch und die Gegend am Great Bear Lake, ist die Heimat der Dogrib-Indianer. Die Vegetation nimmt Richtung Süd um den Great Slave Lake weiter zu. In dieser Region ist der Slavey-Stamm zu Hause. Von hier verläuft die Taiga in einem stetig schmaler werdenden Band nach dem Atlantik hin bis zur Hudson Bay, der Heimat der Chipewyan.
Der Bewuchs der hügeligen Landschaft nimmt gegen Ost ab und geht, das Terrain immer flacher werdend, mit äußerst kargem wie verkrüppeltem Baumbestand in die endlose Ebene der noch raueren Tundra über. Dieses weite Flachland, bis zur Hudson Bay reichend, weist vorwiegend Niedrigwuchs auf und wird deshalb Barren Grounds genannt. Wer jedoch das Glück hatte, im Sommer das prachtvolle Blütenmeer der Tundra zu bestaunen, wird besonders von diesem Land fasziniert sein. Die Baumgrenze verläuft, im Norden etwa 250 km östlich des Mackenzie-Deltas beginnend, in bogenförmig diagonaler Süd/Ost-Richtung und tangiert die genannten Seen.
Der oben abgegrenzte Busch überzieht annähernd eine Fläche von Frankreich und Deutschland zusammen.
Neben den beiden bereits erwähnten riesigen Seen, jeder mehr als 50 mal so groß wie der Genfer See und teilweise über 600 Meter tief, ist diese wildschöne Erdregion überzogen mit einem dichten Netz romantischer, stiller Gewässer, die nicht selten in wilder Bahn zwischen herrlich bewachsen sanfter Ufer, abwechselnd mit felsigen Schluchten, ihren Weg zueinander suchen. Der sprichwörtliche Fischreichtum Kanadas trifft für diese glasklaren Wasser, die allesamt dem Eismeer zuströmen, in ganz besonderem Maße zu. Wenn auch der Lachs, von wenigen Ausnahmen abgesehen, hier nicht vorkommt, so wimmelt es gerade von Äschen, Hechten und Weißfischen. Starke Seeforellen bis zu 50 Pfund sind keine ungewöhnliche Seltenheit. Auch der Saibling findet seine Einstände und so mancher prachtvolle Zander geht an die Angel.
Obwohl das Land nicht besonders reich mit Niederschlägen und fruchtbarer Erde gesegnet ist, sorgt doch im Boden der Permafrost bis weit an die Oberfläche für ein ausreichendes Feuchtigkeitsreservoir und lässt mannigfaltige Vegetation zu. Der Bewuchs wird vorherrschend von Birken und Fichten bestimmt, daneben auch Erlen und Weiden. In den dichter bewaldeten West- und Südausläufern des Busches finden sich zudem Tannen und Zedern. Das Holz der letzteren war für die Indianer wertvoll zum Bau des Gerippes der Kanus, die mit Birkenrinde verkleidet und durch Harz abgedichtet wurden.
Nicht zuletzt gibt es aber auch reichen Niedrigwuchs mit verschiedenartigsten, oft früchtetragenden Sträuchern. Der Wanderer trifft immer wieder auf ausgedehnte Teppiche von genießbaren Blau- und Schwarzbeeren. Sogar Stachel-, Johannis- und Himbeeren finden sich, doch bei kleinrunden, roten Beeren ist Vorsicht geboten. Selbst Pilze sind nicht selten. Besonders auffallend ist das allgegenwärtige leuchtende Grün von Moosen und die den grauen Granit überziehenden bunten Flechten von pechschwarz, hellgrün, rötlich bis goldgelb, je nach Jahreszeit.
In einem zauberhaften Farbkleid zeigt sich der Busch während des sogenannten Indianersommers, bevor der extrem lange, klirrend kalte Winter mit seinen peitschenden, arktischen Stürmen Einzug hält. So mancher tosende Blizzard grüßt dann über die Tundra herein.
Sind auch die Winter bitter kalt, jegliches Gewässer erstarrt zu meterdickem Eis, so sind die Sommer doch oftmals sehr warm. Sogar Temperaturen bis 30 Grad Celsius werden hin und wieder gemessen. Mancher „Outdoor“ erzählt, er hätte an flacher, geschützter Stelle ein genüssliches Bad nehmen können.
Häufig bemerkst du grasgrün wuchernde Wasserpflanzen, insbesondere an sumpfigen Plätzen. Dort hält vorzugsweise der Elch Einstand, um an diesem äußerst eiweißreichen Grün sein Labsal zu nehmen.
Und lenkt der Kanute seinen schnittig wendigen Untersatz in eine isolierte Bucht, dann kann er im Buschsommer sogar von der malerischen Blütenpracht eines Seerosenfeldes überrascht werden.
Vom Beerenreichtum war bereits die Rede. Von solch reich gedecktem Tisch angelockt, findet sich freilich gerne Meister Petz ein. Im Umfeld solcher Plätze ist der Waldläufer bestens gewarnt. Da taucht urplötzlich das silbrig-grau glänzende Fell des Grizzly auf. Dies gilt vor allem für die Gegend am Great Bear Lake. Der etwas kleinere, schwarze Ursus-Verwandte zieht eher die Gefilde Richtung Sklavensee vor.
Doch allgegenwärtig späht der scheue Wolf nach Beute und verrät seine Anwesenheit durch das unverwechselbare, weithin hörbare Heulen.
Auch der für den Europäer kaum mehr als dem Namen nach bekannte Wolverine (Vielfraß) hat seinen Lebensraum in der subarktischen Zone. Er ist dem hier ebenfalls heimischen Dachs sehr ähnlich, allerdings bedeutend größer als dieser. Er hat ein wunderbar gezeichnet langhaariges Fell, wovon der Buschbewohner gerne wärmende Kleidung herstellt. Wie der Name schon sagt, der Wolverine frisst alles, was ihm zwischen die Klauen, besser ausgedrückt, zwischen sein stark ausgeprägtes, messerscharfes Gebiss kommt. Er ist nicht etwa scheu wie der Bär, sondern von aggressivem Verhalten und fällt nicht nur Kleintiere an. Man hat auch schon von Angriffen auf Menschen gehört.
Zum Busch-Großwild zählt freilich das Karibu. Während des kurzen Sommers (Anfang Juli bis August) hält es sich in der nördlichen Region auf, zieht nur für die kältere Zeit gen Süd. Das Röhren des ähnlichen Wapiti (amerikanischer Hirsch) bekommt man so hoch im Norden nicht zu hören. Dass sich hier Fuchs und Hase gute Nacht sagen, dürfte kein Rätsel sein. Es ist natürlich der Rotfuchs gemeint. Allerdings treibt in Küstennähe vermehrt der braunbehaarte arktische Fuchs sein Jagdwesen. Es muss eine Augenweide sein, wenn er im Winter das weiße bis eisblaue Fell trägt.
Neben dem Otter hat vor allem der Biber große Bedeutung, dessen Population gottlob wieder zunimmt. Ebenfalls keine Seltenheit stellen die niedlichen Eichhörnchen, Erdhörnchen und Murmeltiere dar, willkommene Beute aller Raubtiere. Vom ungemein vielfältigen, gefiederten Wild ausführlich zu reden, würde eine Aufzählung ohne Ende gleichen. So sollen nur einige genannt werden:
Verschiedene Arten von Ammer und Falke, der Habicht und Weißkopfseeadler; nicht zu vergessen der im Sommer bunte, im Winter schneeweiße Ptarmigan (Wildhuhnart). Hinzu kommen die vielen Arten an Wasservögeln, von denen hier nur die Möve, die unterschiedlichsten prächtigen Taucher und vor allem die Kanadagans genannt seien.
Wären noch die Raubkatzen zu erwähnen. Dass sich der herrliche braungefleckte Luchs in Kanadas Norden heimisch fühlt, dürfte selbstverständlich sein. Den Puma hingegen hält nichts in dieser Zone. Dieser Jäger bevorzugt das Rotwild in den Bergwäldern als Speise.
Dennoch wird der Buschgänger enttäuscht sein, wenn er, ob der ungemeinen Tiervielfalt, manchmal tagelang so gut wie kein Wild beobachten kann. Dies liegt daran, dass die Tiere, entsprechend dem Nahrungsangebot, das Revier wechseln. Da die Arten stets voneinander abhängig sind, erscheinen dann ganze Landstriche wie leergefegt.
Letztendlich nicht zu vergessen allgegenwärtige Lebewesen: die Mücken, ein sehr wichtiges Glied der Nahrungskette. Weil in diesen Breiten derart massenhaft vertreten, nennt man sie sprichwörtlich „Pest des Nordens.“ Jeder Outdoor weiß ein Lied davon zu singen. Die Moskitoplage tritt vornehmlich im Frühling auf, etwas abgeschwächt im Sommer. Die großen Horseflies (Bremsen) sind auch nicht zu verachten. Besonders in der wärmsten Jahreszeit aber greifen die winzigen Blackflies an. Sie finden jede undichte Stelle der Kleidung und suchen den Weg bis zur nackten Haut, wo deren Bisse dunkel gefärbte, entsetzlich juckende Schwellungen verursachen.
Ein paar Worte zur Geschichte.
Zunächst waren es die abenteuerlichen Expeditionen eines Samuel Hearne, ehemaliger Marineoffizier der englischen Krone, der schon 1771-73 das Landesinnere der Tundra vom Südosten her bis Coppermine am Eismeer durchforschte. Dieser legendäre, knochenharte Abenteurer war in Begleitung des berühmten Chipewyan-Häuptlings Mattanobee, sowie vieler seiner Stammesbrüder.
Später (um 1820) führte das Oberhaupt der Yellowknifes, Akaitscho, den namhaften Polarforscher Sir John Franklin vom Großen Sklavensee aus, den Heimatfluss (Yellowknife River) des Stammes hinauf. Ihr Weg ging weiter über die Gegend um den Winterlake, wo viele seiner Begleiter den Tod fanden. Dann am Ostufer des Großen Bärensee entlang und weiter durch die nördliche Taiga bis zum Coronation Gulf. John Franklin dürfte der erste Weiße gewesen sein, der seinen Fuß in den inneren Busch setzte.
Den größten Einfluss auf die Erforschung und Besiedlung des subarktischen Festlandes im kanadischen Nordwesten brachten jedoch die Unternehmungen des Schotten Mackenzie. Im Juli 1789 befuhr er mit Unterstützung von Indianern und französischen Voyageurs auf Kanus vom Lake Athabasca den Slave River entlang Richtung Norden, überquerte den Großen Sklavensee und trieb seine Expedition den mächtigsten Fluss Kanadas, der heute würdigerweise seinen Namen trägt, hinab bis zum Polarmeer. Während 44 Tagen äußerster Strapazen, legte Mackenzie dabei die unglaubliche Strecke von nahezu 3.000 km zurück und erreichte das riesige Delta an der Einmündung in die Beaufort See. Er selbst nannte seinen Wasserweg „Fluss der Enttäuschung“, weil dieser nicht, wie er hoffte, als Ost-West-Verbindung in den Pazifik mündete. Seiner Route entlang, allerdings nur bis Norman Wells, führt heute immer noch das einzige Straßennetz der Northwestterritories. Alle Punkte fernab dieser Strecke können für den Normalreisenden ausschließlich per Flug erreicht werden.
Es waren Pelzhändler und deren verwegene Voyageure, die in den beiden letzten Jahrhunderten auf ihren Kanus den Mackenzie River, sowie seine vielen Seitenarme befuhren und so nach und nach den Norden, entlang des großen Flusses, für sich eroberten.
Doch auch das Goldfieber brachte immer wieder unzählige Weiße in das Land. Wer kennt nicht die abenteuerliche, für Abertausende mit fatalen Folgen endende Geschichte um den Klondike im benachbarten Land,dem Yukon.
Es bewohnen immer noch Reste von Indianerstämmen den inneren Busch. An beutereichen Gewässern jagen sie und stellen Fallen, retten zum Teil die Kultur ihrer Vorväter in unsere Zeit herüber. So in Fort Franklin, der einzigen Siedlung am Bärensee, nördlich davon in Colville Lake, zum Sklavensee hin in Snare Lakes, Rae Lakes und Indian Village, um die wichtigsten Orte zu nennen. Sie liegen teils hunderte Meilen voneinander entfernt. Keine Straße führt hin, kein Weg. Dort findest du aber vor den Hütten noch die Rudel der blauäugigen Schlittenhunde, wie sie sehnsüchtig auf ihre winterlichen Jagdausflüge warten.
Doch die meisten Ureinwohner sind der Zivilisation des weißen Mannes gefolgt. Sie leben mit letzteren zusammen, oft in überwiegender Mehrheit, hauptsächlich in den Dörfern entlang des hier alles bestimmenden Mackenzie Rivers. Kaum anderswo in Kanada trifft der Fremde noch auf so viele rassenreine Indianer, wie in Fort Smith, Hay River, Fort Providence, Fort Simpson und Fort Norman. Flussabwärts schließen sich Norman Wells, Fort Good Hope, sowie Arctic Red River an. Die meisten dieser Orte entstanden während der Pionierzeit von Anfang bis Mitte des vorletzten Jahrhunderts. Sie zählen auch heute, von Fort Smith abgesehen, nicht mehr als wenige hundert Einwohner.
Die erste nördliche Handelsniederlassung, gleichzeitig ältestes Dorf (1786) der Northwestterritories, ist das an der Einmündung des Slave River in den gleichnamigen See gelegene Fort Resolution. Jüngste Besiedlung ist die erst 1954 für die Inuit entstandene Retortenstadt Inuvik, nahe dem Polarmeer. Sie zählt knapp 4.000 Seelen. Weitaus größte Ansiedlung (20.000 Einwohner) ist freilich Yellowknife am Nordufer des Slave Lake, Verwaltungshauptstadt der Territories. Letztere wurden 1999 neu geteilt und es entstand die autonome Verwaltungseinheit namens „Nunavut“ mit 41.000 Ew., welche direkt der kanadischen Bundesregierung unterstellt ist. Yellowknife wurde erst vor etwa 60 Jahren besiedelt und gewann relativ spät an Bedeutung. Zuvor hatten allerdings bereits Goldschürfer ihre Camps in näherer und weiterer Umgebung.
Berücksichtigt man, dass die weitaus überwiegende Mehrheit in den größeren Ansiedlungen lebt, werden die unermesslich menschenleeren Weiten fühlbar. Man muss sich vergleichend vorstellen, auf einem Drittel der Fläche von Europa leben gerade so viele Menschen, dass man lediglich ein mittelgroßes Fußballstadion füllen könnte. Northwestterritories ist aber auch dasjenige kanadische Gebiet, wo sich die Urvölker noch halbwegs gut behaupten konnten. So teilt sich hier die Gesamtbevölkerung auf knapp 40% Inuit (Eskimo), etwa 20% Dené (Indianer), der Rest sind Eurokanadier.
Zusammenfassend möchte bemerkt werden:
Wer auch je dieses Land der tausenden namenlosen Seen durchquert hat – nur außergewöhnlich zähe und harte Männer konnten derartige Leistungen vollbringen. Insbesondere war der einzelne Buschgänger gefordert – in dieser faszinierenden Wildnis, einer Mischung von schwierigstem Gelände, schier undurchdringlichen Wäldern, romantischer Gewässer, gefährlicher Schluchten und Wasserfällen.
Trotz einer vielfältigen Tierwelt, in einer Region extrem schwankender Witterungsverhältnisse, fällt der Wanderer nicht selten hungrig und erschöpft in den Schlaf. – Und nicht Wenige mussten mit dem Leben bezahlen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Dennoch zieht es immer wieder vereinzelte Abenteurer hinaus in das Herz von Kanadas Nordwesten, in den rauen Busch, in diese unendliche, menschenleere Weite. Er fühlt sich auf den Spuren der Indianer und Eskimos, in einem Land von überraschenden, unvergesslichen Schönheiten, jedoch auch voller lauernder Gefahren.
Ein Land zugleich wie Paradies und Hölle!