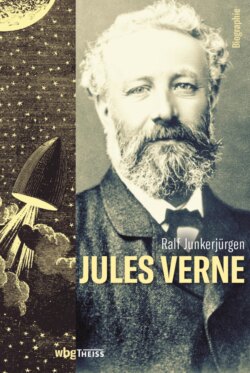Читать книгу Jules Verne - Ralf Junkerjürgen - Страница 9
Pariser Lehrjahre (1848–1856)
ОглавлениеIm August 1848 bestand Verne die Prüfungen des zweiten Studienjahrs. Bisher war er für die Aufenthalte in Paris im Haus seiner Großtante untergekommen, am 10. November dann ging er dauerhaft in die Hauptstadt, um sein Studium abzuschließen. Danach sollte er den Vorstellungen seines Vaters gemäß wieder in die Heimat zurückkehren und dort als Anwalt arbeiten. Tatsächlich erwies sich der Abschied von Nantes jedoch als endgültig.
Die stark ausgeprägte Regionalidentität der Bretonen führte dazu, dass Verne in Paris zunächst von Landsleuten umgeben war, als er mit seinem Studienkollegen Édouard Bonamy aus Nantes eine Wohnung in der Rue de l’Ancienne-Comédie Nr. 24 im Quartier Latin bezog. Zu seinen engsten Studienfreunden gehörte auch der Nantaiser Reedersohn Aristide Hignard, der sich in Paris als Komponist etablieren wollte und mit dem Verne schon bald gemeinsam Lieder und Opern verfasste.
Noch war allerdings nicht entschieden, welchen Weg Verne genau einschlagen würde. Die folgenden Jahre war er daher ganz damit beschäftigt, zu sich selbst zu finden. Die politischen Unruhen des Jahres 1848 waren keineswegs mit der Februarrevolution beendet worden. Eine der Maßnahmen der provisorischen Regierung hatte darin bestanden, mit der Errichtung von Nationalwerkstätten das Recht auf Arbeit umzusetzen. Die neu geschaffene Institution stellte im großen Stil Arbeitssuchende ein, um sie in öffentlichen Großprojekten wie dem Bau der Bahnhöfe Montparnasse und St. Lazare einzusetzen. Das volkswirtschaftliche Experiment wurde allerdings schon wenige Monate später wieder abgebrochen, was die betroffenen Arbeiter am 22. Juni auf die Straßen trieb. Die Regierung reagierte mit aller Härte. Unter der militärischen Führung von Louis-Eugène Cavaignac wurde der so genannte Juniaufstand in einem Blutbad ertränkt, dem über 6.000 Menschen zum Opfer fielen. Im Rückblick sind diese Vorkommnisse deshalb von hoher historischer Bedeutung für das 19. Jahrhundert, weil sich das revolutionäre Proletariat hier eindeutig vom Bürgertum abspaltete. Der Klassenkampf, den sozialistische Theoretiker bereits vorausgesagt hatten, war damit eröffnet und sollte den weiteren Verlauf des Jahrhunderts politisch prägen.
Der junge Verne gehörte dem Bürgertum an und war viel zu sehr damit beschäftigt, sich eine Existenz aufzubauen, als an diesen Ereignissen teilzunehmen. »Was mich betrifft, so schließe ich, klick klack, meine Tür und bleibe Zuhause, um zu arbeiten, solange man mich in Ruhe lässt«, schreibt er am 12. Dezember 1848 an seinen Vater. Als er im August die Möglichkeit hat, die Abgeordnetenkammer zu besuchen, interessiert er sich dementsprechend nicht für die politischen Debatten, sondern für die dort versammelten Dichter, neben Lamartine vor allem für seinen verehrten Victor Hugo, der eine dreißigminütige Rede hielt. Verne war so aufgeregt, dass er »eine Dame umgeworfen und einem Unbekannten die Operngläser aus der Hand gerissen« haben will, um sein Idol zu sehen, wie er dem Vater berichtete.
Vernes Selbstfindung verläuft einerseits über die Kontakte, die er zu literarischen Zirkeln in der Hauptstadt knüpft, und andererseits über die Auseinandersetzung mit seinem Vater. Seine langen Briefe jener Jahre und sein wiederholtes Klagen darüber, dass er trotz der vielen Verwandten so wenig Post erhalte, bezeugen, wie eng der Familienzusammenhalt war. Noch als 28-jähriger sollte Verne sich nicht scheuen, der Mutter sein Liebesleid zu klagen. Als Familienoberhaupt und Vormund spielte allerdings Vater Pierre die zentrale Rolle, denn der finanziell abhängige Verne brauchte dessen Förderung, um sich emanzipieren zu können. Ein radikaler Bruch hätte zwar sowieso nicht zu dem tiefen Respekt gepasst, den er vor dem Vater hatte, er hätte ihn sich auch gar nicht erlauben können. Eine literarische Karriere erforderte Hartnäckigkeit und Geduld, und für diese möglicherweise lange Wartezeit benötigte er finanzielle Unterstützung. Verne musste also nicht nur standhaft bleiben, sondern auch den Vater von seiner Berufung überzeugen.
Dabei war Pierre Verne den Künsten gegenüber durchaus aufgeschlossen und hielt literarische Fähigkeiten grundsätzlich für eine Schlüsselqualifikation. Nicht zuletzt deshalb korrigierte er die Briefe seines Sohnes orthografisch und stilistisch und diskutierte dessen literarische Werke mit ihm. Allerdings lehnte er die Schriftstellerei als hauptberufliche Tätigkeit ab. Anwalt zu sein, versprach ein gutes Auskommen, die Kunst hingegen war prekär. Das sah sein Sohn anders: »Mein Ziel ist es, Geld zu verdienen, und nicht, mir eine andere Zukunft aufzubauen. Lieber Papa, du sagst, dass Dumas und andere keinen roten Heller besäßen. Aber das liegt daran, dass es ihnen an Ordnung, nicht aber an Geld fehlt. A. Dumas verdient seine 300.000 Francs im Jahr. Dumas jr. locker 12 bis 15.000 Francs, Eugène Sue ist Millionär, Scribe vierfacher Millionär, Hugo hat 25.000 Rente, Féval, alle und jeder sind ganz und gar wohlhabend und bereuen es nicht, diesen Weg eingeschlagen zu haben!«
Ebenso gewichtig war allerdings auch, dass der Vater die Literaturszene für moralisch bedenklich einschätzte und Künstler für »exzentrisch« hielt. Und das bedeutete eine scharfe Verurteilung, denn exzentrisch hieß vor allem, mit der katholisch-moralischen Norm zu brechen. Jules musste ihn in dieser Hinsicht immer wieder beruhigen und beschwichtigte, dass die Bürger aus Nantes in Wirklichkeit nicht weniger exzentrisch seien als die Pariser Künstlerszene. Und die wichtigste Botschaft an den Vater war dabei, dass der Lebensstil nicht vom Beruf abhänge und man auch als Künstler ein ruhiges und zufriedenes, und das heißt bürgerlich-katholisches Leben führen könne.
Trotz aller Meinungsverschiedenheiten blieb der Ton der Korrespondenz stets ruhig und höflich. Verne zollte dem Vater immer die Ehre, die diesem in der katholischen Familienkultur kraft seiner Rolle zustand und unterzeichnete oft mit »dein dich respektierender Sohn«. Dementsprechend ging er grundsätzlich auf die Ratschläge des Vaters ein, egal wie wenig er mit ihnen einverstanden war. Als der Sohn sich in einem Brief einmal beiläufig auf ein Goethezitat – »nichts, was uns glücklich macht, ist eine Illusion« – beruft, reagiert der Vater empört, weil er darin einen Freibrief zu unmoralischem Verhalten liest. Sofort stellt Verne klar, dass mit Glück keineswegs Vergnügen gemeint sei. Noch deutlicher wurden die Meinungsverschiedenheiten, als Verne dem Vater im Oktober 1851 die einaktige Charakterkomödie De Charybde en Scylla (Von Charybdis nach Skylla) schickte. Darin karikierte er eine Gruppe von fünfzigjährigen Heiratswilligen, die sich nicht einig werden, weil die Ehe letztlich eine Einschränkung der Rechte für die Frau mit sich bringt, die dementsprechend versucht, den Mann auf ihre Weise zu unterjochen. Pierre ging es definitiv zu weit, dass sein Sohn das heilige Sakrament der Ehe als fragwürdige Institution hinstellte. Im Briefwechsel darauf folgten erneut beschwichtigende Hinweise des Sohnes und das Versprechen, dass er dies überarbeiten werde. Tatsächlich hat Verne den Text jedoch nicht mehr geändert.
Der Sohn suchte somit zwar das Mentorat des Vaters und band ihn geschickt mit ein, ging keiner Diskussion aus dem Weg und versuchte, es dem Vater recht zu machen. Aber das bedeutete nicht automatisch, dass er es immer gänzlich ernst meinte. Verne gestand solche Kommunikationsstrategien in einem anderen Zusammenhang sogar selbst ein. Als er dem Vater Ende Dezember 1848 von seinen ersten Erfahrungen in den literarischen Zirkeln berichtet, stellt er selbstironisch fest, dass er bei allen gut angekommen sei, denn: »Ich rede das nach, was man mir vorsagt, und so mochten mich alle Leute! Wie sollte man gerade mich auch nicht charmant finden, wenn ich mich immer auf die Seite desjenigen schlage, der gerade das Wort führt!«
Sollte das etwa auf jugendlichen Mangel an Selbstvertrauen oder gar Mangel an Charakter hinweisen? Ich meine, dass darin vielmehr eine zentrale Eigenschaft Vernes zum Ausdruck kommt, die ihn zugleich als Mensch und als Künstler beschreibt: nämlich sein sensibles Gespür dafür, welche Erwartungen sein jeweiliges Gegenüber hat. Im menschlichen Umgang zeigte sich dies daran, dass Verne tatsächlich sein ganzes Leben lang in keine schweren persönlichen Konflikte verwickelt wurde. Andererseits führte dies dazu, dass Verne allen gegenüber meist eine höfliche Distanz beibehielt, die von Ironie und Humor geprägt war. Das zeichnet zwar grundsätzlich den Kommunikationsstil des französischen Bürgertums aus, gilt für Verne aber in besonderem Maße. Zu Konflikten konnte es demnach nur dann kommen, wenn diese Distanz nicht aufrecht erhalten werden konnte wie später im Falle der Beziehung zu seinem Sohn Michel. Dem Schriftsteller Verne wiederum schenkte dies die Fähigkeit, sich in verschiedene Rollen und Figuren einfühlen und sich auf unterschiedliche Publika einstellen zu können. Ausdruck dafür ist die erstaunliche Breite seiner schriftstellerischen Anfänge in den 1850er Jahren.
Anders als heute, wo ein breites Netz aus Literaturpreisen und Förderinstrumenten reichliche Sprungbretter für Nachwuchstalente bieten, verlief der Weg in die Literaturszene zu Vernes Zeiten unter anderem noch durch den Salon. Dieses kulturelle Erbe des Ancien Régime bestand aus Treffen geladener Gäste im Haus einer einflussreichen Gastgeberin, bei der man Konversation pflegte sowie kleine Aufführungen von Musik, Tanz oder Theater darbot. Junge Talente, die wichtige Kontakte knüpfen wollten, musste es gelingen, in einen solchen Salon eingeladen zu werden, um eine Chance zu erhalten, sich über geistvoll-witzige Unterhaltung oder den Vortrag aus eigenen Werken zu empfehlen. Verne frequentierte diese Kreise schon ab Ende 1848, und zwar zunächst den Zirkel von Mme Barrère, einer Bekannten seiner Mutter. Schon bald freundete er sich mit Personen an, die seine Entwicklung maßgeblich beeinflussen sollten.
1849 lernte er den nur vier Jahre älteren Alexandre Dumas jr. kennen und baute ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm auf, das so weit ging, dass sie 1850 gemeinsam das Theaterstück Les Pailles rompues verfassten, auch wenn der Anteil von Dumas daran offenbar eher gering war. Die Verbindung zu Dumas gab Vernes Karriere einen kräftigen Schub. Seit 1848 hatte sich Dumas mit dem anhaltenden Erfolg seines melodramatischen Romans Die Kameliendame einen Namen gemacht, der den noch völlig unbekannten Verne mit sich riss. Les Pailles rompues wurde gedruckt und am 12. Juni 1850 in das Vorprogramm des Théâtre historique aufgenommen. Mitte der 1850er und 1871/72 sollte es jeweils weitere vierzig Aufführungen erleben. Damit hatte sich Verne erstaunlich schnell aktiv in die Autorenszene lancieren können. Die eigentliche Herausforderung bestand jedoch darin, sich dort auch zu etablieren, und in dieser Hinsicht sollte er noch einige Geduld aufbringen müssen.
Sein Ziel bestand zunächst darin, als Bühnendichter erfolgreich zu werden. In den folgenden Jahren legte Verne Werke aus ganz unterschiedlichen Bühnengattungen vor: das Vaudeville Une promenade en mer, die von der commedia dell’arte geprägte Komödie Quiridine et Quidinerit, die er Vater und Sohn Dumas vorlas, das Künstlerdrama La Guimard über die Beziehung des Malers Jacques-Louis David zu der Tänzerin Marie-Madeleine Guimard sowie die bereits erwähnte Charakterkomödie De Charybde en Scylla, um nur einige zu nennen.
Die positive Aufnahme seines Talents, der Aufbau eines Netzwerkes und die ersten greifbaren Erfolge bewirkten, dass Verne nun eine klare Haltung gegenüber seinem Vater einnehmen konnte. Als dieser ihm im März 1851 eine Stelle als Anwalt in Nantes anbot, legte der Sohn die Karten offen auf den Tisch: »Die Literatur geht vor, nur dort kann ich erfolgreich sein, denn mein Geist ist ganz auf sie fixiert!« Beide Laufbahnen parallel zu fahren, hielt er für unmöglich, außerdem würde eine Rückkehr nach Nantes alle Kontakte wieder zunichte machen. Aber so schnell gab der Vater nicht auf. Anfang 1852 unternahm er einen weiteren Versuch und bot dem Sohn an, seine eigene Kanzlei zu übernehmen. Das war natürlich verlockend, denn Pierre Verne war höchst angesehen in Nantes, und bedeutete Wohlstand und Sicherheit, wenn man sich nicht ganz ungeschickt anstellte. Aber in der Zwischenzeit war Vernes künstlerisches Selbstbewusstsein ebenfalls weiter angestiegen. Mittlerweile hatte er verstanden, dass er nicht an Mangel an Talent, sondern vielmehr an Mangel an Geduld oder an Entmutigung scheitern würde. Das musste man dem Vater allerdings schonend beibringen, denn Verne war wohl bewusst, dass dieser ihm sein berufliches Lebenswerk anbot und damit alles in die Waagschale warf, was er besaß. Einfühlsam wie er war, versuchte er in einem Brief vom 17. Januar 1852 aus der Sicht des Vaters zu argumentieren: »Dadurch, dass ich weiß, wer ich bin, verstehe ich, was eines Tages aus mir werden würde. Wie sollte ich die Verantwortung für eine Kanzlei übernehmen, die du zur Blüte geführt hast? Da sie unter meinen Händen nichts gewinnen könnte, könnte sie nur zugrunde gehen.« Das musste den Vater überzeugt haben, denn ab jetzt insistierte er nicht weiter.
Bei all dem Aufwind einerseits hatte Verne andererseits ab seiner Studienzeit auch mit schweren gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Über die Jahre hinweg machten ihm erhebliche Verdauungsprobleme zu schaffen, die mit Erbrechen und Durchfall einhergingen. Im Oktober 1854 klagte er, dass er fast nichts mehr essen könne, ohne schwere Koliken zu bekommen. Am 25. November 1854 dann schrieb er seiner Mutter »einen jener unklassifizierbaren Briefe, die man, sich die Nase zuhaltend, auf der Toilette lesen muss!« Es kostete ihn spürbare Überwindung, ihr verständlich zu machen, dass er Probleme mit Inkontinenz hatte, weil sein Rektum heraustrat und daher nicht mehr richtig schloss. Doch damit nicht genug. Offenbar als Folge einer Mittelohrentzündung kam noch eine Gesichtsmuskellähmung hinzu. Vor allem das Jahr 1855 erwies sich gesundheitlich als so schwierig, dass er im Januar und Februar knapp drei Wochen das Haus nicht verließ. Da blieb nichts als Galgenhumor: Wenn er nicht lache, schreibt er in einem Brief, nicht zwinkere oder die Stirn runzele, dann merke man gar nichts von der Lähmung. Also dürfe er nur noch Gesellschaften frequentieren, in denen nicht gelacht werde. Diese Lähmungen sollten ihn auch in Zukunft nicht in Ruhe lassen. Zum vierten Anfall kam es 1864. Verne beschreibt ihn anschaulich in einem Brief vom 8. August dieses Jahres: »Die eine Seite meines Gesichts ist lebendig, die andere tot. Die eine bewegt sich, die andere rührt sich nicht mehr! Eine schöne Lage ist das! Von der einen Seite sehe ich intelligent (bitte erlauben Sie mir das Wort um der Antithese willen), von der anderen wie ein Idiot aus.«
Was die politische Geschichte anging, so erlebte Verne 1851 im Alter von 23 Jahren bereits seinen dritten Umsturz, mischte sich aber erneut nicht in die Auseinandersetzungen ein. 1848 war Louis Napoléon Bonaparte zum Staatspräsidenten gewählt worden, der sich gleich daran machte, einen Staatsstreich vorzubereiten, den er am 2. Dezember 1851 umsetzte. Ganz nach den Regeln Machiavellis zog Louis Napoléon seine grausamen Säuberungsmaßnahmen gleich in den ersten Wochen durch. So baute er als Napoléon III. auf Festnahmen, Deportation und Exil ein Regime auf, das wegen seines wirtschaftlichen Erfolgs und seiner erstaunlichen kulturellen Blüte gut zwanzig Jahre andauerte und als Zweites Kaiserreich in die Geschichte einging.
Anfang Februar 1852 bot sich Verne eine berufliche Gelegenheit an, mit der sich scheinbar seine literarischen Ambitionen verbinden ließen. Im gerade erst erneuerten Opernhaus Théâtre Lyrique trat er die Stelle des Sekretärs für 100 Francs (ca. 320 €) monatlich an. Hier kamen junge Komponisten zum Zuge, und Verne witterte eine Chance für sich, als Librettist tätig zu werden. Von der Spielzeit 1852/53 an verzichtete er auf sein Gehalt und handelte dafür aus, dass pro Saison eine der Opern aufgeführt werden sollte, die er zusammen mit seinem Freund Aristide Hignard verfassen wollte, der gerade 1850 erst den renommierten Rom-Preis zweiter Kategorie errungen hatte. Finanziell erwies sich dies jedoch als eher schlechtes Geschäft, denn als Neuling musste Verne mit dem bekannteren Librettisten Michel Carré zusammenarbeiten und erhielt nur ein Viertel der Vergütung, da die Hälfte an den Komponisten ging. Das Trio errang 1852/53 mit seiner Komischen Oper Le Colin-Maillard einen Achtungserfolg, 1855 folgte Les Compagnons de la Marjolaine. Insgesamt erwies sich die Stelle als Sekretär jedoch als weniger hilfreich, als Verne gehofft hatte. Denn die zahlreichen organisatorischen Aufgaben von Pressebetreuung bis Eintrittskartenvergabe ließen nicht die gewünschte Zeit für die eigene kreative Arbeit.
Zugleich streckte der facettenreiche Verne seine literarischen Fühler auch in Richtung Prosa aus. Er hatte Kontakt zu dem Bretonen Pitre-Chevalier (eigentlich Pierre-Michel-François Chevalier) aufbauen können, der Chefredakteur der illustrierten Familienzeitschrift Musée des familles war, die auch die Vernes im Abonnement gehabt hatten. Das Musée hielt sich bei zeitgenössischen oder politischen Fragen zwar ziemlich bedeckt, bot dafür aber eine breite Palette an allgemeinbildenden und unterhaltenden Artikeln und Prosastücken an, die sich lediglich in den katholischen Grundwerten einig waren. Pitre-Chevalier leitete die Zeitschrift seit 1842 und führte sie Mitte der 1850er Jahre zur Blüte. Illustre Namen wie Balzac, Dumas, Sue und Gautier publizierten hier, ohne dass sich das Musée neuen Talenten verschloss. Pitre-Chevalier sah Potenzial in Verne und erkor ihn, wie er behauptete, zu einem von drei bis vier Schützlingen aus gut 500 vermeintlichen Nachwuchsautoren. In den folgenden Jahren besuchte Verne ihn öfter in Marly im Westen von Paris und verbrachte dort oft mehrere Tage. Zwischen 1851 und 1855 erschienen im Musée Vernes erste Prosatexte.
Zweifellos waren die Erzählungen für Verne im Vergleich zu den Bühnendichtungen zweitrangig. Aus der Rückschau kündigt sich hier allerdings seine eigentliche literarische Karriere an. Von daher lohnt sich ein Blick auf die intertextuellen Koordinaten, zwischen denen sich Verne hier bewegt. Es sind vor allem zwei: James Fenimore Cooper und E. T. A. Hoffmann.
1851 erschien mit Les Premiers Navires de la marine mexicaine (Die ersten Schiffe der mexikanischen Marine) eine Abenteuererzählung im Stil Coopers, wie Verne selbst in einem Brief erwähnt, in der zwei spanische Meuterer ihre Schiffe an die Mexikaner verkaufen und dabei quer durch das Land reisen, bevor sie bestraft werden, wobei Verne die Kapitel geografisch gliedert und einige sachkundliche und anthropologische Informationen einbaut. Noch enger an Cooper angelehnt ist die Erzählung Martin Paz von 1852 über einen Aufstand peruanischer Indianer, bei dem Verne zugleich die sozialethnische Zusammensetzung der Bevölkerung vermittelt. Die melodramatische Handlung dreht sich um eine interethnische Liebesbeziehung zwischen einem Indianer und einer vermeintlichen Jüdin, die sich schließlich als Christin herausstellt – eine Verbindung, die nur im Tod möglich wird, als beide einen Wasserfall herunterstürzen und sie ihm gerade noch wie zur Taufe die Stirn berühren kann. Anleihen bei Cooper liegen in tragenden Figuren und Handlungselementen: der heroische Sohn eines Indianerhäuptlings, der sich in eine christliche Frau verliebt, wobei diese Vereinigung erst im Jenseits möglich wird – all das sind Versatzstücke aus Der letzte Mohikaner. Weiterhin findet sich die von Cooper geprägte Ambivalenz der Indianerfiguren, die sich einerseits durch erstaunliche Tugenden wie hohe Geschicklichkeit und stoische Gelassenheit auszeichnen, sich andererseits jedoch auch zu abscheulichen Grausamkeiten hinreißen lassen. Einmal mehr zeigt sich hier der heute weitgehend vergessene enorme genrebildende Einfluss des US-amerikanischen Romanciers. Seine Abenteuer- und Seeromane mit ihren sachkundlichen und geografischen Aspekten boten damit einen wichtigen Orientierungspunkt bei der Entwicklung von Vernes wissenschaftlichem Roman. Bedauerlich ist, dass Verne in Martin Paz mit der Figur Samuel das antisemitische Klischee vom materialistischen und habsüchtigen Juden bediente, der jenseits des Geldes keine Ideale kennt. Ansonsten hat Verne nur noch einmal in dem Roman Hector Servadac in diese Kerbe geschlagen. Antisemitismus war im 19. Jahrhundert gerade im katholischen Milieu Frankreichs durchaus weit verbreitet. Gegen Ende des Jahrhunderts sollte sich dies, nicht zuletzt durch eine pseudowissenschaftliche Ideologisierung der Judenfeindlichkeit durch den Publizisten Édouard Drumont, sogar noch verschärfen, um schließlich in der stark antisemitisch geprägten Dreyfus-Affäre zu kulminieren. Vor diesem Gesamthintergrund darf man Vernes Werke in dieser Hinsicht relativ beruhigt lesen. Damit sollen die beiden genannten Fälle weder schön- noch weggeredet werden, zugleich muss man aber auch bedenken, dass zwei Nebenfiguren im zahlreichen Volk der Verneschen Charaktere kaum repräsentativ sind.
Auf den in Frankreich stark rezipierten deutschen Romantiker E. T. A. Hoffmann, der als Erneuerer der fantastischen Literatur gilt, verweist Vernes Erzählung Meister Zacharius von 1854. Schon im Namen Zacharius klingen Figuren Hoffmanns wie Klein Zaches nach. Einen Uhrmacher als Hauptfigur zu nehmen, scheint weiterhin der Schauererzählung Das Fräulein von Scuderi entlehnt worden zu sein, wobei Verne seinem Meister Zacharius jedoch einen deutlich moralischen Ton hinzufügt, offenbar auch unter dem Einfluss der Korrespondenz mit seinem Vater, dem er am 4.März 1853 schreibt, dass er eine Erzählung beendet habe, »in der du ein wenig mehr von dem findest, was dir in meinen anderen Novellen gefehlt hat. Man sollte wohl dafür sorgen, dass sich aus allem ein philosophischer Gedanke ergibt und dass es die Aufgabe des Schriftstellers ist, sie mit der Handlung und deren Folgen zu verweben.« Waren das erneut Lippenbekenntnisse des Sohnes, der seinen Vater nicht vor den Kopf stoßen will? Zumindest nicht in dieser Erzählung, denn Verne geißelt in dem Uhrmacher Zacharius die menschliche Hybris, weil dieser sich einbildet, mit seinen exakten Uhren lebendige Wesen erschaffen zu haben und daher Gott gleich zu sein. Gerade weil Verne die Fantastik und ihre symbolischen Möglichkeiten in seinem späteren Werk kaum noch nutzen sollte, zeigt sich an Meister Zacharius, wie stark noch Mitte der 1850er der Einfluss der Romantik auf ihn war.
Allerdings wiesen die Erzählungen aus dem Musée bereits eine klare Tendenz auf. 1851 war auch die Ich-Erzählung Un Voyage en ballon (Eine Reise im Ballon) erschienen, die von einer Ballonfahrt über Frankfurt handelt, bei der dem Ich-Erzähler plötzlich ein Unbekannter in der Gondel gegenübersteht, der sich Erostratos nennt und Ballast abwirft, um bis zur Sonne aufsteigen zu können. Ikarus gleich stürzt er schließlich mit der Gondel ab, während sich der Ich-Erzähler im Netz des Ballons festkrallen kann und gerettet wird. Hier erprobte Verne bereits eine Reihe von Motiven, die er später in Fünf Wochen im Ballon wieder aufnehmen sollte, allerdings stehen die Handlung und die Figur des wahnsinnigen Erostratos zugleich auch Poes Erzählungen nahe, deren Einfluss auf Verne noch gesondert dargestellt wird. 1855 erschien mit Eine Überwinterung im Eise eine weitere Erzählung, die den späteren Romanen unmittelbar vorarbeitete, und zwar konkret den Reisen und Abenteuern des Kapitäns Hatteras. Neben der Lektüre authentischer Reiseberichte verarbeitete Verne in diesem Falle auch eigene Anschauungen, und zwar vom Hafen Dünkirchens, den er auf einer Reise zu seinem Onkel Auguste Allotte im Juli 1851 besichtigt hatte und später zum Ausgangspunkt der Erzählung machte. Hier zeichnete sich somit bereits auch ein literarisches Verfahren ab, das sich verschiedener Quellen bediente.
Der literarische Ertrag jener Jahre war zwar beachtlich, brachte aber finanziell nicht genügend ein, um Vernes prekäre Lage zu überwinden. Und diese spitzte sich nun dadurch zu, dass er immer deutlicher den Wunsch verspürte zu heiraten. Davon war in der ersten Zeit in Paris keine Rede gewesen. Am 9.März 1850 hatte er seiner Mutter gegenüber noch behauptet, das Junggesellendasein sei für einen Mann doch der glücklichste Zustand auf der Welt. Aber schon 1851 begann er damit, seine Mutter auf die Suche nach einer Frau für ihn zu schicken. Wegen seiner natürlichen Schüchternheit, seiner bescheidenen finanziellen Situation und seiner gesundheitlichen Gebrechen dürfte ihm bewusst gewesen sein, dass seine Chancen auf dem Heiratsmarkt nicht sonderlich hoch waren, ganz davon abgesehen, dass er auch vorher kaum bei den Damen reüssiert hatte. Bisher durfte er bloß wiederholt die frustrierende Erfahrung machen, dass alle Frauen, die er auserkoren hatte, zwar in der Tat kurz darauf heirateten, allerdings nicht ihn. In einem Brief vom Dezember 1854 kann er seiner Mutter schon eine stattliche Reihe solcher frisch Vermählten aufzählen: »Alle Mädchen, die ich mit meinem Wohlwollen beehre, heiraten systematisch kurz darauf! Wahrhaftig! Mme Dezaunay, Mme Papin, Mme Terrien de la Haye, Mme Duverger und schließlich auch Mlle Louise François.«
Dabei ist Vernes Blick auf die Ehe keineswegs allein ein romantisches Verlangen, sondern auch von ganz pragmatischen Beweggründen angetrieben. Wie viele andere Künstler, darunter Balzac, der kurz vor seinem Tod noch die polnische Millionärin Mme Hanska heiratete, gab sich auch Verne der Illusion hin, eine reiche Frau zu heiraten, wie er seiner Mutter am 19. Februar 1856 schrieb, »ein reiches Mädchen, das sich zum Beispiel einen Fehltritt erlaubt hat oder bereit wäre, einen zu tun«, um damit auf einen Schlag seine Probleme zu lösen.
Ein solch verzweifelter Zustand verleitet zur Wahllosigkeit. Das konnte im 19. Jahrhundert allerdings schwere Konsequenzen haben, weil das Scheidungsrecht in Frankreich erst 1884 wieder eingeführt wurde. Nicht gerade die besten Voraussetzungen dafür, die richtige Partnerin zu finden. Angesichts von Vernes emotionaler Not, dauerte es auch nicht lange, bis er sich wieder verliebte. Im März 1856 begab er sich nach Amiens, um der Hochzeitsfeier seines Freundes Auguste Lelarge beizuwohnen. Die stimulierenden Wirkungen solcher Festlichkeiten sind bekannt und trafen Verne offenbar, als ihm eine Schwester der Braut, die 26-jährige Honorine, vorgestellt wurde. Prompt verlängerte er seinen Aufenthalt in der Hauptstadt der Picardie. Allerdings hatte die Sache einen Haken: Honorine war Witwe und hatte zwei Töchter, und stellte damit alles andere als eine gute Partie dar. »Ich habe einfach kein Glück!«, schreibt er an seine Mutter. »Ich stoße immer auf die eine oder andere Unmöglichkeit. Sie ist seit sieben oder acht Monaten Witwe, ihr Ehemann starb an Schwindsucht aufgrund einer Unvorsichtigkeit. Aber ich weiß nicht, warum ich dir das überhaupt schreibe. Wozu?«
Diese Zweifel scheinen jedoch bald verflogen zu sein. Honorines erster Mann, Auguste Morel, war am 6. August 1855 verstorben, so dass man nach Ablauf der Trauerzeit von einem Jahr konkret die Hochzeitsplanung in Angriff nehmen konnte. Schließlich heirateten sie im engsten Familienkreis bescheiden am 10. Januar 1857 in der Saint-Eugénie-Kirche in Paris; Vernes Trauzeugen waren sein Freund Aristide Hignard und sein Cousin Henri Garcet.
Über Honorine wissen wir trotz 48 Jahren Ehe mit Jules Verne eher wenig, weil er sie selten in seinen Briefen erwähnt. Offenbar war sie eine eher emotionale Frau, die sich in den literarischen Zirkeln von Paris nicht zu bewegen wusste. Das veranlasste Verne dazu, nach Amiens zu ziehen, wo Honorine sich wohler fühlte. Als Verne dies Jahre später in einem Brief an seinen Verleger Hetzel anspricht, berichtet dieser davon auch seinem Sohn und erklärt ihm in einem Schreiben vom 16. April 1877, dass die gesellschaftlichen Zirkel scharf getrennt seien und die literarische Szene der Bereich Vernes, und nicht der seiner Frau sei und man Frauen eben nicht überall mit hinnehmen dürfe.
Vernes vermeintlicher Fehler, den Hetzel in einen väterlichen Ratschlag für seinen eigenen Sohn umformuliert, sagt viel über die Rolle der bürgerlichen Ehefrau aus. Eine gängige Allegorie stellte sie als Efeu dar, der sich um den starken Stamm einer Eiche rankte, die wiederum den Mann symbolisierte. Die Frau war auf den Mann angewiesen und für Haushalt und Familie zuständig. Dem Mann fiel das Geistig-Intellektuelle zu, der Frau hingegen das Physische und Emotionale. Auch wenn es eine George Sand gab, blieben Dichtung und Schriftstellerei für Verne reine Männersache. Daher war Honorine auch keine Ansprechpartnerin für das, was Verne am meisten interessierte: die Literatur.
Honorine brachte zwar eine stattliche Mitgift in die Ehe ein, aber Vernes Verantwortung war nun eigentlich noch gewachsen und der Druck, aus dem finanziellen Engpass herauszukommen umso größer. Die im Zweiten Kaiserreich florierenden Kapitalgeschäfte zogen viele Männer an die Börse, gerade auch Schriftsteller, die meinten, mit einer Stunde Arbeit pro Tag genügend Geld zu verdienen, um sich dann ungestört ihrer Kunst widmen zu können. Von daher dürfte Vater Pierre wenig erfreut gewesen sein, als sein Sohn, der 1855 noch seine Anwaltskanzlei für die Literatur ausgeschlagen hatte, jetzt auf einmal als Zwischenhändler an die Börse gehen wollte und ihn um 50.000 Francs (ca. 160.000 €) bat, um sich in ein Maklerbüro einzukaufen.