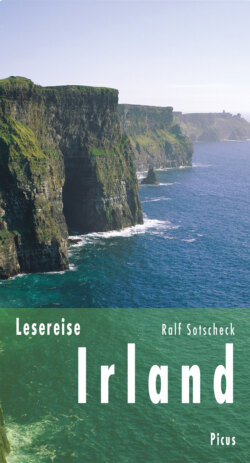Читать книгу Lesereise Irland - Ralf Sotscheck - Страница 9
Als wäre man ein Muezzin
ОглавлениеHinter der Eingangstür ist kein Weiterkommen. Die Menschen stehen dichtgedrängt am Tresen, nur die Musiker haben Anrecht auf einen Sitzplatz am einzigen Tisch gleich neben dem Eingang. Die beiden fiddler, der Gitarrist, die Blechflötistin und der Dudelsackspieler kämpfen gegen Stimmengewirr und Gläserklirren an – O’Donoghue’s am Wochenende. Der Pub in der Dubliner Baggot Street gilt als »Wiege des Balladen-Booms und Brutstätte der singing pubs«, wie es in einem Reiseführer heißt.
Declan Barden ist der Einzige, der in dem Chaos den Überblick behält. Zwar glänzt seine Halbglatze vor Schweiß, doch das weiße Hemd und die Krawatte sitzen tadellos. Barden, der Besitzer, steht auf einer Trittleiter hinter dem Tresen wie ein Kapitän auf der Kommandobrücke. Von der obersten Stufe aus nimmt er die Bestellungen der hinten stehenden Gäste entgegen, die es nicht schaffen, sich bis zum Tresen durchzukämpfen. Das Stammpublikum hat eine Zeichensprache entwickelt, mit der man auch beim größten Lärm seine Bestellung aufgeben kann. »Ein Finger heißt ein Pint Guinness«, erklärt Ian, ewig schon Stammgast. »Zwei Finger heißen zwei Guinness, beide Zeigefinger bedeuten ein Guinness und ein Smithwick’s.« Und ein Gin and Tonic? »Da hilft nur Brüllen«, sagt Ian und schüttelt lachend seine dichten braunen Locken. Er arbeitet gleich um die Ecke, und nach Feierabend schaut er meist auf ein Pint herein – jene 0,56 Liter, in denen das Bier gemessen wird. Manchmal bleibt er bis zur Sperrstunde um halb zwölf, sonntags und im Winter wird schon um elf geschlossen. »Das Dekor hat sich in all den Jahren kaum verändert«, erzählt er. »Nur auf der Platte, die vor der Eingangstür in den Fußboden eingelassen ist, stand früher ›O’Higgins Outfitters‹ in schöner, alter Schrift. Der vorige Besitzer, Dessie Hynes, ließ das herausreißen und seinen eigenen Namen als Mosaik einsetzen. Was kann man von einem Landei aus Longford schon anderes erwarten.«
Plötzlich stimmt einer der Musiker »The Town I Loved So Well« an, ein melancholisches, politisches Lied über Derry in Nordirland. Im Nu kehrt Ruhe ein. Wer spricht, wird von den Umstehenden mit einem energischen »Psst« zum Schweigen gebracht. Selbst im lautesten Pub wird einem Sänger diese Höflichkeit entgegengebracht – wohl deshalb, weil er es schwerer als die Instrumentalmusiker hat, sich gegen den Lärm durchzusetzen.
O’Donoghue’s gehört bei den Anhängern irischer Volksmusik zu den bekanntesten Dubliner Wirtshäusern. Hier hat man den US-Senator Robert Kennedy zu einem Lied überredet, und hier haben sich die »Dubliners« kennengelernt und zum ersten Mal zusammen gesungen. In der Ecke hinter dem Musikantentisch hängen die gerahmten Porträtzeichnungen der bärtigen Bandmitglieder. An der gegenüberliegenden Wand klebt das Werbeplakat ihrer Deutschlandtournee im November 1976. »The Dubliners, Irlands berühmteste Folkgruppe«, steht da auf Deutsch. Die Rundreise führte die Band damals nach Münster, Köln, Kiel, Hannover, Berlin und in dreizehn weitere deutsche Städte.
Die »Dubliners«, von denen keins der Gründungsmitglieder noch am Leben ist, sind im Ausland auch heute noch das Aushängeschild der irischen Musik und tingeln nach wie vor um den Globus. Sie erwecken mit ihren rauen Trinkliedern und rebel songs den Eindruck, als seien sie die authentischen Vertreter einer kontinuierlichen Tradition. Irland verfügt zwar über die lebendigste Musiktradition Europas, doch von einer ungebrochenen Entwicklung kann keine Rede sein: Mitte des 20. Jahrhunderts war die traditionelle Musik in Irland fast ausgestorben. Die Dubliner Regierung hatte sie fast zu Tode geschützt: Hatten die englischen Besatzer die irischen Traditionen, die ihnen als Ausdruck eines Nationalbewusstseins suspekt waren und gefährlich erschienen, über Jahrhunderte unterdrückt, so machte sich der neue irische Freistaat nach seiner Gründung 1922 sogleich daran, die überlieferten Sitten und Bräuche zu pflegen – aber auf bürokratische Art und Weise. Die Regierung legte fest, welche Tänze, Lieder und Gesangsstile »unirisch« waren, und verbot sie kurzerhand. Genauso waren Instrumente wie Klavier, Schlagzeug und Banjo verpönt, weil sie das »Reinheitsgebot« der Regierung nicht erfüllten. Noch 1980 schrieb der Musikexperte Padraig O’Dufaigh in der Zeitschrift Treoir: »Nicht jedes Instrument passt zur irischen Musik. Geige, Blechflöte, Dudelsack, Querflöte und Akkordeon eignen sich am besten für echte irische Musik. Wir müssen einschreiten, wenn wir nicht wollen, dass die große Flut von außen, die unsere Heime überschwemmt, unsere Musik ertränkt.«
Der Dudelsack gilt als typisch schottisches und irisches Instrument. Tatsächlich gibt es jedoch siebzig verschiedene Arten aus aller Welt. »Der Vorteil gegenüber dem schottischen Dudelsack liegt darin«, sagte der aus einer Familie von Fahrenden stammende berühmte piper Finbar Furey einmal, »dass man beim Spielen des irischen Dudelsacks Bier trinken kann.«
Die Zeiten, als die Furey-Brüder bei Sessions – oder seisiúns, wie das mehr oder weniger spontane Musizieren im Irischen heißt – im Pub auftraten, sind vorbei. Heute füllen sie Konzertsäle. Es gibt aber eine ganze Reihe Nachwuchs-Piper, die, wenn man Glück hat, bei einer solchen Session auftauchen. Schon mit ihrer Lautstärke dominieren sie das Geschehen. Einundzwanzig Jahre dauert es, so sagt man, bis ein Musikant den Dudelsack beherrscht: sieben Jahre lernen, sieben Jahre üben, sieben Jahre vervollkommnen.
Die besten Musiker Nordirlands – und dazu gehören zahlreiche piper – spielen im Crosskeys Inn, dem schönsten Pub der Grünen Insel. Er ist nicht leicht zu finden, obwohl es an der Straße von Portglenone nach Randalstown inzwischen ein kleines Hinweisschild gibt. Wie alt die Kneipe ist, weiß niemand genau. Es könnten gut zweihundertfünfzig Jahre sein, wie eine Untersuchung des strohgedeckten Daches ergeben hat. Früher führte die Hauptstraße von Belfast nach Derry am Pub vorbei. Dort, wo heute der Parkplatz ist, wechselte die Postkutsche die Pferde. Die gekreuzten Schlüssel sind Teil des Wappens von St. Patrick, dem Schutzpatron Irlands. Patrick war auch der Heilige des alten Ordens der Hibernier, der regelmäßig im Crosskeys Inn tagte. Damals gab es in dem Laden auch Lebensmittel sowie ein Postamt. Davon künden uralte Rechnungen im Schankraum. Am Nachmittag, wenn der Pub noch recht leer ist, wirkt er wie ein Museum: An der Decke hängen unter anderem ein hölzerner Zigarettenautomat, eine Gasmaske aus dem Ersten Weltkrieg, eine Muskete; im Flur gibt ein hundertfünfzig Jahre altes Plakat Ratschläge, wie man die Kartoffelpest besiegen kann, verblasste Reklametafeln werben für längst vergessene Genüsse.
Doch abends, wenn sich der Pub füllt, ist von Museumsatmosphäre keine Rede mehr. Dann legen die Musiker im big room los. Touristen und Einheimische drängeln sich an den kleinen Tischen im Kerzenschein und bugsieren Tabletts voller Guinness oder Bushmills durch die Menge. Der Whiskey – in Irland schreibt man ihn im Gegensatz zu Schottland mit »e« – stammt aus der ältesten Brennerei der Welt an der Nordküste Irlands. Älter als Bushmills ist die Tradition der Schwarzbrennereien in den versteckten Stichtälern Nordirlands. An der Wand im Crosskeys Inn hängt ein Bleistiftporträt von Mickey McIlhatton, dem legendären Schwarzbrenner, der in den glens von Antrim hochwertigen, aber illegalen poteen – einen farblosen, starken Kartoffelschnaps – hergestellt hat. Der IRA-Mann Bobby Sands, der 1981 im Hungerstreik starb und kurz vor seinem Tod zum Unterhaus-Abgeordneten gewählt wurde, hat im Gefängnis ein Lied über den »King of the Glens« geschrieben. Christy Moore, Irlands Folksänger Nummer eins, hat den Song aufgenommen: »Im Glenravels-Glen, da lebt ein Mann, den manche als Gott bezeichnen würden; denn er heilt ihr Zittern, und eine Flasche von seinem Zeug kostet dich gerade mal dreißig Kröten: McIlhatton, bitte schön.«
Wenn sich die Musikanten die Seele aus dem Leib spielen und im big room kein Durchkommen mehr ist, dann wird schon mal die Küche für die Gäste geöffnet, und im Handumdrehen beginnt eine zweite Session. Wenn in dem riesigen Kamin, wo Kessel und Töpfe am Haken hängen, ein Feuer lodert und knisternd die Musik untermalt, dann versteht man, warum die Fremdenverkehrszentrale in diesem Pub einen Werbefilm gedreht hat.
Seltener trifft man bei Sessions auf Harfner. Dazu ist das Instrument wohl zu unhandlich und zu leise. Die Harfe beherrschte jedoch über Jahrhunderte die irische Musik. Sie wurde solo gespielt oder zur Begleitung von langen epischen Gedichten eingesetzt, die von den filidh vorgetragen wurden, den Hofpoeten von hohem sozialen Rang. Harfenmusik war die Kunstmusik der keltischen Society, die Musik der Oberschicht. Sie bestimmte, verbunden mit Tänzen und Gedichten, einen großen Teil des keltischen Lebens. Mit der zunehmenden Anglisierung Irlands begann der Niedergang der Harfner. Zwar spielten sie zunächst für beide Bevölkerungsgruppen, doch mit dem Ende der gälischen Zivilisation nach Cromwells Sieg 1649 war ihr Untergang nicht mehr aufzuhalten. Die Barden, die bis dahin eine untergeordnete Rolle spielten, begannen nun, eigene Lieder und Gedichte zu schreiben. Ihr Publikum kam, wie sie selbst, vor allem aus der Unterschicht. Doch die Hungersnot Mitte des vergangenen Jahrhunderts machte auch ihrer Musik ein Ende: In einer Zeit, in der die Bevölkerung durch Hungertod und Auswanderung auf die Hälfte dezimiert wurde, stand niemandem der Sinn nach Musik.
Die Versuche der kulturellen Wiederbelebung, die mit dem neuen Nationalbewusstsein Anfang des 20. Jahrhunderts unternommen wurden, wären fast an der Kulturpolitik des jungen irischen Freistaats und seiner rigiden Interpretation des »Irischseins« gescheitert. In den vierziger Jahren interessierte sich niemand mehr für irische Musik – man hörte amerikanische Schlager. Aus den USA kam jedoch auch der Anstoß, der der irischen Musik zu neuem Leben verhalf: Im Zug der Folk-Welle, ausgelöst durch Woody Guthrie, entstanden zahlreiche Balladengruppen irischer Emigranten, die amerikanische Einflüsse mit ihren traditionellen Liedern kombinierten. Die ersten waren die Clancy Brothers, die schon bald zu Plattenmillionären wurden. Ihr Erfolg sprach sich auch in Irland herum: »Es gab einen Folk-Boom, der kommerziell ausgenutzt wurde und meilenweit von den Quellen der Erneuerung irischer Musik entfernt war«, sagte der Musiker David Hammond. »Für viele Menschen klang das alles andere als angenehm.«
Zur selben Zeit gründete der klassische Komponist Seán O’Riada in Irland ein »Kammerorchester«, die »Ceoltóirí Chúlann«, mit ausgesuchten traditionellen Musikern, aus denen später die »Chieftains« hervorgingen – heute die Gralshüter der irischen Musik. Die Puristen waren zunächst entsetzt, doch der Erfolg gab O’Riada recht: Anfang der siebziger Jahre verschmolz seine Musik mit der Folk- und Balladentradition und löste damit eine Entwicklung aus, die bis heute nicht abgeschlossen ist. Donal Lunny, einer der einfallsreichsten Musiker Irlands, war unmittelbar an dieser Entwicklung beteiligt. Er sagt: »Christy Moore hat das alles in Gang gebracht, als er vor vielen Jahren ein paar Musiker zusammenbrachte. Er selbst, Andy Irvine, Liam O’Flynn und ich hatten damals die Idee, ein Lied mit einem traditionellen Instrumentalstück zu kombinieren. Viele Gruppen machten das dann nach.« Später waren es neben Moore und Lunny der Dudelsackspieler Davy Spillane und Gruppen wie »Planxty«, die »Bothy Band«, »Horslips« und »Moving Hearts«, die O’Riadas Werk fortsetzten und es mithilfe von Schlagzeug und Saxofon weiterentwickelten, sodass die irische Musik seit den achtziger Jahren auch die internationale Rockmusik beeinflusst.
Die traditionellen Sessions gibt es aber immer noch. Heute geht es jedoch weniger spontan zu: Die Sessions sind organisiert, viele Musiker verdienen sich ihren – wenn auch bescheidenen – Lebensunterhalt oder zumindest ein paar Freigetränke damit. Nachdem O’Donoghue’s in den sechziger Jahren den Weg bereitet hatte, erwarb sich Slattery’s, eine andere Dubliner Kneipe, in den siebziger Jahren mit den traditional music sessions, die jeden Mittwoch im ersten Stockwerk stattfanden, auch bei Touristen einen geradezu legendären Ruf. Während die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne hauptsächlich traditionelle Volkstänze spielten, war das Publikum zum Stillsitzen und Schweigen verurteilt. »Nur Zuhörer sind willkommen«, verkündete ein nicht zu übersehendes Plakat an der Wand, und selbst die Getränke mussten flüsternd bestellt werden.
Seitdem sind überall in Irland, bis ins kleinste Kaff, music pubs entstanden, wo an ein oder zwei Abenden in der Woche traditionelle Musiker zur Förderung des Umsatzes aufspielen. Vor allem Galway im Westen der Insel gilt als Musikstadt. Erste Adresse ist das Róisín Dubh in der Dominic Street: ein großer, verwinkelter Pub mit Wänden aus unbehauenem Stein. Durch Holzbalustraden ist der Raum in viele kleine Nischen unterteilt, in der einen gibt es einen Kamin, in der anderen ein Bücherregal. Im zweiten Raum hinter einem Torbogen steht die Theke. Die Live-Musik spielt im dritten Raum. Eine richtige Bühne mit Verstärkeranlage gibt ihr allerdings einen eher offiziellen Charakter.
Wenn es im Róisín Dubh zu voll ist, geht man zu Taylor’s gleich nebenan, aber da herrscht meist das gleiche Gedränge. Der Pub besteht aus einem schmucklosen Raum. Die lange Theke mit Holztrennwänden nimmt so viel Platz ein, dass es rechts nur Stehplätze gibt. Wer Live-Musik hören will, muss sich bis ans hintere Ende des Raums durchkämpfen. Links führt eine niedrige Tür zum hinteren Teil der Kneipe. Ein Tisch ist den Musikern vorbehalten.
Róisín Dubh und Taylor’s sind vor allem Studentenkneipen. Nur drei Minuten zu Fuß entfernt, im Hafenviertel Claddagh, liegt The Crane, wo früher ausschließlich Hafenarbeiter verkehrten. Der Schankraum mit seiner niedrigen Decke ist schäbig möbliert, an den wackeligen Resopaltischen spielen alte Männer Karten. Hinter der Theke stehen ganze Batterien kleiner Whiskeyfläschchen bereit – in Arbeiterpubs ein traditioneller Seelentröster für daheimgebliebene Ehefrauen. Gegenüber vom Tresen führt eine schmale Treppe nach oben. »Ladies«, verkündet ein Schild. Doch im ersten Stock ist nicht nur die Damentoilette, sondern auch ein gemütlicher Raum mit dunkelbraunen Dachbalken und gepolsterten Bänken. Es gibt wenige Orte in Irland, wo man mit mehr Begeisterung Musik macht. Die Qualität, das gibt Besitzer David Larkin gerne zu, schwankt, aber wenn die um den Tisch am Fenster gruppierten Musiker ihre jigs, reels und hornpipes spielen, dann herrscht auch an einem Montagabend Wochenendstimmung.
Die irische traditionelle Musik gliedert sich in zwei Kategorien: Instrumentalmusik, die zum überwiegenden Teil als Begleitung für Volkstänze diente, und Gesang, der meistens unbegleitet im »alten Stil« – oder Séan nós – vorgetragen wird. Séan nós ist eine Art rezitativer Gesang, der oft nur eine Oktave umfasst. Es gibt keine feste Melodie – sie wird von Strophe zu Strophe variiert. Dieser Stil ist eng mit der irischen Sprache verbunden und erinnert an orientalischen Gesang. Margit Wagner schrieb in ihrem Buch »Irland« darüber: »Man presst die Töne hervor, als sei man ein Muezzin, und nicht anders als deren östliche Töne kommen und gehen die irischen Melodien in gleichförmiger Weise.«
Wenn Des O’Halloran im Day’s Pub zu einem Séan nós ansetzt, verstummen die Gespräche. O’Halloran heißen viele auf Inishbofin, der kleinen Insel zehn Kilometer vor Connemara im Westen: Laut Volkszählung von 1993 sind es acht von vierundsiebzig Familien, aus denen eine ganze Reihe hervorragender Musiker hervorgegangen sind. Neben Des O’Halloran zum Beispiel Francie O’Halloran, der fiddler, und Michael Joe O’Halloran, der die bodhran spielt, eine mit Ziegenfell bespannte Trommel. Wegen der Musik kommen die Menschen im Sommer aus allen Landesteilen nach Inishbofin.
Gabriel O’Halloran steht am Tresen. Er ist Fischer, und er ist angezogen, als ob er auf hoher See wäre: Er trägt trotz der Wärme, die das Torffeuer im Kamin verbreitet, einen windfesten Anorak und eine schwarze Pudelmütze, unter der strähnige graue Haare hervorschauen. Er trinkt schnell. »Es ist schon eine Ironie des Schicksals«, sagt er. »Meine Tochter Pamela hatte immer Angst um mich, wenn ich auf See hinausgefahren bin, während ich mir nie Sorgen um sie gemacht habe. Und nun ist sie ertrunken.« Pamela war neunzehn. Nach einer feuchtfröhlichen Feier ist sie spätnachts vom Pier gefallen. Vor Kurzem war die Beerdigung.
Die Musiker legen zusammen und stellen Gabriel O’Halloran ein Pint hin. Paddy, der fiddler, hat sich fein gemacht. Er trägt ein weinrotes Jackett und spielt mit den beiden anderen fiddlern um die Wette. Sobald einer die ersten Takte eines Stücks gespielt hat, stimmen die beiden anderen sowie der Banjospieler und der Mann mit dem Knopfakkordeon ein, ihr Repertoire scheint unerschöpflich. Ab und zu steuert Des O’Halloran ein Lied bei.
»Vor zwanzig Jahren gab es auf Inishbofin noch keine Elektrizität«, erzählt der Dichter Seán Brophy aus Dublin. »Das Hotel hatte einen Generator, der furchtbaren Lärm gemacht hat. Wer einmal hier war, kommt immer wieder, weil Landschaft und Musik einmalig sind. Sich hier niederzulassen ist allerdings eine andere Sache: Man hat vor fünf Jahren versucht, arbeitslose Familien aus dem Dubliner Ghetto Darndale hier anzusiedeln. Davon ist nur noch eine junge Frau übrig, sie hat einen Einheimischen geheiratet. Die anderen sind alle wieder weggezogen, es war ihnen wohl zu einsam. Das Jahresende kommt auf Inishbofin schon im September. Danach beginnt der lange, harte Winter. Die Insel erwacht erst wieder zu Ostern. Und dann fängt auch die Musik wieder an.«