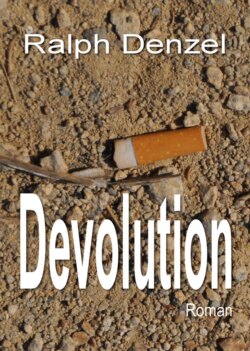Читать книгу Devolution - Ralph Denzel - Страница 7
Noah
Оглавление»Meine Damen und Herren« Der Moderator auf dem Bildschirm, dessen Haare bei Weitem nicht mehr so richtig saßen, wie sie es zu besseren Zeiten getan hatten, machte eine bedeutungsschwangere Pause. Auch hatte augenscheinlich die gesamte noch vorhandene Menge von Makeup und Puder nicht gereicht, die tiefen Augensäcke des Mannes zu überdecken. Er wirkte müde und verbraucht, während er die Worte von seinem Teleprompter ablas. Gleichzeitig schwang in seiner Stimme eine leise, unausgesprochene Angst mit, die er jedoch mit der Professionalität eines Reporters überspielen wollte, der es gewohnt, war über schreckliche Dinge zu berichten.
»Hiermit beenden wir unser Programm. Ich«, diesmal versagte ihm die Stimme trotzdem. Peinlich berührt blickte er an der Kamera vorbei. Vielleicht stand dort ein geliebter Mensch, den er in dieser Situation an seiner Seite hatte wissen wollen, vielleicht hatte es jedoch auch nichts zu bedeuten. Seine Stimme bebte und seine Augen glitzerten feucht. Er schluckte zweimal schwer, bevor er endlich die Contenance wiederfand und weitersprach.
»Eigentlich sollte ich mich jetzt bei Ihnen bedanken. Für die Treue zu unserem Sender und für die Unterstützung, die ich durch Sie in Ihren unzähligen Briefen erfahren habe.« Er machte eine Pause und blickte wieder neben die Kamera. Sein Blick wurde plötzlich stärker und direkter. Langsam fand er wieder zu der alten Professionalität, mit der er damals das erste Mal vom Asteroiden berichtet hatte.
»Aber ich glaube, dass Sie dies nicht hören wollen. Nachrichten haben immer eine besondere Funktion: Wir vermitteln Informationen und Neuigkeiten, klären die Menschen auf und helfen ihnen bei ihrer Meinungsbildung. Aber das können wir nun nicht mehr. Ab morgen wird es keine Nachrichten mehr geben – und auch keine Erde mehr, zumindest nicht mehr so, wie wir sie kennen. Ich – ich habe mich immer gefragt, was ich Ihnen in diesem Fall sagen soll. Als damals »Bright Bob« entdeckt wurde, war dies mein erster Gedanke: Was, wenn wir ihn nicht aufhalten können? Was soll ich dann meinen Zuschauern sagen? Heute sitze ich hier – und weiß es noch immer nicht. Vielleicht sind Sie gläubig, vielleicht sind Sie es nicht. Ich bin es nicht und als Reporter, Journalist und vor allem Familienvater gebe ich Ihnen heute keine Information mehr, sondern einen Ratschlag: Verbringen Sie die letzten Stunden auf Erden mit denen, die Sie lieben oder mit dem, was Sie am liebsten getan haben.«
Wieder ein kurzes Zögern. »Darum bin ich hier. Ich habe diesen Job geliebt.« Er brach ab und räusperte sich. »Ich habe diesen Job geliebt.« Er blickte an der Kamera vorbei. Seine Augen glitzerten noch stärker, als wäre er jede Sekunde so weit, wie ein Kind loszuweinen. »Es tut mir so leid«, flüsterte er mit belegter Stimme und weinte, vielleicht eine Minute lang. Eine Frau kam ins Bild, legte ihm die Hand auf die Schulter. Ihr Gesicht konnte man nicht sehen, denn sie wandte der Kamera ihren Rücken zu. Auch das, was sie mit diesem Mann flüsterte, war nicht zu hören, obwohl das Mikrofon voll aufgedreht war.
Der Moderator nickte immer wieder und schien langsam wieder etwas Kraft zu schöpfen. Irgendwann ging die Frau seitlich aus dem Bild. Sein Blick wurde wieder fester, ebenso wie seine Stimme. Nur die Tränen, die immer noch in kleinen Bächen seine Wange hinunterliefen, straften seine äußerliche Ruhe lügen.
»Ihnen allen viel Glück.« Eine Pause. Gefasst fuhr er fort. »Es sind nun noch sieben Stunden bis zum Aufschlag.«
Damit wurde das Bild schwarz. Sie spielten nicht die typische Erkennungsmelodie am Schluss, und es schlossen sich auch keine Wetterberichte an. Stattdessen zeigte der Fernsehbildschirm nur einen Countdown, der nun bei 7:12:03 stand.
Sieben Stunden, zwölf Minuten, drei Sekunden, eine ungefähre Schätzung, nicht mehr.
Noah schaltete den Fernseher aus und streckte sich mit knackenden Knochen. Aus seinem Schlafzimmer war ein leises Röcheln zu hören. Er kannte den Namen der Frau nicht, die dort auf seinem Bett lag und sich gerade eine Überdosis gesetzt hatte.
Vielleicht hätte er irgendwie versuchen sollen, ihr zu helfen, aber er konnte es nicht. Er wusste nicht, wie viel Gras er geraucht hatte. Vor knapp vier Stunden hatte er sich überlegt, ob er ebenfalls Heroin ausprobieren sollte, aber war beim Gras und beim Koks geblieben. Seine Begleiterin hatte er auf einer Drogenparty in der Innenstadt von Konstanz getroffen und sie mitgenommen. Es war nicht mehr schwer.
In den letzten Monaten hatte er eine Art von Devolution erlebt. Von einer funktionierenden, halbwegs friedlichen Gesellschaft hatte sich Deutschland innerhalb von wenigen Monaten zu einem panischen, anarchischen und brutalen Haufen entwickelt, der wie die Tiere nur noch auf primitive Urinstinkte reduziert war.
In seinem Schlafzimmer lag gerade das perfekte Beispiel für eben diese Entwicklung. Die Frau war Doktorandin an der Universität gewesen. Sie wäre kurz vor der Vollendung ihrer Arbeit gewesen, hatte sie ihm gesagt. Eine strahlende wissenschaftliche Karriere hatte vor ihr gelegen, ein Leben zwischen Vorlesungssälen, Seminaren und akademischen Würden in aller Welt. Aber jetzt würde ihr Leben mit einer Nadel im Arm enden, im Schlafzimmer eines Mannes, dessen Namen sie wahrscheinlich nicht kannte.
Wie ein Feuerwehrmann, der sich seine Sauerstoffmaske über das Gesicht gezogen hatte, klang es aus seinem Schlafzimmer. Ein rasselndes, quietschendes Geräusch, welches immer leiser wurde, bis es irgendwann verstummte.
Noah wollte schlafen. Mühsam kämpfte er gegen die Müdigkeit an, die sich als ein fast übermächtiger Feind erwies. Die Drogen in seiner Blutbahn ließen seine Glieder sich anfühlen, als wären sie mit einem bisher nicht entdeckten Schwermetall gefüllt. Torkelnd versuchte er sein Badezimmer zu erreichen, was er nach einer halben Ewigkeit auch endlich schaffte. Sein Schädel wummerte in unkontrollierten Schwindelanfällen, die ihm den Boden unter den Füßen wegzuziehen versuchten.
Er hämmerte auf den Lichtschalter direkt neben der Eingangstüre und die kleine Lampe, die unter einem alten Glasschirm versteckt war, flackerte ohne zu murren auf.
Es wunderte ihn, dass der Strom noch floss. Ebenso, dass das Wasser noch lief, als er den Hahn aufdrehte und eiskaltes Wasser in das Waschbecken laufen ließ. Er stellte sich vor, dass irgendein Mensch noch in den Stadtwerken saß und verzweifelt versuchte, alles am Laufen zu halten, einsam wie der Mann auf dem Mond. Irgendwie machte ihn dieser Gedanke wehmütig, auch wenn sein benebelter Verstand nicht ergründen konnte, warum.
»Ich habe diesen Job geliebt. Darum bin ich hier.« Die Worte des Moderators klangen noch leise in seinem Kopf nach und genügten ihm in dieser Sekunde als mögliche Erklärung.
Er steckte seinen Kopf ins Waschbecken. Wieder diese Müdigkeit, die ihn sogar jetzt fast einschlafen ließ, während sein Körper gegen die brutale Behandlung mit eiskaltem Wasser rebellierte.
Sein Gesicht begann erst zu kribbeln, bevor die Blutgefäße im Gesicht sich zusammenzogen und der typische, stechende Schmerz einsetzte, den man empfand, wenn eine Unterkühlung drohte. Sein ganzer Körper fühlte sich an, als wäre er in Watte eingepackt und ihm in den letzten Stunden fremd geworden.
Nach einer Weile begannen seine in den letzten Wochen stark malträtierten Lungen zu protestieren und mit einer kompromisslosen Beständigkeit nach Luft zu fordern. Irgendwann musste er diesem Drang nachgeben und tauchte prustend wieder auf.
Das Wasserbad hatte etwas Wirkung gezeigt. Während er laut schnaufend nach Luft schnappte, merkte er, wie sich das Blei in seinen Gliedern verflüssigte und er wieder etwas wacher wurde. Auch die tumbe Taubheit in seinen Gliedern wich einem wachsenden Gefühl, dass sein Arm wirklich zu ihm gehörte.
Er wiederholte diese Prozedur noch mehrmals, bis er sich fitter fühlte. Eigentlich war er immer noch weit davon entfernt, nüchtern oder überhaupt auch nur ansatzweise zurechnungsfähig zu sein, aber es würde wohl reichen, um zu seiner Verabredung zu gehen.
»Miau.«
Sein schwarzer, dicklicher Kater stand in der Badezimmertür und betrachte neugierig sein Herrchen. Müde gähnte die Katze und machte einen Buckel, bevor sie sich langsam und graziös auf Noah zubewegte. Laut schnurrend strich er um die Beine seines Herren und presste seinen Körper mit aller Kraft dagegen.
Er beugte sich hinunter und streichelte das Kinn des Tieres, welches genüsslich die Augen schloss und die Streicheleinheiten genoss.
»Hast du Hunger?«, fragte Noah mit undeutlicher Stimme. Seine Stimmbänder waren immer noch etwas von den Drogen gelähmt. Er musste sich mehrmals an der Wand abstützen, als er aus dem Badezimmer über seinen kahlen Flur in Richtung Wohnzimmer schwankte. Es wunderte ihn, dass sein Kater verstanden hatte, was er gerade gesagt hatte. Die Worte waren ihm wie ein undefinierbarer Buchstabenbrei vorgekommen, den er wie einen Kloß im Hals hochgewürgt hatte. Seine Katze jedoch, nun in freudiger Erwartung auf ihr Fressen, trippelte ihm zwischen den Beinen durch und miaute immer wieder hektisch.
»Gleich, gleich, mein Schatz«, murmelte Noah, als er endlich im Wohnzimmer war. Aus einem kleinen Futtermittelschrank, den er an seiner linken Wand direkt neben dem Katzenklo hingestellt hatte, holte er eine Dose Nassfutter heraus.
Das Tier wusste nun nicht mehr so richtig, wo es zuerst hinrennen sollte. Immer wieder raste der Kater zu seinem Fressnapf, welcher an der anderen Wand neben seinem deckenhohen Kratzbaum stand, nur um dann festzustellen, dass er noch immer leer war.
In seiner Unsicherheit, warum es noch kein Futter hatte, sprang das Tier in seinen Kratzbaum, legte sich kurz in seine Kuschelhöhle, sprang wieder heraus, rannte wieder zu Noah, miaute mürrisch, weil er es nicht schaffte, die Dose zu öffnen, rannte wieder zu seinem Fressnapf und zurück zu seinem Kratzbaum.
Als Noah endlich die Dose geöffnet und den Inhalt in den Napf geleert hatte, gab es für das Tier kein Halten mehr. Als hätte er die letzten Monate nichts zu fressen bekommen, stürzte er sich auf das Futter, verschlang es mit einer Gier, die ans Obsessive grenzte. Laut schmatzend schlang er alles bis auf den letzten Bissen hinunter.
Noah beobachte das Tier und fühlte sich auf einmal traurig, nur wusste er nun genau, woher diese Emotion kam. Es waren diese Abschiede, die einem so unendlich schwer fielen. In diesem Moment war er fast schon glücklich, dass er seit Jahren keinen Kontakt mehr mit seinen Eltern gehabt hatte und auch nicht das Bedürfnis empfand, dies zu ändern.
Aber sein Tier war seit fast vier Jahren sein ständiger Begleiter. Ein Begleiter, der immer da war, nie verurteilte und nie Vorwürfe machte. Eine bedingungslose Liebe, die er mit seinem Herren geteilt hatte.
Noah wandte sich ab, bevor er anfing zu weinen.
Er musste sich anziehen. Nackt wollte er nicht an den See gehen. Der letzte Ort in seinem Leben. Zum Glück hatte er noch ein paar Kleider in seinem Badezimmer, sonst hätte er jetzt ins Schlafzimmer gehen und dort die Leiche seiner Kurzzeitbekanntschaft sehen müssen. Sofern der »goldene Schuss« seine Wirkung nicht verfehlt hatte. Dies war ein Anblick, den er sich gern ersparen wollte.
Er brauchte wieder eine halbe Ewigkeit, bis er im Badezimmer war, auch wenn es dieses Mal ein bisschen schneller und koordinierter ging. Er zog aus seinem Rattanwäschekorb ein vergilbtes T-Shirt und eine dreckige Hose, ebenso wie eine Unterhose und ein Paar Socken. Für eine Sekunde schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf, der ihn erzittern ließ in seiner Endgültigkeit.
Die letzte Kleidung, die ich je tragen werde. Diese Socken und diese Unterhose, dieses T-Shirt und diese Hose. Er würde in diesen Kleidungsstücken sterben. Wie viele andere »letzte Male« würde er noch erleben?
Es kostete ihn etwas Mühe, die Sachen anzuziehen, und er stellte sich ungeschickt an wie ein Kleinkind, das zum ersten Mal selbst für seine Garderobe verantwortlich war. Sie muffelten etwas streng und einer konditionierten Handlung folgend nahm er sein Deo aus dem Regal und sprühte sich großzügig damit ein. Wenn ich sterbe, will ich nicht, dass der letzte Duft in meiner Nase der von Schweiß ist.
Wahrscheinlicher würde es jedoch wohl der Geruch nach verbranntem Fleisch sein. Die Erde würde zu einem riesigen Grillfest eingeladen werden. Auf dem Speiseplan stand: richtig, die gesamte Menschheit.
Guten Appetit.
Er seufzte leise und steckte seinen Kopf noch mal ins Wasser, um sich wacher zu machen. Es zeigte wieder etwas Wirkung, wenn auch nicht so sehr wie bei den ersten paar Malen, was wohl auch daran lag, dass es mittlerweile wärmer geworden war. Er schüttelte sich wie ein nasser Hund und die kleinen, perligen Wassertropfen verteilten sich über seinen grauen Badezimmerboden.
Es war Sommer – und was für einer.
Die Flora stand in voller Blüte, durchsetzte die Stadt mit einem angenehmen, wohlriechenden Duft, während sich im Bodensee aufgrund der Wärme wieder unzählige Algen bildeten. Dies führte dazu, dass der See besonders intensiv roch, was Noah als sehr angenehm empfand. Es war, als würde die gesamte Stadt vom Duft des Sees umschwebt, vor allem wenn der Wind günstig stand. Wenn nicht, dann lag ein anderer Geruch über Konstanz, der wie eine dunkle Prophezeiung das ankündigte, was in wenigen Stunden bittere Realität sein würde. Gerade jedoch strömten nur angenehme Aromen durch sein Fenster, die für ihn nach Sommer rochen. Verrottende Algen und Blumen, die sich ein letztes Mal aufbäumten, bevor der Herbst kommen und ihre intensiven Gerüche bis zum nächsten Jahr verschwinden würden. Manchmal verbanden sich die beiden Düfte auch zu einem Potpourri aus Blütenduft und See, was in Noah früher immer eine fast ekstatische Wirkung gehabt hatte.
Eigentlich hätten die Freibäder diese Saison wohl ein sehr gutes Geschäft gemacht, aber sie waren alle geschlossen geblieben. Die Menschen hatten andere Dinge im Sinn gehabt, als schwimmen zu gehen. Die, die es getan hatten, waren meistens nie wieder aus dem Wasser rausgekommen.
Sein Kater stand nun wieder in der Tür und leckte sich noch genüsslich die Lefzen. Dabei schnurrte er in einem wohligen Ton, der leise in Noahs Magen vibrierte wie eine Stimmgabel.
Noah drehte sich um und lächelte sanft auf das Tier herab. Langsam bewegte er sich auf den Kater zu und hob ihn hoch. Genüsslich schnurrte das Tier noch lauter und legte den Kopf auf die Schulter seines Herren. Die Augen waren in blindem Vertrauen geschlossen. Sein Körper war schwer und warm und ließ die Stellen an denen er auflag, schwitzen.
Langsam, jeden Moment mit seinem Kater genießend, ging Noah zurück in das Wohnzimmer, wobei er mit der freien Hand immer wieder den Kopf des Tieres streichelte. Er spürte einen Kloß im Hals, der sich langsam seinen Weg in seine Eingeweide bahnte.
Seufzend ließ er sich auf seine Couch fallen, die unter seinem Gewicht leise quietschte. Normalerweise hätte ihn es gestört, dass der Kater seine Haare über Noahs gesamte Kleider verteilte, aber heute war es ihm egal. Er legte ihn vorsichtig auf seinen Schoß, sodass sein Kater mit seinem Rücken zwischen seinen Beinen lag. Seine Pfoten hingen schlapp hinunter und zuckten ab und zu leicht, als würden kleine, wohlige Schauer hindurchfließen.
Zärtlich kraulte Noah den runden, prall gefüllten Bauch seines pelzigen Lieblings, der von seinem tiefen, sonoren Schnurren vibrierte.
»Na du? Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, was ich mit dir machen muss«, flüsterte er leise. Die Katze ignorierte das. Ihre Augen blieben immer noch geschlossen und das Schnurren blieb unverändert laut, als würde es für in diesem Moment nur die Streicheleinheiten und den bequemen Platz auf Herrchens Schoß geben.
Das Tier wirkte absolut friedlich. Im perfekten Einklang mit sich und der Welt und in einer Art Zustand, den Noah hoffte, in den nächsten Stunden ebenfalls zu erreichen. Er hatte es bisher nicht geschafft, diesen mit Drogen und Alkohol herbeizuführen, vielleicht würde er es nachher mit seinen Freunden schaffen.
Die wichtigsten Menschen in seinem Leben.
»Sei mir bitte nicht böse«, flüsterte er nochmals leise.
Seine Hand legte sich sanft um den Hals des Tieres, schloss sich zärtlich, als würde er eine antike Vase umfassen, die bei zu großem Druck zerspringen würde.
Zuerst kraulte er noch ein bisschen, vorsichtig und liebevoll, ließ das Fell durch seine Finger gleiten, ebenso wie die weiche Haut, die sich darunter versteckte.
Dann packte er grob zu und drehte den Kopf seines Katers einmal schnell nach links.
Das Knacken der Halswirbel schien durch den Raum zu hallen wie ein Missakkord auf einer Orgel.
Die Katze miaute nicht auf. Sie erschlaffte einfach nur noch etwas mehr in ihrer Position auf dem Schoß. Das Schnurren erstarb augenblicklich.
Vorsichtig streichelte Noah noch etwas weiter über den Bauch des Tieres, dann über dessen Kopf, der jetzt wie eine zu weich gekochte Nudel herunterhing und leicht baumelte. Tränen stiegen ihm in die Augen, als er sich der plötzlichen Stille im Raum bewusst wurde. Die Lefzen seines Katers hingen hinunter, sodass die Zähne entblößt wurden. Aber kein Schnurren oder wenigstens ein sanftes Atmen kam mehr aus dem Maul.
Er küsste zärtlich die Schnauze, streichelte über die Barthaare und über die dicken Backen der Katze. Das hatte sein Tier immer am meistens geliebt und hingebungsvoll seinen Kopf noch fester gegen Noahs Finger gepresst.
Jetzt passierte nichts.
Die leicht gelblichen Zähne des Tieres glitzerten noch von dessen Speichel. Gelblich – eigentlich hätte Noah seinem Kater die Zähne reinigen lassen müssen. Wenn man nur Nassfutter fraß, konnte sich irgendwann Zahnstein bilden, hatte ihm mal sein Tierarzt gesagt.
Das war nun aber auch nicht mehr wichtig.
Er hatte den Mann vor ein paar Tagen vor seiner Praxis gefunden, mehr durch Zufall als durch Absicht. Als er bei einem Spaziergang – rückblickend wusste er gar nicht mehr, was sein Ziel an diesem Abend gewesen war – an dem Haus vorbeikommen war, in dem sein Tierarzt gearbeitet hatte, war ihm durch das offene Fenster aufgefallen, dass ein Mensch dort in der Ecke kauerte. Als er näher gekommen war, hatte Noah entdeckt, dass es eben der Tierarzt seines Katers gewesen war. In seinem Arm hatte eine Nadel gesteckt und neben ihm hatte eine Ampulle mit einem sehr starken Schmerzmittel gelegen, welches er immer in seinem Giftschrank eingeschlossen hatte.
Er hatte sich mehr oder minder selbst eingeschläfert. Konnte man das als Ironie bezeichnen?
»Mach es gut, mein Dicker«, flüsterte Noah und hob sanft die Katze hoch. Den Kopf hielt er in seiner linken Hand, damit er nicht wie das Pendel einer Uhr hin und her schwang. Vorsichtig bettete er sein Tier in seine Kuschelhöhle.
Er rollte ihn zusammen, wie sein Dicker immer am liebsten geschlafen, gedöst oder einfach nur ausgeruht hatte. Für Katzen war dies ein wichtiger Unterschied, dachte Noah sich. Als das Tier so dalag, zusammengerollt zu einem rundlichen, schwarzen Fellball, konnte man kaum einen Unterschied zu dem Zustand erkennen, wenn er wirklich geschlafen hatte.
Noah wischte sich seine Tränen ab. Er würde nur hier weinen. Nur hier. Später nicht mehr, das hatte er sich geschworen. Er wollte so gehen, wie er gelebt hatte, mit viel Humor und ohne allzu viel Bedauern.
Sein Kater wirkte so friedlich, als hätte er den Frieden, den er bei seiner Streicheleinheit empfunden hatte, mit in die nächste Welt genommen. Noah fühlte sich erleichtert, dass sein Tier nicht leiden musste. Er hatte keine Ahnung, wie der Tod über sie kommen würde, all die Menschen, die vielleicht noch hier waren, wie schmerzhaft es sein würde. Der Einschlag war nur gute dreihundert Kilometer entfernt von Konstanz, daher würde diese Stadt wohl direkt in einer riesigen Explosion verbrennen.
Der Asteroid hatte den ungefähren Durchmesser von Frankreich. Viel würde da nicht mehr von der Erde übrig bleiben, dachte er bitter.
Er wollte nicht, dass sein Tier in den letzten Stunden seines Lebens in panischer Angst versuchen würde zu fliehen, was absolut hoffnungslos gewesen wäre. Oder noch schlimmer, was, wenn sein Kater in blinder Furcht nach seinem Herren suchen würde? Er wusste doch, wie schlimm es für seinen Dicken war, wenn er wegging. Meistens hörte er dann noch bis zur Haustüre das klägliche Miauen, als wolle sein Tier ihn zurückrufen. Er ertrug es nicht, wenn sein Herrchen weg war. Heute jedoch würde er nie wieder nach Hause kommen – und sein Tier hätte die letzten, grauenhaften Stunden auf Erden alleine und voller lähmender Angst verbringen müssen – ohne Chance auf Rettung. Nichts würde hier überleben, zumindest nicht in der nächsten Nähe. Das hatten Hunderte Experten immer wieder betont. Sehr aufbauend, wenn man direkt am Einschlagsort lebte.
Sie würden wohl alle verbrennen.
Wenigstens sein Kater würde davon nichts mehr mitbekommen.
Er würde nun für immer das tun, was er auch schon im Leben am liebsten gemacht hatte.
Schlafen.
Friedlich in seinem Lieblingsplatz.
Noah würde ihm bald folgen. "Keine Sorge, mein Großer, Herrchen ist auch bald bei dir", flüsterte er ein letztes Mal und richtete sich auf. Die gesamte Prozedur mit seinem Kater hatte die Müdigkeit und die Abgeschlagenheit aus seinen Gliedern vertrieben, als hätte man ihm intravenös Koffein verabreicht. Er fühlte sich so hellwach wie noch nie, auch wenn er immer noch sehr wackelig auf den Beinen war.
Es war nun ungefähr neunzehn Uhr, was ihm ein schneller Blick auf seine Uhr verriet.
Der Asteroid würde in ziemlich genau sieben Stunden einschlagen.
Er streckte sich nochmals und blickte auf seinen Kater. Einmal streichelte er ihm noch über den Kopf. Eine Stimme in ihm schien ihm zuzuflüstern, er solle hier bleiben. Solange er sein Tier berühren könne, würde er auch keinen Abschied nehmen, aber er schüttelte diese Worte ab, auch wenn sie ziemlich verführerisch für ihn waren. Dann verließ er seine Wohnung.
Zum letzten Mal – schon wieder ein letztes Mal – dachte er sich. Wehmütig drehte er sich noch einmal um, ließ seinen Blick über die Einrichtung schweifen, die unter einer zentimeterdicken Staubschicht lag. Er hatte eigentlich regelmäßig die Wohnung geputzt, was ihmn immer wieder spöttische Kommentare von seinen Freunden eingebracht hatte, wie »Wenn ich mal eine ordentliche Hausfrau will, dann heirate ich einfach dich!« Aber seit ungefähr einem halben Jahr hatte er auf diese Nichtigkeit keinen Wert mehr gelegt.
Die Tür schloss er nicht mehr ab, er schloss sie nicht einmal.
Die meisten Menschen hatten Konstanz verlassen und die die noch hier waren, waren aller Wahrscheinlichkeit nach mit anderen Dingen beschäftigt als mit Plündern. Aber auch wenn sie plündern wollten: Alles, was er nun noch in der Wohnung hatte, würde ihm in den nächstens Stunden nichts mehr bringen, so dachte er zumindest.
Devolution war das Wort der Stunde, und als die Medien noch regelmäßig sendeten und nicht nur so sporadisch, wie es in den letzten Wochen der Fall gewesen war, auch ein Wort, welches immer wieder gefallen war. Die meisten hatten versucht zu fliehen, weit weg, und die Stadt lag still und leise vor ihm wie ein riesiges Grab aus Beton.
Mindestens vier Menschen aber waren noch hier in Konstanz.
Er, Chris, Mick und Tom.
Sie hatten einen Logenplatz für den Weltuntergang – dies war eine Show, die man nur einmal sehen würde.
Der Tag war sehr, sehr warm und die Hitze flimmerte in spiegelnden Reflexionen über den grauen Asphalt.
Normalerweise hätten sich auf der Eichhornstraße die Wagen von Badegästen gestaut, die im Freibad am Bodensee auf den Wiesen die Sonne genossen und sich im See abgekühlt hätten. Heute waren keine Autos unterwegs. Eine gespenstische Stille lag über der gesamten Stadt. Nur die Stechmücken waren wieder unterwegs und Noah ärgerte sich, dass er kein Abwehrspray dabei hatte.
Er lief einen kleinen, unbefestigten Seitenweg an einem Gymnasium vorbei. Auf einem Sportplatz direkt daneben, der von einem hohen Drahtzaun umschlossen war, trafen sich normalerweise immer wieder Schüler der dazugehörigen Schule, um dort Fußball oder Basketball zu spielen. Heute bot sich Noah eine gänzlich andere Szene.
Auf der grünen Grasfläche lagen unzählige Leiber, die es miteinander trieben. Ein groteskes Gebilde aus Gliedmaßen, ein Stöhnen wie von Tieren. Noah beobachtete die Szenerie ein paar Sekunden, bevor Ekel in ihm aufstieg. So etwas gab es derzeit überall auf der Welt, dessen war er sich sicher. Meistens waren es verabredete Treffen gewesen, meistens über das Internet, zumindest solange es noch funktioniert hatte. Wenn man schon sterben musste, warum nicht während einer Orgie? Und wer wollte schon als Jungfrau abtreten?
Hier zeigte sich nun die gesamte Verdorbenheit der Menschheit, empfand Noah – und die so oft angepriesene Devolution.
Männer taten es mit Frauen, Frauen mit Männern, Männern mit Männern, Frauen mit Frauen, Jung mit Alt, hässlich mit hübsch – alles lag übereinander, stieß, stöhnte, grunzte. Es ging hier wahrscheinlich nicht einmal um Lustgewinn oder Befriedigung, sondern vielmehr um eine Grenze, die überschritten werden musste. Es an einem öffentlich Platz zu treiben – er hatte es selbst Hunderte Male gemacht in den letzten Monaten und daran nichts Verwerfliches gefunden, aber in diesem Moment, seinen toten Kater im Hinterkopf, schien ihm so etwas nur abstoßend.
Vielleicht war es ganz gut, dachte Noah, während er sich eine Zigarette ansteckte. Jetzt machte das ja schließlich auch nichts mehr, dass die Menschheit bald ein Ende finden wird einst die Dinosaurier. Es schien, als würde sie auf den letzten Metern ihrer Existenz geradezu darum betteln, doch auch wirklich ausgelöscht zu werden.
Nicht mehr ganz sieben Stunden, sagte seine Armbanduhr, deren helle Digitalziffern in einem unheilvollen Rot glühten.
Der Rauch prickelte in seiner Lunge und er zögerte eine Weile, bis er ihn wieder ausblies. Auch wenn seine Beine noch kribbelten und er sich nicht ganz standfest fühlte, war er um einiges klarer als noch vor einer halben Stunde. Unglaublich, wie revitalisierend der Tod eines geliebten Wesens den Geist erfrischen kann, dachte er traurig.
Er spürte an seinen Händen noch das samtene Fell seines Stubentigers, in seinen Ohren verwandelte sich das Gestöhne der Menschen auf dem Fußballplatz zu einem wohligen Schnurren seiner Katze. Wenn jemand in purer Lust einem anderen auf den Hintern schlug, wurde dieses Geräusch nicht mehr zu einem Klatschen, sondern zu einem Knacken, wie das Brechen eines Genicks. Er erschauderte, spürte den Widerstand des Knochen unter seinen Fingern nachgeben, als würden sie sich noch immer gegen seine Haut pressen.
Dann drehte er sich um und ging weiter. Das Schauspiel widerte ihn nur an und brachte zu allem Überfluss Gedanken in ihm hoch, die er am liebsten ganz tief vergraben hätte. Der Kies knirschte unter seinen Füßen und jeder Schritt wirbelte winzige Staubwolken auf, so trocken war der Boden. Er wollte sich nicht mehr umdrehen. Nicht noch einmal das Haus sehen, welches ihm die letzten Jahre ein Zuhause gewesen war. Die möglichen Erinnerungen schreckten ihn zu sehr ab.
Das Stöhnen und Kopulieren wurde langsam leiser, als er an einer Kreuzung ankam. Er überquerte die Straße, ohne nach links oder rechts zu schauen, denn es war nicht mehr nötig, dachte er zumindest. Doch als er wieder auf den Bürgersteig trat, vertieft in seinen düsteren Gedanken, rannte ihn ein Jogger fast um.
»Pass doch auf!«, schnaufte dieser zwischen zwei Atemzügen, die eine unheimliche Ähnlichkeit mit den Geräuschen hatten, die er gerade gehört hatte.
Erschrocken wich Noah zurück und blickte dem Mann hinterher, der ungerührt weiterlief. Nur ein leichtes, kaum merkliches Kopfschütteln deutete darauf hin, dass der Jogger sich gerade über diesen drogenverquollenen Mann aufregte, der ihn aus seinem Tempo gebracht hatte.
Der Jogger war ein etwas älterer Mann, vielleicht um die fünfzig Jahre alt, mit sehnigen Muskeln, die bei jedem Schritt unter der Haut nach oben gedrückt wurden, als würden sie versuchen, aus ihrem fleischigen Gefängnis auszubrechen. Seine Haut war braun gegerbt von der Sonne und seine Haare waren fast militärisch kurz gestutzt. Er trug ein ärmelloses, blaues Sportshirt, eine orangene Hose und nagelneue Nike-Laufschuhe. Die Farben der Schuhe hatten noch nicht den rußigen, grauen Ton von Sportschuhen, die sie nach spätestens einem Monat Dauerbenutzung annahmen, sondern leuchteten noch grell in der Sonne, als wären sie mit einem fluoreszierenden Licht eingeschmiert worden. An einem dünnen Arm hing ein Pulsmesser, der leise vor sich hin piepste, am anderen ein iPod .
»Hey, Sie da!«, rief Noah ihm hinterher.
Der Mann blieb stehen und drehte sich um, wobei er jedoch weiter auf der Stelle trabte. Mit der rechten Hand zog er sich die Kopfhörer aus den Ohren, mit der linken maß er, sich verrenkend, seinen Puls. Leise hörte man Eric Clapton aus den Kopfhörern singen. Er spielte gerade »Cocain«, wenn Noah sich nicht komplett irrte.
»Was ist denn?«, fragte sein Gegenüber ungeduldig, als hätte er irgendwo einen wichtigen Termin, zu dem er nun in aller Eile rennen musste. Aber niemand musste mehr irgendwo hin. Wir sind wandelnde Leichen, die dem Ende entgegensehen, ging es Noah durch den Kopf.
»Entschuldigung, aber«, Noah stockte kurz. Ein kleiner Schwindelanfall erfasste ihn. Entweder eine Nachwehe vom Nikotin, vom Kokain, oder einem anderen guten Stoff, der wahrscheinlich auf »in« endete. Das Bild des Joggers, der ihn mit einer Mischung aus Enervierung und aufkeimender Wut anblickte, verblich kurzzeitig wie ein Aquarell, bei dem der Maler zu viel Wasser benutzt hatte.
Noah presste die Augen zusammen, was ihm zu einiger Klarheit half und die Konturen des Mannes wieder schärfer machte.
»Was zur Hölle machst du hier?« Er hatte sich entschlossen, auf die Etikette zu pfeifen. Jetzt war es eh egal. Höflichkeit war eine Tugend derer, die einen fremden Menschen noch am nächsten Tag wieder sehen könnten. Alles, was von dem Mann gegenüber morgen noch übrig sein würde, könnte man höchstens unter einem Mikroskop untersuchen – wenn es noch Mikroskope geben würde.
»Wonach sieht es denn aus?«, antwortete der Jogger gereizt und wollte sich abwenden und weiterlaufen.
»Ich weiß, wonach es aussieht!«, erwiderte Noah im gleichen Tonfall. »Ich verstehe nur nicht – warum?« Er warf einen Blick zum Himmel.
Dort oben, irgendwo in diesem blauen Himmel stand er. »Bright Bob«. Noch konnte man ihn nicht sehen. Wie ein grausamer Attentäter versteckte er sich irgendwo hinter einer Baumkrone oder einer der Wolken, die wie Luftschiffe gemächlich über den Himmel zogen.
Der Jogger folgte seinem Blick und runzelte die Stirn, als würde er dort oben wirklich nichts sein. Nur ein blauer Himmel und einige Schäfchenwolken.
»Wo ist das Problem?«, fragte er achselzuckend.
»Vielleicht, dass uns in wenigen Stunden der Himmel auf den Kopf fällt?«, antwortete Noah, schockiert und auch gleichzeitig ein bisschen neidisch über so viel Gelassenheit.
»Quatsch«, antwortete der Mann.
»Wie bitte?« Noah blickte ihn irritiert an. »Da steht das Ding!« Er zeigte zum Himmel – irgendwo dort musste das »Ding« wirklich stehen. Sobald die Dunkelheit einsetzen würde, könnte man »das Ding« auch wirklich sehen, aber nun war der Himmel noch zu hell erleuchtet vom letzten Tageslicht, welches jemals auf die Stadt am Bodensee fallen würde.
»Es rast mit einer ungeheuren Geschwindigkeit auf uns zu! Beim Aufprall wird sich eine Hitze entwickeln, die alles in einem Umkreis von …« Wie groß war der Umkreis gleich wieder gewesen? Sein Gehirn war wohl noch nicht wieder auf volle Leistung hochgefahren.
»… in einem ziemlich großen Umkreis alles verbrennt. Was heißt also Quatsch?«
»Das ist Blödsinn, ok?«, erwiderte der Jogger. Seine Stimme klang etwas brüchiger, ängstlicher und hatte auch die grimmige Genervtheit verloren, die davor aus jeder Silbe getropft war. »Das ist absoluter Blödsinn!«, setzte er trotzig hinzu. Sein braunes Gesicht spannte sich zu einer seltsamen Maske, auf der mehrere Emotionen gleichzeitig wie auf einem Schlachtfeld um die Vorherrschaft kämpften. In der einen Sekunde hatte die Angst die Oberhand, in der nächsten war es Ignoranz und dann plötzlich wieder Zorn. »Man hat gezeigt, dass das »Ding« nicht groß genug ist, um durch unsere Atmosphäre zu dringen. Die Messungen von Henrys sind doch allesamt widerlegbar. Die Flugbahn des Asteroiden wird dazu führen, dass er genau an der Atmosphäre abprallen wird, und auch wenn er eintritt, so wird er verglühen! Die Größe von »dem Ding« ist völlig falsch berechnet worden!«, sagte er mit einer Sicherheit, die Noah kurzzeitig an ein Kleinkind erinnerte, während er jede mögliche Theorie aufzählte, die während der letzten Monate von ängstlichen Wissenschaftlern in die Welt hinausposaunt worden war. Alle hatten eines gemeinsam gehabt: In der blanken Hoffnung, dass das Ende der Welt vielleicht doch noch um einige Jahre verschoben worden war, hatten sie Daten bewusst oder unbewusst falsch gelesen, uminterpretiert, verschoben, so lange an ihnen geschraubt, bis ihre Theorien halbwegs glaubwürdig geworden waren.
Selig die, die sich in Selbstbetrug wiegen können, hatte sein Priesterfreund Tom dies einst zynisch kommentiert.
»Wir werden alle sterben!«, entgegnete Noah so kühl, dass er vor seinen eigenen Worten zurückweichen musste. Er zog eine neue Zigarette aus der Tasche und zündete sie an, während diese Worte in seinem Schädel nachhallten und sich langsam zu all ihrer grausamen Bedeutung entfalteten.
»Das ist Blödsinn! Warum glaubt jeder diesen Blödsinn?« Der Mann sprach sich in Rage. »Keiner wird sterben. Und ich muss jetzt weiterlaufen. Ich muss fit bleiben. Morgen muss ich meine Mutter besuchen. Sie wohnt in der Rosenau. Sie wartet immer auf meinen Besuch.«
Noah wollte den Mann anbrüllen, ihn schlagen, ihm klarmachen, dass er verrückt war, aber er ließ es. Eine Erkenntnis erfasste ihn. Nicht die letzte in seinem Leben.
Er drehte sich um und ging, sagte nichts mehr. Der Jogger lief weiter, immer weiter.
Irgendwann, es war schon lange dunkel geworden und »Bright Bob« stand hell und unübersehbar am Firmament, ungefähr zu der Zeit, als sein iPod den Jogger immer wieder mit einer mechanischen Frauenstimme »Battery low« gewarnt hatte, war der Mann zusammengebrochen. Er war zu diesem Zeitpunkt fast auf der anderen Seite des Sees angekommen und seit zehn Stunden nur am Rennen gewesen. Unbewusst hatte er versucht, vor seiner eigenen Angst davonzulaufen, aber diese war immer schneller gewesen, wie das Rennen "Igel gegen Hase".
Er hatte nicht gespürt, wie es gekommen war. Sein Herz, kräftig und mit starken Muskeln, hatte der Belastung jedoch irgendwann nicht mehr standhalten können und aufgehört zu schlagen. Wie ein gefällter Baum war der Mann auf einem Schotterweg nach vorne gekippt, hatte sein Gesicht in den Dreck gegraben und war tot gewesen. Den Asteroid, »das Ding«, hatte er nie gesehen.
Was wäre jedoch passiert, wenn Noah diesem Mann gesagt hätte, dass die meisten Patienten in den Pflegeheimen »euthanisiert« worden waren? Er wollte nicht das Wort »eingeschläfert« benutzen, irgendwie empfand er den Ausdruck sogar in diesen Zeiten für Menschen als respektlos. Es war ein letzter Gnadenakt für diese Patienten gewesen. Genauso wie für die auf den Intensivstationen. Wenigstens war dies die Geschichte im Fernsehen gewesen. Dann hatten Ärzte tapfer in die Kamera geblickt und ihren dankbaren Patienten ein Schlafmittel injiziert, manche hatten die Dreistigkeit besessen »Schlafen Sie schön!« zu sagen. Ein Arzt hatte doch sogar wirklich die Frechheit besessen zu sagen: »Einer muss den Job ja machen.«
Noah wusste jedoch, dass die Menschen mehr als einmal einfach sich selbst überlassen worden waren. Chris hatte ihm gegenüber etwas in diese Richtung angedeutet, dann jedoch das Thema sehr schnell wieder gewechselt, so wie er es in den letzten Monaten immer getan hatte, wenn sie über irgendwas gesprochen hatten, das Leid oder Tod beinhaltete.
Es waren die heimlichen Geschichten, die immer die Runde machen. Der Pizzabäcker spuckt in den Teig, der Schuhverkäufer trägt am liebsten die Damenschuhe selber, der Sohn von einem Geschäftsführer ist in der Psychiatrie, weil er kleine Tiere foltert. Bösartige, kleine Geschichten, die sich wie Tumore ausbreiten und ganze Leben zerstören konnten. Auch der Weltuntergang war kein Heilmittel gegen solche Arten von Klatsch gewesen, wie Noah hatte feststellen müssen.
In dem Altenheim, in dem die Schwester meines Freundes gearbeitet hat, haben sie die Patienten einfach zurückgelassen. Diese Geschichte hatte ihm ein zugedröhnter Rastafari erzählt, den er vor einigen Wochen in der Innenstadt getroffen hatte. Die Alten haben wochenlang nach einer Schwester gebrüllt, aber nie ist jemand gekommen. Er hatte dabei einen leichten schwäbischen Akzent gehabt, was Noah damals, trotz der ernsthaften Thematik, zu einem Lachen gebracht hatte.
Jetzt war ihm jedoch nicht nach Lachen zumute.
Das schreckliche Bild von bettlägerigen Patienten stieg in seinem Kopf hoch. Die Windeln voller Kot und Urin, lagen sie dort, unfähig sich zu bewegen. Falls ihr Verstand noch fit genug war, um zu verstehen, was hier gerade passierte, würden sie wohl in blanker Todesangst daliegen und gedemütigt in ihren eigenen Exkrementen auf den sicheren Tod warten. Demenz war wohl doch nicht immer das Schlimmste. Die Menschen, denen ein solches Schicksal bevorstand, waren hoffentlich dieser Welt weit genug entrückt, als dass sie noch etwas davon mitbekommen konnten.
Er erinnerte sich an die Schlangen, die sich vor den Krankenhäusern gebildet hatten. Jeder hatte gehofft, er würde ein »Schlafmittel« oder sonst irgendetwas bekommen, damit er seinem Leben ein Ende setzten könnte, wenn er es wollte und nicht, wenn es ein Himmelskörper bestimmte. Ein lächerlicher Versuch. Das, was dagewesen war, war entweder von den Angestellten direkt an Patienten ausgegeben oder geklaut worden. Wartende, die Schwestern und Ärzte angefleht, bedroht und zusammengeschlagen hatten, in der Hoffnung, ein Mittel für ihren Abgang zu bekommen, waren meistens leer ausgegangen.
Das war natürlich vor »Silencium« gewesen. Danach hatte es nur noch vor dem Stadion Schlangen gegeben.
Schlange stehen um zu sterben. So verrückt konnte nur Deutschland sein.
Der Jogger war nur noch ein kleiner, blauer Strich in einiger Entfernung und auch Noah setzte seinen Weg fort. Vielleicht glaubte der Mann wirklich, was er gesagt hatte. Vielleicht wusste er jedoch auch, wie die Realität aussah. Noah schämte sich, dass er so reagiert hatte. Jeder Mensch ging mit dem Ende auf seine Weise um. Vielleicht war es sogar die beste Weise, wie der Jogger damit umging. Oder Margnuson hatte doch recht gehabt.
Er kam an einem Mehrfamilienhaus vorbei, während er darüber nachdachte.
m Augenwinkel nahm er eine Bewegung im zweiten Stockwerk wahr. Ein Mann von ungefähr vierzig Jahren stand dort an der Brüstung. Seine Kinder saßen darauf. Um ihre Hälse waren Stricke gebunden, die mit der Metallverstrebung verbunden waren.
Noah schluckte, auch wenn er noch nicht ganz genau verstand, was hier eigentlich gerade passierte.
Es waren drei Kinder, zwei Mädchen von circa dreizehn und sieben Jahren und ein Junge von ungefähr fünf, vielleicht auch jünger.
Der Kleine grinste Noah an. Für ihn schien das alles ein großes Abenteuer zu sein. Eine Ausnahmesituation, die es mit der kindlichen Neugier zu erforschen galt. Er winkte fröhlich, während er die Beine über die Brüstung baumeln ließ und freudig gegen die Holzverkleidung des Balkons hämmerte.
Er drehte sich zu seinem Vater um. Der Mann weinte unablässig, als er seiner Ältesten über den Kopf strich und versuchte, sie zu trösten. Er wandte seinem Sohn den Rücken zu, sodass die Tränen vor ihm verborgen blieben.
Leise und kaum hörbar trieben die letzten Worte zwischen dem Vater und seiner Tochter zu Noah. Bei einem normalen Abend in Konstanz hätte er sie nicht verstanden, dazu wären die Hintergrundgeräusche zu laut gewesen. Die Menschen am See, die sich unterhalten hätten, die Köche vom Gourmetrestaurant in einigen Metern Entfernung, die rauchend über ihre Dienstpläne sprachen und sich über die Sonderwünsche der Gäste mokierten. Bis auf das leise Stöhnen im Hintergrund war es jedoch ruhig, absolut ruhig.
Und so wurde er Zeuge von einem weiteren letzten Mal.
»Ganz ruhig, mein Schatz, ganz ruhig«, schluchzte der Mann. »Es geht ganz schnell. Wie wenn du mit einer Achterbahn fährst. Erinnerst du dich, letztes Jahr mit Mama im Europapark? Wie im Silver-Star. Kurze Zeit bist du schwerelos – und dann …« Er stockte, wischte sich über die Augen, schluckte schwer.
»Dann sind wir wieder bei Mama!« Er küsste seine Tochter sanft auf den Kopf. Dabei presste er seine Augen fest zusammen, als wollte er die Realität um sich herum ausblenden. Seine Lippen klebten auf den braunen, schulterlangen Haaren seines Kindes, das unablässig schluchzte. Nach einer halben Ewigkeit löste er sich von ihr, streichelte über ihre Wange und legte seinen Arm um seine andere Tochter.
»Hätten wir es nicht auch so machen können wie Mama?«, fragte die Ältere. Sie bemühte sich mit all ihrer Kraft, die Fassung zu bewahren.
Noah hätte eigentlich wegschauen sollen. Aber er konnte nicht. Er spürte einen Kloß in seinem Hals, der ihm die Luft zum Atmen nahm. Es war ein ekelhaftes, grauenhaftes Schauspiel, was sich ihm hier bot. Seine Beine wurden steif wie Stein.
»Weil wir keine Medikamente hatten. Wir hatten nur ganz wenige und die Mama hat die meisten genommen. Der Rest reicht nicht. Und am Stadion war keiner mehr.«
»Warum hat sie uns keine übrig gelassen?«, fragte die etwas jüngere Tochter. Ihre Stimme klang schrill und durchdringend und bebte bei jedem Wort voller panischer Angst.
»Papa, wann darf ich denn jetzt endlich fliegen?«, nörgelte der kleine Junge und klopfte jetzt ungeduldig mit seinen Füßen gegen die Balustrade. Den fremden Mann, der vor ihrem Balkon stand und sie mit einem entsetzten Gesicht anstarrte, bemerkte er gar nicht.
»Gleich, Flo!«, sagte der Mann verzweifelt und mühevoll. Seine Stimme war kurzzeitig streng und böse geworden, aber er hatte sich noch rechtzeitig gefangen. Dann drehte er sich wieder zu seiner Tochter, lächelte sanft, streichelte ihr über den Kopf.
»Seit wann willst du denn Medikamente schlucken?« Durch seinen Tränenvorhang zwinkerte er ihr kurz zu. »Wäre ja das erste Mal gewesen, dass du das freiwillig machst.« Er küsste sie erneut und streichelte auch ihren Kopf, presste ihn gegen seine Brust. Das Schluchzen seiner beiden Mädchen wurde lauter und lauter und hallte gedämpft von seinem bebenden Brustkorb durch die leeren Straßen.
»Ich liebe euch. Ich liebe euch so sehr. Das Schönste was ich erleben konnte, war …« er brach ab, sprach nicht weiter, sondern handelte, bevor ihn der Mut verließ – und schubste die beiden Mädchen vom Balkon.
Ein kurzer, panischer Aufschrei dröhnte vom gegenüberliegenden Haus und erzeugte ein schreckliches Echo. Dann baumelten die beiden Mädchen an ihrem improvisierten Galgen.
Wenigstens habe ich das Knacken nicht gehört, dachte sich Noah. Tränen stiegen ihm in die Augen. Er wollte gehen, das hinter sich lassen, aber dieses grausame Schauspiel ließ ihn nicht los, hielt ihn gefangen wie eine Würgeschlange.
Er sah wieder seinen Kater vor seinem inneren Auge. Wie bei den Kindern hatte auch dort der Kopf so abartig unnatürlich gebaumelt. Der Kopf des Tieres verwandelte sich in die alte Großvateruhr seiner Eltern, die sie immer in ihrem Wohnzimmer stehen hatten. Nur dass das Pendel nicht aus Messing war und bedächtig hin und her schwang – nun waren es die Köpfe der Mädchen, die hier wie Verbrecher aufgehängt worden waren und sanft in der Abendbriese baumelten.
»Papa! Guck! Miriam und Anna schweben! Guck doch, Papa!«, kreischte der Junge voller Begeisterung. »Guck doch, Papa! Guck! Sie fliegen!«
Der Mann war über die Brüstung gebeugt, weinte hemmungslos. Das war wohl zu viel für jeden Menschen – ganz zu schweigen für einen Vater. Sein Junge jedoch beugte sich immer weiter nach vorne und Noah spürte, wie sich in seiner Kehle ein ängstlicher Schrei bereitzumachen schien. Pass auf, Kleiner, sonst fällst du runter.
»Darf ich jetzt auch fliegen, Papa? Darf ich? Darf ich?«
Es dauerte eine Weile, bis der Mann sich wieder aufraffte.
»Warum weinst du denn?«, fragte sein Sohn jetzt ein bisschen beunruhigt. Wahrscheinlich war er davor zu sehr damit beschäftigt, sich auf das vermeintliche Fliegen zu freuen und hatte so auch nicht mitbekommen, welches Drama zwischen seinen Schwestern und seinem Vater abgelaufen war. Nervös blickte er seinen Vater an.
Dieser riss sich zusammen. Er drehte sich kurz weg, wischte sich über die Augen und schnaufte laut ein und aus. Sein Blick ging in Noahs Richtung, aber er blickte direkt durch ihn hindurch, als wäre er gar nicht da. Nur wenige Sekunden schien er ihn zu bemerken, als seine Augen flehentlich zu sagen schienen: Bitte verurteile mich nicht. Ich mache es für meine Kinder.
Dann drehte er sich zu seinem Sohn. Langsam und bedächtig ging er auf ihn zu, streichelte auch ihm über den Kopf und zerzauste ihm die Haare. Noah hatte keine Kinder und er wusste nicht, wozu man fähig war, wenn man welche hatte. Aber nun sah er, wozu man wohl fähig sein konnte, wie intensiv die Liebe zwischen einem Vater und seinem Sohn sein konnte.
Selbst in dieser ausweglosen Situation versuchte der Mann seinem Sohn die Angst zu nehmen, aus allem ein Spiel zu machen, einen Spaß. Man spürte die Liebe zwischen den beiden. Diese intensive, pure Liebe.
Er kümmerte sich nicht um seine eigene Angst, sondern jetzt nur um seine Familie und seine Kinder. Noah wühlte dies zutiefst auf. Sein Magen verkrampfte sich schmerzhaft, als der Mann sich zu seinem Sohn beugte.
»Na, Captain Flo?« Er lächelte, obwohl ihm immer noch die Tränen über das Gesicht liefen. »Ready for take off?« Er grinste sehr gequält. Dem Kleinen entging das wohl nicht.
»Warum weinst du denn, Papa?«, fragte der Junge mit einem besorgten Unterton. Sein zuvor so fröhliches Gesicht war ernst geworden und Noah bemerkte, dass auch der Vater wieder nervöser wurde. Die Fassade bröckelte langsam wie alter Putz von einer Wand.
»Ach, das ist nichts«, winkte der Vater ab. »Ich – ich hab mir den Zeh angeschlagen, wie du letzte Woche, erinnerst du dich?«
Der Junge nickte. »Ja, das weiß ich noch. Das hat ganz wehgetan.«
»Ja, und dann hast du ein Eis bekommen, nicht wahr? Und dann war es schon fast wieder vorbei, erinnerst du dich?« Die Wörter sprudelten aus in einem unaufhaltsamen Schwall aus ihm heraus.
Das Wort »Eis« ließ den Jungen wieder lächeln. »Ja, das war lecker.« Er rieb sich über den Bauch und kicherte fröhlich.
»Genau. Und nachher essen wir alle Eis, Kumpel.« Er stockte und schluckte schwer. »Soooo viel Eis, bis uns die Bäuche wehtun. Dann sind wir aufgebläht wie ein Fass.« Der Mann hielt sich die Hände vor den Bauch und blähte seine Backen, um es dem Jungen plastisch zu zeigen. Nur seine Augen spiegelten die vernichtende Verzweiflung wider, jedoch schien die Emotion nicht greifbar für das kleine Kind vor ihm zu sein.
Sein Sohn, Flo hieß er, kicherte noch etwas lauter.
Noah war starr vor Bestürzung. Er wollte schreien, der Mann sollte es lassen, er sollte den Jungen leben lassen – aber wofür? In wenigen Stunden würden sie eh alle tot sein. Und wahrscheinlich war dieser Tod gnädiger.
»Also, du fliegst jetzt ein bisschen rum, aber nicht zu weit weg, damit ich dich noch sehen kann.« Er zögerte, zog die Nase hoch und sprach dann mit brüchiger Stimme weiter. »Währenddessen hole ich das Eis aus dem Keller und bereite es vor, damit es nachher leicht geschmolzen ist, wie du es gerne hast! Und dann wecke ich die Mama auf, damit sie dich fliegen sieht, ok?«
»Ich will Schoko! Und Erdbeere!«, sagte das Kind.
»Natürlich! Ich weiß …« Eine Pause. »Ich weiß …«
»Also.« Der Mann trat hinter den Jungen, umarmte ihn noch einmal zärtlich. Nach einer gefühlten Ewigkeit löste er sich und legte seine Hände auf die Schultern des Kindes. Noah sah die Lippen des Mannes beben und wie sein Gesicht kurz davor stand, komplett in einem erneuten Heulkrampf zu entgleisen.
»Ready for Countdown!«, verkündete er und das Kind klatsche voller Vorfreude auf das »Fliegen« und das Eis in die Hände. Nervös rutschte es auf der Balustrade vor und zurück.
»10, 9, 8, 7 …«
Noah war zu einer Salzsäule erstarrt. Das Grauen, was sich vor seinen Augen abspielte, war mehr, als er sich in seinen schlimmsten Albträumen hätte vorstellen können. Er wollte schreien, über diese gesamte verdammte Situation und über diese Ungerechtigkeit, die er hier gerade erleben musste. Er wollte brüllen, aus diesem Albtraum aufwachen – er wollte sofort tot umfallen. Wenn er sich vorstellte, dass er nun noch etwas über sechseinhalb Stunden leben musste, war dies eine unerträgliche Vorstellung für ihn – die Hölle hätte wohl nicht schlimmer sein können.
»6,5,4,3,2,1 …«
Die Zeit schien stillzustehen.
»Lift off.« Der Mann weinte diese Worte mehr als dass er sie aussprach, fiel in sich zusammen, als er seinen Jungen über die Brüstung schubste.
Für wenige Sekunden schien das Kind wirklich zu fliegen. Der Strick um seinen Hals schwebte in der Luft, genauso wie das Kind.
Er schwebte einem Engel gleich, ruderte mit den Ärmchen wie ein Vogel. Die Luft war erfüllt von Hitze, Staub und dem fröhlichen Jauchzen des Jungen.
Für wenige Sekunden schien die Welt ein schöner Ort zu sein und nicht ein riesiges Massengrab.
Das Seil spannte sich.
Das Jauchzen erstarb so ungemein plötzlich.
Noah spürte, wie jegliche Kraft aus seinen Beinen wich, genauso wie das Leben aus dem Gesicht des Jungen.
Wenigstens war sein Genick sofort gebrochen, genauso wie bei seinen Schwestern – nicht auszudenken, wenn der kleine Junge jetzt dort baumeln würde, in einem letzten grausamen Todeskampf, bis sein Körper den Sauerstoffmangel nicht mehr hätte kompensieren können und er dann endlich gestorben wäre.
Noah musste sich setzen. Wenn noch irgendwelche Drogenspuren in seinem Körper gewesen waren, jetzt waren sie aus seinem Körper geschwemmt worden. Er zitterte am ganzen Leib.
Er fühlte, wie jegliche Lebensgeister aus seinem Körper wichen.
Er würde genau hier bleiben. Ja, genau hier würde er sterben.
Genau hier.
Der Mann verließ den Balkon. Eine Tür wurde aufgeschoben. Noah hörte das nur. Von seiner sitzenden Position aus konnte man nur die drei baumelnden Kinder sehen, die der Größe nach in aufgereiht leise hin und her schwangen.
Dann hörte man nichts mehr.
Er würde nie erfahren, wie sich der Mann das Leben genommen hatte.
Nie würde er wissen, dass der Mann danach zusammengebrochen war, mehrere Stunden seinen Körper von Heulkrämpfen hatte schütteln lassen, bis er keine Tränen mehr gehabt hatte. Dann hatte er seine Kinder abgehängt, mit Flo hatte er begonnen. Die blauen Würgemale an den kleinen, zarten Hälsen hatten ihn fast verrückt gemacht. Nacheinander hatte er seine Kinder in das Elternschlafzimmer gebracht und sie auf das Bett neben ihre Mutter gelegt. Auch wenn er seine Frau für ihren Egoismus hasste, so war sie doch die Mutter seiner Kinder gewesen und für dieses Geschenk würde er ihr ewig dankbar sein.
Er hatte sich zwischen seine Familie gelegt, die kalten Körper, die langsam hart und steif wurden, und hatte sie gestreichelt. Er hatte nichts mehr von der Welt mitbekommen, die wenige Stunden später in einem gleißenden Feuerball zerstört wurde und ihn von all seinen Qualen befreite. Im Tod war die Familie zu einer großen Aschewolke verbrannt.
Es war nur ein Schicksal von Milliarden, welche meistens nach dem gleichen Muster abliefen. Die Menschen mussten ihre Familie zurücklassen, sich von ihr trennen – mit der Ungewissheit, wie es danach weitergehen würde, aber mit der Gewissheit, dass es in dieser Welt kein Wiedersehen mehr geben würde.
Es dauerte, bis Noah endlich wieder die Kraft fand, sich aufzurichten. Immer noch fühlte er sich, als sei jeder Muskel in seinen Beinen durch Gummi ersetzt worden. Die Eindrücke waren erschlagend gewesen.
Es hatte überall Selbstmorde gegeben. Millionen, Milliarden vielleicht.
Aber es war eine Sache, wenn man in den Nachrichten zwischen dem Wetterbericht und den neusten Eskapaden der Bundesregierung als Lückenfüller die Nachricht hörte, dass sich wieder eine Gruppe Verrückter vergiftet hatte und etwas ganz anderes, wenn man so etwas live sah und vielleicht das Blut in seiner Nase roch – oder das Knacken von Kinderhälsen hörte.
Er erinnerte sich noch gut, als es sicher geworden war, dass der Asteroid die Erde treffen und die Menschheit vernichten würde. Das öffentliche Leben war so lange weitergelaufen, wie es irgendwie möglich gewesen war, als würde nie etwas passieren. Doch irgendwann wurde den Menschen klar, dass dies nicht mehr lange so sein würde. Die Gesellschaft zerbrach nicht sofort und schlagartig, sondern bröckelte zuerst langsam vor sich hin, bevor sie wie ein Kartenhaus zusammenkrachte.
So war es auch zu erklären, dass man hier in Konstanz im Seestadion die Leichen hatte stapeln müssen, aus Platzmangel, denn die regulären Leichenhallen waren hoffnungslos überfüllt von Selbstmördern, die den üblichen Betrieb mit Verblichenen gehörig störten.
Der Münsterturm hatte abgeriegelt werden müssen, nachdem sich eine ganze Gruppe von Menschen dort hinuntergestürzt hatte. Es hatte eine Art Verabredung sein müssen, wie sie damals öfter zustande gekommen war. Noah war damals zufällig in der Innenstadt gewesen und hatte dieses Spektakel miterlebt.
Fump, Pflatsch.
Fump, Pflatsch.
Fump, Pflatsch.
Die heutigen Wetteraussichten von Konstanz: Örtlich Niederschlag von verzweifelten Menschen. Nach dem 11. September war aus Respekt vor den Opfern der Song »It’s raining men« nicht mehr gespielt worden. Während Noah nun wie unzählige andere Menschen schockiert und unfähig etwas zu machen diesem Schauspiel zuschaute, dröhnte dieser Song in seinem Kopf. Jedoch war es nicht die beschwingte Partymusik, die man von jeder besseren Coverband an einem Abend mindestens einmal hörte: Für ihn klang es wie der Gesang der Hölle. Egal wie sehr er sich auch anstrengte, das Lied abzustellen, es gelang ihm einfach nicht – es schien sogar, dass die Menschen fast im Takt des Liedes auf dem Pflastersteinboden vor dem Münster aufklatschten. Einer, ein junger Mann, höchstens neunzehn, landete besonders nahe vor Noah.
Beim Aufprall platzte der Körper des Mannes auf wie eine Wassermelone. Das Blut spritzte hoch und Noah ins Gesicht. Er hatte wegrennen wollen, sich übergeben, aber er war nur verzweifelt und starr gewesen, während das Blut des jungen Mannes seine Wange hinuntergelaufen war und sein Gesicht mit lauter kleinen roten Punkten gesprenkelt hatte.
An diesem Tag hatte er das erste Mal Drogen genommen und der Münsterturm war zugemauert worden, um solche Zwischenfälle zu vermeiden. Deutsche Bürokratie: wenn schon sterben, dann wenigstens geordnet. Die Möglichkeiten wurden ja einige Zeit später gegeben.
Das Seestadion. Zuerst hatte man all die Selbstmörder auf dem Friedhof beigesetzt, solange, bis der Platz aufgebraucht war. Wohin nun mit den Menschen? Man hatte einen großen, abgelegenen Platz gebraucht, am besten mit Möglichkeit für Massengräber. So waren pfiffige Planer auf das Stadion gekommen.
Es kam der August und es war nur noch ein Jahr bis zum Einschlag. Normalerweise wäre das Stadion jetzt voller Musikfreunde gewesen, die zu Rock am See in die Stadt gepilgert waren. Jetzt waren es Menschenhaufen, die sich auf die unterschiedlichsten Arten das Leben genommen hatten.
Unzählige Menschen.
Im anliegenden Wald waren die Bäume gefällt worden, um dort Löcher auszuheben, die groß genug waren für die Toten, die jeden Tag in Müllwagen kamen, anders konnte man der Masse kaum Herr werden. Es erinnerte an die Zeit der Pest, als die Pestwägen durch die Straßen zogen und die neusten Opfer des schwarzen Todes aufluden und vor die Stadt karrten, um sie dort zu verscharren. Der Pestkarren gehörte nun zu den Stadtwerken Konstanz.
So ging es immer weiter.
Der Rettungsdienst und die Krankenhäuser arbeiteten kaum noch. Wofür sollte man auch einen Menschen am Leben erhalten, wenn er sowieso in einem Jahr sterben würde? Das einzige, was sie taten, war Überdosen auszugeben, soweit dies eben noch möglich war und man nicht Gefahr lief, eventuell am Ende selbst ohne dazustehen.
Es war ungefähr im Dezember, als die Bundesregierung eine Art Weihnachtsgeschenk an das Land verschickte – das letzte Weihnachten der Weltgeschichte. Es war ein Medikament, welches innerhalb von wenigen Minuten den Tod herbeiführen würde – ohne Nebenwirkungen. Ein Nachrichtenmagazin brachte als einen ihrer letzten Berichte die Meldung, dass dieses Medikament schon hergestellt worden war, als man noch die Hoffnung hatte, der Asteroid könne abgewehrt werden, was der Regierung ihren letzten Skandal einbrachte, der jedoch keinen wirklich interessierte.
Trotzdem setzte sich die deutsche Gründlichkeit fort. So wurden die Medikamente nicht an die Bürger verschickt, nein, vielmehr wurden sie nur an örtlichen Sammelstellen verabreicht – in Konstanz also das Bodenseestadion, um dort den Abtransportweg zu optimieren. Umfallen und direkt ins Stadion auf den Haufen zur Zwischenlagerung, so war der makabre Plan gewesen.
Es war auch Dezember, als man genau sagen konnte, wo der Asteroid einschlagen würde. Davor waren es nur vage Vorhersagen gewesen, die alles, aber nicht zuverlässig gewesen waren, aber sie hatten gereicht. Es war Dr. Richard Henrys, ein pickeliges Computergenie, landläufig auch der intelligenteste Mensch der Welt genannt, der mit seinem Modell den genauen Einschlagsort errechnete. Fehlerchance: 1 : 1 503 000 303. Noah hätte den kleinen Scheißkerl umbringen können, als er damals diese Nachricht in die Welt hinausposaunte, mit einen Grinsen auf seinem Gesicht, als hätte er gerade den Wissenschaftspreis seiner Schule gewonnen und nicht unzählige Menschen zum Tode verurteilt.
Dann hörten die Selbstmorde in Konstanz auf. Die Menschen flüchteten so weit wie sie konnten und die, die da blieben – joggten, vögelten, fixten, erlösten ihre Kinder – das Übliche in einer Welt, in der nichts mehr von Wert war.
Devolution.
Noah mühte sich auf. Der Boden fühlte sich angenehm warm an, aufgeheizt von einem weiteren schönen Sommertag, aber er fühlte nur eine eisige Kälte in sich, die ihn erzittern ließ.
Seine Beine waren noch schlapp und wackelig, trugen ihn jedoch so gut es ging. Seine Zigarette, die er immer noch in den Fingern hielt, war fast komplett abgebrannt und stank nach verbranntem Plastik, während der Filter langsam kokelte. Er warf sie weg und zündete sich eine neue an, in der Hoffnung, das Nikotin würde seine Nerven beruhigen.
Er wusste in diesem Moment nicht, was er tun sollte.
Vielleicht war ihm klar geworden, dass das, was er vorhatte nicht so einfach werden würde, wie er es sich am Anfang vorgestellt hatte, als die Idee, mit seinen Freunden den Weltuntergang zu begehen, romantisch verklärt angemutet hatte. Er hatte Monate in einem von Drogen umnebeltem Zustand verbracht, was ihn daran gehindert hatte, sich bewusst zu werden, was ihn eigentlich erwarten würde.
Es war nicht so einfach wie in einer Facebook-Gruppe – »Wahre Freunde sitzen am Weltuntergang zusammen und schließen Wetten darauf ab, wer zuerst abkratzt.« Wenn Noah jetzt wetten müsste, würde er sagen, er würde zuerst sterben. Unmöglich, dass er diesen Druck noch länger aushalten würde.
In diesem Augenblick konnte er sich nämlich nicht vorstellen, dass er dieses Grauen überleben würde. Mit jeder Minute, in der die Drogen ihre Wirkung verloren, fühlte er die Angst in sich wachsen. Wie ein Krebsgeschwür fraß sie sich durch seinen Geist und wurde befeuert von den grauenhaften, grotesken Eindrücken, die sich ihm boten.
Vor gut einer Stunde hatte er noch zwischen den Beinen einer Frau gelegen und war gerade aufschreiend gekommen. Jetzt saß er hier und wünschte sich den Tod – nein, nicht den Tod. Er wünschte sich das Leben.
Er wünschte sich, dass dieser verdammte Asteroid verschwinden würde und die Welt nicht untergehen müsste. Warum konnte er nicht einfach sein altes Leben wieder aufnehmen? Er hatte immer versucht ein guter Mensch zu sein, hatte seiner Nachbarin geholfen, hatte alten Damen immer die Tür aufgehalten, wenn es sich ergeben hatte – er war ein guter Mensch gewesen und nun würde er sterben – verängstigt und vielleicht unsagbar qualvoll, wer wusste das schon.
Warum? Es war nicht fair.
Er schloss die Augen und spannte seine Muskeln an, versuchte, die Angst aus sich herauszupressen.
Nein, er musste gehen. Es war ein Pakt zwischen ihm und seinen Freunden gewesen. Am 16. Juli 2013 sitzen wir zusammen auf einer Bank in Konstanz am Bodensee. Wir trinken Bier und sind zusammen.
Dort haben wir Logenplätze für den Weltuntergang.
Er hatte es geschworen, genauso wie die anderen. Keiner hatte gezögert. Sie hatten sich die Hand darauf gegeben und Mick hatte sogar explizit gesagt: Ich schwöre es euch.
Genauso wie es Tom getan hatte, der gerade aus der Kirche kommen würde. Wahrscheinlich würde er wieder nach Weihrauch duften, der sich in seiner Kleidung wie ein starkes Parfüm festgesetzt hatte.
Chris, der bei den Sammelstellen arbeitete und dort Menschen eingeschläfert hatte, als wäre es das Natürlichste der Welt gewesen. Davor war er Rettungsassistent gewesen. Als die Medikamente verbraucht waren, hatte er sich wie die meistens Menschen vom Leben verabschiedet und nur noch auf diesen Tag gewartet. Noah glaubte, dass nur der Pakt schuld daran war, dass er überhaupt noch da war. Sonst hätte er sich wohl mit der gleichen Gleichgültigkeit, mit der er die Medikamente verteilt hatte,selbst hingerichtet.
Und Mick.
So wie Noah Mick kannte, würde er entweder mit einer gestohlenen Yacht vom Yachthafen aufkreuzen oder mit einem gestohlenen Edelwagen. Er war eigentlich mal Polizist gewesen, hatte jedoch ziemlich schnell den Dienst quittiert und alles getan, wozu er Lust gehabt hatte, als die Erde ein Verfallsdatum bekommen hatte. Dann hatte er begonnen Häuser anzuzünden, Orgien zu feiern, Drogenexzesse mitzumachen, Sportwägen zu klauen und mit Freunden, unter anderem Noah, auf den leergefegten Straßen Rennen zu veranstalten.
Er und Noah waren sich sehr ähnlich gewesen in ihrem destruktiven Verhalten, wenn auch Mick etwas exzessiver gewesen war. Noah hätte sich nicht gewundert, wenn Mick es nicht schaffen würde, weil er eine Überdosis Drogen aus dem Bauchnabel einer wildfremden Frau geschnieft, gespritzt oder geschluckt hätte. Ein Tod, wie er ihn sich immer gewünscht hatte – zumindest, seit die Welt unterging.
Aber sicher war, dass Chris und Tom da sein würden.
Er blickte auf die Uhr.
Nach knapp sechseinhalb Stunden – dann würde es Adios amigos heißen, dachte Noah bitter.
Er setzte seinen Weg fort. Es dauerte etwas, bis die Kraft wieder in seine Beine zurückgekehrt war und er nicht mehr wie ein Betrunkener torkelte. Trotzdem bewegte er sich nur sehr langsam fort und fühlte sich dabei wie hundert.
Mittlerweile konnte er den See sehen und noch deutlicher riechen. Die leichte Brise, die davor die Leichen der drei Kinder wie ein Pendel hatte schwingen lassen, trieb nun den sanften, einschmeichelnden Seeduft in seine Nase. Gierig sog er den Geruch ein. Seit er hier gelebt hatte, hatte dieser Duft eine beruhigende Wirkung auf seine Nerven gehabt und so war es auch heute wieder. Besser als jede Zigarette streichelte der Duft von algendurchsetztem Wasser seine Nerven und glättete die Sorgen.
Fast schon andächtig schritt er weiter und sog die Luft ein.
Er war auf nun auf der Höhe des Kasinos Konstanz, oder was davon noch stand. Durch zwei alte, große Bäume konnte er die Altstadt sehen. Das Lago, den Hafen, Teile der Schweiz – alles wirkte so grausam normal.
Das Kasino hatte in den letzten Monaten Rekordumsätze erzielt. Die Menschen hatten all ihre Habe verzockt – warum auch nicht? Manche, weil sie keinen Sinn mehr darin gesehen hatten, noch Geld auf die Seite zu legen, andere, weil sie einem Gerücht aufgesessen waren. Anscheinend solle es Bunkerplätze geben, in denen man sicher sei, gebaut von einer mysteriösen russischen Privatperson, die ihr gesamtes Vermögen dafür ausgegeben hätte und nun Plätze verkaufen würde. Ob das stimmte oder nicht, es war ein letztes verzweifeltes Greifen nach einem Strohhalm, der nicht da war.
Viele hatten versucht, sich im Kasino das Geld dafür zu erspielen – wenn sie verloren hatten, waren sie meistens direkt zum Seestadion gelaufen und hatten sich umbringen lassen.
Die, die das getan hatten, hatten auf ihrem letzten Gang in ihrem Leben noch einmal das herrliche Panorama des Sees genießen können. Vorbei am Yachtclub, an den Pflegeheimen mit ihren gepflegten Grünanlangen und der Schmiederklinik, bis sie irgendwann am Seestadion angekommen waren. Dort hatten sie dann ihre tödliche Injektion empfangen können.
Und es war vorbei gewesen.
Links neben ihm befand sich ein Luxushotel. Früher waren dort die Besserverdienenden abgestiegen. Im Sommer waren die Parkplätze überfüllt gewesen von Mercedes, Audis und anderen teuren Autos. Heute war der Parkplatz leer und auch das Hotel hatte wenig von seinem alten Glanz behalten.
Kaum war die Nachricht vom nahen Untergang publik geworden, hatten die Leute angefangen das Hotel zu plündern und alles geraubt, was man irgendwie hätte brauchen können. Luxusartikel, die keinen Sinn mehr gehabt, aber vielleicht dem Besitzer ein paar schöne Stunden beschert hatten.
Überhaupt war es interessant gewesen, wie krass die Gegensätze am Anfang gewesen waren. Es hatte gedauert, bis die öffentliche Ordnung zusammenbrach und Anarchie herrschte. Es waren eigentlich nur kleine Blitze von anarchischem Verhalten gewesen, wie eben z.B. die Plünderung des Hotels oder die Zerstörung eines Einkaufscenters. Im Großen war die Ordnung erst später zusammengebrochen.
Es hatte gedauert, bis auch das Kasino geplündert worden war. Noah war damals dabeigewesen, hatte an einer Orgie auf der Terrasse teilgenommen und die teuren Getränke geplündert. Im Keller hatte er noch gut gekühlten Champagner gefunden. Eine Flasche hatte mehrere hundert Euro gekostet, wenn er sie in den guten alten Zeiten ehrlich gekauft hätte. Er hatte sie zur Hälfte ausgetrunken und dann damit eine Scheibe eingeschlagen, die klirrend unter dem dicken Flaschenboden explodiert war.
Warum er das getan hatte, konnte er heute nicht sagen. Vielleicht war es der Reiz des Verbotenen und Neuen gewesen.
Jetzt war es nur noch eine abgebrannte Ruine. Irgendjemand hatte es vor einem Monat angezündet. Die Trümmer hatten bis letzte Woche sogar noch geraucht, denn es war keine Feuerwehr dagewesen, um es zu löschen. Dass die Flammen nicht auf ein anderes Gebäude übergegriffen hatten, hatte nur daran gelegen, dass das Kasino relativ separat von den meisten anderen Häusern gelegen hatte.
Ein schwarzes, verkohltes Skelett, das seine knochigen Glieder flehentlich in den Himmel reckte – mehr war nicht mehr übrig von dem einstigen Prachtbau am Bodensee.
Der Gestank von verbranntem Holz, ein leicht beißender Geruch, verdrängte den Duft des Sees, als er auf der Höhe der Kasinoruinen war. Wahrscheinlich lag das daran, dass der Wind gerade gedreht hatte.
Noah wandte seinen Blick von den Ruinen ab und blickte nach vorne. Es hingen nicht unbedingt die besten Erinnerungen mit diesem Ort zusammen.
Dort saßen sie.
Zwei der drei wichtigsten Menschen in seinem Leben.
Wie er erwartet hatte, waren bisher nur Tom und Chris da. Mick fehlte bisher.
Er beschleunigte seinen Schritt, so sehr es seine schlappen Beine eben zuließen. Er stolperte etwas, aber fing sich im rechten Moment wieder. Seine Freunde blickten ihn zuerst verwundert an, dann grinsten sie nur höhnisch – zumindest Tom.
Chris blickte nach links, in Richtung der Alpen, die sich grau und monströs vor dem blauen Himmel abzeichneten.
Dort, irgendwo im Gebirge, würde der Asteroid runterkommen. Beim Aufprall würde er eine unvorstellbare Energie freisetzen, die alles Leben in einem Umkreis von – wie groß war der Umkreis gewesen? Noah wusste es nicht mehr. Ganz Europa? Halb Europa? Ganz Europa und Asien? Verdammt, er konnte sich einfach nicht daran erinnern.
Vielleicht war es auch besser.
Seelig die Unwissenden.
Was er wusste war, dass beim Aufprall Milliarden von Tonnen brennendem Gestein in die Atmosphäre geschleudert werden würden, die dann irgendwann auch wieder runterkommen müsste und alles erschlagen würden, was in der Nähe war – Nähe bedeutete hierbei jedoch auch Amerika und Australien, denn die Steine konnten um den gesamten Erdballen fliegen.
Wahrscheinlich würde die Druckwelle des Himmelsgeschosses ihn und seine Freunde sofort töten. Sie würden verglühen, zu Asche zermalmt werden, oder Schlimmeres.
Er wollte es nicht wissen, wenn er ehrlich zu sich selbst war.
Zum ersten Mal seit Monaten klammerte er sich an sein Leben wie ein Ertrinkender an seinen Rettungsring. Er wollte nicht sterben und die Vorstellung, dass in wenigen Stunden alles vorbei sein sollte, trieb ihm die Tränen in die Augen.
Er beneidete Tom um seinen Glauben und wünschte sich, er hätte auch so etwas, an das er sich festklammern konnte. Sein Freund wirkte ruhig und gefasst, während er nun auch in dieselbe Richtung starrte wie Chris.
Reiß dich zusammen, mahnte er sich selbst. Genieße die letzten Stunden deines Lebens. Mehr kannst du eh nicht tun.
Das war natürlich eine Lüge.
Es gab Erhängen, Erschießen, Ertränken, die Pulsadern aufschneiden, von einem Turm stürzen, einen goldenen Schuss setzen – unzählige Dinge, die er noch tun könnte.
Er trat an die Bank, auf der die beiden saßen.
»Schaut mal wer da auch noch kommt!« Tom drehte sich um und lachte fröhlich auf. Dann umarmte er Noah herzlich, ohne jedoch aufzustehen. Die Umarmung fühlte sich gleichzeitig wohltuend und wie ein Abschied für immer an und ließ Noah nochmals leise aufschluchzen. Tom hörte es und drückte seinen Arm noch einmal fester um die Brust seines Freundes, als wollte er ihm so etwas mehr Mut zusprechen.
»Meine Fresse, siehst du scheiße aus!«, urteilte Chris über Noahs Erscheinungsbild, was diesem ein kurzes, gequältes Lächeln abrang. Chris Stirn war in Sorgenfalten gelegt, während er seinen Kumpel umarmte. Es fühlte sich nicht ansatzweise so herzlich an wie bei Tom, dachte Noah. Mehr wie eine Pro-Forma-Geste, die kaum mehr Bedeutung hatte.
»’n Abend Leute.« Noah versuchte zu lächeln, was ihm jedoch missglückte. Tom warf ihm einen kurzen Blick zu, der zu sagen schien, er solle diese Scharade aufgeben. »Heute ist ein guter Tag zu sterben«, überspielte Noah seine wahren Gefühle mit einer flapsigen Bemerkung. Mehr fiel ihm im Moment nicht ein, und so hingen diese Worte mit einem bitteren Beigeschmack über ihm und seinen Freunden.
»Ha! Aber Hallo!«, erwiderte Chris, fasste zwischen seine Beine und holte eine Flasche Bier hervor. Seine Stimme klang irgendwie tonlos und weit weg, als würde er durch ein Funkgerät mit ihnen sprechen.
Erst jetzt sah Noah, dass unter der Bank ein Kasten Bier stand, was ihn für einige Sekunden seine Sorgen vergessen ließ. Lächelnd nahm er das angebotene Bier und öffnete es mit einem Feuerzeug. Etwas Kohlensäure entwich mit einem leisen Zischen aus der Öffnung, und Noah trank gierig mehrere Schlucke. Das Bier schmeckte kalt und erfrischend, wenn es auch ziemlich bitter und eigentlich nicht seine Hausmarke war. Am Ende der Welt durfte man nicht unbedingt wählerisch sein, dachte er sich und ließ sich neben Tom nieder. Sag mir, was los ist, sagte sein Blick, aber Noah schüttelte nur leicht den Kopf. Sein Kumpel fixierte ihn noch etwas mit seinen Augen, wandte sich jedoch nach einer Weile wieder dem Einschlagsort in den Alpen zu.
Sein Gesicht verdüsterte sich für wenige Sekunden, was für Noah beruhigender wirkte als alle schönen Worte, die er hätte sagen können. Er spürte, dass er in diesem Moment nicht alleine war mit seiner Angst. Er fühlte sich etwas leichter und nahm einen neuen Schluck.
»Tja«, begann Tom irgendwann, nachdem alle schweigend nebeneinander gesessen hatten und jeder seinen eigenen, düsteren bis depressiven Gedanken nachgehangen war. Seine Stimme wirkte fest und gefasst, als würde er zu einer donnernden Predigt ansetzen. Aber er sagte nur ein paar kurze Worte.
»Willkommen bei der Apokalypse.«
Dem war nichts mehr hinzuzufügen.
Die Männer stießen mit ihren Bieren an und tranken.
Ja, dem war wirklich nichts hinzuzufügen.
Die Freundschaft war immer so wichtig für alle vier gewesen, und nun spürte Noah auch warum. Es war das Gefühl, dass alles irgendwie richtig war, so wie es war. Die Angst verschwand, langsam, aber sie verschwand.
Er seufzte und blickte auch zu den Alpen.
Willkommen bei der Apokalypse.
Es dauerte eine Weile, bis wieder jemand das Wort ergriff.
»Wisst ihr, was mich richtig ärgert?«, fragte Tom in die Runde. Er wartete eine Weile, als wollte er Spannung aufbauen, bevor er eine Antwort auf seine eigene Frage gab.
»Jetzt habe ich mir über die Jahre und vor allem im letzten Jahr angewöhnt, früh aufzustehen und dementsprechend auch früh ins Bett zu gehen. Und jetzt muss ich fast die Nacht durchmachen, bis«, er zögerte und dachte eine Weile über die richtige Wortwahl nach, »bis ich wieder schlafen kann.« Darauf nahm er einen tiefen Schluck.
Chris schaute auf seine Armbanduhr. »Jetzt ist 19 Uhr 30 – noch etwas mehr als sechs Stunden.« Also würde der Asteroid um ungefähr zwei Uhr morgens deutscher Zeit einschlagen.
»Zwei Uhr morgens. Ist es nicht irgendwie seltsam? Das alles so schnell vorbei sein wird?«, fragte Noah die anderen, immer noch unter den Eindrücken des Abends stehend mit einem ängstlichen Zittern in seiner Stimme.
Weder Tom noch Chris antworteten sofort.
»Kannst du uns nicht irgendwie Mut machen?«, fragte Chris Tom. In seiner Stimme lag ein leichter Anflug Sarkasmus, was jedoch von Tom ignoriert wurde.
»Glaubst du das denn?«, gab dieser mit sanfter und freundlicher Stimme zurück. Man merkte, dass er die letzten Jahre ein Priesterseminar genossen hatte und daher auch wusste, wie man mit zweifelnden Schäfchen umgehen musste.
Chris lachte höhnisch auf. »Ich glaube daran, dass das »Deutsche« zuletzt in den Menschen gestorben ist.« Er nahm einen tiefen Schluck und blickte ein paar Sekunden ins Leere, bevor er fortfuhr.
Noah lächelte, denn das stimmte seiner Meinung nach.
»Wisst ihr, die letzten Wochen, in denen ich den Menschen am Seestadion geholfen habe …« Das Wort »geholfen« hatte er wohl mit Bedacht gewählt. Man konnte nicht sein ganzes Leben danach trachten, Menschen zu retten, um dann den Rest seines Lebens danach auszurichten, das Leben von anderen zu beenden. Den Widerspruch löste er auf, indem er die Euthanasie als »helfen« bezeichnete.
»Was ist denn da passiert?«, unterbrach ihn Noah bevor Chris seinen Satz beenden konnte. Dieser fuhr jedoch ungerührt fort.
»Die Leute haben Schlange gestanden, wie es Deutsche immer gemacht haben. Wir haben erwartet, dass die Menschen durchdrehen, drängeln, aber keiner hat gedrängelt. Alle haben gewartet, waren höflich und gefasst. – Es war alles so – so deutsch.«
»Du hast meine Frage nicht beantwortet«, erwiderte Tom, immer noch freundlich und ohne Drängen in seiner Stimme.
Chris blickte Tom an. In seinem Gesicht lag eine Art von Ekel und Abscheu.
»Leck mich, Pfaffe!« Er zeigte ihm den Finger. Seine Worte und seine Geste waren wohl gespielt, aber trotzdem lag auch jede Menge Ernsthaftigkeit darin. Tom und Noah lachten dumpf.
»Nein, ich glaube nicht. Ich kann es einfach nicht mehr.« Er sagte dies mit voller Überzeugung. Die anderen beiden spürten es überdeutlich und zuckten leicht zusammen, so unerschütterlich war seine Überzeugung.
»Ich habe Kindern, die kaum die Augen offen gehabt haben, »geholfen«, Müttern, Vätern, ganzen Familien. Ich habe Hunderte von Menschen getötet.« Seine Stimme wurde etwas leiser. Es schien, als würde er von weit, weit weg erzählen. »Es ist unglaublich schwer, einen Fontanellenzugang zu legen. Einmal habe ich mich verstochen. Ich habe drei Anläufe gebraucht, bis ich das Kind endlich – bis ich dem Kind endlich geholfen habe. Es hat die ganze Zeit gebrüllt wie am Spieß. Und dann war es plötzlich ganz ruhig.« Er zögerte. Seine Hand begann leicht zu zittern. Er schloss sie zu einer Faust, blickte sie für einige Sekunden an und öffnete sie dann in einer fließenden Bewegung wieder mit der Handfläche nach unten gerichtet, als würde er etwas fallen lassen.
»Und dann? Wir sind so abgestumpft gewesen.« Es war das erste Mal, dass er diese Worte laut aussprach. Erst jetzt wurde ihm wirklich bewusst, wie tief ihn all das berührt hatte, was er gesehen hatte. »Wir haben das Kind wie ein Stück Müll auf einen Haufen geworfen. Zusammen mit anderen Kindern. Ein paar Stunden später war das Kind von unzähligen anderen Leichen bedeckt gewesen.«
Er nahm einen tiefen Schluck Bier, fummelte nach einer Zigarette. Seine Hand bebte unkontrolliert wie bei einem Parkinsonkranken. Er blickte etwas über seine Schulter in Richtung des Stadions, dass nur wenige Kilometer von ihrer Position entfernt lag. Sein Blick verdüsterte sich wie der Himmel bei einem starken Gewitter.
»Dieser ekelhafte Gestank. Ich bin froh, dass es bald vorbei ist.«
»Darum glaubst du nicht mehr?«, fragte Tom und biss sich direkt auf die Zunge, denn diese Frage war unnötig gewesen und verursachte wohl nur neuerliche Schmerzen.
»Nein. Ich glaube nicht. Denn wenn ich glauben würde, dann würde es für mich doch jetzt nur einen Ort geben, an den ich komme, oder? Was passiert wohl mit einem Menschen, der Hunderte andere Menschen, Kinder, Männer, Frauen getötet hat?« Diesmal sagte er nicht »geholfen«.
Tom drehte sich kurz weg und überlegte eine Antwort.
»Ich glaube nicht, dass der Herr dich deswegen strafen würde.« Er lehnte sich zurück, faltete die Hände über seinem Bauch. Er wirkte nicht mehr wie der alte Freund aus Kindertagen für die beiden anderen, sondern eher wie ein Philosoph, der die Weisheit des Universums eröffnen würde.
»In unserem Glauben ist Gott der gütige Vater. Und genauso sehe ich es auch. In dieser Situation, glaubst du, dass dein Vater dich verstoßen würde, wegen dem, was du getan hast? Nein. Er wäre stolz auf dich. Er würde dich vielleicht sogar bewundern für das, was du deinen Mitmenschen gibst. Du hast geholfen – nicht getötet. Das Wort hast du da ganz richtig gewählt.« Er zögerte. »Ich finde es bewundernswert, was du getan hast. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit! Kehr deinen alten Leben den Rücken zu und komm zum Herrn! Er wird sich über dich erbarmen! Unser Gott vergibt uns, was auch immer wir getan haben! Jesaja 55,7.«Tom lachte kurz auf. »Im Endeffekt hast du ihnen wohl das gegeben, was ich den Menschen in der Kirche nur gepredigt und versprochen habe.«
Tom fühlte sich gut, Chris so etwas sagen zu können. Chris hatte ihm wohl noch viel schlimmere Geschichten erzählt als das, was er nun vor Noah preisgegeben hatte. Aber Tom hatte eines im Auge gehabt: Er hatte Chris helfen wollen, ihm vielleicht wenigstens ein bisschen Hoffnung geben. Das war er ihm schuldig gewesen – und das war auch das einzige, was er in den letzten Monaten immer und immer wieder versucht hatte. Dabei war es wohl pure Ironie, dass er als einziger keine Hoffnung für sich sah.
»Darauf ein Schluck Bier«, erwiderte Chris bitter. Er legte Tom die Hand auf die Schulter und ließ sie eine Weile liegen. Das Beben in seinen gräulichen Fingern wurde etwas weniger. Er schaute ihm nicht in die Augen, sondern blickte nur auf seine Füße.
»Was hast du denn den Menschen versprochen?«, fragte Chris irgendwann.
»Frieden. Ruhe. Keine Angst – genaugenommen das absolute Gegenteil von dem, was wir derzeit hier haben.«
»Eine schöne Vorstellung«, murmelten sowohl Chris als auch Noah nachdenklich.
»Aber jetzt mal im Ernst, werden wir jetzt den ganzen Abend so düstere Themen haben? Ich dachte, wir wollen Spaß haben! Das Leben genießen – solange wir es noch haben!«, brach Noah die Stille. Er wusste nicht, warum er das gesagt hatte. Vielleicht, weil ihm die letzten Eindrücke, die er gesammelt hatte, viel zu schwer vorkamen, als dass er die letzten Stunden mit so etwas verbringen wollte.
Die beiden blickten ihn an und lachten. »Du hast recht«, grinsten beide. Sogar Chris wirkte dabei überzeugt.
»Wir hätten uns vielleicht überlegen sollen, was wir tun, bis es so weit ist«, dachte Tom laut.
»Hätten wir etwa Brettspiele mitnehmen sollen?«, meinte Chris schief.
»Wir könnten ein Trinkspiel spielen«, schlug Noah vor.
»Zu wenig Bier«, entgegnete Tom kopfschüttelnd.
»Na super. Müssen wir jetzt etwa dem Ende der Welt nüchtern entgegentreten?«, entrüstete sich Chris.
»Wir können ja noch in die Stadt gehen. Die meisten Wohnungen dürften eh leer stehen. Und vielleicht finden wir auch irgendwo in einem Keller oder einer Kneipe noch etwas Alkohol«, meinte Noah, der sich nun, da er wieder nüchtern war, nach nichts mehr sehnte, als wieder betrunken zu sein.
Seit er nüchtern war, geißelten ihn die Bilder, die er in den letzten Stunden hatte sehen müssen. Und wenn die einzige Möglichkeit, diese Bilder verblassen zu lassen, die war, dass er sich betrank, dann musste es wohl so sein.
»Wir müssen aber auf jeden Fall auf Mick warten«, gab Tom zu bedenken.
Plötzlich kam Noah ein Gedanke. Wenn sie in die Stadt gingen, war die Möglichkeit, dass sie noch andere Menschen trafen, ungleich größer, als wenn sie einfach hier auf der Bank sitzen bleiben würden.
Baumelnde Kinder, tote Menschen, kopulierende Körper. Hier waren alles, was sie sehen konnten, der See, ein wunderschönes Panorama und das Ende der Welt. Er überlegte kurz, ob er seinen Freunden diese Ängste erzählen sollte, entschloss sich aber dagegen.
»Gut, dann sollten wir vielleicht warten, bis Mick da ist, dann können wir ja los«, meinte Tom und klang dabei wie ein Diplomat. »Vielleicht können wir ein Auto nehmen. Stehen ja genug rum.«
»Ja. Können wir«, murmelte Noah, der immer noch die Bilder der Kinder vor seinem inneren Auge tanzen sah wie Derwische, die ihn quälten.
»Was hast du eigentlich mit deinem Kater gemacht?«, fragte Chris nach einer Weile.
Ein Schlag in die Weichteile wäre für Noah weniger schmerzhaft gewesen. Er zuckte zusammen und zündete sich eine neue Zigarette an, bevor er antwortete.
»Ich hab ihm den Hals gebrochen«, sagte er trocken. Die beiden starrten ihn kurz entgeistert an. Selbst in dieser Zeit, in der ein Leben nicht mehr wert war als ein halbes Dutzend Stunden, wirkte es noch erschreckend, wenn jemand so kaltschnäuzig davon erzählte, was er mit seinem treusten Begleiter gemacht hatte.
»Immerhin hat er es jetzt hinter sich – und muss nicht verbrennen«, schob Chris ein. Den letzten Teil des Satzes flüsterte er fast.
Noah seufzte. Das Verlangen, seinen Freunden seine Angst zu offenbaren, brannte in seiner Brust, aber er hielt es mit stoischer Selbstbeherrschung zurück. Er sehnte sich in den leicht abgehobenen Drogenzustand zurück, der ihn zuvor wie eine Rüstung vor allen Ängsten beschützt hatte. Er war abhängig geworden, ziemlich sicher sogar, aber das war jetzt egal.
Die drei blickten fast synchron auf ihre Armbanduhren.
»Wann kommt Mick wohl endlich?«, fragte Tom halblaut mehr sich selbst als die anderen.
»Kommt wohl nur darauf an, wie gut SIE ist«, versuchte Noah mit einem schlechten Witz seine Sorgen wenigstens ein bisschen abzulenken. Er wünschte sich, dass Mick nicht kommen würde. Dann müssten sie nicht in die Stadt und er müsste nicht noch mehr schreckliche Dinge sehen.
Er setzte an, wollte seine Einwände formulieren, brach aber mitten in der Bewegung ab. Seine Freunde merkten es gar nicht.
Sein Blick ging zum Himmel. Man sah ihn jetzt. Er war groß und hell, wie eine zweite Sonne, nahm immer mehr Platz am Himmel ein und schien mit jedem Wimpernschlag größer und bedrohlicher zu werden.
Die beiden anderen lachten noch über seinen Witz, der Micks Verhalten in den letzten Monaten wohl am besten beschrieben hatte.
Noah unterbrach die beiden mit einer weiteren Frage.
»Sag mal, Tom, warum wolltest du eigentlich Pfarrer werden?« Wenn einem die Zeit weglief, mussten manche Fragen so schnell wie möglich gestellt werden, bevor es zu spät war.
Tom blickte Noah an. Wieder hatte er dieses sanfte, friedliche Lächeln auf dem Gesicht, das wohl eher einem Buddhisten gestanden hätte als einem katholischen Priester in spe. Trotzdem wirkten seine Augen auf eine seltsame Weise traurig und nachdenklich.
»Ich kam wegen des gratis Brotes, aber ich bin geblieben wegen dem Wein!«, verkündete er, was Noah seinerseits mit einem halb gelachten »Arschloch« quittierte.
»Jetzt im Ernst. Wir sehen die Welt untergehen und ich hab nie erfahren, warum einer meiner besten Freunde Pfarrer werden will.«
Tom wurde ernst.
»Ich werde dir die Antwort geben, wenn ich dazu bereit bin, wenn dir das recht ist, ok?«
»Klar, Mann. Kein Thema.« Sie stießen ihre Fäuste zusammen, eine Geste, die sie nicht mehr gemacht hatten, seit sie fünfzehn gewesen waren. »Solltest nur nicht zu lange warten.« Keiner der anderen beiden reagierte auf diesen Witz.
Von Weitem hörten sie ein Geräusch, dass alle aufhorchen ließ. Verdutzt wandten sie die Köpfe nach rechts, in Richtung Innenstadt. In den letzten Monaten hatte man kein Auto gehört, nicht mal ein leises Motorenbrummen. Nun jedoch heulte auf der Rheinbrücke ein lautes, schrilles Motorengeräusch auf. Von ihrer Position aus sahen sie nur ein orangenes Etwas, welches mit einer ungeheuren Geschwindigkeit über die leere Brücke donnerte. Der Sog war so kräftig, dass die Fahnen, die das Geländer darauf säumten, leicht zu flattern begannen.
»Mick?«, fragte Noah die anderen.
»Was glaubst du denn?«, war die trockene Antwort.
Es dauerte eine Minute, bis Mick in einem orangenen Ferrari vor den anderen stand. Er donnerte mit ungefähr hundertachtzig die Seepromenade hinunter, vorbei an alten Eichen, Bänken, unverschämt teuren Jugendstilwohnungen, die jetzt alle verwaist waren, bis er bei seinen Freunden angekommen war. Dort stampfte er auf die Bremse, was den Ferrari jedoch nur unwesentlich verlangsamte. Das Auto schoss an ihnen vorbei. Der Gummi kreischte auf dem Asphalt und hinterließ dunkle, schwarze Bremsspuren, bevor der Wagen einige hundert Meter entfernt zum Stehen kam.
Das Brummen erstarb mit einem letzten, mürrischen Aufheulen und Mick stieg aus dem Wagen. Als Noah ihn so anschaute, erinnerte Mick ihn an einen Musiker oder Schauspieler, der zu leicht Zugang zu vielen Drogen bekommen hatte. Seine Augen lagen tief in den schwarzen Höhlen und seine Haare hingen in fettigen Strähnen hinunter. Seine Haut war bleich wie Alabaster und sein Gang wirkte genauso unsicher wie der von Noah, als er hierhergekommen war.
»Na Leute?«, brüllte Mick den anderen zu, gefolgt von einem fast manischen Lachen. In der linken Hand hielt er eine Flasche mit einer orange-gelben Flüssigkeit. Sicher kein Apfelsaft, dachte sich Tom.
Beunruhigend war jedoch, was er in der anderen Hand trug.
Seine Dienstwaffe, die er als Accessoire hin und her schwenkte. Das harte Metall der Kanone schlug einige Male gegen den Ferrari, hinterließ tiefe Dellen und schrammte den sauberen, glänzenden Lack ab.
Aus dem Auto stieg ein Mädchen. Sie wirkte höchstens wie vierzehn, was Noah ziemlich abstoßend fand. Sie hatte kaum einen Busen entwickelt und ihre Gesichtszüge waren noch die eines Kindes. Sie trug einen Hauch von nichts, bestehend aus einem Tanktop, welches beim Bauchnabel stoppte, und Hotpants, die kaum ihren Hintern verbargen.
Das Make-Up in ihrem Gesicht ließ sie noch kindlicher erscheinen, denn es wirkte nicht professionell aufgetragen, wie man es von einer Frau erwarten würde, sondern dilettantisch hingeschmiert und unvorteilhaft, wie bei einem Kind, das sich an Mamas Schminkschatulle bedient hatte.
»Darf ich vorstellen?«, sagte Mick mit einer großen Geste in Richtung des Mädchens. »Angie!«
Angie schien nicht zu realisieren, was Mick eigentlich meinte. Ihre Augen wanderten verwirrt in die Richtung, aus der sie ihren Namen gehört hatte.
»Was soll der Scheiß, Mick?«, fragte Chris angespannt. Er war aufgestanden und einige Schritte auf seinen Kumpel zugegangen. Die Bierflasche stellte er vorsichtig auf seinen Platz auf der Parkbank und seine Zigarette warf er hinter sich in den See.
»Wieso?« Mick blickte ihn gespielt verwirrt an. Seine Augen tanzten zwischen Angie und Chris hin und her, bis er irgendwann mit großer Geste Verstehen andeutete. »Ach so. Das ist ja eine exklusive Veranstaltung. Und da sind Frauen nicht erlaubt.« Er wankte auf Angie zu. Sie blickte direkt durch ihn hindurch.
»Sorry, Püppchen. Keine Mädchen erlaubt.« Sanft tätschelte er ihren Kopf, als wolle er sie trösten.
Während Noah Angie anblickte, sah er vor seinem inneren Auge wieder das Mädchen auf dem Balkon mit dem Strick um den Hals baumelnd. Vielleicht waren die beiden mal in dieselbe Klasse gegangen, waren Freundinnen gewesen. Jetzt war das doch alles so bedeutungslos, aber es machte ihn fast wahnsinnig vor Traurigkeit. Einzig die Wut über Micks Verhalten erstickte die Trauer etwas.
Es war eine Sache, sich gehen zu lassen, dessen waren sich wohl alle einig. Aber alle drei Männer auf der Bank, Chris, Tom und Noah, spürten auch gleichzeitig, dass hier eine Grenze überschritten wurde. Zumindest Noah konnte nicht erklären, warum es das zu vermeiden galt, aber er war sich sicher, dass Tom es konnte und tun würde.
»Mick, wie alt ist sie?«, fragte Tom wie aufs Stichwort. Er stand langsam auf, den Blick immer auf die Waffe gerichtet, die Mick in der Hand hielt und wie eine Rassel hin und her warf.
»Ich weiß nicht – vierzehn? Fünfzehn? Zwölf?« Er kratze sich am Kopf und blickte Angie an. »Wie alt bist du gleich noch mal?«
Sie reagierte nicht, sondern versuchte immer noch mühevoll, nicht umzufallen.
»Mick, das geht zu weit und das weißt du«, sagte Tom immer noch ruhig. »Lass das einfach und lass das Mädchen gehen, wie wäre es?«
Alle drei spürten, dass es eigentlich lächerlich war, was sie gerade taten. Die Welt kannte keine Regeln und Ethik mehr. Anarchie war das Wort der Stunde. Devolution. Was auch immer man machte, es war in Ordnung. Aber irgendwie, und das hatte jeder von den dreien in den letzten Monaten immer wieder gespürt, wollten sie eine gewisse Ordnung doch noch aufrechterhalten. Es MUSSTE einfach Grenzen geben, zumindest für sie, das waren sie sich selbst schuldig.
Aber Mick schien das nicht mehr so zu sehen, zumindest in diesem Moment.
»Gehen lassen? Okidoki«, sagte Mick, hob seine Waffe und hielt sie dem Mädchen an den Kopf.
»Mick, nein!«, brüllte Chris und Noah gleichzeitig, doch der Knall übertönte ihre Stimmen und hallte in der schier unendlichen Stille eines fast ausgestorbenen Konstanz wider wie Donnergrollen.
Das Mädchen plumpste auf den Boden – und begann zu schreien. Sie brüllte wie am Spieß, hielt sich ihre Hand an den Kopf, aus dem beständig Blut schoss wie aus einem Springbrunnen. Sie wandte sich, vor Schmerzen unfähig, etwas anderes zu tun als zu schreien und sich hin und her zu rollen.
»Mick, verdammt!«, brüllte jetzt auch Tom und schnappte Mick die Waffe weg.
»Hey", protestierte dieser halblaut und blickte auf die Blutlache. Ein kleiner See aus rotem Lebenssaft floss auf seine Füße zu, umspülte seine weißen Sneakers und färbte die Gummisohlen in einem tiefen Dunkelrot.
»Hey!«, brüllte er, dieses Mal noch lauter. Mit einem Satz, den man seinem mit Drogen und Alkohol angefüllten Körper gar nicht zugetraut hätte, stand er über dem Mädchen und trat auf sie ein, immer und immer wieder.
Tom warf die Waffe weg und sprang auf Mick zu, um ihn von dem Mädchen wegzuziehen, während Noah und Chris ebenfalls aufgesprungen und zu dem Mädchen gerannt waren.
Angie lag immer noch am Boden und brüllte panisch, weinte, schluchzte – und flehte leise nach ihrer Mama.
Ein Glück, dass sie Chris hatten, dachte Noah, und vergaß dabei, in welcher ausweglosen Lage sie sich befanden. Was brachte es ihnen? Chris konnte keine Operationen durchführen, konnte nicht seine Kollegen rufen – ihm waren die Hände gebunden.
Im Augenwinkel sah er, wie Tom gerade versuchte, den wütenden Mick zu beruhigen, was ihm jedoch nur leidlich gelang. Er versuchte ihn zu umklammern, aber der drahtige und kampfsportgeübte Ex-Polizist wand sich immer wieder aus seinem Griff.
Chris betrachtete in der Zwischenzeit fachmännisch Angie und runzelte sorgenvoll die Stirn.
»Noah, halt sie fest. Ich muss sie untersuchen«, befahl er. Noah tat sofort wie ihm geheißen. Währenddessen schlug Tom Mick mit seiner Faust ins Gesicht, was Mick zuerst torkeln und dann ohnmächtig zusammenbrechen ließ. Nach wenigen Sekunden schnarchte er vernehmlich, als würde er schlafen, während sich an seiner linken Schläfe ein dicker, blauer Fleck bildete.
»Was zur Hölle ist mit ihm los?«, murmelte Tom, als er ebenfalls zu Angie kam und Noah half, das zappelnde Mädchen zu fixieren. Seine Hand pochte schmerzhaft, aber er ignorierte die Schmerzen.
»Er dreht durch. Vielleicht ein schlechter Trip«, mutmaßte Noah blass.
Mick war früher immer ein sehr maßvoller Mensch gewesen. Nie hatte er über die Stränge geschlagen, genau genommen hatte Noah ihn nur einmal betrunken erlebt. Aber seit es sicher war, dass die Welt untergehen würde, war alles anders geworden.
Das Mädchen brüllte mit einer Lautstärke, die durch Mark und Bein ging. Warum konnte sie nicht einfach die Klappe halten? Kurzzeitig erwischte sich Noah bei dem Gedanken, ihr seine Hand auf den Mund zu pressen. Dieser Gedanke schockierte ihn und zeigte, wie überfordert er gerade mit dem war, was hier passierte.
»Die Kugel steckt noch«, urteilte Chris düster. In der linken Hand hielt er die blonden, nun blutverschmierten Haare des Mädchens und entblößte so das Loch in ihrem Kopf. Es sah aus wie ein winziger Brunnen, aus dem noch immer Blut rann. Kleine, weiße Fragmente klebten an ihrer Schädeldecke, die schwarzrot verfärbt war.
»Was sollen wir jetzt tun?«, fragte Tom verzweifelt.
»Wir können nichts für sie tun«, gab Chris knapp zurück. Seine Stimme war düster und bestimmend, jedoch fielen ihm die Worte nicht leicht. Noah wusste nicht, ob diese Kaltschnäuzigkeit vom »Helfen« der letzten Monate am Bodenseestadion herrührte oder es die gegebene Professionalität eines Rettungsassistenten war, die er hörte.
»Schaut mal, ob in der Waffe noch ein Schuss steckt«, schlug Chris vor.
Noah sprang als erster auf und rannte zur Pistole. Es war nicht schwer zu erraten, warum Chris diesen Vorschlag gemacht hatte. Es dauerte eine Weile, bis er herausgefunden hatte, wie man das Magazin der Waffe entfernte.
»Nein, da ist nichts mehr drin«, gab er trocken und schockiert zurück. Er ließ resignierend die Waffe sinken.
»Was?«, platzte es fast ungläubig aus Tom. »Warum sollte die Waffe nur mit einem Schuss geladen sein?«
Dafür gab es hundert Gründe, dachte sich Noah, aber er sprach es nicht aus. Vielleicht hatte Mick ein paar Schießübungen gemacht, bevor er hierhergekommen war. Vielleicht hatte es keine Munition mehr gegeben, die er hätte mitnehmen können.
Oder vielleicht hatte er auch nur einen Schuss gebraucht.
Für sich? Für Angie? Für einen von ihnen?
»Was machen wir jetzt?«, fragte Tom verzweifelt. Der blutige Haarschopf erinnerte ihn an die beiden Jungs im Einkaufszentrum. »Wir müssen ihr doch helfen!«
»Ich weiß!«, blaffte Chris zurück. Er hatte Angies Kopf losgelassen. Seine Finger waren über und über mit Blut bedeckt. Verzweifelt richtete er sich auf und blickte sich um, als könnte er irgendwo in der Nähe eine Lösung finden.
Dann beugte er sich wieder runter und nahm das Mädchen in den Arm. Das Schreien wurde leiser, aber ihre Augen, die davor vernebelt und blutunterlaufen gewesen waren, wurden auf einmal hellwach und blickten panisch. Ihre zuvor wild hin und her zuckenden Hände erwachten aus ihrer unkoordinierten Bewegung, packten Chris Arm und versuchten, ihn davon abzuhalten, was er vorhatte.
»Lass es geschehen«, flüsterte Chris leise, aber noch hörbar für die anderen, denen alle Farbe aus dem Gesicht wich. Der Kopf des Mädchens wurde immer röter, während sie versuchte, nach Luft zu schnappen. »Lass es geschehen. Dir wird gleich etwas schwindelig, dann wirst du einschlafen. Dann hast du keine Schmerzen mehr.«
Tom und Noah standen da und schauten dem Schauspiel hilflos zu. Noah wollte fragen, ob sie irgendwie helfen könnten, aber er brachte kein Wort heraus.
Tom war es, der als erste reagierte. Er ging langsam auf das Mädchen zu, faltete die Hände.
Dann ging er vor ihr in die Hocke. Er lächelte, oder zumindest versuchte er das. Die Augen des Mädchens fixierten ihn voll blanker Angst und schienen stumm nach Hilfe zu verlangen. Er hob die Hand und legte sie dem Mädchen auf die Stirn.
Dann sprach er das Sterbesakrament. Etwas anderes konnte er nicht mehr machen, aber Noah beneidete ihn dafür. Wie gerne würde auch er jetzt irgendwas tun können, außer hier zu stehen und zuzuschauen, wie das Mädchen gerade durch einem Ex-Rettungsassistenten von seinem Leiden erlöst wurde.
»Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er dich auf.« Eigentlich hätte Tom Öl gebraucht, aber es musste auch so gehen. Blutstropfen rannen über den Kopf, hinunter in ihr Gesicht und zwischen seine Finger, die ein Kreuz daraus formten.
Die Wortfetzen kamen nur leise bei Noah an, aber das war in Ordnung. Das ging nur Tom, das Mädchen und in geringerem Maße Chris etwas an.
Tom sprach konzentriert und fest. Er hatte die Sterbesakramente in den letzten Monaten öfter verteilen müssen, da war sich Noah sicher. Und nun sprach er sie für das Mädchen. Ein junges, unschuldiges Ding, welches sein gesamtes Leben eigentlich noch vor sich gehabt hätte. Wie hätten wohl die Eltern reagiert, wenn sie gewusst hätten, dass ihre Tochter eines Tages am Ufer des Rheins von einem Rettungsassistenten erwürgt werden würde, angsterfüllt mit wahrscheinlich fast allen Drogen, die die moderne Welt kannte?
Tom begann kleine Kreuzzeichen auf die Stirn, auf den Mund, auf das Herz des Mädchens mit den Fingern zu zeichnen.
»Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heilligen Geistes.«
Die Augen des Mädchens verloren ihren Glanz. Die Arme wurden schlaff, lösten ihren Griff und fielen auf den Boden. Ihre Zunge hing halb aus dem Mundwinkel. Ein letztes, kehliges Röcheln drang aus ihrem Hals, dann herrschte Stille.
Chris drückte weiter zu. Seine Arme zittern. Noah konnte nicht beurteilen, ob vor Anstrengung oder vor Verzweiflung.
Es war vorbei.
Tom rannen Tränen über die Wangen, während er das letzte Zeichen auf dem Herzen zeichnete.
»Amen.«
Dann stand er auf, ging ein paar Schritte von den anderen weg. Sein Oberkörper zuckte und bebte immer wieder unkontrolliert auf, bevor er wütend auf den Boden stampfte und laut »Scheiße!« brüllte.