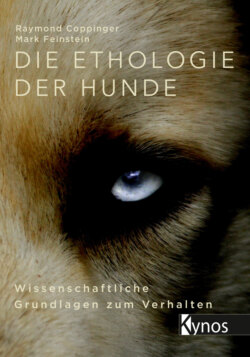Читать книгу Die Ethologie der Hunde - Raymond Coppinger - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWir Ethologen befassen uns im Wesentlichen mit dem Verhalten von Tieren in der Natur. Unsere Zeit verbringen wir damit, Tierbewegungen im natürlichen Lebensraum zu untersuchen und zu beobachten, während die Tiere „ihren Lebensunterhalt verdienen“ – also beim Nahrungserwerb, wie sie dem Gefressenwerden zu entgehen versuchen, ihr Verhalten im Wettstreit mit anderen Tieren um Vorräte oder einen Partner, bei der Geburt und Aufzucht ihrer Jungen. Das wissenschaftliche Ziel ist, eine Theorie aufzustellen, wie Tiere zu all dem in der Lage sind. Wenn man verstehen möchte, warum ein Lebewesen wozu in der Lage ist (oder wozu es veranlasst werden könnte), gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Tiere unter kontrollierten, künstlichen Bedingungen im Labor zu studieren. Aber gerade Ethologen beobachten Tiere viel lieber in ihrer natürlichen Umgebung an Ort und Stelle.
Viele Ethologen sind insbesondere von der Verhaltensforschung in der freien Wildbahn fasziniert, wo es, abseits von Einfluss oder Kontrolle durch den Menschen, viele Millionen wild lebender, faszinierender Arten gibt. Man nehme irgendeine Zeitschrift über Tierverhalten oder Ethologie zur Hand und man wird darin haufenweise Studien über grasende Gazellen aus der afrikanischen Savanne oder kreischende Brüllaffen finden, die in den Bäumen des Regenwalds am Amazonas leben. Dabei braucht man nicht eigens darauf hinzuweisen, dass wir „Menschentiere“ einen erschreckend großen Teil der natürlichen Welt besetzen und heutzutage nur noch wenige Tierarten in der ursprünglichen, unberührten Wildnis vorkommen.
Tatsächlich führten die Ausbreitung der menschlichen Bevölkerung und deren wirtschaftliche Aktivitäten auch zu einer kontinuierlichen Verdrängung wilder Arten - viele ihrer Bestände sind zahlenmäßig stark zurückgegangen (manche bis hin zum Aussterben), und so ist es immer schwieriger geworden, sie zu erforschen. Das ist einer der Gründe dafür, warum das Objekt unserer Forschungsarbeit der alltägliche, überall vorkommende und sich erfolgreich vermehrende domestizierte Hund ist, eine Art, mit welcher der Mensch nun schon seit mehr als achttausend Jahren eng zusammenlebt. Es gibt eine ganze Milliarde von ihnen, sie mögen uns so vertraut sein wie jede gewöhnliche kleine Töle und wir betrachten sie nur zu oft durch eine vermenschlichende und sentimentale Brille. Trotzdem sind Hunde ganz großartige Modelle zur Erhellung der allgemeinen wissenschaftlichen Prinzipien, die erklären, was Tiere – und damit auch wir Ethologen – tun.
Konrad Lorenz (1903-1989) war einer der Gründerväter der modernen wissenschaftlichen Ethologie (Abb.4). Als Nobelpreisträger, akribischer Beobachter vieler Arten sowie literarisch begabter und aktiver Tierschriftsteller verbrachte er viel Zeit seiner langen Karriere damit, Hundeverhalten aus der Sicht eines Wissenschaftlers zu betrachten – was ihn allerdings nicht daran hinderte, sich dem besten Freund des Menschen gegenüber auch ein wenig sentimentalen Gefühlen hinzugeben. Seinen eigenen Schäferhund beschreibt Lorenz in der letzten Zeile seines Buchklassikers So kam der Mensch auf den Hund als „unermessliche Summe von Liebe und Treue“. Kaum einer der heutigen Hundeliebhaber würde dieser charmanten Hommage widersprechen wollen, und Lorenz, der Hundeliebhaber, mag wohl gedacht haben, er könne aus der Sicht seiner tiefen Verbundenheit mit den vielen Tieren heraus, die er in Haus und Hof hielt, zu einem gewissen Maß an wissenschaftlicher Erkenntnis gelangen.
Abb. 4: Die beiden Coppinger-Jungs 1978 beim Fachsimpeln über Ethologie zuhause bei Greta und Konrad Lorenz. Foto: Lorna Coppinger
Als Lorenz 1973 für seine Untersuchungen zur Prägung von Graugänsen den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielt (gemeinsam mit Nikolaas Tinbergen, für dessen Werk über Silbermöwen und Karl von Frisch, der die „Tanzsprache“ der Honigbiene entdeckte), verlieh man ihm diesen jedoch nicht deshalb, weil das Nobelpreiskomitee überzeugt davon gewesen wäre, dass Zuneigung und Mitgefühl mit Tieren zu des Rätsels Lösung führen würden, wie und warum Tiere sich so oder so verhalten. Nein, vielmehr wurde der Preis – der erste, der für eine wissenschaftliche Arbeit zu Tierverhalten vergeben wurde – für die grundlegende Theorie in der Ethologie verliehen, dass, in den Worten des Nobelpreiskomitees, „Verhaltensmuster erklärbar werden, wenn man sie analog zu anatomischen und physiologischen Merkmalen als das Ergebnis natürlicher Auslese betrachtet.“
Dieser Gedanke verkörpert den Herzschlag der Ethologie. Er bedeutet, dass das Verhalten an sich eine Folge organischer Evolution ist – und damit genauso ein Merkmal der adaptiven Maschinerie eines Tieres wie dessen Gliedmaßen oder Leber. Gleichzeitig impliziert er, dass bestimmte Verhaltensweisen auch auf die gleiche Art und Weise untersucht werden müssen wie körperliche Eigenschaften – als arttypische Merkmale, mit denen die Zuordnung in der Taxonomie vorgenommen wird. Der Begriff „Ethologie“ selbst stammt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet „Untersuchung des Charakters“, was den Kerngedanken der Einheit von Verhaltensmerkmalen und körperlichen Attributen recht treffend beschreibt.
Eine Folge dieser ethologischen Sichtweise ist die Erkenntnis, dass die natürliche Auslese also gleichzeitig sowohl auf das Verhalten als auch auf die äußere Erscheinung einwirkt. Es ist nicht zu weit hergeholt, zu sagen, dass (aus der Sicht von Ethologen) das, worum es in der Evolution wirklich geht, das Schwimmen, Fliegen oder Laufen ist. Flossen, Flügel oder Gliedmaßen sind nur Mittel zum Zweck. Als das erste Meerestier an Land gekrochen oder gekrabbelt kam, bestand sein Vorsprung im Selektionsprozess im Verhalten – es konnte einige der bereits entwickelten Eigenschaften seiner Form und Struktur nutzen, um sich auf bestimmte Art und Weise zu bewegen.
Von daher ist es nur logisch, dass Ethologen ihre Forschung auf die Beobachtung, Messung und Erklärung stammesgeschichtlich erworbener Verhaltensmuster konzentrieren. Manchmal wurden diese als angeborenes Verhalten oder Instinkt bezeichnet. Keine dieser Bezeichnungen ist jedoch sonderlich zeitgemäß, ganz besonders der Begriff „Instinkt“ mutet etwas verstaubt an. Die frühen Ethologen scheuten sich zwar nicht, dieses Wort zu verwenden (Tinbergen hat ein sehr schönes Buch mit dem Titel Instinktlehre verfasst), doch im Nachhinein betrachtet war das vermutlich ein Fehler. Der Begriff verschleiert nämlich die grundlegende ethologische Erkenntnis, dass verhaltens- und körperbezogene Eigenschaften ein und dasselbe sind. Beides sind angeborene und ererbte Eigenschaften, während Begriffe wie „instinktiv“ oder „angeboren“ zumindest im allgemeinen Sprachgebrauch nur im Zusammenhang mit dem Verhalten verwendet und nicht auf körperliche Eigenschaften eines Lebewesens bezogen werden. Man stelle sich nur einmal vor, wie grundfalsch es sich anhörte, wenn man sagte, der Mensch habe „einen Instinkt für fünf Finger“.
Auch der Begriff „angeboren“ ist problematisch. Versteht man doch darunter im Allgemeinen, dass ein Merkmal bei der Geburt vorhanden und im Wesentlichen durch ein spezielles genetisches Programm festgelegt ist. Wenn man ein Körpermerkmal als „angeboren“ bezeichnet, so ist das weniger unglücklich formuliert, als wenn man es „Instinkt“ nennen würde. Doch genauso wenig, wie es einzelne Aggressions-Gene gibt, gibt es auch keine Gene für fünf Finger. Finger sind das Ergebnis eines ursprünglichen Bauplans, der im Verlauf der Entwicklung eines Lebewesens einer ganzen Kaskade von kettenförmig ablaufenden physikalischen und chemischen Reaktionen unterliegt. Kleinste Änderungen in diesem Ablauf, und seien es auch nur einfache physikalische Einflüsse auf die Umgebung wie Hitze oder Kälte oder chemische Einflüsse wie die Zufuhr von Arzneien oder Alkohol, können die Form und sogar die Anzahl der Finger verändern. Dass also der Großteil von uns Menschen fünf Finger besitzt, liegt daran, dass wir beim Ablauf der Stufenreaktionen in sehr ähnlichen fetalen Umgebungen lebten: Unsere Mütter hatten eine Körpertemperatur von 37°C, waren gesund und nahmen weder Medikamente noch andere Chemikalien zu sich, welche unsere Entwicklung beeinflussten. Es war die Entfaltung der Genexpression zu den richtigen Bedingungen, die uns unsere fünf Finger beschert hat. Wenn man es so betrachtet, kann das Merkmal nicht als „angeboren“ oder „in den Genen liegend“ bezeichnet werden. Es ist vielmehr das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, der von einem Gensatz angestoßen wurde. Die Kritiker der Terminologie „Instinkt“ und „Angeborensein“ vertreten die Ansicht, dass man unmöglich den Rückschluss ziehen dürfte, ein Verhaltensmuster sei gänzlich von Geburt an vorhanden. Zu jedem Zeitpunkt seines Lebens, und sogar noch ehe es geboren ist (wie unser Beispiel mit den fünf Fingern zeigt), wird ein Lebewesen immer entscheidend von der Umgebung um es herum beeinflusst.
Da nun diese beiden Begriffe so viel diskutiert werden, möchten wir an die Stelle von „instinktiv“ oder „angeboren“ generell den Begriff „intrinsisch“ setzen. Die Verwendung von „intrinsisch“ in diesem Zusammenhang schulden wir den Embryologen, welche Entwicklung und Wachstum erforschen. Warum dieses Wort besser für die Beschreibung ererbter Eigenschaften (egal ob in Bezug auf Verhalten oder physische Eigenschaften) geeignet ist, werden wir in einem späteren Buchabschnitt aufzeigen. Wir werden außerdem zwei weitere Begriffe einführen, die vom üblichen Vokabular eines Ethologen abweichen: „Akkomodation“ und „Emergenz“.
Unter „Akkomodation“ (ein weiterer Fachbegriff aus der Embryologie) verstehen wir, dass die Entstehung und Entwicklung biologischer Strukturen und Verhaltensmuster – das Ergebnis der Gene – nicht nur gegenseitig voneinander abhängen, sondern auch von der Umgebung, in der sie sich entwickeln. “Emergenz“ ist die Art, wie einfache Prozesse und Eigenschaften zusammenspielen und dadurch Strukturen und Verhaltensmuster ausbilden können, die im Ganzen oft erheblich komplexer sind als die Summe ihrer Teile. In Wissenschaften wie Biologie, Physik und Informatik ist dieser Gedanke von wachsender Bedeutung. Wir werden in den Kapiteln 7 und 8 noch näher darauf zu sprechen kommen.
Mit unserem Vokabular und unserer Auffassung von der Ethologie verabschieden wir uns also gewissermaßen vom herkömmlichen Fokus auf den Instinkt. Wir betrachten Verhalten aus drei verschiedenen (und doch miteinander verbundenen) Kräften und Prozessen heraus entstehend - intrinsisch, akkomodativ und emergent - und wir dürfen keine von ihnen außer Acht lassen, wenn wir Hunde oder andere Tiere studieren.
Natur kontra Umwelt?
Vielleicht fühlen Sie sich bei diesem Streit um Begrifflichkeiten und deren Feinheiten an die schon lange andauernde und immerwährende Kontroverse von „Natur kontra Umwelt“ oder „Natur kontra Erziehung bzw. Sozialisation“ (im Englischen „Nature or Nurture“) erinnert. Zwischen Wissenschaftlern aller Sparten und der breiten Öffentlichkeit wird seit vielen Jahren heiß diskutiert, was von größerer Bedeutung ist: Die genetische Disposition bei Lebewesen und deren physische Gestalt (Natur) oder deren Entwicklung unter stark veränderlichen Umgebungsbedingungen (Erziehung / Sozialisation bzw. Umwelt). Diesbezüglich schwankt die öffentliche Meinung, zumindest was den Menschen anbelangt, heftig hin und her. Im einen Moment noch ist die öffentliche Meinung geradezu gefangen von der Idee, es gäbe „Gene für Religion“ oder angeborene Veranlagungen zu Gewalt- und Kriegsbereitschaft. Dann wieder folgt die Gegenbewegung und Gedanken zum Angeborensein werden als Beispiele für einen „biologischen Determinismus“ verteufelt, der den Einfluss von Kultur oder jeglicher Möglichkeit einer Veränderung im menschlichen Verhalten glattweg ignoriert. Nur wird diese Fragestellung leider allzu oft dichotom gesehen, also eine Diskussion geführt, bei der es nur zwei Seiten gibt, von denen entweder nur die eine oder die andere überwiegend oder komplett für das Verhalten verantwortlich sein kann.
Es mag daher wenig überraschen, dass den der Biologie zugeneigten Ethologen oftmals nachgesagt wird, sie seien Vertreter der Natur-Seite. Wie alle Biologen nehmen auch wir den Darwinschen Leitsatz ausgesprochen ernst, der besagt, dass die Tierarten sich durch evolutionäre (stammesgeschichtliche) Prozesse an ihren Lebensraum angepasst haben. Die „Natur“ ist also ganz klar der Ursprung dieser adaptiven Sichtweise. Aber nicht jeder Biologe ist davon überzeugt, biologische Anpassung erkläre das ganze Geheimnis von Leben und Verhalten. Einige jüngere Evolutionstheoretiker (unter anderem Steven Jay Gould und Mary Jane West-Eberhard) zweifeln an der Vorrangstellung der Adaptation gegenüber einer natürlichen Auslese als treibender Kraft der Evolution und glauben, dass Entwicklungsprozesse – ja sogar Naturkatastrophen – die Hauptrolle spielen. Zunehmend wird die Geschichte der Biologie als Produkt des Zusammenspiels beider Prozesse angesehen, sowohl evolutionärer als auch entwicklungsvorantreibender Kräften (genannt die evolutionäre Entwicklungsbiologie, oder engl. evo-devo für evolutionary developmental biology). Wie wir noch in Kapitel 7 und 8 sehen werden, werfen auch einige unserer eigenen Gedanken zu entwicklungsbedingter Akkomodation und Emergenz Fragen auf, und zwar bezüglich der Macht des üblichen Bilds von einem „starken Adaptionismus“.
Andere Wissenschaftler, darunter viele Psychologen, haben sich von einem anderen Blickwinkel her einzig und allein damit beschäftigt, wie sich Verhalten (wie ein Tier „lernt“) als Feedback auf nicht planbare und zufällige gemachte Erfahrungen im Laufe einer individuellen Lebensspanne verändert. Es überrascht nicht, dass sie der „Umwelt“-Seite zugeneigt sind - einige lehnen den Gedanken, dass jegliches Verhalten in irgendeiner bestimmten Weise durch Gene vorherbestimmt sein könnte, sogar komplett ab.
Letztlich erscheint es uns glasklar, dass die Bezeichnungen „Instinkt“ und „Angeborensein“, genauso wie „Natur“ und „Erziehung/Sozialisation“ wirklich die falsche Wortwahl darstellen. Der Phänotyp eines Tieres – also die Gesamtsumme all seiner physischen und verhaltensbedingten Merkmale – ist stets und notwendigerweise das Ergebnis eines hochkomplexen Zusammenwirkens aus Genen (und deren Produkten) sowie aus der Entwicklung und Erfahrungen des Lebewesens. Die Verfügbarkeit von Nahrungsquellen, die Gegenwart anderer Tiere und sogar zufällige unwägbare Ereignisse wie das Wetter – alles kann eine tiefgreifende Auswirkung darauf haben, wie ein Tier aussehen wird oder wie es sich zu irgendeinem Zeitpunkt verhält.
Wir zum Beispiel fragen unsere Studenten gern scherzhaft: „Glaubt ihr, ihr seid genetisch für genau das Gesicht vorprogrammiert, das ihr habt?“ (Dieses großartige Beispiel verdanken wir dem Evolutionsbiologen und Genetiker Richard Lewontin.) Üblicherweise antworten die Studenten mit: „Natürlich, deshalb sehe ich ja aus wie mein Vater [oder meine Mutter, oder mein Großonkel].“ Zweifellos ähneln Menschen häufig ihren Eltern oder anderen Vorfahren, und es erscheint nur zu vernünftig, zu glauben, diese Ähnlichkeit müsse der Natur geschuldet sein, sie sei genetisch vererbt. Nun, in gewichtiger Hinsicht muss ein Gesicht genetisch bedingt sein – es ist immerhin eine Ansammlung aus Haut, Knochen und Bindegewebe, welche natürlich durch die Gene des speziellen Individuums entstanden ist. Aber Gene können nicht alles sein. Gesichter können sich im Laufe eines Lebens - manchmal ganz dramatisch - verändern. Welches Gesicht war denn nun genetisch vorprogrammiert worden? War es das, wie man mit vier Jahren ausgesehen hat? Und was ist mit dem Gesicht, als man siebzehn war? Oder fünfundsiebzig? Es ist wohl nur recht und billig, zu behaupten, dass ein Mensch tatsächlich an keinen zwei aufeinanderfolgenden Tagen das gleiche Gesicht hat. All die vielen Gesichter mögen mehr oder weniger aussehen wie „man selbst“, aber gibt es denn für jedes einzelne Gesicht, das man im Laufe seines Lebens im Spiegel erblickt, einen eigenen Satz an Genen? Selbstverständlich nicht.
Tatsächlich entwickeln sich alle Lebewesen während der Spanne ihres Lebens – ständig verändert sich ihre äußere Erscheinung durch ein feines Zusammenspiel zwischen den Genen und der Umgebung des Tieres. Zu Beginn ist ein Säugetier oder ein Vogel ein befruchtetes Ei, der Embryo wird größer und bildet sich differenziert heraus. Von Geburt an haben ein neugeborenes Säugetier oder ein frischgeschlüpfter Vogel eine vollkommen andere äußere Erscheinungsform als das erwachsene Tier seiner Art. Jede dieser Entwicklungsstufen des Lebens – das Ei, der Embryo, Neugeborenes, Jungtier und erwachsenes Tier – funktioniert aufgrund desselben Gensatzes, aber genau diese Gene tun sich irgendwie zusammen, während das Tier wächst und bringen ganz unterschiedliche Ergebnisse hervor.
Ein Neugeborenes hat nicht nur einen anderen Körper als ein Erwachsener, sondern es zeigt auch spezielle Verhaltensweisen, die intrinsisch zu seiner derzeitigen Entwicklungsstufe sind. Ein neugeborenes Säugetier nuckelt an der Zitze seiner Mutter (und muss das nicht beigebracht bekommen); ein Erwachsener frisst feste Nahrung auf eine Art und Weise, die sich erheblich vom Nuckeln eines Babys unterscheidet. Während seiner Entwicklung herrscht ein Wechselspiel der intrinsischen Eigenschaften des Lebewesens miteinander wie auch mit seiner Umgebung und es bilden sich neue Strukturen und Fähigkeiten heraus: Akkomodation und Emergenz spielen dabei wichtige Rollen. Die Quintessenz ist, dass kein Genom eines Tieres den vollständigen Entwurf enthält, der die genauen Details all der Veränderungen in seiner Erscheinung und seinem Verhalten festlegt, wie es sie in seinem Leben zeigt. So gesehen kann es keine simple binäre Unterscheidung zwischen Natur und Erziehung geben, denn die beiden spielen zusammen. Doch auch dieser vermittelnde Ansatz ist ein wenig zu vereinfachend. Biologen möchten verstehen, wie der Phänotyp (P) eines Tieres entsteht. Der Genotyp (G) ist seine genetische „Natur“. Der Einfluss der Umwelt ist das, was wir unter „Erziehung“ verstehen. (E für engl. Environment, oder „Erziehung“). Ist der Phänotyp ein bloßes Ergebnis von Genotyp und Umwelt, Natur und Erziehung? Oder, mathematisch ausgedrückt, trifft die Gleichung P = G + E zu? Wenn wir wissen möchten, wie die Natur beteiligt ist, können wir die Gleichung nach G auflösen, indem wir E auf beiden Seiten subtrahieren: P – E = G? Das heißt, wenn wir den Phänotyp betrachten und die Rolle der Erziehung abziehen, bleibt dann der Einfluss der Natur übrig?
Man hat Experimente folgendermaßen überprüft: Man nahm zwei Tiere und zog diese in identischen Umgebungen auf; also mussten alle Unterschiede genetisch bedingt sein. Nun nehmen wir einmal an, wir möchten wissen, welche Rinderrasse die meiste Milch gibt. Also ziehen wir zwei Rassen – sagen wir einmal Holsteiner und Guernseys – in den gleichen Ställen auf und versorgen sie mit demselben Futter. Ihre Genotypen sind verschieden, aber die Umweltbedingungen, in denen sie leben, sind exakt die gleichen. Unter diesen Umständen geben die Holsteiner Kühe mehr Milch. Können wir also einfach die Umwelt/Erziehung von der Gleichung abziehen und daraus schließen, dass ein genetischer Rassenunterschied – die Natur – die Holsteiner zu besseren Milchkühen macht? Leider nein.
Es mag zwar stimmen, dass Holsteiner in einer bestimmten Umgebung mehr Milch geben als Guernseys, doch wenn wir die Ernährungsbedingungen umstellen, indem wir etwa beide Tiere für einige Tage zum Grasen auf die Weide stellen, können Guernseys die Holsteiner übertreffen. Wieder haben wir die Umweltbedingungen (Erziehung) beeinflusst – aber dieses Mal gaben die Guernseys mehr Milch. Also welche Rinderrasse gibt denn nun die meiste Milch? Vielleicht liegt die Antwort in einer anderen Frage: An welche Umweltbedingungen sind sie angepasst?
Die Bedingungen der Umwelt, in der Tiere leben, sind ausgesprochen vielfältig und befinden sich in ständiger Veränderung. Intensiveres Licht könnte einen Unterschied bei der Milchproduktion ausmachen; die Temperatur könnte ein Faktor gewesen sein. Wie wir nun gesehen haben, erbringt die Genanalyse eines Tieres keine vollständige Darstellung all der Details in Aussehen und Verhalten, die es während seines Daseins zeigt – das ist auch gar nicht möglich. Genauso ist auch die Betrachtung eines Tieres in einer bestimmten Umgebung kein ausreichender Garant dafür, dass wir uns ein tatsächliches Bild seiner Fähigkeiten machen können. „Natur plus Erziehung“ unterstellt, dass man den Einfluss je einer der beiden Kräfte leicht herauskitzeln kann. Doch so einfach ist es nicht. „Natur mal Erziehung“ oder P = G x E ist vermutlich ein besserer Weg, um die komplexen phänotypischen Auswirkungen zu erfassen, die wirklich für Lebewesen charakteristisch sind.
Warum Arbeitshunde beobachten?
Wir erwähnten zuvor, dass es etwa eine Milliarde Hunde auf der Welt gibt. Nur ein Viertel von ihnen lebt bei uns zu Hause oder in sehr enger Bindung zu uns; von diesen werden viele nur zur Gesellschaft als reine Begleiter gehalten. Andere dagegen nutzen wir vorrangig für unsere praktischen Zwecke wie zum Beispiel die Landwirtschaft. In unserer eigenen Forschungsarbeit konzentrierten wird uns speziell auf diese „Arbeitshunde“.
Ray hat fünfzehn Jahre mit der Zucht und Ausbildung von Hunden zugebracht, die Schlitten ziehen, und wurde zu einem kompetenten Musher. Er verfasste viele Artikel zur Anatomie, Physiologie und Biomechanik von Schlittenhunden. Etwa viertausend Hunde „gingen über seinen Hof “. Danach wandten wir uns gemeinsam dem Studium von Hunden zu, die Schäfer bei der Herdenhaltung unterstützen. Wir schauten uns zwei Arten an: Hütehunde, die die Herde von einem Ort zum nächsten treiben (unser Studientier war der Border Collie aus Schottland), und Herdenschutzhunde, die die Herde vor Fressfeinden beschützen. Wir holten und studierten Maremmen-Abruzzen-Schäferhunde aus Italien, Šarplaninacs aus dem ehemaligen Jugoslawien und Anatolische Schäferhunde aus der Türkei, zusammen mit einer großen Anzahl an Chesapeake-Bay-Retrievern, die von Rays Sohn Tim Coppinger aufgezogen und für Wettkämpfe trainiert worden waren. Die Gesamtzahl der Schäferhunde, die für Beobachtungsund Versuchszwecke nutzten, belief sich auf etwa fünfzehnhundert Tiere. Viele der Herdenschutzhunde gingen letztendlich bei mit uns kooperierenden Farmern quer über die Vereinigten Staaten und auch ins Ausland in Dienst.
Es zeigte sich, dass sie alle wunderbare Studienobjekte dafür waren, um herauszufinden, was einen Hund grundsätzlich „zum Ticken bringt“. Schlittenhunde waren perfekte Beispiele für Hunde, die nur auf ein einzelnes Verhalten selektiert worden waren – nämlich das, über lange Strecken schnell zu rennen und dabei Schlitten und Fahrer zu ziehen. Und die Hirtenhunde – Herdenschutzhunde wie Hütehunde – waren das Traumstudienobjekt eines jeden Ethologen: Zwei Hundetypen, die unter den gleichen Umweltbedingungen für die Arbeit mit demselben Zieltier (Schaf) selektiert werden, die sich aber ganz deutlich in ihren Verhaltensmustern und der Art, wie sie diese der Herde gegenüber zeigen, unterscheiden.
Schauen wir uns einmal kurz an, wie und warum wir an diesen drei Arbeitshundetypen Interesse entwickelt haben. Als Ray noch jünger und beweglicher war, beschloss er, dass er sich mit der aufwändigen (aber aufregenden) Angelegenheit des Schlittenhunderennens beschäftigen wollte. Er erstand seine erste Huskyhündin und zeigte sie voller Stolz Charlie Belford, seinem ortsansässigen Veterinär und Weltmeister im Schlittenhunderennen. Belford schaute skeptisch drein und fragte: „Woher weißt du denn, ob sie ein Schlittenhund ist – hat sie schonmal einen Schlitten gezogen?“
Diese Frage mag seltsam erscheinen, sind doch Huskys das Bilderbuchbeispiel für einen Schlittenhund schlechthin. Nun, Schlittenhunde sind erstaunliche Tiere – das schnellste Säugetier der Welt, wenn man über Strecken von Marathondistanz hinausgeht. Kein anderes kann ihnen da das Wasser reichen. Für Bedford ging es allerdings ganz offensichtlich nicht nur um die Frage der „richtigen Rasse“. Es ging noch um etwas anderes. Somit warfen diese Hunde einige große ethologische Fragen auf: Wie verhalten sich Genotyp und Phänotyp bei Schlittenhunden zueinander? Welches sind die Anpassungsmerkmale, die es ihnen ermöglichen, beim Iditarod Trail in Alaska innerhalb von acht Tagen unter arktischen Bedingungen über tausend Meilen zu laufen? Was motiviert sie dazu? Können ihre spezielle Biomaschine, ihre Physiologie und Anatomie, das bemerkenswerte Verhalten dieser Tiere erklären?
An die Untersuchungen zu den Herdenschutzhunden gingen wir ganz anders heran. Unser Interesse an ihnen begann mit einem Auftrag – wir hatten einen eher praktischen Grund dafür, ihr Verhalten verstehen zu wollen. Seit den ersten Tagen des amerikanischen Westens wurden Wölfe, Kojoten, Adler und Pumas von Farmern und Ranchern, später auch von offiziellen „Schädlingsbekämpfern“ der Bundesbehörden, pausenlos gejagt und eingefangen oder man ging mit Sprengstoff und Gift gegen sie vor. Alles, was Nutztierherden angriff, geriet ins Visier. In den frühen 1970ern begann man dann in ganz Amerika, tödliche Methoden zur Raubtierkontrolle mittels Bundesgesetzen zu verbieten. Natur- und Umweltschützer waren davon überzeugt, dass zu einem ausgeglichenen Ökosystem auch die Spitzenprädatoren gehören. Das Verständnis um Ökosysteme war damals noch nicht besonders umfassend, aber nachdem Mitte der 90er Jahre wieder Wölfe im Yellowstone Nationalpark angesiedelt worden waren, wurde klar, dass Arten wie der Wolf tatsächlich eine erstaunlich wichtige Rolle im natürlichen Lauf der Dinge spielen. Im Yellowstone Park war vor der Rückkehr der Wölfe die Hirschpopulation explodiert, und über viele Jahre hinweg hatte die große Anzahl an Hirschen und Bisons einen Großteil der Vegetation im Park kahlgefressen – besonders entlang der Bäche und Flüsse, an denen sie sich zum Fressen und Trinken sammelten.
Die Auswilderung der Wölfe änderte das alles wieder. Als die Grasfresser ihre Fressgewohnheiten änderten, um dem neu entstandenen Druck durch die Wolfsangriffe auszuweichen, begannen sich die Wiesen und Wälder entlang der Bäche und Flüsse zusehends zu erholen. Die Wiederentstehung von Wäldern führte zu einer Explosion der Artenvielfalt von Vögeln. Biber kehrten zurück, sie bauten Dämme mit dem neuen Baumbestand und schufen dadurch neuen Lebensraum, der wiederum andere Wassertiere einlud, die schon längst aus dem Park verschwunden gewesen waren. Die Flüsse selbst änderten ihren Lauf (wie der Schriftsteller und Umweltaktivist George Monbiot es in einer fesselnden TED-Talk-Aufzeichnung [TED = technology, entertainment, design] über die Auswirkung der Wiederansiedlung von Wölfen formulierte), als der Druck durch die Beweidung auf die Vegetation an ihren Ufern abnahm. Der Versuch, zu verstehen, welche Rolle Verhalten in der Verursachung dieser großen, ineinander verzahnten Folgen von kleinen Veränderungen in komplexen biologischen Systemen spielt, hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf das Denken von Ökologen, Evolutionsbiologen und Ethologen. Aber nachdem Fressfeinde wie der Wolf und der Kojote unter Schutz gestellt worden waren, waren die Lebensgrundlagen der Schaf- und Rinderzüchter weiterhin bedroht. Man benötigte dringend Mittel und Wege, die für die Spitzenprädatoren nicht tödlich sein würden, und viele solcher Methoden wurden tatsächlich entwickelt. Zum Beispiel versuchte eine Gruppe von Verhaltensforschern in Kalifornien, Kojoten beizubringen, keine Schafe zu fressen, indem sie diesen eine ungiftige Substanz zu fressen gaben, die ihnen den Geschmack von Schaffleisch vergällen sollte – aversive Konditionierung. Das funktionierte ganz gut, wurde aber von den Ranchern nicht angenommen.
In unserem Forschungsprogramm für Ethologie und Kognitionswissenschaften am Hampshire College in Amherst, Massachusetts, entwickelten wir einen anderen Ansatz. Wir hatten gehört, dass Hirtenvölker auf der ganzen Welt Haushunde nutzten, um zu verhindern, dass ihre Herdentiere gerissen wurden. Beinahe überall – außer in den Vereinigten Staaten – setzten die Völker schon seit Urzeiten diese „speziellen“ Wachhunde ein, deren einzige Aufgabe darin bestand, die Nutztiere vor Raubtieren zu schützen – und zwar vor allen, von Löwen und Leoparden bis hin zu Schakalen und Pavianhorden. In einigen Mittelmeerländern setzten Hirten Hunde ein, um ihre Tiere vor vertrauteren Feinden wie Wölfen oder Bären zu schützen oder sogar vor streunenden Hunden, die auch hierzulande oder in Europa eine erhebliche Bedrohung für die Herden darstellen. Mancherorts werden Hunde auch zum Schutz vor Schafsdieben eingesetzt.
Wie nun konnte dieses System funktionieren? Was hat es auf sich mit diesen Hunden, die Fressfeinde abhalten können? Welches Verhaltensmerkmal ist notwendig, damit ein Hund friedvoll mit einem Schaf zusammenleben kann? Würde dies in den Vereinigten Staaten ebenfalls funktionieren - zum Schutz von Nutztierbeständen in Gegenden, in denen Raubtiere wieder angesiedelt worden waren? Im Rahmen unserer Untersuchungen von Herdenschutzhunden kamen wir in der ganzen Welt herum. Wir fanden Länder von Portugal über Italien und die Türkei bis hin zu Tibet, in denen es eine oder mehrere „Landschläge “ von Arbeitshunden gibt (örtlich vorkommende, natürlich angepasste Hundevarietäten), die manchmal voller Stolz als „Rasse“ (absichtlich „gestaltete“ Produkte künstlicher Selektion) bezeichnet werden. Schriftlichen Aufzeichnungen zufolge setzen die Völker dieser Kulturen solche Landschläge an Herdenschutzhunden bereits seit mehreren tausend Jahren ein.
Um etwa 1930 begannen auch einige Hundeliebhaber in Amerika und Europa welche zu züchten – aber eher als Haustiere und Hausbewacher denn als arbeitende Herdenschutzhunde. Wir dagegen wollten die originalen, „natürlich“ vorkommenden Arbeitshunde studieren, ehe Züchter ihrer habhaft geworden waren, um herauszufinden, wie sie ihre Arbeit denn tatsächlich verrichteten. Waren sie tatsächlich erfolgreich bei der Abschreckung von Angreifern oder gehörte dies auch nur in den Bereich der unverwüstlichen Mythologie, wonach Hunde des Menschen beste Freunde sind, immer glücklich und eifrig unseren Befehlen gehorchend? Und wenn sie tatsächlich Erfolg hatten, wie arbeiteten sie? Besonders fasziniert waren wir angesichts der Tatsache, dass viele Haushunde Schafe und andere Herdentiere hetzen oder sogar töten, und das allem Anschein nach rein aus Spaß.
Unser drittes Studientier war der Border Collie, ein Hütehund (oder Koppelgebrauchshund) mit einer ganz anderen Aufgabe: Border Collies sollen das Ziehen großer Schafherden leiten können, indem sie die Kommandos umsetzen, die der Schäfer ihnen erteilt. Diese Aufgabe ist eine enorme Herausforderung für jedes Tier, und kein anderer Hund wird so großflächig dafür eingesetzt, um die kleinsten Bewegungen der Herden zu steuern. Ihr Können (in Kooperation mit einem pfiffigen Schäfer) ist legendär, und wer jemals einen Hütehundwettbewerb verfolgt hat, der wird das offensichtlich erforderliche Geschick und die Reaktionsfähigkeit auf menschliche Kommandos hin anerkennen. Was macht Border Collies dafür geeignet, diese Aufgabe zu erfüllen und diese Art von Arbeit zu verrichten? Ist es das Ergebnis mühevollen Trainings? Oder ist es ihrer natürlichen Intelligenz geschuldet (sie werden manchmal als einige der „klügsten“ Hunde angesehen)? Oder sind ihre Fähigkeiten ein intrinsisches Verhaltensmerkmal dieser Rasse?
Zu Beginn unserer Untersuchungen über Herdenschutzhunde wurden wir regelmäßig gefragt, ob man diese Hunde auch zum Hüten und Arbeiten wie Border Collies ausbilden könnte. Damals kannten wir die Antwort noch nicht – aber es war eine spannende Frage für Ethologen und ihre Schüler. Wie entstehen diese beiden unterschiedlichen Arbeits-Verhalten? Gibt es Grenzen dafür, was ein bestimmter Hundetypus kann? Das war Wissenschaft vom Feinsten: Neben der Beobachtung des Arbeitsverhaltens in der Praxis konnten wir auch sorgfältig überwachte Experimente anstellen, um diesen Fragen nachzugehen. Wir konnten zum Beispiel Welpen jeder der Typen, die für eine bestimmte Aufgabe herangezüchtet worden war, „quer-aufziehen“: Jede Art konnte in der Umgebung der jeweils anderen aufgezogen werden, und im Hüten und Beschützen gleichermaßen ausgebildet werden.
Das war ein Traumunterfangen. Wir (eine Gruppe von Hampshire College Studenten und ihre Professoren) reisten zu den großen Schafweidegründen am Mittelmeer und in Asien, mit dem Ziel, einen Grundstock für die Zucht von Hunden mitzubringen, mit denen man eine zur systematischen Beobachtung auf Farmen in den Vereinigten Staaten sowie in unseren Laboren ausreichend große Population hervorbringen konnte. Wir holten Herdenschutzhundewelpen aus der Türkei, Jugoslawien und Italien, wobei wir besonders darauf achteten, dass die Welpen aus diesen Ländern möglichst am selben Tag geboren waren, damit wir nicht nur die Kontrolle über ihre Lebensbedingungen, sondern auch bei deren Aufzucht und Ausbildung hatten.
Auf dem Heimweg machten wir Halt in Schottland, besuchten Hütehunde-Wettbewerbe, sprachen mit Verkäufern und Farmern und kauften letztendlich sechs Hunde aus deren Bestand, von denen vier am selben Tag wie die bereits von uns erstandenen Welpen von Herdenschutzhunden geboren worden waren.
Abb. 5: Diese sechs Wochen alten Welpen wurden alle am selben Tag geboren. In diesem Alter sind sie alle gleich groß. Wie viele Herdenschutzhunde erreichen auch Maremmanos (weiß) um die achtzig bis einhundert Pfund, während Border Collies (schwarz) nur bis zu fünfunddreißig Pfund schwer werden. Foto: Lorna Coppinger
Im Laufe der Jahre konnten wir aus den Datensammlungen aus unserem Labor und von den Farmern, mit denen wir zusammenarbeiteten, eine ganze Menge darüber lernen, wie sich „Natur“ und „Erziehung“ auf das Verhalten dieser Hunde auswirkten. Im weiteren Verlauf dieses Buches werden wir auch noch darüber sprechen, was genau wir aus vielen verschiedenen Blickwinkeln her betrachtet über all diese Hundespielarten herausgefunden haben. Nun aber möchten wir kurz einen näheren Blick auf eine kleine Beobachtung zum Verhalten eines Herdenschutzhundes „in der Praxis“ werfen und dann schauen, wie Ethologen darangehen, dies zu beschreiben und zu erklären.
Herdenschutzhunde in den Abruzzen
Unsere erste Aufgabe bestand darin, Herdenschutzhunde in Aktion zu finden und ihr Verhalten in natürlicher Umgebung zu beschreiben. Wir mussten eine brauchbare Definition von „die Herde schützen“ entwickeln, damit wir dazu Beobachtungen anstellen und diese vergleichen konnten. Wir wollten verstehen, wie die Hunde überhaupt mit einer Schafherde interagieren und wissen, ob ihre Fähigkeit zur friedvollen Koexistenz mit der Herde eine genetisch bedingte, intrinsische Eigenschaft ihrer Rasse oder aber das Ergebnis ihrer Ausbildung war. Und für die anstehende Aufgabe war auch wichtig zu wissen, ob es wahrscheinlich war, dass Herdenschutzhunde einen die Herde bedrohenden Angreifer töten würden. Schließlich neigen Menschen dazu, „Schutzhunde“ (wie knurrende Deutsche Schäferhunde an den Zäunen eines Gefängnisgeländes) für so große und wilde Tiere zu halten, dass sie in der Lage sind, Wölfe oder Bären zu töten. Wenn an der ganzen Sache etwas dran sein sollte, dann würden diejenigen von uns, die auf der Suche nach einer friedlichen Methode der Raubtierkontrolle waren, diese Hunde ganz sicher nicht dafür einsetzen wollen – der Sinn der Übung lag ja darin, eine Methode zur Abwehr von Angriffen zu finden, die den Angreifer zwar abschreckte, aber unversehrt ließ.
Die Abruzzen im östlichen Mittelitalien sind ein großartiger Ort, um dieses interessante biologische System vor Ort genau unter die Lupe zu nehmen (außerdem war es ein Traum von Forschungsgebiet, weil man in Italien fantastisches Essen bekommt – etwas, das jeder Ethologe bei der Auswahl des Gebietes für sein Forschungsprojekt vor Ort berücksichtigen sollte). Wie in beinahe jeder traditionsgeprägten ländlichen Umgebung findet man auch in den Abruzzen Hunde, die mit und zwischen Schafen leben. Auf den Hügeln und dem grasreichen Weideland der Abruzzen haben schon unzählige Generationen von Schafen gegrast, manche von ihnen mit Hunden und menschlichen Hirten, manche in der alleinigen Gesellschaft von Hunden. Man sieht kaum einmal eine Schafherde ohne Hunde.
Wie bei allen Tieren (einschließlich Hunden) wird das Verhalten von Schafen von Futtersuche, der Vermeidung von Gefahren wie etwa Raubtiere und der erfolgreichen Hervorbringung von Nachkommen geleitet. Dasselbe gilt natürlich auch für die Raubtiere selbst: Die Wölfe, Füchse, Luchse und wilden Bären, die noch im Apennin umherstreifen, müssen ebenso fressen, sich fortpflanzen und Gefahren aus dem Weg gehen. Eine Möglichkeit zur Futterversorgung besteht für sie darin, Schafe zu töten und diese oder ihre Lämmer zu fressen. Natürlich ist die Lage für die Herdenschutzhunde selbst eine andere: Hoch in den Bergen finden sie wenig zu fressen – und wie alle Hunde verlassen auch sie sich darauf, vom Menschen mit Futter versorgt zu werden.
Als Ethologen wollen wir verstehen, wie dieses komplizierte Zusammenspiel zwischen Mensch, Schafen, Hunden und Raubtieren funktioniert. So trafen wir uns zu Beginn unserer Forschungsarbeit eines Sommermorgens mit einem Schäfer mit Schlapphut, dreihundertfünfzig Schafen und einigen großen weißen Maremmen-Abruzzen-Hunden (Maremmanos). Zur Mittagszeit kann die Sonne in derartiger Höhe infernalisch hell sein. Schon das Sonnenlicht allein kann Menschen und Tier förmlich umbringen – nur „mad dogs and Englishmen“ (verrücktgewordene Hunde und Engländer) gehen in der Mittagssonne nach draußen. Hautkrebs und Hitzschlag stellen sowohl für Hunde als auch Schäfer eine Bedrohung dar. Wenn erhitzte Hunde keinen Schatten finden, hecheln sie und ihre rosa Zungen können einen Sonnenbrand bekommen; und in der Tat tritt bei einigen von ihnen Zungenkrebs auf. Wenn große Tiere der Sonne draußen ausgeliefert sind, können sie rasch sterben. Die Schäfer sind so schlau, sich mit angemessener Kleidung zu schützen (wie auf Abb. 6 zu sehen).
Abb. 6: Schäfer auf der ganzen Welt schützen sich durch ihre Kleidung vor der Sonne. Der Schäfer auf dem oberen Bild mit dem riesigen Mantel stammt aus dem Weideland der ungarischen Puszta, der andere Schäfer darunter im Riesenmantel aus Lesotho, Südafrika.
An einem ganz besonders heißen Tag verlangsamten die Schafe gegen Mittag ihr Tempo und legten eine Pause ein. Die Hunde fanden ein wenig Schatten unter überhängenden Felsen und der Schäfer kroch unter seinen riesigen Feldmantel, der ihn zusammen mit seinem Hut vor der Sonne schützte. Während wir dasaßen und beobachteten, fiel der Schäfer rasch in einen tiefen Schlaf. Nach einiger Zeit, als er noch schlief, erhoben sich seine Schafe und wanderten davon. Und trotz der unendlich heißen Sonne gingen die Hunde mit ihnen. Der Schäfer wachte auf, nachdem die Tiere schon eine Zeitlang ganz außer Sichtweite gelangt waren, um festzustellen, dass seine Herde und Hunde verschwunden waren. Ein wenig peinlich berührt schaute er uns an und wir zeigten in die Richtung, in die die Tiere gegangen waren. Er winkte uns zum Dank zu und ging los, um ihnen zu folgen.
Ethologische Gedanken über die Maremmenhunde
Wie sehen eigentlich Ethologen eine kleine Begebenheit wie diese? Wissenschaft ist ja tatsächlich nichts anderes als eine systematische Art und Weise, Fragen zu stellen und zu versuchen, Antworten auf diese zu finden. Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Fragen zu stellen und die richtige Methode zu wählen, um sie zu untersuchen. Der eigentliche Trick dabei ist, nachprüfbare Fragen zu formulieren – Hypothesen oder begründete Annahmen – mit denen man Vorhersagen machen kann. Dann muss man eine Feldstudie und Versuche ausarbeiten, um Daten zu sammeln, die es ermöglichen, diese Vorhersagen zu überprüfen. Nachfolgend eine Sammlung von vielen, vielen Fragen, die Ethologen zu unserer kleinen Beobachtung zum Verhalten der Maremmanos in den Abruzzen stellen könnten:
Warum haben diese Hunde ihren Herrn zurückgelassen (sind sie nicht des Menschen bester Freund?) und sind stattdessen den Schafen gefolgt?
Würden alle Maremmanos sich so verhalten wie die von uns beobachteten?
Würde jede beliebige Hunderasse sich so verhalten? Wie steht dieses Arbeitshundeverhalten in Bezug zu dem möglichen Verhalten unserer Haushunde, die in Familien leben?
War ihr Verhalten eine Folge der Einwirkung von Sonne und Hitze (oder anderer Umweltbedingungen) ihres Lebensraumes im Hochgebirge? Waren sie möglicherweise den Schafen gefolgt, um Abkühlung zu finden?
Wurden die Maremmanos in den Abruzzen gezielt darauf abgerichtet, sich besonders um die Schafe zu kümmern, wenn diese weiterzogen?
Was würde geschehen, wenn man sie Ziegen oder Pferde hüten ließe anstelle von Schafen?
Waren diese Hunde ganz einfach intelligent genug, um selbst herauszufinden, was zu tun war?
Werden Herdenschutzhunde mit einer genetisch bedingten Eigenschaft geboren, die sie die Schafe dem Menschen vorziehen lässt?
Könnte es am Alter dieser speziellen Hunde gelegen haben?
War ihr Verhalten die Folge von etwas, das geschieht, während diese Hunde aufwachsen und sich entwickeln? Falls ja, gab es eine bestimmte Zeitspanne in ihrem Leben, in der sich diese Art der Verbindung entwickelte?
Lassen Sie sich nicht von den verschiedenen (und manchmal auch gegensätzlichen) Möglichkeiten verwirren, wie man einen kleinen Teil des hündischen Verhaltens betrachten und hinterfragen kann. Wenn Wissenschaftler ein Naturphänomen untersuchen, ist es so gut wie immer möglich – und auch wünschenswert – eine Vielzahl an Hypothesen aufzustellen. Der Kern jeder wissenschaftlichen Arbeit ist die kreative Aufstellung von Hypothesen, die man dann anschließend gegen sorgfältig erstellte und gemessene Beobachtungen der äußeren Welt überprüft. Über konkurrierende Thesen zu streiten und sie zu überprüfen macht einen großen Teil des Spaßes und der Spannung bei der Wissenschaft aus.
Und es gibt noch einen anderen, wesentlicheren Grund dafür, dass unterschiedliche Wissenschaftler auch unterschiedliche Erklärungen dafür haben, warum die Dinge sind, wie sie sind. Die Frage nach dem „Warum“ einer bestimmten Verhaltensweise ist in der Tat keine einfache Frage. Niko Tinbergen – einer der Begründer der modernen Ethologie – war der Meinung, dass ein Biologe das „Warum“ von Verhalten mindestens auf vier verschiedene Arten hinterfragen sollte. Diese wurden unter Ethologen als „Tinbergens vier Fragen“ bekannt.
In der Zeitschrift Science stellte Tinbergen selbst diese Fragen 1968 so:
Inwiefern beeinflusst dieses Phänomen (Verhalten) das Überleben und den Erfolg des Tieres?
Wie wird die Verhaltensweise an einem beliebigen Zeitpunkt ausgelöst? Wie funktioniert ihre „Maschinerie“?
Wie entwickelt sich die Verhaltensmaschinerie beim Heranwachsen des Individuums?
Wie haben sich die Verhaltenssysteme einer jeden Spezies entwickelt, bis sie zu dem geworden sind, was sie heute sind?
Die erste Frage betrifft die Funktion einer Verhaltensweise: Wie passt diese zu den grundlegenden Bedürfnissen eines Tieres: Nahrungserwerb, Gefahrenvermeidung und Fortpflanzung? Als die Maremmanos in den Abruzzen den Schafen anstatt dem Schäfer folgten - verbesserte das ihre Chance zur Futtersuche oder konnten sie mehr oder bessere Nachkommen zeugen als Hunde, die nicht bei der Herde bleiben? Könnte es ganz einfach damit zu beantworten sein, dass die Schäfer diejenigen Hunde füttern und versorgen, die bei den Schafen bleiben, während sie die anderen aussortieren?
Zweitens wollte Tinbergen, dass wir Vorgänge hinterfragen (oder die Kausalität). Welche Prozesse - physiologische, neurologische oder motivationsgeleitete - könnten, während sich ein Tier tatsächlich in Raum und Zeit bewegt, neben der Bewegungs-Biomechanik selbst noch eine Rolle spielen, oder auch eben nicht? Waren unsere Maremmanos durch die direkten körperlichen Auswirkungen der hohen Temperaturen veranlasst worden, sich zu bewegen? Gibt es einen „Schalter“ ihrer Nervenbahnen im Gehirn, der durch die Bewegung von Schafen gesteuert wird? Werden sie innerlich belohnt, einfach weil es sich gut anfühlt, Schafen nachzufolgen? Wenn sie das tun, sorgt dann ihr Gehirn für eine kräftige Endorphinausschüttung, so wie bei einem Läuferhoch?
Zum Dritten müssen wir uns die individuelle Entwicklung (oder Ontogenese) einer Verhaltensweise bei einem Tier anschauen. Ist es gleichbleibend und unveränderlich (intrinsisch), oder verändert es sich im Laufe der Zeit? „Verwechseln“ Herdenschutzhunde, die inmitten von Schafen aufwachsen, zu einem kritischen Zeitpunkt in ihrer Entwicklung einfach nur Schafe mit anderen Hunden, bei denen sie lieber bleiben würden? Würden dieselben Hunde, falls sie mit Ziegenböcken aufwüchsen, dann Schafen gar nicht folgen?
Viertens und letztens und von entscheidender Bedeutung für die Ethologie müssen wir die Stammesgeschichte (oder Phylogenese) einer Art zu verstehen versuchen. Warum führte der Verlauf der biologischen Evolution zu einer besonderen Art des Handelns? Was war der adaptive Wert eines Verhaltensmusters, welches von der natürlichen Auslese beeinflusst wurde? Wie wirkt sich Verhalten bei verwandten Arten aus, die eine gemeinsame Evolutionsgeschichte haben? Zuvor haben wir gesagt, dass Hunde keine Wölfe sind - aber sie haben gemeinsame Vorfahren, und der Vergleich der zwischen beiden bestehenden Verhaltensunterschiede (die wir im weiteren Verlauf des Buches öfter ansprechen werden) dürfte aufschlussreich sein.
Auf all diese Fragen über Maremmanos (und ähnliche Fragen über Schlittenhunde und Border Collies) kommen wir an späterer Stelle im Buch wieder zurück. Jetzt aber werfen wir zunächst einmal einen Blick auf ein anderes, aber bekanntes Tier und eine ganz „einfache“ Frage – wie sie ein Kind stellen könnte, deren Beantwortung aber, wie Tinbergen behauptet, gar nicht so einfach ist.
„Warum fliegen Vögel?“ Vom Standpunkt der Mechanik und der direkten Kausalität aus gesehen lautet die Antwort: Fliegen ist das Ergebnis der Aktivierung verschiedener Skelett- und Muskelbewegungen zu einem Muster, das über die Aerodynamik ein Anheben der Schwingenkonstruktionen verursacht. Aber zu welchem funktionalen Zweck? Eine begründete Annahme wäre, dass Fliegen die Chancen der Vögel erhöht, zu überleben und sich fortzupflanzen. Diese Art der Fortbewegung macht es ihnen vergleichsweise leicht, vor Fressfeinden zu fliehen und auf der Suche nach Futter und Schutz lange Strecken zurückzulegen.
Eine Antwort von einer anderen Perspektive her bietet uns die Evolutionsgeschichte der Vögel: Sie haben deshalb heute flugfähige, gefiederte Schwingen, weil ihre Vorfahren diese Strukturen entwickelt haben. Schwingen mögen teilweise eine andere Funktion gehabt haben – möglicherweise haben die Dinosauriervorfahren der Vögel Federn nur zu Isolationszwecken ausgebildet oder um Partner anzulocken. Am Ende aber haben die Kräfte der Evolution die Vögel mit Genen versehen, welche eine aerodynamische Form mit Flugfähigkeit hervorbringen. Und zu guter Letzt können wir auch noch sagen, dass Vögel deshalb fliegen, weil sie sich auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln. Frischgeschlüpfte Küken im Nest (von Eiern ganz zu schweigen) können nicht fliegen. Ihre Körperform, ihre Federn und das Nervensystem sind an das Nestleben angepasst und sie brauchen Zeit, um sich in erwachsene Vögel zu verwandeln. Tatsächlich brauchen manche Vögel Übung, ehe sie das Fliegen gut hinbekommen. Also, warum fliegen Vögel? Darauf gibt es nicht nur eine einzige Antwort. Weil das Fliegen einem Anpassungszweck (oder mehreren) dient; weil Vögel die Strukturen und körperlichen Mechanismen besitzen, die es ermöglichen; weil ihre Evolutionsgeschichte die Mittel dazu hervorgebracht hat; weil sie sich im Laufe ihres Lebens entwickeln und verändern und ihre Körper (und Gehirne) sich dabei dahingehend verändern, dass Fliegen möglich ist. Damit wir ein umfassendes Verständnis für das Verhalten von Hunden oder anderen Säugetieren entwickeln können, benötigen wir eigentlich eine mehrdimensionale, ganzheitliche Darstellung von Erkenntnissen auf all diesen Ebenen.