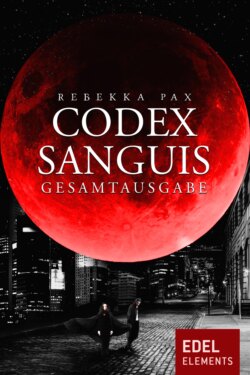Читать книгу Codex Sanguis – Gesamtausgabe - Rebekka Pax - Страница 10
KAPITEL 2
ОглавлениеJulius
Curtis’ Befehl, Amber Handschellen anzulegen, damit sie für die Vampire des Lafayette keine Gefahr darstellte, war unumstößlich, auch wenn sich alles in mir dagegen wehrte. Ich hatte ihr Vertrauen ausgenutzt, damit sie mir trotz der verbundenen Augen die Hände reichte, wohl wissend, dass ich damit einen tiefen Keil zwischen uns trieb. „Es tut mir leid, dir wird nichts geschehen“, brachte ich heraus, ehe Steven blitzschnell die Handschellen schloss. Als sie mit einem leisen Klacken einrasteten, erstarrte Amber für den Bruchteil einer Sekunde – und verwandelte sich im nächsten Moment in eine Furie.
Mit aller Kraft, die ihr menschlicher Körper aufbringen konnte, warf sie sich uns entgegen. Sie schrie so laut, dass man es sogar auf der Straße hören musste.
Steven bekam einen saftigen Tritt ab, ich einen zweiten, der überraschend genau mein Knie traf. Steven hielt ihre Hände fest, während ich ihren Körper umklammerte. Wir hätten ihr mit Leichtigkeit die Knochen brechen können.
„Tu ihr nicht weh, Steven!“, schrie ich. „Bitte!“
Ich riss die Augenbinde von ihrem Kopf. „Amber, Amber, beruhige dich!“
Keine Chance. Das Messer, das in ihrem Gürtel steckte, sandte in alle Richtungen Morddrohungen aus.
Stevens Gesicht war schmerzverzerrt.
Dava, die nicht viel älter war als er, rannte in Panik davon. Und auch ich hatte das Gefühl zu verbrennen.
Ambers Körper strahlte heiß wie glühende Kohlen.
Unter Aufbietung meiner gesamten Willenskraft riss ich ihr das Messer aus dem Gürtel.
Sobald ich es berührte, zerrte ein heftiger Sog fast alle Lebensenergie aus meinem Leib. Es fühlte sich an, als hätte mir jemand mit einem Ruck alle Nerven aus den Gliedern gerissen.
Ich schrie auf, ließ die Waffe fallen und taumelte zur Seite.
Meine Hand brannte wie Feuer. Ich wagte kaum, sie anzuschauen, sah im Geiste verkohlte Stümpfe anstelle der Finger, dachte an den sterbenden Vampir, den das Messer getroffen hatte. Doch mir war nichts passiert.
Amber verstummte. Ihr Brustkorb bebte, und sie starrte wie ein in die Enge getriebenes Tier in die Runde.
Aber sie besaß Kampfgeist, und sie war noch lange nicht bereit, aufzugeben.
Plötzlich ließ sie sich auf den Boden fallen und warf sich mit aller Kraft in Richtung Messer.
Steven wurde vorwärtsgerissen, doch zum Glück hatte er die Handschellen fest im Griff. Als Amber merkte, dass sie gegen ihn nicht ankam, gab sie endlich auf und blieb liegen.
Ich stützte mich schwer atmend gegen die Wand.
Die verlorene Energie kehrte nicht zurück. Mein Körper war ausgelaugt wie nach einer mehrwöchigen Fastenkur. Ich blinzelte immer wieder, doch der Raum wollte einfach nicht aufhören, sich zu drehen. Amber schien sich auf dem Boden zu krümmen und doch wieder nicht, der Teppich unter ihr kreiste und die Muster darin verwischten sich zu verschwommenen Flächen.
Für einen Augenblick herrschte gespenstische Ruhe.
Brandon, der indianische Vampir, war hinter seine Dienerin getreten, als könne sie ihn vor dem Messer beschützen. Er starrte die Waffe auf dem Boden an, als würde sie jeden Moment zum Leben erwachen.
Eivi und Manolo hatten sich sogar bis in den Eingang unseres Versammlungsraumes zurückgezogen. Alle schienen darauf zu warten, dass ich etwas tat.
Das scharfe Klackern von High Heels durchbrach die Stille. Kathryn kehrte mit einer hölzernen Schachtel und einem Pullover in der Hand zurück. Abwartend hielt sie mir beides hin. Das Messer war nicht ihr Problem, sondern meines.
„Mach schon, Julius“, sagte sie schneidend. Sie hatte mir nichts zu befehlen, doch ich wusste, dass die Order von Curtis kam.
Erschöpft stieß ich mich von der Wand ab, wickelte mir den dicken Wollstoff um die Hand, hob das Messer auf, ohne dass mir etwas geschah, und legte es vorsichtig in die Holzkiste.
Sobald Kathryn den Deckel geschlossen hatte, machte sich Erleichterung breit. Die Spannung, die die Vampire in den letzten Minuten befallen hatte, ließ nach.
Mit zähen Schritten durchquerte ich den Raum. Jede Bewegung schien eine zu viel. Aber ich musste zu Amber, das Siegel zerrte an mir, ich hatte geschworen, sie zu beschützen. Amber saß noch immer auf dem Boden. Ihre Hände waren durch den Druck der Handschellen blau angelaufen. Sie rang nach Atem und starrte enttäuscht zu mir hinauf. Wie sollte ich das jemals ungeschehen machen?
Ich wollte Amber aufhelfen, doch sie schüttelte meine Hand ab. Ihre Augen blitzten wütend. Ich hatte ihr Vertrauen schändlich gebrochen, das wusste ich. Doch es war nicht meine Entscheidung gewesen.
„Amber, es tut mir leid, aber es ging nicht anders.“
Sie ignorierte mich und sah Kathryn hinterher, die mit dem Messer in einem Flur verschwunden war.
Mir wurde immer deutlicher bewusst, wie viel mich die Berührung der Waffe gekostet hatte. Meine Energie war aufgefressen, ich zitterte am ganzen Leib.
Noch einmal streckte ich Amber die Hand hin. Als sie sie erneut ausschlug, riss mir der Geduldsfaden und ich griff ihr unter die Arme und stellte sie auf die Füße. Dabei fiel ich fast nach vorn, konnte mich aber gerade noch abfangen.
Amber war viel schwerer als erwartet, oder nein, ich war viel schwächer als sonst. Das Messer hatte meine fast verheilten Wunden aufgerissen, und meine Rippen knirschten erneut wie frisch gebrochen. Ich biss die Zähne zusammen und zwang mich zu einer aufrechten Haltung, lehnte mich aber zur Sicherheit wieder an die Wand.
Die Konturen meiner Welt verschwammen und ich befand mich am Rande einer Ohnmacht.
Bis der Meister das Entrée betrat.
Ich hatte seine Präsenz schon früh wahrgenommen. Er beobachtete uns seit einer ganzen Weile.
Ich musste furchtbar aussehen, das sagte mir Curtis’ mitfühlender Blick.
Energie wusch tröstend über meinen Körper, und ich fühlte mich augenblicklich besser. So gut, dass ich einige Schritte auf Amber zuging und an ihrer Seite stehen blieb. Ich spürte ihre Angst, wollte sie beschützen.
Curtis strahlte Macht und Würde aus, und Amber starrte ihn an, als sei er ein Wesen von einem anderen Stern.
Mein Meister genoss seinen Auftritt. Mit Bewegungen, so weich und fließend wie die einer großen Katze, glitt er auf uns zu. Auf Amber musste es fast so wirken, als schwebe er.
Seine Aura war für Unsterbliche wie Sterbliche gleichermaßen anziehend.
„Schön, dich zu sehen, Julius“, sagte er mit einem warmen Lächeln.
Beinahe vergaß ich meinen Zorn darüber, dass er Amber Handschellen hatte anlegen lassen und damit dieses ganze Unglück hervorgerufen hatte. Ich erkannte, dass er Magie verwendete, doch als mir das bewusst wurde, war es bereits zu spät und mein Zorn verflogen.
„Amber, das ist Curtis Leonhardt“, stellte ich ihn vor.
Er deutete eine Verbeugung an. Eine kurze Beugung des Oberkörpers, eine elegante Neigung des Kopfes. Eine Gestik, die über Jahrhunderte hinweg perfektioniert worden war.
Amber blieb unbeeindruckt und starrte ihn wütend an.
„Das ist Amber Connan.“
„Frederiks jüngere Schwester. Willkommen in meinem Haus.“ Curtis’ Stimme klang dunkel wie aus Grabestiefen.
„Sag ihm, dass er sofort aus meinem Kopf verschwinden soll!“, fauchte Amber und drückte sich trotz ihres Zorns an mich.
„Ich will Ihnen nichts Böses, Miss Connan.“
Curtis hob beschwichtigend die Hände, doch Amber ließ sich nicht von seiner Fassade blenden und blieb ihrer feindseligen Haltung treu.
Der Meister verlor das Interesse. „Bring sie fort, Steven. Julius, du kommst mit mir.“
Das war ein klarer Befehl, und Steven ließ sich nicht lange bitten. Ehe ich mich versah, zerrte er sie davon.
„Steven, nein! Lass mich los, verdammt! Julius!“ Amber kämpfte gegen Stevens Griff, doch natürlich war sie dem Vampir hoffnungslos unterlegen.
Sie so verzweifelt zu sehen, tat mir weh, aber ich konnte jetzt nicht bei ihr bleiben. Mir blieb keine andere Wahl, als mit Curtis zu gehen. „Hab keine Angst, dir passiert nichts.“
Sie versuchte, mich über ihre Schulter hinweg anzusehen, während Steven sie durch das Entrée schleifte.
„Bitte, Julius, hilf mir!“, schrie sie mit Tränen in den Augen.
Für einen Augenblick fühlte ich ihre Angst, als sei sie meine eigene. Mit ihrem Hilfeschrei hatte sie das Siegel geöffnet. Ich wollte zu ihr, doch Curtis’ Magie hielt mich fest, sie war stärker als mein Eid.
„Hab keine Angst, ich bin gleich bei dir!“, rief ich Amber noch lautlos zu, dann schloss sich das Tor des Siegels.
Curtis hatte den Kontakt unterbrochen, als wäre zwischen Amber und mir eine bleierne Trennwand heruntergelassen worden. Hin- und hergerissen zwischen Curtis’ Befehl und der Verantwortung, die ich Amber gegenüber auf einmal empfand, sah ich noch einmal in die Richtung, in die Steven sie gezerrt hatte.
„Komm jetzt, Junge. Ihr wird nichts geschehen.“
„Ich kann sie doch nicht einfach so alleine lassen!“
„Doch, du kannst.“
„Hast du denn nicht ihre Angst gerochen?“
Mein Meister wurde ungeduldig, und das konnte schnell unangenehm für mich werden.
Die anderen spürten es ebenfalls und beobachteten uns mit Interesse, allen voran Kathryn. Sie schien sich auf eine Konfrontation regelrecht zu freuen.
„Bitte, Curtis.“
Er schüttelte den Kopf, fasste mich am Arm und führte mich davon, tief in das Innere des alten Kinos hinein. Dann rauschte seine Energie über meine Haut und nahm mir jeden Zweifel.
***
Amber
Julius war einfach so verschwunden. Ich konnte es nicht fassen. Bis zum letzten Moment hatte ich gehofft, dass er mir helfen würde. Ich hatte ihm ansehen können, dass er es wollte, doch dann flackerte sein Blick einen Moment lang. Es war, als würde er sich gegen eine unsichtbare Mauer stemmen. Doch plötzlich brach sein Widerstand, er drehte sich um und folgte diesem Curtis wie ein Hund seinem Herrn.
Aus, vorbei. Ich konnte nicht mehr. Vor der Treppe ließ ich mich auf die Knie fallen. Steven, der damit nicht gerechnet hatte, strauchelte und griff hastig nach dem Geländer.
Ich spürte, dass sein Griff an den Handschellen stärker wurde anstatt schwächer, und das, obwohl er sie nur noch mit einer Hand hielt. Je weiter ich mich vom Messer entfernte, umso mehr Kraft gewannen die Vampire.
Die Waffe hatte mir Sicherheit gegeben, ihre Stärke war auf mich übergegangen. In der kurzen Zeitspanne eines einzigen Tages hatte ich mich auf erschreckende Weise daran gewöhnt.
Als ich den kalten Stahl der Handschellen auf der Haut gespürt hatte, war etwas in mir ausgerastet. Das Messer hatte all meine Gefühle aufgesogen, und auf einmal hatte ich nur noch Aggression und den Wunsch zu töten gekannt. In diesem Augenblick hätte ich das Messer ohne Unterschied jedem Vampir in die Brust gerammt, der mir zu nahe kam.
Jedem, auch Julius. Vor allem Julius! Wie hatte ich nur so bescheuert sein können, ihm zu vertrauen?
„Amber, komm bitte mit“, sagte Steven zögerlich.
Ich sah auf. Der junge Mann schien von der Situation beinahe überfordert. Trotzdem wurde er nicht nachlässig. Er hatte meine Fesseln fest im Griff, und wo er mich berührte, spürte ich die Eiseskälte seiner Haut.
„Steh auf, Amber, bitte.“
Ich schüttelte nur den Kopf, mein Hals war wie zugeschnürt.
Stevens Blick änderte sich, die Augen wurden heller, der volle Mund bekam plötzlich einen harschen Zug. „Ich will dir nicht wehtun, aber ich werde es, wenn es sein muss“, drohte er und bleckte kurz die Zähne.
Ich zuckte zurück. Adios, fröhlicher High-School-Junge. Dieser Steven hier war ein Raubtier, mit dem man sich lieber nicht anlegte. Er würde alles tun, um den Befehl seines Meisters auszuführen, alles.
Steifbeinig erhob ich mich und stapfte hinter Steven her die Treppe hinauf. Nach wenigen Stufen stiegen mir die ersten Tränen in die Augen, und ich verachtete mich dafür.
***
Julius
Ich stolperte hinter meinem Meister her, als sei mir der Weg völlig unbekannt. Er führte mich durch dunkle Gänge, spärlich erleuchtet von alten goldenen Wandlampen. Bilderrahmen warfen mein mattes Spiegelbild zurück.
Ich sah hin und erschrak.
Die Wunden, die mir der weißhaarige Vampir in der vergangenen Nacht zugefügt hatte, waren wieder da und bluteten. Meine Haut schimmerte transparent, nahezu durchsichtig. Darunter leuchteten bläuliche Adern. Die Kraft des Messers hatte mich fast zur Gänze aufgezehrt.
Curtis öffnete eine holzverkleidete Stahltür.
Seine kalte Hand hielt noch immer mein Gelenk, und ich verdankte es einzig dem stetigen Energiefluss, der von meinem Meister ausging, dass ich die Kraft fand, einen Fuß vor den anderen zu setzen.
Erdgeruch umfing uns, als wir die lange Treppe zu seinen Gemächern hinabstiegen. Hinter den Wänden lagen zu beiden Seiten die alten Indianergräber, Dutzende davon, oft in mehreren Schichten übereinander. Eine weitere Tür aus feuerfestem grauen Stahl, und wir waren da.
Flammen prasselten im Kamin und tauchten Wände und Möbel in goldenes Licht. Die Sehnsucht, meine kalten Glieder zu wärmen, wurde beinahe schmerzhaft.
Curtis lebte in seiner eigenen Welt, einer Welt, die bereits seit Jahrhunderten untergegangen war. Die Kalksteinwände seiner Kammer waren übersät mit Fresken. Tristan und Isolde in Grün- und Blautönen. Mittelalterliche Gemälde von erschreckender Lebendigkeit.
In der Nähe des Kamins stand ein Steinsarkophag. Aus seinem Deckel war ein liegender Ritter herausgemeißelt, der seine Füße und den Kopf auf zwei Löwen bettete.
Die Berührungen unzähliger Hände hatten den Granit glattgeschliffen und schwarzpoliert.
An den Wänden standen Regale voller Bücher: moderne Taschenbücher neben alten, ledergebundenen Folianten und einer Erstausgabe von Miltons Paradise Lost.
Curtis hieß mich, auf dem Sofa Platz zu nehmen. Er selbst kniete sich vor mich.
Ich war so schrecklich müde, war das alles so leid. Die Nähe des Meisters machte mir meine Schwäche nur umso bewusster.
„Diese Aufgabe frisst dich auf“, sagte Curtis leise. „Wenn du willst, entbinde ich dich davon. Sobald sie mit dem Messer in deiner Nähe war, konnte ich dich kaum erreichen. Was glaubst du, weshalb ich Steven nach dir geschickt habe?“
Das hatte ich mich selbst schon gefragt, jetzt hatte ich die Antwort. Ich schwieg.
Curtis strich mir die Locken aus der Stirn und musterte mich. „Mein Diener Robert könnte an ihrer Stelle den Platz des Adepten einnehmen.“
Und ich sollte mein Scheitern eingestehen? Davon wollte ich nichts hören. Ich konnte meine Aufgabe erfüllen, Amber konnte ihre Aufgabe erfüllen.
„Nein, Amber ist dazu bestimmt.“
„Ich will nicht zusehen, wie du dich zerstörst. Julius, du bist mir wichtig.“
Ich hob die Augen und sah meinen Meister an. Wir waren Freunde, Vater und Sohn, Herr und Knecht, Meister und Schüler, je nachdem, was die Situation oder die Zeiten von uns verlangten.
„Ich verstehe, dass du die junge Frau nicht verlieren willst. Es ist eine besondere Kraft in ihr. Mach sie zu einer vollwertigen Dienerin, du hast meine Erlaubnis. Mach sie zu einer von uns, wenn es sein muss, und ich nehme sie in den Clan auf.“
„Nein. Sie bleibt, was sie ist. Du weißt, dass ich keine Dienerin will, nicht auf Dauer.“
Curtis nickte. „Wir werden sehen.“
Ich wollte protestieren, doch seine Magie erstickte den Impuls im Keim. Hier galten die Regeln meines Meisters.
Er setzte sich neben mich, und ich legte mit geschlossenen Augen den Kopf auf seine Knie. Kräftige Finger fuhren durch mein Haar und über meine Schläfen. Curtis’ Hunger erwachte, als er das Blut von meinen Wunden abwischte und sich die Finger ableckte.
Magie prickelte wie tausend winzige Ameisen über meine Haut. Hilflos ergab ich mich in mein Schicksal.
Mit schweren Gliedern setzte ich mich auf und lehnte mich zurück. Wie sollte ich nur die Nacht überstehen, wenn er mir auch noch das letzte bisschen Kraft aus dem Körper sog? Ein kalter Schauder fuhr über meinen Rücken. Wie ein lauer Strom floss die Magie aus Curtis’ Poren und bündelte sich zu einem lichten Punkt direkt über meinem Herzen. Ich ließ mich fallen und badete in dieser Wärme, die mir die Schmerzen nehmen würde.
Meine Muskeln entspannten sich, während mein Schöpfer meinen Kragen zur Seite schob.
Plötzlich sehnte sich alles in mir nach seinem Biss, nach seinem Hunger. So musste sich ein Mensch fühlen, der unserer Magie erlag.
Als die Zähne endlich über meine Halsbeuge kratzten, hielt ich es kaum noch aus. Die Haut leistete kurzen Widerstand, dann bohrten sich seine Fänge in mein Fleisch. Brennende Nadelstiche, mehr nicht.
Curtis schluckte laut und genussvoll.
Ich hingegen zitterte und wurde schwächer. Als ich meinen Meister endlich wegstoßen wollte, um mich zu retten, konnte ich meine Arme schon nicht mehr heben.
Es war zu spät.
Hatte ich Curtis so enttäuscht, dass er beschlossen hatte, mir das Leben zu nehmen? Das konnte nicht sein, das würde er nicht tun!
Ich dämmerte bereits weg, da schloss sich plötzlich seine Hand um meinen Hinterkopf. „Trinke tief und wachse an meiner Stärke.“ Bestimmend drückte er meinen Mund an seinen Hals. Ich biss mit letzter Kraft zu.
Sein mächtiges Blut schoss aus der Wunde und füllte meine Kehle mit flüssigem Gold. Ich glaubte, eine wundersame Melodie zu hören, starrte mit aufgerissenen Augen und verlor mich in den Fresken an der Wand.
Curtis trank mein Blut und ich das seine, wir waren verbunden in einem glühenden Kreislauf aus Licht. Nie zuvor hatte ich von ihm mehr als einen kleinen Schluck erhalten und noch niemals gleichzeitig mit ihm getrunken.
Heiße Schauder wechselten mit kalten, während der Lebenssaft kam und ging. Ich fühlte, wie mich Curtis’ uralte Macht erfüllte, wusste, dass ich für kurze Zeit fast so stark sein würde wie er.
Tranken wir Stunden, eine Ewigkeit, Augenblicke?
Ich wusste es nicht, wusste nur, dass der Bluttausch fast vollständig war.
Curtis’ Energie floss langsam, kalt und stetig in meinen Adern. Von meinen Verletzungen spürte ich längst nichts mehr, und ich wusste: Diesmal würde sie nicht einmal das Messer zurückbringen können.
„Genug, Julius!“
Curtis’ Magie zog sich mit einem Schlag aus mir zurück, wie eine Pflanze, die mitsamt den Wurzeln ausgerissen wird.
Ernüchtert glitten meine Zähne aus seinem Fleisch.
Unsere Wunden schlossen sich beinahe augenblicklich. Curtis sog die letzten Tropfen von meinem Hals, bis darunter unversehrte Haut zum Vorschein kam. Berauscht lehnten wir uns in die Kissen zurück.
Hätte ich mit einer Frau Blut getauscht, hätten wir uns jetzt geliebt, doch Curtis war ein Mann und mein Meister. So genossen wir einfach nur die berauschende Energie des Rituals.
Curtis hielt die Augen geschlossen. Mit einem leisen, genießerischen Seufzen rückte er in eine bequemere Position und reckte die Beine in Richtung Kamin.
„Danke, Curtis“, flüsterte ich, „danke.“
Curtis brummte zustimmend. Kurz flammte seine Magie auf und strich wie ein großes, freundliches Tier durch meinen Körper. „Du hattest dir eine Belohnung verdient.“
Ich schmiegte mein Gesicht in die weichen Felle und genoss die prasselnde Wärme des Kamins. Das neue Blut in meinen Adern war kalt, so kalt und so mächtig. Es hatte jeden Gedanken an Amber verdrängt. Träumend erinnerte ich mich daran, wie ich Curtis kennengelernt hatte.
London, 1818. Ich stand in der Blüte meiner Jahre, war allerdings nicht unbedingt in bester Verfassung. Meine Frau Mariann zog es vor, die Nächte mit einem jungen Komponisten zu verbringen, und ich hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als sie dabei zu überraschen.
Meine Arbeit als Fernhändler langweilte mich, der Traum, eines Tages mit einem unserer Schiffe nach China oder Afrika zu fahren, war längst gestorben. Ich hatte alles auf die Ehe mit einer Frau gesetzt, die ich nicht mehr liebte. Ich entfloh der Tristesse meines Lebens und tauchte ein in die Welt der Literatur- und Rauchsalons. In einem der erlesensten Klubs der Stadt traf ich dann auf ihn – Curtis. Ich saß in einem schummerigen Winkel, eingehüllt in den Nebel exotischen Pfeifentabaks, als sich die Stimmung im Raum schlagartig veränderte. Ein vornehmer Gentleman war hereingekommen und ließ sich von einem livrierten Diener Hut und Mantel abnehmen. Seine Augen, es waren seine Augen, die mich vom ersten Moment an faszinierten.
Fast widerwillig wandte ich mich erneut meinen pseudointellektuellen Saufkumpanen zu, mit denen ich gerade die von mir geliebten Werke Lord Byrons diskutierte. Ich versuchte, mich auf das Gespräch zu konzentrieren, als Curtis plötzlich neben unserem Tisch stand und höflich darum bat, sich zu uns setzen zu dürfen. Den Rest der Nacht hing ich an seinen Lippen. Er sprach von Kunst und Literatur, als seien sie die Luft, die er atmete. Schon damals handelte er mit Gemälden. Er war als Mäzen bekannt, und seine Meinung war hochgeschätzt.
Curtis trank von mir, in jener Nacht und in vielen Nächten darauf. Ich erfuhr nichts davon, sondern glaubte nur, dass ich in ihm einen Freund gefunden hatte, jemanden, den ich grenzenlos bewunderte. Er war ein Gott, ein Gentilhomme der alten Schule, wie sie sonst nur in meinen Büchern existierten. Wir besuchten Opernaufführungen, Konzerte und Kunstausstellungen, vor allem aber redeten wir, meist während eines Spaziergangs.
Die damals so modernen Spazierstöcke gaben den Takt vor, wenn wir den Hyde Park besuchten oder im Mondlicht am Themseufer entlangstreiften.
Es waren Nächte voller Zauber. Laue Sommernächte und später, wenn im Winter der Flussnebel zu feinen Eiskristallen gefror, auch bitterkalte.
Curtis’ betörende Stimme trug mich tiefer und tiefer in fremde Welten, entführte mich in alte Sagen, erzählte Mythen von Unsterblichkeit und zitierte Shelley und Byron, Gedicht um Gedicht, bis mein Kopf angefüllt war von Gespenstern, Spukgestalten und Vampiren, ja, Vampiren.
Ein halbes Jahr nach unserem ersten Treffen schien für Curtis die Zeit gekommen zu sein. Er ließ die Magie fallen, die sein Aussehen maskierte, und offenbarte mir seine wahre Natur.
Ich kann mich an jedes Detail erinnern, als sei es erst gestern gewesen. Meine Angst verflog schnell. Und dann stellte er mich vor die Wahl.
„Du weißt nun, was ich bin. Heute Nacht siehst du mich entweder zum letzten Mal, oder du kommst mit mir, und zwar als einer von uns. Ich frage dich nur ein einziges Mal, Julius Lawhead. Willst du werden wie ich, willst du dich von Blut ernähren, ewig jung sein und ewig in der Nacht leben?“ Das waren seine Worte.
Ich überlegte nicht lang, flehte ihn förmlich an, es zu tun.
Curtis bewegte sich schrecklich schnell. Er riss mich an sich, biss zu und trank und trank. Ich zwang mich, nicht zu schreien, und als schließlich mein Tod nahte, konnte ich es auch nicht mehr. Ich erinnere mich an heftigen Schmerz, ein Licht und dann sein Blut, das köstlichste, das ich je getrunken habe.
Es zog mich fort von dem Licht, hinein in ewige Dunkelheit.
„Julius?“ Curtis’ Samtstimme weckte mich aus meinen Erinnerungen. Ich öffnete die Augen und setzte mich auf.
Das Zimmer lag in weichem Dunkel. Die Kerzen waren herabgebrannt.
Im sterbenden Licht hatten die Fresken ihre Farbe verloren, doch die glühenden Kohlen im Kamin spendeten noch immer mehr als genug Licht für Vampiraugen.
Ich merkte sofort, dass es mit unserer Vertrautheit vorbei war. Curtis verschloss sich, und auch ich verkroch mich wieder hinter den Schutzschilden, die meine Gefühle vor anderen Vampiren abschirmten. Sofort kehrte die Erinnerung an Amber zurück und damit auch die Angst um sie. Ich erkannte erschrocken, dass Curtis meine Gedanken manipuliert hatte.
Er hatte mich Amber beinahe vergessen lassen. Nun erwachte die Macht des Siegels mit neuer Kraft. Ich sprang auf, hielt aber schon im nächsten Augenblick wieder inne.
Curtis streifte meine Hand. Eine letzte Geste der Verbundenheit, doch der Zauber war endgültig vorbei.
„Nimm es nicht so schwer, was immer auch mit ihr geschieht.“
„Vielleicht wäre es besser, sie nicht zu töten“, murmelte ich.
Curtis musterte mich aufmerksam, dann nickte er langsam. „Ich dachte, das sei es, was du wolltest? Den menschlichen Ballast so schnell wie möglich wieder loswerden, oder nicht?“ Er lächelte böse, als sei ich freiwillig in seine Falle getappt.
„Ich weiß es nicht“, erwiderte ich. In meiner Brust rebellierte das Siegel. Am liebsten hätte ich es mir in diesem Moment herausgerissen. Ich wollte niemandes Marionette sein, und doch hing ich nicht nur an Curtis’ Fäden, sondern jetzt auch an Ambers, die ich zu allem Überfluss auch noch selbst geknüpft hatte.
Noch immer lächelnd, entließ mich Curtis mit einer herablassenden Geste. Die Audienz war beendet.
***
Amber
Steven brachte mich in einen winzigen Raum, in dem es nach Chemikalien stank. Es gab nur ein einziges Fenster, doch das war winzig und führte nicht ins Freie. Dahinter gähnte die Dunkelheit leerer Räume.
Die Wände waren schwarz gestrichen. Das Zentrum bildete ein klobiger antiker Tisch aus Asien, dessen scharlachrote Lackoberfläche vielfach geplatzt war. Steven zog mir einen Stuhl heran, und ich ließ mich kraftlos hineinfallen.
Er setzte sich mir gegenüber, dicht neben die Tür, sodass ich an ihm vorbeimusste, falls ich auf die Idee kam zu flüchten.
Für den Augenblick begnügte ich mich damit, zu kooperieren und alles genau zu beobachten. Vielleicht würde meine Chance später kommen.
Ein kleiner, naiver Teil von mir hoffte noch immer, dass alles wieder gut würde. Ich klammerte mich an Julius’ Blick fest, in dem so etwas wie ein Versprechen gelegen hatte.
Steven saß still da und atmete flach. Es wunderte mich, dass er es überhaupt tat. Als er bemerkte, dass ich ihn ansah, zog er die Mundwinkel hoch, doch das entstandene Lächeln wirkte kläglich. „Tut mir leid“, sagte er leise. „Hab ich dir wehgetan? Das wollte ich nicht.“
Die Haut an meinen Handgelenken war gerötet. Ich rieb darüber. „Es geht.“
„Ein Glück.“
Wollte mich der Typ verarschen? „Als ob dich das interessieren würde!“
„Meinst du, ich wollte das alles?“, gab er offenkundig beleidigt zurück.
Ich wurde aus diesen Leuten nicht schlau. Sie kamen mir beinahe vor wie brave Soldaten, die ihre eigene Meinung mit dem Diensteid abgegeben hatten. Steven schien gar nicht so daneben zu sein, wenn man mal davon absah, wovon er sich ernährte. Vielleicht war er der Schlüssel zu meiner Flucht.
„Was passiert jetzt mit mir, bringt ihr mich um? Meine Mutter und meine Freunde werden mich suchen, die Polizei …“
Er hob blitzschnell die Hand, und seine Augen wurden einen Moment lang so hell wie Gletschereis. „Keine Polizei. Dir passiert nichts.“
„Versprich es mir! Lass mich gehen und ich rede mit niemanden.“
Er legte den Kopf schief. „Ich kann dir nichts versprechen, Amber Connan, Messerträgerin. Hier gilt nur Meister Curtis’ Wort etwas. Aber du bist nett, und ich glaube, du wirst gut zu Julius passen.“
„Was?“ Wovon redete er da? Bildete er sich ernsthaft ein, ich würde das hier einfach so vergessen und wieder mit diesem Typen ausgehen? Nach allem, was gerade passiert war?
Steven blieb mir eine Antwort schuldig. Er rutschte noch etwas näher zur Tür, um sicherzugehen, dass ich nicht an ihm vorbeikam, zog sein Smartphone aus der Tasche und klickte sich durch ein Fotoalbum.
Fassungslos starrte ich ihn an, bis meine Augen zu brennen begannen. Ich ballte meine Hände zu Fäusten, bis sich die Nägel in die Innenflächen gruben. Heulen kam nicht infrage!
***
Julius
Ich war wie berauscht von meiner neuen Stärke. Wie viel leichter waren meine Schritte jetzt! Fast hatte ich das Gefühl, die Treppe, die von dem Gang vor Curtis’ Gemach nach oben führte, hinaufzufliegen.
Ich fühlte die Eifersucht der anderen Vampire wie Nadelstiche. Sie spürten, dass Curtis mir seine Gunst gewährt hatte. Ein starker Magiefluss wie dieser blieb in einem Clan nie lange unbemerkt. Wir alle buhlten um die Gunst unseres Meisters. Dieses ständige Anbiedern war einer der Gründe, weshalb ich es vorzog, alleine auf dem Hollywood Forever Cemetery zu hausen und nicht hier mit all den anderen. Es ekelte mich an.
Plötzlich scheute ich mich davor, in ihre Gesichter zu schauen, in ihre neidverzerrten Fratzen.
Doch ich musste nach oben, Amber wartete. Ich hatte ihr ein Versprechen gegeben und würde es halten, selbst wenn ich mich deshalb mit jedem von Curtis’ Vampiren prügeln müsste.
Ich versuchte, den Magierausch abzuschütteln und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die meisten hätten ihn genossen und sich darin treiben lassen. Doch Curtis war kein Gott aus goldenem Licht, auch wenn es mir jede Faser meines Körpers weismachen wollte. Und er hatte mir seine Kraft auch nicht aus purer Freundlichkeit geschenkt. Es war Teil einer Strategie, doch ich erkannte den Plan noch nicht und auch nicht meine Rolle darin.
Im Obergeschoss gab es nur einen Ort, an den Steven Amber gebracht haben konnte.
Der ehemalige Vorführraum des Kinos war klein und schallisoliert. Wenn dort jemand um Hilfe rief, hörte das niemand. Noch nicht einmal Handys funktionierten darin.
Auf einmal witterte ich Ambers Angst und riss die Tür auf.
Amber sah wie in Zeitlupe auf. Sie hatte die noch immer gefesselten Hände ineinandergekrampft und wandte sich mit hochgezogenen Schultern demonstrativ von mir ab.
In Stevens Gesicht las ich Überraschung. Er war wohl noch zu jung, um den Bluttausch spüren zu können. Jetzt sog er schnuppernd die Luft ein. Steven konnte Curtis’ Blut in meinem Körper riechen, und viel davon.
Wie hypnotisiert stand er auf und strich mir zögernd über die Schulter. Curtis’ Macht strahlte durch meinen Körper. Im Gegensatz zu den anderen Clanmitgliedern hasste mich Steven nicht dafür. In seinem Blick lagen nur unschuldiger Hunger und die stumme Bitte, ihn trinken zu lassen. Und wie sollte ich meinem kleinen Bruder das ausschlagen? Manolo hatte ihn zwar auf Curtis’ Befehl hin verwandelt, doch von da an hatte ich ihm alles beigebracht, was er wissen musste. War ein Jahr lang fast jeden Abend mit ihm losgezogen. Es war eine gute Zeit gewesen. Hatten sich Curtis’ Hoffnungen in ihn auch nicht erfüllt, so hatte ich doch wenigstens einen Bruder bekommen – das einzige Wesen im Lafayette, das mir neben meinem Schöpfer wirklich etwas bedeutete.
„Bald, nicht heute“, versprach ich daher.
Ich würde einen kleinen Teil meiner neuen Macht an ihn weitergeben. Natürlich war es ein großer Unterschied, ob er das Geschenk von mir oder von Curtis erhielt. Dennoch, das Blut eines zweihundert Jahre alten Vampirs war mehr, als ein Junge wie er sich erhoffen konnte.
Ich blickte Steven in die Augen. „Versprochen“, bekräftigte ich. „Jetzt lass mich bitte mit ihr allein.“
Er grinste breit und bleckte seine Zähne.
Ich schloss die Tür hinter ihm.
Amber musterte mich nach wie vor schweigend. Ich roch Furcht, aber auch Zorn. Sie war tief enttäuscht von meinem Verrat.
Geplagt von Schuldgefühlen setzte ich mich zu ihr, nahm ihre Hände und streichelte die geröteten Gelenke.
Sie reagierte nicht, sah mich nicht einmal an.
„Dir wird nichts geschehen“, beschwor ich sie.
Amber glaubte mir nicht. Willenlos ließ sie meine Berührungen über sich ergehen. Ich hob ihr Kinn, um ihr ins Gesicht zu schauen. Ihre Augen waren gerötet von Tränen und Müdigkeit.
„Ich konnte es nicht verhindern, Amber.“
Sie rückte ein Stückchen von mir ab.
„Du hast mich gefragt, ob ich mich einem direkten Befehl meines Meisters widersetzen könne. Die Wahrheit lautet, nein, ich kann es nicht. Es ist schwierig zu erklären. Als wir hergekommen sind, wusste ich nicht, was sie vorhatten. Ich war so naiv, nicht daran zu denken, dass Curtis sichergehen würde, dass du das Messer nicht benutzen kannst. Niemand will dir wehtun, ich nicht, und auch nicht die anderen“, redete ich auf sie ein. „Du bist hier sicher, hier bei mir. Dir wird nichts geschehen.“
Amber wich meinem Blick noch immer aus, aber ihre Körperhaltung war nun ein kleines bisschen weniger abweisend.
Wie sollte ich ihr nur erklären, was vor sich ging, wie?
„Sieh mich an, Amber. Bitte.“
Langsam, ganz langsam hob sie den Blick. Als sie mir in die Augen sah, öffnete ich vorsichtig das Siegel und ließ Amber erkennen, dass ich es ehrlich meinte. Immer tiefer drang sie in mich vor, bis meine Seele, mein innerster Kern schutzlos vor ihr lag.
Nie in meinem Leben hatte ich mich jemandem derart ausgeliefert gefühlt! Ich wehrte mich, zerrte das Siegel wieder zu und fühlte mich dennoch, als habe mir jemand mitten im Kampf die Rüstung heruntergerissen.
Amber hob die Hand und strich mir über die Wange. Die Kälte meiner Haut erschreckte sie nicht.
„Ich glaube dir.“ Ihre Stimme war leise und rau.
„Was ist mit dir geschehen, Julius? Du hast dich verändert, ich kann es irgendwie … fühlen.“
Ich erzählte ihr, wie mich das Messer geschwächt hatte und dass der Bluttausch mit Curtis mich gleichzeitig geheilt hatte und ein kostbares Geschenk war, das ein Clanherr nur äußerst selten gewährte. Amber hörte aufmerksam zu.
„Aber ich dachte, Vampire trinken nur menschliches Blut.“
„Es befriedigt unseren Hunger. Das Blut anderer Unsterblicher ist viel mächtiger, denn im Gegensatz zu ihnen besitzen die meisten Menschen keine Magie.“
Noch immer berührte Amber meine Hand und spürte meiner neuen Kraft nach.
„Könnt ihr eigentlich keine Blutkonserven trinken? Das wäre weniger …“, sie stockte und sah auf ihre Hände, „weniger eklig.“
„Totes Blut?“ Jetzt war es an mir, ein angewidertes Gesicht zu machen. Allein bei der Vorstellung drehte sich mir der Magen um.
„Wir trinken auch die Lebensenergie. Es ist die Kraft, die ein Wesen lebendig macht, der göttliche Funke. Im Alten Testament steht ‚Blut ist Leben‘, und das stimmt“, erklärte ich. Dann gingen uns beiden die Worte aus.
Amber gähnte und rutschte auf dem unbequemen Stuhl herum.
„Curtis kommt gleich. Er möchte persönlich mit dir reden, dann kannst du sicherlich wieder heim.“
„Wie lange müssen wir denn noch hier warten?“
Ich legte einen Arm um ihre Schultern. „Nicht mehr lang.“
So saßen wir schweigend und beobachteten, wie sich der Zeiger der kleinen Uhr an der Wand langsam der Vier näherte.
Endlich fühlte ich, dass Curtis seine Gemächer verließ. Das kürzliche Blutgeschenk machte mich besonders empfänglich. „Er ist auf dem Weg zu uns.“
Amber setzte sich aufrechter hin.
Schritte auf der Treppe. Die Tür ging auf und Curtis streckte Amber freundlich lächelnd die Hand entgegen.
„Vergessen wir, was unten geschehen ist, und versuchen es noch einmal. Amber Connan? Curtis Leonhardt.“
Er hatte Amber kalt erwischt. Völlig verdattert erlag sie seinem Charme und reichte ihm die Hand. Selbst ich konnte mich seiner Wirkung nicht ganz entziehen.
„Es tut mir leid, wie Sie hier empfangen wurden, aber ich musste sicherstellen, dass die mysteriöse Waffe, die sich in Ihrem Besitz befindet, nicht die Kontrolle über Sie erlangt hat.“
Amber überraschte mich, indem sie nickte und schweigend auf Erklärungen wartete.
„Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll“, sprach Curtis und drehte die Handflächen nach oben. „Also werde ich dort beginnen, wo es für Sie wichtig wird: bei Ihrem Bruder und den Vampirclans von Los Angeles.“
Curtis zog einen Stuhl heran und setzte sich.
Er sah aus wie ein normaler Mensch, hatte die Maske der Macht fallen lassen, die er üblicherweise in Gegenwart anderer Unsterblicher trug, und Amber ließ sich täuschen. Ich hörte ihren Herzschlag langsamer werden, ihr Atem ging ruhiger. Sie begann, dem Mann auf der anderen Seite des Tisches zu vertrauen.
Curtis räusperte sich. „Niemand von uns weiß, wie Frederik an das Messer kam, und leider wird er uns diese Frage ja auch nicht mehr beantworten können. Alte Aufzeichnungen sprechen davon, dass die Holzmesser von der Heiligen Inquisition geschaffen wurden. Es sollen einstmals zwölf von ihnen existiert haben, so viele, wie es Apostel gab. Heute weiß man von dreien, die die Zeiten überdauert haben. Unseres hier ist das Paulusmesser, ein zweites wird in Südamerika unter Verschluss gehalten, das dritte gehört dem Vatikan und reist noch heute mit der Inquisition durch die Welt.“
Curtis hielt kurz inne und sah Amber an. „Ihr Bruder Frederik war nicht mehr Herr seiner selbst. Das Messer hatte ihn in seiner Gewalt. Es lenkte seine Schritte, zwang ihn dazu, jede Nacht loszuziehen und uns zu jagen wie seltenes Wild.“
„Es tut mir leid“, sagte Amber schnell.
„Das muss es nicht“, beruhigte er sie. „Jäger und Gejagte. Es ist der Lauf der Welt. Das versteht wohl keiner besser als wir.“
Amber zuckte mit den Schultern, wusste nicht, was sie antworten sollte.
„Seit es uns gibt, sind es Blut und Tod, die Menschen und Vampire verbinden. Jahrhundertelang haben wir euch getötet, um existieren zu können. Die Sterblichen wiederum haben uns vernichtet, wo sie uns fanden. Natur, wenn man so will. Ein ewiger Kreislauf.“
„Den wir durchbrechen wollen“, warf ich ein.
„Richtig. Mein Clan und einige andere haben vor fast einem Jahrhundert einen neuen Weg eingeschlagen, dem heute so gut wie alle Unsterblichen folgen.
Wir leben jetzt nach anderen Regeln. Die Vampire haben sich vom Töten abgewendet, wenngleich das Blut geblieben ist. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wer kann dem Löwen verbieten zu jagen? Niemand kann und darf seine Natur verleugnen. Täten wir es, gingen wir zugrunde.“
„Und was habe ich damit zu tun?“ Amber starrte unentwegt in Curtis’ graue Augen, doch ich konnte spüren, dass er keine Magie einsetzte.
„Eine berechtigte Frage. Sie werden das tun, wozu Sie bestimmt sind.“
Curtis setzte eine Pause, um den nachfolgenden Worten Gewicht zu verleihen. „Ihr Bruder Frederik hat Ihnen das Messer vererbt. Er hat an Sie geglaubt, und deshalb sollten Sie seinen Wunsch respektieren und Ihr Schicksal erfüllen. Sie werden Vampire töten!“
Amber sprang entsetzt auf. Ihre aufgerissenen Augen zuckten zwischen Curtis und mir hin und her. „Niemals!“, spie sie uns entgegen. „Nie wieder! Sind hier denn alle völlig übergeschnappt?“
„Bitte setz dich.“ Ich stand auf und ging zu ihr. „Bitte Amber, sei vernünftig und lass Curtis erst einmal erklären, was er damit sagen will.“
Sie schüttelte den Kopf und stieß mich zornig zur Seite. „Das ist ja wohl jetzt schon mehr als deutlich.“
„Miss Connan.“ Curtis war wie immer ruhig geblieben. Er saß am Tisch, als sei nichts geschehen.
Amber und ich standen uns gegenüber und waren beide unsicher, was zu tun war.
„Setz dich, Julius, sofort!“ Curtis’ Stimme ließ mich herumschnellen.
Ich neigte den Kopf und kam seinem Befehl nach.
„Bitte, Miss Connan.“
Wie auf ein Wunder folgte Amber Curtis’ Bitte, setzte sich aber mit demonstrativ verschränkten Armen neben mich.
„Ich höre zu, aber ich werde es trotzdem nicht machen! Ich bin keine Mörderin und bringe weder Menschen um noch sonst wen. Nicht für alles Geld der Welt.“
„Es gibt solche unter uns, die sich nicht an die Regeln halten. Sie töten ihre Opfer, und zwar auf bestialische Weise. Ein ganzer Clan droht sich abzuspalten und dem alten Weg zu folgen. Auf drei dieser Vampire sind Sie vorige Nacht gestoßen."
Die Erinnerung an den Kampf beschleunigte meinen Puls. Es ging um viel, um alles vielleicht.
„Sie bringen uns in Gefahr. Die Polizei kennt heute Wege und Mittel, die vor hundert Jahren noch undenkbar waren. Es darf nicht zu einem Kreuzzug kommen! Wir müssen unsere Existenz um jeden Preis geheim halten.“
Amber starrte uns an. „Dann müssen Sie sich wohl einen anderen Killer suchen als mich.“
Curtis’ Eisaugen streiften mich kurz. „Du hast es ihr nicht gesagt?“
Ich sah ihn erschrocken an. Ich war mir sicher, dass Amber mir niemals wieder trauen würde, wenn sie es erfuhr. Deshalb hatte ich es verschwiegen.
„Curtis, nicht, bitte!“
Meine Bedenken kümmerten ihn nicht. „Amber, es gibt bereits jemanden, der verwilderte Vampire tötet. Es ist Julius. Er vollstreckt seit Jahrzehnten die Todesurteile unseres Rates. Deshalb habe ich ihn auch ausgesucht, um Sie und das Messer zu finden.“
Jetzt war es heraus, und ich wünschte mich weit fort.
„Julius, was bedeutet das?“, fragte Amber zögernd, doch ich hörte bereits die Gewissheit und die Abscheu in ihrer Stimme.
Gnadenlos sprach Curtis aus, was ich nicht konnte. „Es bedeutet genau das, was ich gesagt habe. Julius jagt und erlegt Täter, die nach unseren Gesetzen zum Tode verurteilt wurden.“
Amber starrte mich an. Sie war sprachlos. „Julius, ist das wirklich wahr?“
„Ja, ja, das ist es.“ Jetzt, da es ohnehin zu spät war, konnte sie auch alles wissen. „Curtis hatte mich beauftragt, Messer und Träger zu finden, damit wir in Zukunft gemeinsam agieren können. Als unschlagbares Team, sozusagen.“
„Frederik hat Sie zur neuen Trägerin bestimmt“, warf Curtis ein. „Ihr eigener Bruder. Sie würden Leben retten. Menschenleben. Und in gewisser Weise haben Sie auch kaum mehr eine Wahl. Denn Julius hat …“
„Nein!“ Das durfte er nicht sagen! Nicht das auch noch! „Später, Curtis, bitte, ich erkläre es ihr später!“
Curtis schüttelte kaum merklich den Kopf. Kein Versteckspiel. „Julius hat Sie mit seinem Zeichen versehen. Sein Blut fließt in Ihren Adern. Sie sind jetzt sein und tragen das erste Siegel einer Famula, einer menschlichen Dienerin.“
Ich vergrub den Kopf in den Händen. So hätte es nicht laufen sollen. Merkte Curtis nicht, dass wir die Frau, die unsere Verbündete werden sollte, gerade verloren?
„Julius, was bedeutet das?“
„Curtis, geh! Lass uns allein, bitte.“
„Wie du willst.“
Ich hörte, wie er aufstand und an mir vorbeiging.
Curtis ließ seine Hand einen Moment auf meiner Schulter ruhen. „Bald geht die Sonne auf. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Auf Wiedersehen, Miss Connan. Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen kennengelernt.“
Amber schwieg, bis er endgültig fort war. Als seine Schritte auf der Treppe verklungen waren, senkte sich eine fast greifbare Stille über uns. Ich sah auf.
„Was hast du mir angetan, Julius?“ Ambers Stimme bebte, ihr Gesicht war vor Zorn gerötet.
„Nachdem ich gestern von dir getrunken habe, wurdest du ohnmächtig. Ich hielt dich in den Armen, und …“
„Und?“
„Und ich ließ etwas von meinem Blut auf deine Lippen tropfen. Du hast es nicht bemerkt. Was du da empfangen hast, ist das erste von fünf Siegeln. Fünf Siegel, das bedeutet fünf Blutgeschenke, dann ist der Mensch zum Diener eines Vampirs geworden.“
„Zu einem Sklaven?“
„Nein. Anders und mehr als das, viel mehr. Der Famulus lebt genauso lange wie sein Herr, er wird nie krank, nie alt. Du siehst also, es gibt Vorteile.“
„Was hast du mir da angetan, Julius?“
„Betrachte es als ein Geschenk. Du kannst meine Gedanken hören, und ich sehe durch deine Augen.“
„Und wenn ich das, verdammt noch mal, gar nicht will?“
„Dann tut es mir leid.“
„Kannst du es rückgängig machen?“
„Nein. Einzig der Tod kann die Verbindung trennen.“
Schweigen.
„Julius, ihr müsst aufbrechen!“ Curtis’ Stimme dröhnte in meinem Kopf. Die nächsten Worte sagte ich mit zugeschnürter Kehle. „Wir fahren zurück, und du wirst mich nie wiedersehen.“
Amber nickte wütend. Ihre Schultern bebten. „Gut so. Ich will nicht, dass ein Mörder in meinem Kopf ein und aus geht. Und das verdammte Messer könnt ihr auch behalten und euch damit gegenseitig massakrieren!“
Es gab nichts mehr zu sagen. Ich schloss das Siegel zu ihr, so fest ich konnte. Schlagartig breitete sich Kälte in mir aus, eine Leere, wie ich sie früher nur hin und wieder in meinen dunkelsten Phasen empfunden hatte. Lag es daran, dass mein Körper durch das Siegel für eine Weile wieder Zugang zum Leben der Sterblichen gehabt hatte? Es fühlte sich an, als hätte man mir etwas sehr Wichtiges genommen.
Einerseits war ich zwar erleichtert, dass ich zu meinem alten Dasein zurückkehren konnte, doch auf der anderen Seite waren die Leere und auch leise Wehmut. Mit der Verbindung zu Amber war ich dem Leben und der Lebendigkeit so nahe gewesen wie seit zweihundert Jahren nicht mehr.
„Lass uns aufbrechen“, sagte ich leise und verband Amber erneut die Augen.
Auf der Straße vor dem Kino erwartete uns schon mit rasselndem Motor der alte Mustang, den ein Diener vorgefahren hatte.
Ich trat aufs Gas, wollte diesen Ort nur noch hinter mir lassen.
Als wir den Freeway erreichten, zeichnete sich der erwachende Morgen bereits als heller Pastellstreifen am wolkenlosen Himmel ab. Es war zu spät für mich, um Amber noch nach Hause zu bringen.
Schließlich bog ich in die Gower Street beim Friedhof ein, und Amber hatte noch immer kein einziges Wort gesprochen und auch die Augenbinde nicht abgenommen.
Ich hielt an, ließ den Schlüssel stecken und lief davon, floh förmlich, fort vor dem anklagenden Meergrün ihrer Augen. Ich weiß nicht, ob sie mir schließlich doch noch nachsah, wollte es gar nicht wissen und eigentlich sollte es mich auch nicht interessieren.
Hinter der Trauerhalle blieb ich stehen und wartete, bis Amber davonfuhr. Erst dann eilte ich zu meinem Mausoleum.
In meinem unterirdischen Verlies verkroch ich mich in meinem Sarg. Noch immer konnte ich das Siegel über meinem Herzen spüren, wenngleich es nun eher einem harten Knoten glich.
Ich verstand mich selbst nicht mehr. Warum war ich nicht froh, dass die Dinge diesen Lauf genommen hatten? Immerhin hatte ich die mir gestellte Aufgabe erfüllt. Das Messer gehörte nun dem Clan der Leonhardt. Dass Amber es nicht führte, war schade, aber nicht tragisch. Es gab noch einige andere Menschen, die dazu in der Lage waren und unser Vertrauen genossen – ganz im Gegensatz zu ihr, einer Wildfremden.
Dennoch fühlte ich mich grauenhaft. Weil ich meinen Schwur gebrochen hatte. Und wegen dieses verdammten Siegels, das danach schrie, geöffnet zu werden. Es zerrte Amber immer wieder in meine Gedanken zurück, sobald ich versuchte, sie daraus zu verbannen. Was hatte ich mir da nur eingebrockt? Wann würde das aufhören? Wirklich erst, wenn ich sie tötete? Ich bezweifelte mittlerweile, dass ich dazu überhaupt in der Lage war. Das Siegel würde es verhindern. Schon jetzt rebellierte es in meiner Brust und ich musste wieder an meine erste Begegnung mit Amber und den Kuss am Tag darauf denken. An die Wärme, die ich seit dem Bluttausch in ihrer Nähe gespürt hatte, und an den Abglanz dieses Gefühls, wenn sie weit weg war. Es war das pure Leben. Ich war süchtig danach geworden.
Zornig starrte ich in die Dunkelheit und versuchte, das Siegel zu verrammeln und zu verriegeln, bis die Sonne meine Augen zu Milchglas gefror.
***
Amber
Der Ford dröhnte durch die Häuserschluchten des Sunset Boulevard.
„Ich bin so dumm, so dumm, so dumm!“
Jetzt kümmerte es mich nicht mehr, ob das Lenkrad widerlich speckig war. Ich krampfte die Finger darum, presste meinen Zorn hinein, um nicht laut schreien zu müssen.
Julius hatte mich betrogen, und es geschah mir nur recht. Wer so naiv war und es doch eigentlich besser wusste, hatte einen Schlag ins Gesicht verdient. Das hatte ich nun davon, dass ich mir einen Flirt gesucht hatte, statt um meinen Bruder zu trauern, wie es sich gehörte.
Von Anfang an hatte Julius mich nur belogen und benutzt. Wütend hämmerte ich auf das Lenkrad, während sich die Sonne als brennende rote Kugel über den Horizont schob.
„Nie wieder!“
Es war nur noch ein halber Block bis zu Hause im Edgecliff Drive. Die Straße war schmal, aber ich dachte nicht einmal daran, meine Fahrt zu verlangsamen. Im letzten Moment riss ich das Lenkrad herum, und der alte Ford rutschte mit quietschenden Reifen in eine Kurve. Um ein Haar hätte ich einen nagelneuen BMW gerammt, der am gegenüberliegenden Straßenrand parkte. Der Beinahe-Unfall rief mich zur Raison. Das letzte Stückchen fuhr ich im Schneckentempo, parkte und legte die Stirn auf das Lenkrad. Als ich den Zündschlüssel herauszog, fühlte ich mich unendlich matt. Die Morgensonne ließ es im Wagen unangenehm stickig werden, doch ich blieb sitzen, bis mir der Schweiß von der Stirn lief. Erst dann fand ich die Kraft, ins Haus zu gehen.
Drinnen roch es nach schalem Wein und verdorbenem Essen. Überall standen leere Gläser und Flaschen herum. Mechanisch begann ich, die Überreste einzusammeln. Ma hatte am Vortag Verwandte und Freunde eingeladen, die sich über die Sachen aus Frederiks Wohnung hermachten. Jeder durfte sich eine Erinnerung mitnehmen.
Ich war schon nach einer Stunde abgehauen, all die Mitleidsbekundungen widerten mich an. Und so war ich zu Julius gefahren, in der Hoffnung auf Ablenkung und Antworten. Beides hatte ich bekommen – und von beidem zu viel.
In der Küche stapelte ich das dreckige Geschirr in der Spüle, machte dann noch einen Rundgang mit dem Mülleimer und sammelte alle Essensreste ein: Pizzaschachteln, Fertigkuchen, selbst gemachte Salate, die in der Septemberhitze ein schnelles Ende gefunden hatten.
Beim Spülen fiel mein Blick immer wieder auf die Spuren, die die Handschellen auf meinen Gelenken hinterlassen hatten. Von rot färbten sie sich langsam zu blau. Sie würden mich noch eine ganze Weile daran erinnern, dass nicht jedem gut aussehenden Kerl zu trauen war.
Und doch war ich mir sicher, dass es Julius leidtat. Er schien von der Entwicklung, die der Abend genommen hatte, genauso überrascht gewesen zu sein wie ich.
Konnte er sich wohl wirklich nicht aus Curtis’ Einfluss befreien? War er so etwas wie ein Sklave seines Schöpfers? Ich verbot mir, diesen Gedankengang weiterzuverfolgen, denn das würde nur in eine Richtung führen: zurück in seine dunkle Welt, die mich widersinnigerweise anzog wie lockendes Gift.
***
Julius
Die folgenden Nächte verbrachte ich wie in Trance. Streifte durch mein Revier, versuchte, nicht am Amber zu denken, und tat es doch viel zu oft.
Was sie wohl machte? Hasste sie mich?
Ich verbot mir, in ihre Gedanken zu schauen, und tat es tatsächlich nicht ein einziges Mal. Curtis rief mich an, erkundigte sich, ob er beim Rat eine Genehmigung einholen sollte, um Amber zu beseitigen. Er versprach, mit ihrem Tod nicht mich, sondern den zweiten Jäger der Stadt zu beauftragen. Doch ich verneinte.
Sie würde uns schon nicht verraten. Und wer würde ihr auch glauben, so kurz nach dem vermeintlichen Selbstmord ihres Bruders?
Für einen kurzen Moment hatte ich mich durch das Siegel gefühlt wie neugeboren. Nun wurde mir umso schmerzlicher bewusst, dass ich alles andere war als das. Häufig zog es mich in die Nähe der Zuflucht. Ich lief barfuß über den Strand von Santa Monica und Venice, versuchte das Leben zu spüren, nach dem ich mich so sehr sehnte.
Wenn ich nicht nachdenken wollte, rannte ich.
Rannte, so schnell ich konnte, bis mein Herz beinahe zersprang und ich mit schmerzenden Gliedern zusammenbrach. Aber auch der Schmerz gab mir mein Leben nicht zurück, wie es sonst manchmal der Fall gewesen war. Nichts half.
Der Pazifik spiegelte die Leere meiner Seele. Grauer Himmel, graue Wellen, eine dunkelgraue Trennlinie dazwischen. Ich hasste mein ewiges Leben.
Hin und wieder, wenn mich der Hunger packte, ernährte ich mich von stinkenden Obdachlosen, die im Schutz der Rettungshütten schliefen, oder einem späten Jogger.
Ein Hund folgte mir, als suche er den Tod. Er war ein Streuner wie ich. Seine braunen Augen sprachen von Verlust. Jemand hatte ihn hier zurückgelassen und einfach vergessen. Jetzt ernährte er sich von dem, was die Menschen ihm zuwarfen. Er kam zu mir, als ich schon eine Weile reglos im Sand gesessen hatte. Legte sich ganz dicht neben mich, sodass sein struppiges gelbes Fell meine Finger streifte.
Für einen Augenblick war er glücklich, dann traf ihn meine Magie und er schlief ein, um nicht mehr aufzuwachen. Das Hundeblut war bitter, und es steckte so wenig in dem kleinen, mageren Leib. Ich trank und ekelte mich, trank und ekelte mich, doch ich hörte nicht auf.
Als sein Herz schließlich das letzte Mal müde zuckte, wartete ich auf den besonderen Kick. Er kam nicht.
Nicht einmal der Rausch des letzten Herzschlages war mir vergönnt.
Als ich den toten Hund betrachtete, der so vertrauensvoll zu mir gekommen war, erschauerte ich. Amber hatte recht.
Ich war ein Monstrum. Ich zerstörte jene, die mir Vertrauen schenkten, und betörte sie, wenn sie nicht freiwillig kamen, um mir zu geben, wonach ich verlangte.
Jemand wie ich hatte nur Abscheu und Tod verdient. Doch zu sterben war nicht leicht nach all den vielen Jahren, und jede weitere Minute machte es noch schwerer.
Meine Reue ließ das Tier nicht wieder lebendig werden. Stundenlang saß ich mit dem kleinen Körper im Schatten eines weißen Holzturms der Küstenwache und grub meine Hände in das struppige Fell, bis der Kadaver im Wind ebenso erkaltet war wie ich.
Meine Gedanken gingen auf Wanderschaft, zu der letzten Frau, die ich geliebt hatte – und der die Liebe zu mir den Tod gebracht hatte.
Marie. So viele Jahre, und ich hatte sie noch immer nicht vergessen. Ihr Haar war so rot gewesen wie Ambers, doch ihre Haut war weiß, so weiß, wie sie es nur nach Jahrzehnten ohne Sonnenlicht werden kann.
Wir hatten uns kurz nach meiner Ankunft in Paris auf einem Ball kennengelernt. Sie war mit ihrem Meister dort, dem sie auch in Liebesdingen gehorchen musste, ich mit Curtis, der als junger Clanherr nach Verbündeten suchte. Es war Liebe auf den ersten Blick. Nichts im Vergleich mit den spröden Gefühlen für meine sterbliche Ehefrau im alten London. Mit Marie verstand ich zum ersten Mal, wovon Poesie wirklich sprach, was das Leuchten bedeutete, das manche Paare in den Augen und im Herzen trugen.
Wir trafen uns heimlich. Anfangs einmal die Woche, schließlich konnten wir keinen Tag mehr ohne einander sein. Ich war so glücklich mit ihr. Marie schien kein Problem damit zu haben, dass ich schwach und beinahe einhundert Jahre jünger war als sie. Wir hielten uns für so schlau, unsere Stelldicheins waren perfekt geplant.
Doch Curtis hat von uns gewusst, von Anfang an. Er kontrollierte mich völlig, trank von mir und las meine Gedanken, ohne dass ich es merkte. Wie hätte er den lauten Chor, der in mir sang, überhören sollen?
Eines Abends erschien Marie nicht zu unserem verabredeten Treffen. Sie hatte mich noch nie versetzt, kam immer pünktlich. Ich war krank vor Sorge und lief in der kleinen Gasse auf und ab, die auf der Grenze der Territorien von Curtis und ihrem Meister lag.
Kurz nach Mitternacht erschien eine gekrümmte Figur unter dem Torbogen. Es war Marie. Ihr Meister hatte von uns erfahren, und die Eifersucht war mit ihm durchgegangen. Er hatte sie halb totgeschlagen, sie gegen ihren Willen ins Bett gezwungen.
Unser Entschluss fiel binnen Sekunden. Wir wollten davonlaufen, so verzweifelt und dumm waren wir.
Eine Kutsche brachte uns fort aus Paris. Der Kutscher trieb die Pferde bis zur völligen Erschöpfung. Schließlich erreichten wir ein kleines Dorf. Die Tiere konnten keinen einzigen Schritt mehr tun. In einem alten Keller suchten wir uns ein Versteck, um den Tag zu verschlafen. Das Erwachen war bitter.
Curtis’ und Maries Meister hatten ihre Diener nach uns ausgeschickt. Sie fanden uns, weil unsere Schöpfer uns fühlen konnten.
Die Männer gruben uns aus, während wir schliefen, und fesselten uns. Als die Sonne unterging, waren wir wieder in Paris. Ich werde niemals Curtis’ Gesicht vergessen, als er mich, seinen ausgerissenen Erstgeborenen, in Empfang nahm.
Weder schlug er mich noch nutzte er seine Magie, um mich für meine Untreue zu bestrafen.
Marie und mich erwartete ein schlimmeres Schicksal: der Vampirrat von Paris. Er verurteilte mich zu Dunkelheit und Hunger. Vor Maries Augen prügelten sie mich in einen steinernen Sarg und begruben ihn.
Der Hunger war unerträglich, die Enge noch schlimmer, doch die Stille war es, die mich endgültig in den Wahnsinn trieb.
Die ganze Zeit über kreisten meine Gedanken um Marie. Was war mit ihr, was hatten sie ihr angetan? Und dann kamen die Schuldgefühle. Ich hatte schrecklich unüberlegt gehandelt und bereute meinen Verrat an Curtis zutiefst.
Anfangs zählte ich noch die Tage, dann wurden die Bedürfnisse meines Körpers so unerträglich, dass ich den Verstand verlor. Irgendwann gewöhnte ich mich an das Leid, mein Bewusstsein kehrte zurück, aber mein Zeitgefühl wollte sich nicht wieder einstellen. Mein Körper verdorrte, mumifizierte. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, nicht einmal blinzeln.
Und dann erwachte ich eines Abends und spürte sofort, dass etwas anders war.
Es waren Vampire in der Nähe. Nach all der Zeit in der Erde hörte ich plötzlich wieder Stimmen, fühlte Herzen schlagen.
Mein Hunger erwachte brüllend zum Leben und mobilisierte meine letzten Kräfte. Mit allem, was ich noch hatte, stieß ich gegen den steinernen Sargdeckel. Er zersplitterte mit lautem Krachen, und ich fand mich in einem unterirdischen Verlies wieder.
Die Herzen, die ich hatte schlagen hören, gehörten Marie und dem einzigen Vampir, den sie bislang geschaffen hatte. Beide hatten furchtbare Angst. Doch damals erkannte ich sie in meinem Wahn nicht einmal. Meine Sicht war verschwommen, ein roter Nebel, in dem die blutgefüllten Leiber gleich Pulsaren aufleuchteten und nach mir riefen.
Ich stürzte mich auf sie. Hörte weder Schreie noch fühlte ich ihre Gegenwehr. Ich tötete beide auf bestialische Weise. Sog sie leer, und als die Adern nichts mehr hergaben, zerriss ich die Körper auf der Suche nach mehr Blut. Als ich endlich aus meiner Raserei erwachte, hielt ich noch Maries zitterndes Herz in der Hand und leckte die letzten Tropfen ab.
Zwei Tage lang habe ich geklagt und geschrien und mich selbst verflucht.
Irgendwann war es nicht mehr Maries Name, den ich wiederholte, sondern der meines Meisters. Curtis, immer nur Curtis. Meine Geliebte war nicht mehr. Mein Schöpfer sollte mich aus diesem Albtraum erlösen.
Während des dritten Tages legte man mich in Ketten. Ich wurde wieder dem Rat vorgeführt. Voller Erstaunen erkannte man, dass mein Geist das halbe Jahr im Sarg überstanden hatte. Ich flehte um Vergebung. Erst da brachten sie mich heim, nach Hause zu Curtis.
Mein Meister hatte nicht gewusst, wie meine Strafe ausfallen würde. Ich glaubte seinen erschütterten Worten, wonach er fast täglich um meine Freilassung ersucht hatte. Ich warf mich ihm zu Füßen, flehte und bettelte um seine Güte. Seitdem hat er nie wieder ein Vergehen vor den Rat gebracht, und ich habe nie wieder gewagt, gegen ihn aufzubegehren.
Die Flut kam als schwarzes Rauschen.
Als die Nacht am dunkelsten war, trug ich den kleinen Hund tief hinein ins Meer. Mit aller Kraft kämpfte ich gegen die Wogen an. Sie rissen mich wieder und wieder von den Beinen. Ich erhob mich immer aufs Neue, bis ich nicht mehr stehen konnte. Dann schwamm ich.
Als ich den Hund schließlich nicht mehr halten konnte, war ich bereits weit draußen. Ich ließ mich mit dem toten Tier im Wasser treiben. Tauchte unter, kam wieder hoch – es war mir gleichgültig.
Delfine zogen neugierig ihre Kreise, als mein Körper gegen die muschelübersäten Pfeiler des Piers schlug. Meine Haut hing in Fetzen, aber ich spürte nichts.
Kurz vor Sonnenaufgang trieb ich endgültig zurück an den Strand. Ich grub mich im Schatten des Piers in den Schlick, um zwischen Muscheln, Würmern und Krebsen den Tag zu verschlafen.
Schließlich fand mich Curtis. Es war kurz vor der Morgendämmerung und ich war die ganze Strecke vom Strand bis zu meinem Friedhof gelaufen.
Ich hatte meine Gedanken vor meinem Meister verschlossen und seine Anrufe ignoriert, bis er aufgab – das hatte ich jedenfalls gehofft.
Jetzt, zehn Tage später, saß er morgens auf den Stufen des Mausoleums.
Ich erreichte Hollywood Forever völlig durchnässt, meine Haut verklebt mit Salz und Sand.
Den Tag zuvor hatte ich mich wie fast jeden anderen am Strand vergraben und dort geschlafen. Die Sonne brachte den Boden zum Kochen und hatte mich durch eine Feuerhölle der Albträume geschickt.
Curtis saß einfach da und blinzelte in die heraufziehende Dämmerung. Er vertrug viel Licht, doch nicht so viel. Er hatte alles genau geplant. Es blieb nicht genug Zeit für ihn, zur Zuflucht zurückzukehren, und ich würde ihn wohl oder übel in mein Heim bitten müssen.
Da saß er nun und sah mich an mit seinen uralten Augen.
Im erwachenden Tag schimmerte seine Haut wie Alabaster.
„Schön hast du es hier“, war alles, was er sagte. „Wunderschön.“
Er stand auf, seine Bewegungen fließend wie Schatten, und trat zur Seite, damit ich aufschließen konnte. Das Wasser tropfte von meiner zerfetzten Kleidung und malte dunkle Seen auf die weißen Marmorstufen. Die Schuhe hatte ich längst verloren, und meine Füße waren schwarz und wund vom Dreck der Straße.
Curtis folgte mir hinein ins Dunkel der Gruft.
Ich war nicht auf Besuch vorbereitet. In meiner geräumigen Kammer angelangt, entzündete ich einige Kerzen und wies auf eine Eisentür. Dahinter verbargen sich mehrere Särge, die ich bei meinem Einzug dorthin verbannt hatte.
Schweigend machten wir uns ans Werk, entfernten die beiden Kindersärge, die zuoberst lagen, und zogen einen schlichten Marmorsarg heraus, in dem Curtis bequem würde liegen können. Er bog die Eisenklammern mit den bloßen Händen auf. Seine Kraft war für ihn eine Selbstverständlichkeit, die mich immer wieder verblüffte.
Der Tote war längst vergangen. Freilich nicht zu Staub.
Curtis sammelte die Knochen auf und deponierte sie respektvoll in einem der Kindersärge.
Zurück blieb ein Leichenschatten aus Moder und Erde. Der Tod riecht nicht schlecht, dachte ich kurz, ein bisschen wie morsches Holz und alte Bücher.
Vorsichtig hoben wir das brüchige Leinen heraus und ließen die braunen Reste zu den Knochen gleiten.
Als letzten Akt kehrte ich Generationen kleiner Käfer mit einem Handfeger zusammen. Die meisten waren tot, doch einige krabbelten noch matt umher.
Curtis beobachtete mich. Er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, doch ich ahnte, wie sehr ihn mein Anblick entsetzte. Immer wieder glitt sein Blick über meinen mageren Körper, die zerrissene Kleidung und meine dreckigen Hände und Füße. Aber solange er schwieg, würde auch ich es tun.
Die Sonne kratzte am Horizont.
Ich reichte Curtis eilig eine Decke und ließ mich in meinen Sarg sinken.
„Ich mache zu, wenn du eingeschlafen bist“, sagte er sanft.
Das hatte er früher oft getan.
Und so saß er bei mir, bis ich nichts mehr spürte und das Augenlicht verlor. An diesem Tag schlief ich seit Langem wieder ohne Albträume.
Als ich am Abend aufwachte, war Curtis schon wach. „Ich hoffe, du kommst jetzt wieder zur Vernunft“, sagte er. „Du und Brandon, ihr seid die Einzigen in meinem Clan, die immer wieder solche Phasen durchleben. Seine Probleme haben sich allerdings gelegt, seitdem er seine Dienerin hat.“ Der Vorwurf stand deutlich zwischen den Zeilen: Wenn es ihm gelingt, warum dann nicht dir?
Während ich zu mir kam, entzündete Curtis die Kerzen in den Wandhalterungen und sah sich in meinem kleinen Reich um.
Meine unterirdische Kammer war nichts im Vergleich mit seinen Gemächern unter dem Lafayette, aber dennoch mehr als eine Gruft mit einem Sarg darin.
Die Wände waren mit weißem Marmor verkleidet, so wie auf diesem Friedhof vieles weiß war und mich die Melancholie des Ortes vergessen ließ.
Zwei wunderschöne Truhen, verziert mit schweren Schnitzereien und nur wenig jünger als ich, bildeten das Herzstück meines kleinen Heims. An den Wänden stapelten sich Bücher, hingen meine Kleider. Es gab ein Tischchen, einen gemütlichen Sessel und einen großen Spiegel.
Curtis lächelte über den Schädel neben meinem Sarg und klopfte mit den Fingernägeln darauf. Es gab ein hohles, trockenes Geräusch.
„Eigentlich bist du zu alt dafür. Das ist Kinderkram.“
Als ich aufstand, rieselte Sand aus meiner noch immer klammen Kleidung. Weiße Salzränder zierten jede Falte im Stoff. Mein Haar war verklebt und ich roch wie ein Hafenbecken.
Während ich mich auszog und wusch, betrachtete Curtis meine Büchersammlung. „Steven vermisst dich, er fragt oft nach dir“, sagte er. „Anscheinend hast du ihm etwas versprochen. Warum willst du das tun?“
Er spielte auf den Bluttausch an.
„Warum hast du mich beschenkt?“, gab ich zurück. „Ich mag ihn. Seit seiner Erweckung ist er wie ein Bruder für mich. Mir gefällt es nicht zu sehen, wie er von den meisten im Clan behandelt wird. Er verdient Besseres.“
„Er ist der Jüngste, natürlich steht er an unterster Stelle. Meine Gabe an dich war etwas anderes. Du weißt, was du mir bedeutest. Außerdem hattest du eine Aufgabe für mich erfüllt, an der andere zugrunde gegangen wären.“
Ich trocknete mich ab und zog mich an. Obwohl ich mich bemühte, jeden Gedanken an Amber zu vermeiden, konnte ich mir eine Frage nicht verkneifen. „Was ist mit dem Messer?“
„Ich habe ein paar Tage gewartet. Nach unserem Telefonat war mir klar, dass die junge Frau nicht zu dir zurückgekehrt ist. Robert hat das Messer in Verwahrung, doch er weigert sich, es zu benutzen.“
„Du könntest es ihm befehlen.“
„Sicher.“
„Aber?“
Curtis sah mich nachdenklich an. „Ich dachte, das hättest du von Miss Connan gelernt. Es ist immer besser, wenn Immortalis und Famulus in die gleiche Richtung blicken. Freier Wille ist der Schlüssel zur vollen Wirkung der Siegel.“
„Du hast mir niemals erklärt, wie sie funktionieren“, sagte ich und spürte Zorn in mir erwachen.
Curtis lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand. „Du hast Augen und Ohren und einen klaren Verstand, das sollte eigentlich reichen, um zu sehen, dass mich mit Robert eine tiefe Freundschaft verbindet. Manchmal befehle ich in kleinen Dingen, aber ich schätze Rat und Hilfe höher.“
Selten hatte Curtis so offen mit mir gesprochen.
„Hat er je um die Gabe gebeten?“, fragte ich.
„Darum, dass ich ihn zu einem von uns mache? Nein, nie. Robert liebt den Tag zu sehr, um ein Wesen der Nacht zu werden.“
Ich nickte, dachte an Amber. Sie hätte mein Tag sein sollen.
„In den nächsten Wochen müssen wir einen Adepten finden. Das Messer braucht einen freien Geist als Träger. Amber wäre eine gute Wahl gewesen.“
„Ich bin falsch vorgegangen, wollte zu schnell Ergebnisse.“
„Vielleicht braucht sie nur Zeit“, warf Curtis ein.
„Amber ist anders als wir“, widersprach ich. „Der Tod ist kein Teil ihres Daseins. Wir hätten sie nicht so früh in die Zuflucht bringen und mit den Tatsachen konfrontieren sollen.“
Curtis stieß sich von der Wand ab und kam auf mich zu.
„Julius, lass dich nicht von deinen Gefühlen blenden, das Siegel verstärkt sie auf unnatürliche Weise. Du kennst das Mädchen doch kaum! In einigen Wochen musst du spätestens entscheiden, was mit ihr wird. Mach sie zu deiner Famula oder gib mir die Einwilligung für ihr Ende.“
Ich dachte an den ersten Kuss mit Amber, an den sonnigen Geruch ihrer Haut, und mir wurde flau. Wie sollte, wie konnte ich über ihren Tod entscheiden?
„Lass dir Zeit. Aber nicht zu lange.“
Ich nickte und wandte mich ab.
In derselben Nacht streiften wir gemeinsam durch mein Revier. Unser Weg führte durch die belebten Viertel, vorbei an Restaurants und Bars, über neonbeleuchtete Boulevards und palmengesäumte Alleen. Schließlich wurden wir der Menschen müde und wandten uns auf dem Western Boulevard nach Norden. Es ging stetig bergauf, vorbei an Luxusanwesen und uralten Gummibäumen. Kojoten huschten durch die Schatten der Gärten. Vom Fern Dell Drive aus konnten wir die erhabene Form des Griffith Observatory sehen, das seit den Dreißigern auf einer Kuppe über der Stadt thronte. Schließlich verließen wir die geteerten Wege endgültig und tauchten in Waldesdunkel.
Der Mond stand als breite Sichel am aschgrauen Himmel. Heiße Santa-Ana-Winde rauschten in den Wipfeln der hartblättrigen Eichen. Wir stiegen staubige Wege hinauf und setzten uns unter eine Kiefer. Der warme Wind bog die Gräser. Am Berg rechts hinter uns zeichnete sich der Hollywood-Schriftzug ab, vor uns lag die Stadt, leuchtend, irisierend. Der viele Staub in der Luft trog das Auge und ließ die Lichter funkeln wie Juwelen.
Ich zog die Beine an, stützte das Kinn auf die Knie und starrte auf endlos aneinandergereihte Schachbretter aus Licht, deren Linien sich in der Ferne verloren.
Curtis saß neben mir und hatte zu seiner Reglosigkeit zurückgefunden. Sein Blick ruhte auf dem Horizont, doch ich ahnte, dass mir mein Meister noch etwas zu sagen hatte.
„Gestern ist der Rat zusammengetreten“, begann er.
Sofort schnürte sich mein Hals zu. Ich schluckte, doch der Druck blieb. Ich wusste, was seine Worte bedeuteten.
„Wieder einer von Gordons neuen Vampiren? Ich dachte, jetzt, da wir das Messer haben …“
„Nein. Gordon macht einfach weiter, als sei nichts geschehen. Wir beobachten ihn. Seine Armee wächst. Fast täglich tauchen neue Vampire auf. Sie jagen mittlerweile auch in fremden Territorien, doch leider sind sie uns bislang immer erwischt.
In den letzten Tagen gab es mehrere Morde in Beverly Hills, in der Nähe des Robertson Boulevards. Da alle Clanherren ihre Reviere besonders aufmerksam bewachen, wurden die Leichen zum Glück früh genug entdeckt und beseitigt.“
„Es gibt also ein Urteil?“, fragte ich mit belegter Stimme.
„Ja.“
Ich nickte und ließ mir durch den Kopf gehen, was ich gerade gehört hatte. Die Bedrohung durch Gordon war nicht geringer geworden, sondern wuchs, und ich sollte wieder einmal meiner Aufgabe als Jäger nachkommen. Hätte Amber zugesagt, wäre dies unser erster gemeinsamer Auftrag gewesen. Jetzt musste ich es alleine tun, wie seit eh und je.
Mit jedem neuen Toten verschwand ein weiteres Stückchen meiner kostbaren Menschlichkeit. Es war stets das Gleiche: Ein Teil von mir verabscheute, was geschah, doch der Jäger in mir genoss jede Sekunde der Hatz.
Die Angst des Opfers, der Rausch des Tötens – was wir uns bei Menschen seit Langem versagten, kostete ich auf der Jagd nach meinesgleichen voll und ganz aus.
„Das Urteil ist seit gestern rechtskräftig.“ Curtis reichte mir ein versiegeltes Stück Papier.
„Gibt es einen Namen? Weißt du, wer es ist?“
„Nein, und ich glaube, er weiß es selber nicht. Wahrscheinlich ist er schon ein halbes Raubtier.“
„Ich werde ihn finden“, seufzte ich.
„Natürlich wirst du das, Julius.“ Curtis hatte wieder Samt in der Stimme. Ich lehnte mich an ihn und sehnte mich plötzlich erneut nach seinem mächtigen Blut.
Curtis spürte es sofort. „Du wirst unverschämt.“
Ich hielt die Augen geschlossen und hoffte, denn ich hatte das Lächeln in der Stimme meines Schöpfers gehört. Sein Blut wisperte verheißungsvoll.
„Dann nimm, was du so sehr begehrst.“
Ich nahm nur wenig und brauchte diesmal auch keine Ermahnung, um aufzuhören. Curtis manipulierte meine Gefühle, und ich ließ es geschehen. Sein Blut heilte meine Seele. Die Zweifel an meiner Existenz schwanden, und mit ihnen zumindest teilweise auch die seltsamen Verlustgefühle, die ich seit dem Bruch mit Amber empfand.
Ich konnte wieder atmen, funktionieren und tun, was Curtis und der Rat von mir erwarteten: einem jungen Vampir zu seinem Ende verhelfen.
***
Daniel Gordon
Daniel Gordon lief auf und ab. Er konnte dieses dumme Gesicht nicht mehr ertragen, diese milchigen Augen, die jeden seiner Schritte mit hündischem Eifer verfolgten. Konnte dieser untote Vampirjäger nicht endlich zur Sache kommen, damit er ihn samt seinem Fäulnisgestank fortschicken konnte?
„Du warst also bei deiner Schwester“, versuchte er ihm auf die Sprünge zu helfen.
„Ja, ich war bei Amber, aber sie hat es nicht bei sich, es ist nicht in Silverlake, und auf ihrer Arbeit ist es auch nicht.“
Daniel Gordon war ratlos. Er war sich so sicher gewesen, dass Amber Connan die neue Adeptin war, aber weder Frederik noch einer seiner Vampire hatte die junge Frau noch einmal mit der Waffe gesehen. Es schien auch kein Kontakt mehr zwischen ihr und dem Clan der Leonhardt zu bestehen.
Uralter Hass wallte an die Oberfläche und weckte in Gordon den Wunsch, etwas zu zerstören. Sein unsteter Blick fiel auf Frederik. Nein, den würde er später noch brauchen.
Es gab nur einen Ort, an dem sich das Messer befinden konnte: in der Zuflucht der Leonhardt. Tristans Aussage über den Kampf in Hollywood war zu glauben. Der Jäger Julius Lawhead hatte das Messer zuerst gefunden, und wo hätte er es hinbringen sollen, wenn nicht zu seinem Meister? Das Lafayette war selbst mit der inzwischen beachtlichen Armee von Vampiren und Menschen, die Gordon gehorchten, nahezu uneinnehmbar. Sein ganzer Plan war dahin. Er schlug mit der Faust auf die Fensterbank, und der Stein zersplitterte wie Glas.
„Ich will dieses verdammte Messer!“, schrie er.
Frederik zuckte zusammen. Fast hatte Gordon ihn bereits vergessen, doch jetzt entstand eine neue Idee in seinem Kopf.
Warum sollte er nicht auch ohne die Waffe mit seinem Plan fortfahren? „Ich habe eine Aufgabe für dich.“
Der Untote straffte die Schultern. „Womit kann ich dienen, Meister?“
***
Amber
Das beste Mittel gegen Trauer und Erinnerungen war Ablenkung. Und so war ich heute bereits den zweiten Tag wieder in die kleine Vergolderwerkstatt gefahren, in der ich arbeitete. Es gab immer viel zu tun, doch im Augenblick ertranken wir sogar fast in Aufträgen. Etwas Besseres hätte mir nicht passieren können.
Um mich ganz meiner Aufgabe zu widmen, hatte ich mich in einen kleinen Werkraum zurückgezogen, in dem ich ungestört war.
Meine Kollegen respektierten meinen Wunsch nach Einsamkeit sogar in der Mittagspause. Gestern, als ich zum ersten Mal seit Frederiks Tod gekommen war, hatte ich sie gleich darum gebeten, mich mit meinem Kummer alleine zu lassen. Die anderen hier kannten mich seit Jahren und akzeptierten meinen Wunsch.
Ich streckte den Rücken durch, bis es knackte.
Viel zu lange hatte ich über den Tisch gebeugt dagestanden und mit einem kleinen Stück Schleifpapier die Verzierungen eines antiken Rahmens gereinigt.
Durch ein kleines Fenster fiel trübes Licht in die Werkstatt. Alles in dem Raum lag unter einer feinen Staubschicht. Weiß wie Schnee bedeckte sie Regale, Bretter und Dosen, Kisten und Werkzeuge.
Ich löste durch einige Drehungen mit dem Schleifpapier eine besonders hartnäckige Verkrustung und blies die Reste fort.
In den vergangenen Stunden hatte ich viel nachgedacht. Leider. Zum ersten Mal hasste ich meinen Job dafür, dass er so viel Raum für eigene Gedanken ließ. Während die Hände mit Feinarbeit beschäftigt waren, konnte der Geist auf Reisen gehen, und derzeit kannte er nur zwei Ziele: Frederik und Julius.
In den vergangenen Tagen war ich noch mehrfach in Frederiks Wohnung gewesen. Mittlerweile war das Apartment vollständig geräumt.
Ich hatte dort noch andere Verstecke gefunden. Zwischen Bett und Wand war eine Mappe mit Zeichnungen verborgen gewesen. Zuerst hatte ich mich gewundert, warum Frederik sie überhaupt getrennt von den anderen aufbewahrte, doch als ich sie öffnete, wurde alles klar. Vor mir lagen überaus gelungene Porträts von Männern und Frauen verschiedenen Alters, und zu jedem Bild existierte ein zweites, ungleich schrecklicheres.
Anscheinend waren all diese Menschen Vampire gewesen, und Frederik hatte sie getötet. Die zweiten Bilder zeigten Gemetzel, Blutbäder und gekrümmte Gestalten, deren Haut sich schwarz und brodelnd auflöste. Die Bilder waren detailreich und drastisch, als hätte Frederik den Anblick der leidenden Kreaturen genossen. Auf jedem Bild war neben dem Datum eine kurze Beschreibung der Jagd notiert, manchmal auch der Name des Ermordeten.
Ich hatte alles, was auf Frederiks geheime Tätigkeit hinwies, verbrannt. Nicht nur die Zeichnungen, sondern auch die Pflöcke und Frederiks Tagebuch landeten im Garten im Feuer. Es hatte gutgetan, in die Flammen zu schauen, die all dies vernichteten. Es war ein Weg abzuschließen.
Ich wollte nur schöne Erinnerungen erhalten. Frederik als mordlüsterner Vampirjäger würde nach und nach verblassen, und damit, so hoffte ich, auch Julius.
Grübelnd, warum es sich noch immer so anfühlte, als bestünde eine besondere Verbindung zwischen uns, ging ich zu einem kleinen Kühlschrank und nahm eine Schale mit Kalkmasse heraus.
Während ich dort, wo der Zahn der Zeit an dem antiken Rahmen genagt hatte, Schicht für Schicht Schnecken und florale Muster ergänzte, wanderten meine Gedanken zu Julius. Ich wollte nicht an ihn denken, doch er ließ sich nicht so einfach vergessen.
Immer wieder ertappte ich mich dabei, wie ich mir seine Stimme ins Gedächtnis rief, seinen sonderbaren, aber schönen Geruch und die Berührung seiner kühlen, weichen Hände.
„Julius Lawhead hat mich benutzt und betrogen“, wiederholte ich leise, während ich die Kalkverzierungen mit Wasser und einem kleinen Spachtel glättete.
Es konnte doch nicht so schwer sein, von ihm loszukommen!
Wir hatten nur zwei Tage miteinander zu tun gehabt … und trotzdem hatte ich das Gefühl, er habe sich in meiner Brust eingenistet, und zwar in direkter Nachbarschaft von Herzrasen und Schmetterlingen im Bauch.
War das etwa die Wirkung dieses seltsamen Siegels, von dem Curtis gesprochen hatte? Und wenn ja, wie wurde ich es wieder los? So wie jetzt konnte es kaum weitergehen. Es machte mich regelrecht krank. In den Nächten träumte ich so intensiv von den Vampiren, dass ich manchmal kaum unterscheiden konnte, was real war und was nicht. Ich war ständig übermüdet. Tagsüber drifteten meine Gedanken immer wieder zu Julius, als könnte es das Siegel nicht ertragen, dass ich mich von ihm fernhielt. Ich war unkonzentriert und schrecklich müde. Mein Körper fühlte sich ausgelaugt an wie nach langer Krankheit. Das musste aufhören!
Ich stellte die restliche Kalkmasse zurück in den Kühlschrank und wusch mir die Hände.
Irgendwann würde ich Julius vergessen können, vielleicht noch nicht bald, aber in einigen Wochen oder Monaten.
Noch hielt ich abends manchmal nach ihm Ausschau, meinte, ihn durch das Fenster einer überfüllten Bar zu sehen, in einem Bus oder einfach am Straßenrand. Und jedes Mal war ich froh, dass er es doch nicht war.
Die Tür wurde geöffnet. Ich fuhr erschrocken herum.
Es war mein Chef. Sein wirres Haar war von einem dichten Film aus Kalkstaub bedeckt, ebenso die Gläser seiner Brille, die er jetzt abnahm und an seinem Ärmel sauberwischte. Er trug den gleichen Kittel wie ich, doch seiner spannte sich über eine gemütliche Figur. Eigentlich stand er kurz vor der Rente, doch er dachte gar nicht daran, seine Arbeit an den Nagel zu hängen. Sein Beruf war sein Leben.
„Es ist nach sechs, Amber. Willst du nicht auch langsam nach Hause gehen? Die anderen sind schon weg.“
„Ja, sicher“, antwortete ich und rang mich zu einem Lächeln durch. „Ich bin gleich so weit.“
Ein letztes Mal begutachtete ich prüfend den Rahmen, dann legte ich meinen Kittel ab. Ein weiterer Abend zu Hause erwartete mich. Schmerzhaftes Schweigen oder genauso schmerzhafte Gespräche mit Mama.
***
Julius
Als ich am Abend den Santa Monica Boulevard erreichte, fuhr mein Bus, der 704er, gerade an mir vorbei. Ich sprintete los und holte ihn noch vor der Bushaltestelle ein.
Drinnen nickte ich dem dicken schwarzen Busfahrer zu und steckte einen Dollar und fünfundsiebzig Cent in die Maschine. Einfache Fahrt. Den Rückweg würde ich laufen, dann hätte ich mehr Zeit.
Das Fahrzeug setzte sich ächzend und stöhnend in Bewegung.
Es war noch immer Hauptverkehrszeit und der Bus brechend voll. Die marode Klimaanlage gab ihr Bestes, kam gegen die schwitzenden Leiber aber nicht an.
Ich versuchte, das Elend einfach über mich ergehen zu lassen, aber jede Kurve, jedes Bremsen ließ die Menschen schwanken. Immer wieder klebte ich an verschwitzten Armen fest. Manche Vampire mochten in so einer Situation an einen reich gedeckten Tisch denken, ich aber ekelte mich.
Je näher wir Beverly Hills kamen, desto freier konnte ich atmen. Der Bus leerte sich, und so traute ich mich endlich, den Arm, den ich schützend über mein Schwert gehalten hatte, zur Seite zu nehmen.
Es war eine besondere Klinge, die sich unter meiner leichten Jacke versteckte: zweiundzwanzig Zoll feinster Stahl, verborgen in einem Ebenholzgriff. Es war eine Spezialanfertigung und mein Markenzeichen als Jäger. Auf den ersten Blick sah es wohl nicht anders aus als ein elegant geschwungener Holzstock. Der kleine Hebel, der die Mechanik auslöste, war gut versteckt. Etwas Druck in die richtige Richtung, und die Klinge und zwei kurze Parierstangen sprangen hervor.
Heute Nacht sollte das Schwert wieder im Blut eines Vampirs baden, und die Silberlegierung würde dafür sorgen, dass dessen Begegnung mit der Waffe endgültig war.
Silber war ein Symbol des Mondes, also des Gestirns der Tageszeit, in der wir zu leben gezwungen waren. Die Nacht beherrschte unser Dasein, das Silber unsere Kraft.
Silber befand sich auch auf den Bolzenspitzen meiner Pistolenarmbrust, die mit eingeklapptem Griff in meiner ledernen Umhängetasche verborgen war.
„La Cienega“, krakeelte es aus den Lautsprechern.
Draußen flatterten Regenbogenfahnen. Halbnackte Transvestiten tanzten vor einem Café, in dem offensichtlich gerade eine Hochzeitsfeier stattfand.
Der Bus hielt, spie einen Haufen Passagiere in die Nacht und nahm wieder Fahrt auf.
Ich beugte mich zum Fenster und zog an der verklebten gelben Schnur, die dem Fahrer das Signal zum Anhalten gab. Die nächste Haltestelle war meine.
„San Vicente.“
Ich stieg aus, wischte mir die Hände an der Hose ab und überquerte die Straße. Robertson Boulevard, hatte Curtis gesagt. Der Vampir hatte sein kleines Revier mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht verlassen.
Ich durfte nicht säumen, sonst gab ich ihm die Gelegenheit, ein weiteres Opfer zu töten.
Ich schob die Hände in die Taschen, beschleunigte meinen Schritt und lief bis zur Kreuzung Robertson und Olympic. Dort suchte ich die innere Leere, den Ruhepunkt tief in mir, und senkte meine Schilde, die mich sonst wie eine zweite Aura umgaben und mich davor schützten, beständig andere Vampire zu spüren oder von ihnen wahrgenommen zu werden. Mit den Schilden schlug mein Körper erst Alarm, wenn die Distanz eine kritische Nähe erreichte. Jetzt allerdings lauschte ich. Tastete mit unsichtbaren Fingern über den Boden, durch Häuser und über Hinterhöfe.
Ich fand vielerlei Leben, menschliches und tierisches. Fernab erwachte ein Vampir im Keller eines Mietshauses, doch er war nicht mehr ganz so jung und nicht der, den ich suchte. Offenbar schlief meine Beute noch. Ich hatte das ungefähre Herz des Reviers meines Gegners erreicht und suchte mir eine Bank. Das Warten begann.
Ein letzter Rest Licht stand noch am Himmel, doch bald musste der Vampir aufwachen. Er war noch sehr jung und schlief daher lange. Wenn er sich erst einmal aus seiner Starre löste, musste ich schnell handeln.
Der Hunger machte ihn zur reißenden Bestie.
Ich rieb mir die Schläfen und konzentrierte mich wieder darauf, nach den Gedanken meiner Beute zu fahnden.
Immer noch nichts.
Nach und nach gingen die Lichter in den Wohnungen an, Gitter rasselten vor Schaufensterscheiben hinunter, Türen wurden abgeschlossen.
Plötzlich schrillten meine Sinne Alarm.
Ich fühlte einen anderen Vampir. Er war noch sehr jung. Ich konzentrierte mich, fischte nach seinen Gedanken und fand nichts, nur Hunger und vage Bilder. Eine von Bäumen überschattete Straße, orientalische Lebensmittelgeschäfte, ein Kebab-Restaurant.
Ich sprang auf.
Sein chaotisches Bewusstsein verriet ihn. Er war es, mein Ziel, doch er hielt sich viel weiter südlich auf als gedacht. Ich hastete über die Straße, provozierte ein wildes Hupkonzert und lief den Robertson hinunter, vorbei an einem Rabbi auf dem Weg zum Gebet, vorbei am Kabbalazentrum.
Hoffentlich war es noch nicht zu spät! Hoffentlich erwischte ich ihn, bevor er sein nächstes Opfer fand! Mein Kopf war erfüllt von seinen tierhaften Gedanken, seinem Hunger. Sogar den faden Geschmack in seinem Mund teilte er mit mir. Muffiges, altes Blut.
Er durfte mich auf keinen Fall zu früh bemerken.
Einen Block, vielleicht noch zwei, dann hatte ich ihn eingeholt. Die Luft begann nach ihm zu schmecken. Mein Herz hämmerte. Die Spur wurde immer frischer. Der dumpfe Geruch von Blut, Tod und schmutziger Kleidung war eine deutliche Fährte.
Ich erreichte den Gemüseladen, den ich in seinen Gedanken gesehen hatte. Bilder stürzten unablässig auf mich ein.
In mir regierte der Jäger. Doch im Gegensatz zu meiner Beute hatte ich meine Mordlust unter Kontrolle.
Lautlos überquerte ich einen Parkplatz und verschwand im Gewirr der Nebenstraßen. Sie waren gerade breit genug für ein Auto und führten zu Hinterhöfen und Einfahrten. Rissiger Beton, Mülltonnen, Trostlosigkeit. Keine Menschenseele weit und breit.
Ich verlangsamte meine Schritte, sah mich um und lauschte angestrengt.
In einem der Häuser stritt ein Ehepaar, Fernseher liefen, Geschirr klapperte. Vor meinem inneren Auge sah ich Bilder all dieser fremden Leben aufsteigen, menschliche Leben, nur eine Mauerstärke von mir entfernt.
Plötzlich wurde die Hinterhofstille vom kurzen Schrei einer Frau zerrissen.
Es war ein Todesschrei. Ich hatte mich ablenken lassen. Jetzt war es geschehen und ich kam zu spät!
Die Euphorie des jungen Vampirs stürzte wie eine Lawine auf mich ein. Der Rausch, den er empfand, während das Blut seines Opfers durch seine Kehle strömte.
Mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Auch ich empfand nun Hunger. Ich riss meine Schilde hoch.
Zu spät. Der andere hatte mich bemerkt. Er musste ganz in der Nähe sein. Im Bruchteil einer Sekunde erfasste er mein Alter und den Grund, weshalb ich gekommen war. Noch war er hin- und hergerissen zwischen seinem Durst und der Angst vor mir.
Mir blieben wenige Augenblicke, die alles entscheiden konnten. Ich lief, so schnell ich konnte, lugte in jede Einfahrt. Der dumpfe Aufschlag eines Körpers auf Beton wies mir die Richtung. Neben einem Metallzaun kam ich zum Stehen.
Eine Tür schlug zu, schnelle Schritte entfernten sich. Die Geräusche kamen aus dem Hinterhof.
Mit einem Sprung setzte ich über den Zaun, und da lag sie.
Eine Frau, Anfang vierzig vielleicht. Ihre Glieder zuckten, die Hände fuhren ziellos über den ausgewaschenen Beton.
Mit ihr ging es zu Ende. Sie hatte kaum noch Leben im Leib. Neben der Sterbenden lag der aufgeplatzte Müllbeutel, der sie im Dunkeln auf den Hof geführt hatte. Wenn sie nicht in wenigen Minuten zurückkehrte, würde man sie in der Wohnung vermissen und nachsehen. Der Biss an ihrer Kehle würde Fragen aufwerfen. Seit Jahren hatte der Rat Claire Steen und ihren Bruder dazu auserkoren, tote Menschen und Vampire spurlos zu beseitigen. Claire war zwar gut, doch so schnell konnte selbst sie nicht hier sein und die Leiche verschwinden lassen. Das zwang mich zu handeln, auch wenn es mich wertvolle Minuten kosten würde.
Ich ging neben ihr in die Knie. Als sie mich sah, flackerte Hoffnung in ihren Augen. Doch ich war kein Retter, ich war der endgültige Tod!
Für sie kam jede Hilfe zu spät, ich würde ihr Ende nur beschleunigen. Es bestand kein Zweifel darüber, was zu tun war. Am Hals der Frau klaffte der Biss, die Haut zerfleischt und die ertragreichen Adern zerrissen. So trank kein Vampir, das war das Werk eines Tieres. Unter dem Körper wuchs eine Blutlache.
Der Atem der Frau ging schwer und stoßweise. Sie wollte etwas sagen, doch ihrem Mund entwich nur ein heiseres Zischen.
„Sie werden nichts spüren, keine Angst“, flüsterte ich, strich ihr über die schweißnasse Stirn und zog ein Messer, das ich in einer Schiene am Unterarm getragen hatte. Als sie die Klinge sah, begann sie hektisch zu blinzeln, zu mehr war sie nicht in der Lage.
„Keine Angst, keine Angst“, wisperte ich und benutzte die Macht meiner Stimme, um die Frau zu betäuben. Ihre Züge entspannten sich augenblicklich, der rasselnde Atem ging ruhiger und ihre Hände hörten auf zu zittern.
Sie spürte nichts, als ich ihr mit einer einzigen raschen Bewegung die Kehle aufschnitt und die Klinge wieder und wieder durch ihre Haut zog, bis von der ursprünglichen Bisswunde nichts mehr zu sehen war. Ihr Körper bäumte sich ein letztes Mal auf, dann lag sie still.
„Verzeihen Sie mir“, flüsterte ich.
Mit zitternden Fingern schloss ich ihre Augen und stand auf. Ich würde dafür sorgen, dass sie sein letztes Opfer war, heute Nacht noch.
Ich starrte auf die verstümmelte Leiche hinab. Nein, hier würde niemand an den Tod durch einen Biss denken.
Auch wenn die Unseren den Leichnam nicht rechtzeitig bargen, würde unsere Existenz geheim bleiben. Ich straffte den Rücken, verschickte eine schnelle Nachricht mit der Position der Leiche und sah mich um.
Der Vampir hatte den Hof durch ein kleines Tor verlassen. Sein Vorsprung war recht groß. Ein letzter Blick zurück auf die Tote, dann rannte ich lautlos in die Nacht.
Ich überließ mich jetzt ganz meinen Instinkten. Wie eine lästige Hülle streifte ich alles Menschliche ab und wurde zum Jäger, zum Raubtier.
Mein Herz hämmerte euphorisch, und ich fühlte mich so lebendig wie lange nicht mehr.
Blutdurst schrie wie ein wildes Tier nach dem Tod des jungen Vampirs. Sein letzter Herzschlag gehörte mir!
Da, ich hörte Schritte. Jemand rannte um sein Leben. War ich schon so nahe, oder hallten sie in meinen Gedanken? Die Sinneseindrücke des anderen überlappten meine, mal war ich in seiner, mal in meiner Welt.
Dann passten die Bilder plötzlich zusammen.
Der junge Vampir sah das gleiche Gebäude wie ich: eine alte Autowäscherei.
Ich setzte über ein parkendes Fahrzeug und trieb ihn weiter auf das Gebäude zu, bis ihm nur noch die Zufahrt als Fluchtweg blieb.
Und da war er! Endlich konnte ich ihn mit eigenen Augen sehen. Ein dunkler Schatten, nicht mehr. Er durchschlug das dünne Blechtor und verschwand im Gebäude.
Ich hielt kurz inne und sah mich um.
Die Straße war verlassen. In der Nähe standen nur andere Industriegebäude, manche leer, andere um diese späte Stunde mit rostigen Eisengittern verschlossen. Keine Wohnhäuser. Keine Bars. Keine Menschen, nur Dutzende von Staren, die aufgereiht auf einer Stromleitung saßen und verstummten, sobald sie mich bemerkten.
Meine Beute und ich waren allein. Gut so, denn für das, was geschehen würde, konnte ich keine Zeugen gebrauchen.
Ich sah mich ein letztes Mal um, dann stieg ich aufs Äußerste gespannt durch das zerbeulte Blechtor. Das Licht einer Straßenlaterne fiel durch die schmutzigen Fenster und tauchte das Innere der großen Halle in diffuses Grau.
Da stand er, schwankend wie ein in die Enge getriebener Bär.
Er hatte nichts Menschliches mehr an sich. Seine zerrissene Kleidung war verkrustet von altem Blut, der Mund mit den spitzen Zähnen schnappte nach Luft. Niemand hatte ihm gesagt, dass er nicht mehr atmen musste.
Dieser junge Vampir hatte nie einen Mentor gehabt, nicht einmal für die ersten Wochen. Es war nicht seine Schuld, dass er zum Monstrum geworden war, doch das scherte den Jäger in mir nicht. Frisches Rot troff vom Kinn meines Gegenübers, und seine Augen glühten.
Er steckte in einer Sackgasse. Der Weg zum einzigen Ausgang führte an mir vorbei, und ich war der sichere Tod, das wusste er. Ich hatte Verurteilte erlebt, die bei meinem Anblick weinten oder um Gnade flehten, doch dieser hatte beschlossen zu kämpfen. Das würde interessant werden.
Mein Gegner fauchte und bleckte die Zähne.
Halblange Haare hingen ihm ins Gesicht und verstärkten den Eindruck, dass er schon eine Weile auf der Straße verbracht hatte. Wie viele Menschen mochte er getötet haben, bevor die ersten Opfer gefunden worden waren? In den Tagen oder Wochen seit seiner Erweckung konnte viel geschehen sein.
Seine hellgrünen Augen tasteten hektisch den Boden ab, die Hände öffneten und schlossen sich. Er war unschlüssig.
Plötzlich bückte er sich in einer Geschwindigkeit, die ich ihm nicht zugetraut hätte, und im nächsten Augenblick teilte eine Stahlstange die Luft.
Ich wich mühelos aus, und das Eisen zischte an mir vorbei. Ich hätte mit meinem Schwert parieren können, doch dafür war mir die Waffe zu schade.
Der Vampir umklammerte das Metall und knurrte.
„Wolltest du etwas sagen?“ Erneut nur eine tierhafte Reaktion. Ich versuchte, Worte zu erkennen, doch der Vampir hatte die Fähigkeit zur Sprache längst verloren. Ohne einen Meister, ohne jemanden, der ihn durch die erste Zeit führte, hatte er alles Menschliche hinter sich gelassen.
Wir umkreisten einander, lauerten, warteten darauf, dass der andere einen Fehler beging. Meine Sinne waren gespannt, alles erregte jetzt meine Aufmerksamkeit. Irgendwo schaukelte eine Metallkette im Wind, und draußen hatten die Stare wieder zu singen begonnen.
Auf einmal sprang der Vampir auf mich zu.
Ich duckte mich unter dem Schlag, der meinen Kopf zertrümmern sollte, und rammte meinem Gegner den Ellenbogen in die Rippen. Knochen splitterten, gefolgt von einem dumpfen Schrei. Die erste Runde ging an mich. Der andere keuchte. Seine Hände krampften sich um die Waffe, bis die Knöchel weiß hervortraten. Für einen Augenblick fiel seine Deckung. Ich schoss vor und hämmerte meine Fäuste erst in sein Gesicht und dann in seinen Unterleib.
Er sackte zusammen und würgte. Ein Schwall frischen Bluts klatschte auf den Boden. Ich trat zurück und musterte den Vampir wie ein exotisches Spielzeug.
Doch mein Gegner überraschte mich. Er war nicht im Mindesten bereit aufzugeben. Mit dem Mut der Verzweiflung ließ er die Eisenstange in meine Richtung sausen und verfehlte mich nur knapp.
Ich versuchte, sie ihm aus der Hand zu reißen, doch meine Rechte glitt an dem erbrochenen Blut ab.
Der nächste Hieb bohrte sich in meinen Bauch und schickte mich zu Boden. Überrascht sah ich die Welt plötzlich von unten. Für einen Moment war alles taub, meine Sicht verschwommen.
Mein Gegner hätte seine Chance nutzen sollen. Stattdessen ließ er die Metallstange fallen. Er wollte mich nicht töten, er wollte fliehen. Das war ein riesiger Fehler. Ich würde ihn nicht verschonen, spürte er das denn nicht?
Er lief an mir vorbei zum Tor, aber ich war schneller.
Blitzschnell zog ich meine kleine Armbrust aus der Tasche, ließ den Griff ausklappen und nagelte dem Vampir einen Pfeil in die Wade.
Er strauchelte kurz und rannte weiter. Blitzschnell verstärkte ich meinen Griff an der Waffe mit der Linken, dann riss mich der Ruck vorwärts. Mein Gegner schlug der Länge nach hin und schrie ohrenbetäubend.
Der Pfeil war aus silberlegiertem Stahl. Scharfe Widerhaken hielten ihn im Fleisch, und ein dünner, aber starker Metallfaden verband ihn mit der Armbrust.
Ich kam auf die Beine und verkeilte die Waffe in einem Haufen Eisenschrott.
Erfolglos riss der andere am Faden und zerschnitt sich dabei die Handflächen, gefangen wie ein Fisch am Haken.
Der Geruch seiner Panik berauschte mich. Meine Schmerzen waren längst vergessen. Als mein Gegner merkte, dass er sich nicht losmachen konnte, sprang er auf und stürzte sich auf mich. Er kratzte und biss. Seine dreckigen Nägel zerfetzten mir Hals und Gesicht, ehe ich Abstand gewinnen konnte.
Wieder schlug er mit gekrümmten Fingern nach meinen Augen.
Ich wich zurück, weiter und weiter in die Halle hinein, bis er mir nicht mehr folgen konnte. Der Metallfaden spannte sich und riss an dem Pfeil in seinem Bein. Der Vampir heulte wütend auf und blieb stehen.
Ich wusste, dass es grausam war, mit dem Verurteilten zu spielen. Doch es war niemand hier, um mich zu richten, niemand, um mich aufzuhalten.
Ein letztes Mal sammelte er seine Kräfte, stürzte mit einem verzweifelten Aufschrei vorwärts und wurde wieder zu Boden gerissen.
Kälte breitete sich in mir aus, und die Stille, die sich meiner stets bemächtigte, wenn ich kurz davor war zu töten.
Mühsam kam der Vampir auf die Beine. Ich trat vor, begab mich mit voller Absicht in seine Reichweite und ließ ihn kommen. Ahnungslos wie ein Stier in der Arena rannte er in seinen Untergang.
Ich fing seinen Schlag mühelos ab, ergriff seine Rechte und drehte sie ihm auf den Rücken.
Er wand sich. Seine Zähne schnappten ins Leere.
Es war vorbei. Er wusste es, ich wusste es. Sein Herz schlug verzweifelt gegen meine Brust, und ich starrte fasziniert auf den hüpfenden Puls seiner Schlagader.
„Du hättest nicht töten sollen“, flüsterte ich, die Lippen schon gegen seine Haut gepresst. Die Welt um uns schien zu verschwimmen, und es gab nur noch mich und mein Opfer.
Seinen Körper gegen meinen gepresst, bewegte ich die Fänge in der Wunde hin und her, um sie offen zu halten. Jedes Mal schoss frisches Blut in meine Kehle.
Ich trank und trank.
Was ich bei Menschen nicht durfte, feierte ich hier in einem obszönen Rausch. Der Vampir wurde schwächer, sein Herz schlug langsamer und langsamer. Sein Blut war gewürzt mit Angst, kalt und weich, süß wie der Morgen.
Wir standen in dieser heruntergekommenen Blechhalle zwischen verrosteten Maschinen und Schutt, und ich glaubte mich im Paradies.
Wegen der großen Gefahr, süchtig nach dem Rausch des Todes zu werden, war es tabu, im Kampf von unseresgleichen zu trinken. Doch hier sah mich niemand.
Die Beine meines Opfers sackten weg, doch ich hielt den Vampir und trank, bis sich seine Adern zusammenzogen, auch das letzte Tröpfchen Blut herausgesaugt war und sein unsterbliches Herz endlich den letzten Schlag tat.
Der Rausch traf mich mit voller Wucht.
Achtlos ließ ich den Körper zu Boden gleiten und lehnte mich gegen die Wand. Es war wunderbar. All seine Kraft, all sein Leben gehörte jetzt mir. Mit weichen Knien wartete ich darauf, dass sich meine Sinne wieder klärten.
Der Vampir lag zusammengekrümmt auf der Seite, der Blutverlust lähmte ihn, aber er war noch nicht tot. Ich beugte mich zu ihm, drehte ihn auf den Rücken, streckte seine Beine aus und drapierte die leblosen Arme dicht an den Körper.
Hätte Amber in diesem Moment in meine Augen geblickt, hätte sie das Monster gesehen, das ich in Wirklichkeit war.
Ich zog das Todesurteil aus der Innentasche meiner Jacke, platzierte es auf der ausgemergelten Brust und beschwerte es mit einem Stück Schrott.
Der Blick des jungen Vampirs suchte das Papier zu fassen. Er verstand noch immer nicht, was da geschah. Niemand hatte ihm gesagt, was mit Unsterblichen passierte, die den Codex brachen.
Sicherlich wusste er noch nicht einmal, dass es einen Codex gab.
Ich löste den Pfeil aus seinem Bein und verstaute ihn samt der Armbrust. Erst danach zog ich mein Schwert.
Irritiert hielt ich einen Augenblick lang inne. Wurde ich beobachtet?
Es war nur ein Gefühl, aber es hielt sich beharrlich. Ich blickte durch das Loch im Tor, doch draußen wartete nur die orange Dunkelheit der Großstadt. Entschlossen richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder auf mein Opfer.
Die Klinge sprang aus dem langen Holzschaft und brach das fahle Laternenlicht, das durch die verdreckten Fenster fiel. Die Lippen des Vampirs zuckten ein letztes Mal, als ich mit der Henkerswaffe neben ihm Aufstellung nahm.
Mit einem sauberen Schlag trennte ich den Kopf vom Körper und fühlte – nichts. Danach reinigte ich die Klinge mit einem Tuch und bettete den abgeschlagenen Kopf im Schoß des Toten. Die Haare fühlten sich fettig an, und das alte Blut in seinem Shirt stank erbärmlich. Plötzlich ekelte ich mich und wollte nur noch fort von diesem trostlosen Ort.
Aber es galt ohnehin, sich zu beeilen. Ein Meistervampir spürte immer, wenn einem seiner Kinder etwas zustieß. Gordon würde vielleicht jemanden schicken, um nachzusehen. Besser, wenn ich bis dahin weit, weit weg war.
Dass der junge Vampir tatsächlich aus Gordons Linie stammte, hatte mir der Geschmack seines Blutes verraten.
Es gab nur sieben große Clans in Los Angeles, und beinahe alle hatten sie verwilderte Vampire hervorgebracht, deren Blut ich getrunken hatte. Dieser hier war mit Sicherheit nicht von Gordon selbst erschaffen worden. Wohl aber von jemandem, der ihm Bluteide geleistet hatte, und das reichte mir und auch dem Rat.
Ich zog mein Smartphone aus der Tasche und wählte eine gespeicherte Nummer. Der automatische Ansagetext einer Mailbox erklang. Ich machte eine möglichst genaue Angabe, wo der tote Vampir zu finden war, und hoffte, dass Claire Steen die Nachricht noch vor Sonnenaufgang erhielt. Bis dahin war die Leiche hier gut aufgehoben.
Ich legte den Kopf in den Nacken. Ja, es gab Dachfenster, wenn auch schmutzige, doch sie würden reichen, damit sich die Leiche entzündete, falls Claire sie heute Nacht nicht mehr entsorgen konnte.
Ich brachte meine Kleidung in Ordnung und verbarg die Waffen. Immerhin würde ich mich wieder unter Menschen begeben müssen. In der Hosentasche fand ich ein Tütchen mit einem Erfrischungstuch. Ich riss die Packung auf und wischte mir das Gesicht sauber. Der Alkohol und das Zitronenaroma brannten noch in meiner Nase, als ich ins Freie trat.
Niemand zu sehen. Ich war allein – oder nicht?
Wieder beschlich mich diese seltsame Nervosität. Die kalte, frische Lebenskraft des Vampirs ran wie Wasser über meine Haut. Vielleicht war ich nach der Jagd übersensibel.
Meine Augen suchten nach Ungewöhnlichem und fanden nichts.
Nur die abgeblätterte Farbe des Zauns, eine Ratte, die im Müll wühlte, die allgegenwärtigen Kakerlaken und über allem die Mondsichel am Himmel.
Ich beschleunigte meinen Schritt und schlug den Weg zur nächsten größeren Straße ein, wohin ich mir einen Wagen bestellen würde.
Ich hatte mich gegen den Fußweg entschieden, da ich den Nachklang meines Festmahls lieber in der Sicherheit meines Zuhauses genießen wollte.
Die Straßen waren menschenleer und still, dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, verfolgt zu werden. Kurz glaubte ich, jemanden von Gordons Clan zu wittern.
Ich blieb stehen, konzentrierte mich. Der Wind trug den Geruch von altem Blut heran, doch das elektrisierende Gefühl, das die Nähe eines anderen Unsterblichen üblicherweise mit sich brachte, blieb aus. Ich musste mich also geirrt haben.
Vielleicht haftete noch etwas Blut des Verurteilten an meiner Kleidung. Ich sah an mir hinab, fand aber nichts und ging weiter. Meine Schritte hallten schwer über das Pflaster, das üppige Mahl machte mich träge. Ich sah mich immer wieder um und schimpfte mich gleich darauf paranoid.
So schnell konnte Gordon niemanden schicken.
Ich wollte Curtis Bescheid geben. Telepathie zu benutzen, hätte meine übrigen Sinne eingeschränkt, daher zog ich erneut mein Smartphone aus der Tasche. Curtis meldete sich sofort. Anscheinend hatte er meinen Anruf erwartet.
„Das Urteil ist vollstreckt“, berichtete ich, leckte mir die Mundwinkel sauber und hatte den Geschmack von Plastik und Zitrusaroma auf der Zunge. Großartig! Ich spuckte aus, doch die Chemie des Erfrischungstuchs hatte den guten Nachgeschmack gründlich verdorben.
„Hat er Probleme bereitet?“, fragte Curtis.
„Nein. Aber ich konnte nicht verhindern, dass er noch einmal jagt.“
„Und das Opfer?“
„Wird niemand als solches erkennen. Der Vampir stammte aus Gordons Brut, wie du vermutet hast. Er war nicht älter als ein paar Wochen, vielleicht auch nur Tage.“
„Gut gemacht, mein Junge.“
„Wir sehen uns.“
Ich beendete das Telefonat. In der Ferne rauschte der Verkehr. Der Olympic Boulevard war nicht mehr weit. Ich blieb stehen und sah in ein Schaufenster. Die Scheibe reflektierte mein Spiegelbild. Von den Kratzern im Gesicht war nichts mehr zu sehen.
Ich grinste zufrieden wie eine satte Katze, die unerlaubt von der Sahne genascht hat, und setzte meinen Weg fort.
Mit trägen Schritten erreichte ich schließlich den Boulevard und blieb am Straßenrand zwischen einigen Zeitungsboxen stehen, um auf den Wagen zu warten, den ich mit dem Fahrdienst Uber bestellt hatte, der im Gegensatz zu Taxen in L.A. noch bezahlbar war. Schließlich hielt ein gut gelaunter Inder an und ich stieg ein.
Während ich mich anschnallte, kehrte das deutliche Gefühl zurück, verfolgt zu werden. Leise Panik machte sich breit. Ich drehte mich im Sitz und starrte aus dem Fenster in die Nacht. Und da sah ich ihn: Frederik!
Wie konnte das sein?
Ich hatte mit eigenen Augen seine Leiche gesehen, war bei seiner Beerdigung gewesen. Der Inder trat aufs Gas und katapultierte den Wagen in einem waghalsigen Manöver zurück in den Verkehr, was in einem lauten Hupkonzert resultierte. Doch ich blickte weiter fassungslos durch das Rückfenster.
Da stand er noch immer. Frederik. Eine lebende Leiche!
Mir schlug das Herz bis zum Hals. Hatte er beobachtet, wie ich das Urteil vollstreckte? Und wenn er unsterblich war, warum konnte ich ihn dann nicht spüren?
Von ihm war vorhin also der Geruch nach altem Vampirblut gekommen! Gordons Blut klebte an ihm. Und es war nicht das irgendeines Vasallen, es stammte von dem Meister selbst.
Durch die Dunkelheit bemühte ich mich, mehr zu erkennen. Frederik trug einen schwarzen Anzug, womöglich den, in dem er beerdigt worden war. Sein Gesicht war ohne Mimik und erschien im Licht der Laternen beinahe grünlich. Das war eindeutig ein Toter und kein Vampir.
Das Taxi nahm Fahrt auf, und bald konnte ich Frederik nicht mehr sehen. Was hatte Gordon jetzt wieder ausgeheckt? Was bezweckte der Meister aus Downtown damit? Und vor allem, wie hatte er das bewerkstelligt?
Während ich grübelte, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, plauderte der Fahrer fröhlich vor sich hin. Die Sprache war weder Englisch noch Hindi, sondern eine obskure Mischung aus beidem.
Es kümmerte ihn nicht, dass ich nicht zuhörte.
Bis wir Gower Street, Ecke Sunset erreichten, ließ ich mich von dem blinkenden rosa Ganesha auf dem Armaturenbrett hypnotisieren.
Dort stieg ich aus, wünschte noch eine schöne Nacht und wartete, bis der Wagen hinter der nächsten Straßenecke verschwunden war.
Erst nachdem ich mich versichert hatte, dass mich wirklich niemand beobachtete, kramte ich den Schlüssel für das Tor heraus und schloss auf.
Sobald ich den Friedhof betrat, meldeten die Pfaue lautstark meine Ankunft. Die bunten Vögel, die tagsüber über die Gräber stolzierten, verbrachten die Nächte in einem Holzverschlag.
Ich hatte sie niemals frei umherlaufen gesehen.
Während ich meine Schritte über die breiten Straßen des Friedhofs lenkte, beschloss ich, Curtis anzurufen und von dem untoten Vampirjäger zu berichten. Ich schlurfte durch das dicke Gras, ging an meinem Mausoleum vorbei und setzte mich schließlich auf meinen Lieblingsplatz: die Steinbank unter dem alten Wacholder.
Curtis meldete sich nicht. Beim zweiten Versuch war der Empfang gestört. Wahrscheinlich hatte er sich wieder in seine Gemächer zurückgezogen, tief unter der Erde, unerreichbar für Feinde und Smartphones.
Ich war mir selber nicht darüber im Klaren, was ich von der Sache halten sollte. Vielleicht versuchte ich deshalb nicht, telepathisch Kontakt aufzunehmen.
Ich starrte auf den Teich mit seinen riesigen Kois, die als schlafende Schatten unter der Wasseroberfläche trieben. Genau hier hatte ich auch mit Amber gesessen.
Wir hatten geredet und uns an den Händen gehalten.
Amber hätte mein Tor in die normale Welt sein können, doch das war vorbei. Ich hatte meine Chance zerstört.
Meine Welt war nicht die ihre, und sie hatte sich Amber gleich von der schlimmsten Seite gezeigt. Von ihrer tödlichen.
Gerade deshalb war es vielleicht besser, wenn sie sich von mir fernhielt. Meine Welt war gefährlich, und ich war es ebenfalls.
Ich war ein Jäger und würde es immer sein, so viel war mir heute Abend wieder einmal klar geworden. Ein Henker im Namen des Rates. Ein Mörder, der nur deshalb ungeschoren davonkam, weil auch der Vampirrat jemanden brauchte, der für ihn die Drecksarbeit erledigte.
Und jetzt war ich bei meinem blutigen Handwerk beobachtet worden. Einen Menschen hätte ich gespürt, einen Vampir ebenfalls, doch Frederik nicht.
Warum nicht? Was war er, wenn kein Vampir?
Ich grübelte und wurde doch nicht schlauer aus meinen Überlegungen. Stunden flossen dahin, und erst, als sich der Hollywood-Schriftzug auf den Hügeln rosa färbte, verkroch ich mich in meiner Zuflucht.
Am nächsten Abend tat ich, was ich vielleicht besser gelassen hätte. Ich fuhr nach Silverlake, zu Amber. Mit klopfendem Herzen stand ich kurz nach Sonnenuntergang vor dem kleinen Bungalow, in dem sie mit ihrer Mutter wohnte.
Nach unentschlossenen Minuten öffnete ich das Gartentörchen, ging die zwei Stufen zur Veranda hinauf und klingelte. Der Ton summte durchs Haus.
Ich hörte Schritte eine Treppe hinunterkommen, doch es waren nicht Ambers.
Als die Tür geöffnet wurde, stand ich ihrer Mutter gegenüber.
„Ja?“, fragte sie, weder unfreundlich noch abweisend.
„Ist Amber da?“
Sie trug einen viel zu warmen Pulli und einen Rock, beides in Schwarz. Ihre Gesichtszüge ähnelten Ambers, doch ihr Haar war braun und von grauen Strähnen durchzogen.
„Sie sind doch der junge Mann, der auf der Beerdigung war, nicht? Ein Freund von meinem Frederik.“ Freude und Bitterkeit mischten sich in ihre Stimme. „Amber ist noch bei der Arbeit, aber sie kommt sicher bald nach Hause. Möchten Sie so lange warten?“
„Gerne. Darf ich eintreten?“ Ich musste fragen, denn unsereins kann das Haus eines Sterblichen nicht ohne Einladung betreten.
„Natürlich, kommen Sie doch bitte herein.“
Ich ging an ihr vorbei ins Haus. Hier also wohnte Amber.
Der Bungalow war lange nicht mehr renoviert worden. Auf dem Boden wellte sich billiges Linoleum. Auf den Fensterbänken bleichten Nippes und Plastikblumen um die Wette.
Direkt gegenüber dem Eingang befand sich ein Durchgang ins Wohnzimmer, durch den man eine weitere Tür erkennen konnte, die in den Garten führte. Der verschwommene Blick durch das Fliegengitter machte Hoffnung auf etwas Grün. Mrs Connan folgte meinem Blick. „Möchten Sie sich vielleicht in den Garten setzen? Ich bringe Ihnen eine Limonade.“
„Gerne.“ Ich lächelte. Nur zu gerne. Hier drinnen roch alles nach Amber und brachte mich völlig durcheinander. Sie war überall. An der Garderobe hing ihre Jacke, ihr Gesicht sah mich aus unzähligen Bilderrahmen an. Ich blickte auf ein Foto von Frederik und ihr. Ja, jetzt war ich mir sicher. Ihn hatte ich am Olympic Boulevard gesehen.
„Gehen Sie ruhig schon vor.“
Ich durchquerte das enge Wohnzimmer, in dem eine etwas schäbige braune Sofagarnitur stand, und trat hinaus in ein kleines Paradies.
Lilien dufteten in die hereinbrechende Nacht. Ich streifte meine Schuhe ab, nahm sie in die Hand und vergrub meine Zehen im dichten Grasteppich.
Meine Schritte führten mich zu einer kleinen Terrasse, über die ein Orangenbaum seine schweren Arme reckte. Blüten schimmerten in einem grünen Himmel, Äste bogen sich unter den Früchten.
Ich setzte mich in einen der ehemals weißen Metallstühle, legte den Kopf in den Nacken und schloss für einen Moment die Augen.
Jetzt wusste ich, woher Amber ihren Orangenduft hatte.
Winzige Kolibris flitzten im letzten Licht von Blüte zu Blüte.
Viel zu schnell ging die Tür auf und zerstörte das Idyll.
Mrs Connan brachte mir das versprochene Glas Limonade. Ihre Schritte waren schwer. In ihren geröteten Augen glitzerten Tränen.
Ich nahm ihr das beschlagene Glas ab, drehte es in der Hand und genoss seine Kühle.
Sie sah mich erwartungsvoll an. „Möchten Sie nicht probieren? Amber macht die Limonade selber.“
Ich seufzte schicksalsergeben. Anscheinend blieb mir keine Wahl. Vorsichtig trank ich einen kleinen Schluck.
Die Magenschmerzen kamen prompt, und ich musste mich anstrengen, trotzdem zu lächeln. „Sehr gut, danke“, brachte ich heraus.
„Schön. Ich lasse Sie dann wieder allein.“
Ich wartete, und mit jeder Minute wuchs meine Nervosität.
Was um alles in der Welt tat ich hier? Vielleicht war es am besten, wenn ich gleich heute Abend entschied, was mit Amber geschehen sollte. Vielleicht ließ sich ja doch ein Weg finden, der nicht in ihren Tod führte, und ich konnte Curtis überzeugen, nur ihre Erinnerung zu löschen, auch wenn das bedeutete, dass ich in den nächsten Jahrzehnten keinen Menschen an mich binden konnte. Die Vorstellung, einen Diener zu haben, erschien mir nun, nachdem ich durch Amber das Leben endlich wieder deutlich hatte spüren können, auf einmal gar nicht mehr so abstoßend wie noch vor wenigen Wochen.
Doch Curtis würde auf ihr Ende drängen.
Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen, als plötzlich das charakteristische Dröhnen des alten Fords ertönte. Der Wagen quälte sich die steile Straße hinauf, dann erstarb der Motor.
Ambers Schritte erklangen auf dem Weg zum Hauseingang, das Törchen quietschte, und dann schloss sie auch schon auf. Ihre Mutter fing sie ab. Augenblicke später stand Amber in der Tür zum Garten.
Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Das Siegel flammte in meiner Brust auf. Ich stellte mein Glas ab und erhob mich, unfähig, etwas zu sagen.
Amber kam auf mich zu. Ihre Schritte waren steif. „Verdammt noch mal, was machst du hier?“, presste sie hervor. Ihre Augen funkelten wütend.
„Es tut mir leid, aber ich muss dringend mit dir sprechen.“
„Wehe, wenn es nicht wirklich wichtig ist.“
Amber ging zu einem Stuhl und setzte sich. Ich tat es ihr nach.
„Versprich mir, dass dies dein letzter Besuch ist. Versprich es mir! Du lässt Mutter und mich in Frieden, ist das klar?“
„Ich verspreche es.“ So viel also zu der Idee, sie doch noch an unsere Welt zu binden und nicht töten zu müssen. Der Gedanke riss mir beinahe das Herz aus der Brust, und ich befürchtete, Amber würde ihn mir aus den Augen ablesen können. Also starrte ich auf meine nackten Zehen und grub sie ins Gras.
„Was also ist so wichtig?“
„Ich habe Frederik gesehen.“
„Was? Das ist nicht dein Ernst.“ Sie starrte mich an. „Mein Bruder ist tot! Erzählst du das, um mir wehzutun? Julius, was stimmt bloß nicht mit dir?“ Sie sprang auf, lief hin und her. „Ich möchte, dass du gehst. Sofort!“
„Aber es ist die Wahrheit! Er war da, Amber, er hat mich beobachtet!“
„Mein Bruder ist tot, tot und begraben!“
„Das bin ich auch, Amber!“
„Er ist mein Bruder, Herrgott, ich habe seine Leiche identifiziert, ich war auf seiner Beerdigung! Du doch auch!“
Ich stand auf, wollte sie beruhigen. Meine Hände flatterten sinnlos in der Luft. „Ich verstehe es doch selber nicht“, entgegnete ich ratlos.
Amber blieb abrupt stehen und sah mir zum ersten Mal in die Augen. „Ist er jetzt wie du, Julius? Ist er ein Vampir geworden?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Nein? Was dann?“ Ihre Stimme wurde unangenehm hoch und schrill.
„Leise, denk an deine Mutter“, warnte ich.
„Sag du mir nicht, was ich tun soll!“
„Okay, okay. Ich weiß nur, was Frederik nicht ist. Er ist kein Vampir, er ist kein Mensch und auch kein Geist. Er stinkt nach Gordons Blut, und er geht nachts umher. So etwas wie ihn habe ich noch nie gesehen.“
„Wer hat ihm das angetan?“, fragte sie erschüttert. „Dieser Gordon?“
„Ja. Ich verstehe nur nicht, warum und wie. Aber wir finden es heraus.“ Ich legte meine Hände auf ihre Schultern, und sie ließ mich gewähren. „Wenn er hier auftauchen sollte …“
„Oh Gott!“
„Amber, hör mir zu! Wenn er hier auftaucht und du Hilfe brauchst, komme ich. Du kannst mich rufen. Das Siegel verbindet uns. Ich höre dich, wenn du es nur willst.“
Sie biss sich auf die Lippen und nickte, berührte flüchtig meine Hand.
„Danke, Julius. Ich weiß deine Sorge zu schätzen.“
In meiner Brust rebellierte das Siegel. Es schien sie zu spüren und wollte geöffnet werden. Ich sog Ambers Geruch ein und versuchte, sie an mich zu ziehen, doch sie stieß mich fort. „Geh jetzt, bitte.“
Ich wollte mich abwenden, als sie doch noch nach meiner Hand fasste. Wie ein feiner elektrischer Strom floss die Energie zwischen uns hin und her.
„Du darfst Frederik nicht wehtun, Julius. Egal, was passiert. Versprich es mir!“
„Versprochen“, sagte ich schnell.
Amber wies mir den Weg an der Garage vorbei zur Vorderseite des Hauses. Als wir zwischen einigen hohen Büschen hindurchgingen, blieb ich stehen und hielt sie am Arm fest. Sie drehte sich zu mir um. Ihr Gesichtsausdruck wurde weich.
„Verzeihst du mir?“
„Vielleicht irgendwann. Ich weiß es nicht.“ Amber holte Luft und sah zu mir auf. „Weißt du, es liegt weniger an dem, was du bist und tust. Was ich dir vor allem übelnehme, ist deine Unaufrichtigkeit.“
Wäre ich ehrlich zu ihr gewesen, dann wäre vielleicht wirklich alles besser verlaufen. Aber dafür war es jetzt zu spät.
„Du hättest mir nicht geglaubt“, sagte ich leise.
Sie schwieg und sah zu Boden. „Kann sein.“
Ihre Gefühle für mich waren noch da, irgendwo vergraben unter den Erlebnissen im Lafayette, und womöglich zerrte das Siegel an ihr ebenso wie an mir. Vorsichtig strich ich ihr mit einem Finger über die Wange. Ihre Lippen bebten, während ihr Körper in Reglosigkeit verharrte. Ich konzentrierte mich auf das Siegel. Da war sie, die kleine Verbindung zu ihr. Vorsichtig schickte ich ihr wohlige Lebensenergie, ein kleiner Trost für all das, was schiefgelaufen war.
Amber schmiegte einen Augenblick lang ihre Wange in meine Hand, dann ging sie auf Abstand. „Bitte geh jetzt, Julius.“
Sie sah mir nach, ich konnte ihren Blick fühlen. Doch als ich mich nach ihr umdrehte und zögernd die Hand hob, hatte sie sich bereits umgedreht und ging zurück in den Garten.
Kurz überlegte ich, welcher Bus mich am schnellsten zur Zuflucht bringen würde, doch dann entschied ich mich spontan für eine andere Lösung. Ich hatte keine Lust, den Abend wieder alleine zu verbringen. Ambers Nähe hatte mir ein wenig Lebendigkeit zurückgebracht, meine Stimmung hatte sich gehoben. Wer hätte mir in diesem Moment eine angenehmere Gesellschaft sein können als Steven? Er war erst so kurz tot, dass er mir oft eher wie ein Mensch als wie ein Vampir vorkam. Außerdem hatte ich meinem kleinen Bruder ein Versprechen gegeben, und es war Zeit, es einzulösen.
Davon verriet ich ihm aber noch nichts, als ich ihm am Telefon nüchtern befahl, mich schnellstmöglich abzuholen.
Ich ging ihm entgegen und hielt dabei das Siegel zu Amber ein klein wenig offen. Ein steter Austausch wehte mir etwas von ihrer menschlichen Energie in die Brust und ließ meine Laune stetig steigen. Es dauerte nur eine Viertelstunde, bis Stevens Wagen mit quietschenden Reifen auf dem Sunset wendete und neben mir zum Stehen kam.
Er versuchte erst gar nicht, seine schlechte Laune zu verbergen. „Guten Abend, Sir, wohin darf ich Sie bringen?“
Ich stieg ein und wuschelte ihm durch seinen blonden Lockenkopf.
„Du bist ein Idiot, Julius!“, schimpfte er und fuhr sich mit den Fingern ordnend durchs Haar. Auf seine Frisur legte er immer sehr viel Wert.
„Bring mich ins Lafayette, ja?“
„Ich hab noch nicht gejagt!“, antwortete er beleidigt. „Können wir nicht vorher noch irgendwo anhalten?“
„Nein. Fahr erst mal. Ich überlege mir etwas.“ Ich genoss es, ihn etwas zappeln zu lassen.
Steven nickte niedergeschlagen und trat das Gaspedal durch.
Wir rasten durch die Nacht. Musik dröhnte aus den offenen Fenstern. Steven hatte die teure Anlage voll aufgedreht, und die Red Hot Chili Peppers sangen der Stadt ihre Hymnen.
Stevens Hände umklammerten das Lenkrad, er wippte unruhig mit dem Bein. Der Hunger des jungen Vampirs war fast greifbar. Immer wieder sah er mich an und wartete darauf, dass ich doch noch einlenkte. Aber ich hatte etwas Besseres für ihn vorgesehen.
„Wir fahren noch an den Strand“, befahl ich schließlich, als wir nur noch wenige Minuten vom Lafayette entfernt waren.
Jetzt endlich begann Steven etwas zu ahnen. „Du meinst, ich darf …?“
„Das habe ich nicht gesagt, oder?“, antwortete ich grinsend, hob eine Braue und rieb mir wie zufällig über das Handgelenk.
Steven riss augenblicklich das Lenkrad herum und bog mit quietschenden Reifen ab.
Schweigend liefen wir zu dem Strand hinunter, an dem ich noch vor wenigen Tagen Wasserleiche gespielt hatte. Steven folgte mir quer über den Ocean Front Walk bis zum Wasser. Unruhig sah er zu, wie ich meine Schuhe auszog, sie an den Schnürsenkeln zusammenband und mir über die Schultern hängte.
Der Pier lag in Sichtweite.
Einige Sprayer werkelten auch um diese Uhrzeit noch an ihren Bildern. Sie hatten Strahler aufgestellt und hörten ihre seltsame, wütende Musik, die aus einem Auto auf dem nahen Parkplatz schallte.
Alte Plastiktüten raschelten im Wind. Hier und da tupften faulende Orangen den Sand mit Farbe.
„Hier?“
„Nein, Steven, wir gehen noch ein bisschen.“
Er verschränkte seine Arme vor dem schmerzenden Magen und taumelte neben mir her.
„Du musst lernen, deinen Hunger zu kontrollieren“, sagte ich schulmeisterlich.
„Du bist ein Sadist, Julius.“
„Ich weiß.“
Nachdem wir die halbe Strecke nach Venice zurückgelegt hatten, setzten wir uns in den klammen Sand.
Ich sah auf das Meer hinaus, das sich als schwarze Unendlichkeit vor uns ausbreitete.
Es war Neumond. Die dünne Sichel, die am Himmel stand, besaß kaum genügend Kraft, um den sommerlichen Smog zu durchdringen.
„Bitte, Julius!“ Der Hunger schien Steven inzwischen körperliche Schmerzen zu bereiten.
Ich wartete noch ein paar Herzschläge lang, dann reckte ich ihm gönnerhaft den Arm hin und drehte die Pulsadern nach oben. „Aber sei vorsichtig.“
Steven ließ sich kein zweites Mal bitten.
Nach einem letzten schnellen Blick, ob auch wirklich keine unliebsamen Beobachter in der Nähe waren, schlug er seine Zähne in meinen Arm.
„Au, verdammt!“ Mir war das Grinsen mit einem Mal vergangen.
Steven war zu schwach, um mir den Schmerz zu nehmen, sein Geschick reichte gerade eben für seine menschlichen Opfer.
Ich ließ ihn eine Weile trinken, und ein Teil seines Glücksgefühls übertrug sich auf mich, doch nicht genug, um die Gabe zu einer auch nur halbwegs angenehmen Prozedur zu machen.
Dann spürte ich plötzlich, wie er mich schwächte.
„Es reicht“, sagte ich möglichst ruhig, doch er hörte mich nicht. „Steven, hör auf!“
Ich griff ihm ins Haar und zerrte ihn von meinem Arm los. Blut schoss aus seinem offenen Mund in den Sand. Seine Augen glühten.
„Das war ein ordentlicher Sprung auf der Karriereleiter“, sagte ich nüchtern und presste die Hand auf meinen brennenden Arm.
„Was?“ Steven war noch ganz in seinem Rausch gefangen.
Seit seiner Geburt in die Nacht hatte er nie wieder von einem anderen Unsterblichen trinken dürfen. Nach einer Weile stand er auf und wusch sich den verschmierten Mund mit Meerwasser, dann ließ er sich wieder neben mich in den Sand fallen.
„Damit hast du Dava überholt.“
„Ja?“
Ich lachte, dachte an das dumme Gesicht, das Kathryn machen würde, und lachte noch mehr. Jetzt war ihr Zögling die Schwächste, und das würde in den nächsten Jahrzehnten auch so bleiben, selbst wenn sie Dava wiederholt von sich trinken ließ. Denn Steven hatte nicht nur etwas von meiner Kraft bekommen, sondern auch von dem, was Curtis mir geschenkt hatte.
„Was ist so lustig, Julius?“
Ich sprang auf und wusch mir ebenfalls das Blut ab. Dann gingen wir Arm in Arm zurück.
„Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen“, sagte Steven und hüpfte aufgeregt an meiner Seite. „Wenn du was brauchst, für dich mache ich alles“, sagte er mit erwachendem Ernst.
„Ich werde vielleicht darauf zurückkommen, mein Kleiner“, antwortete ich und brachte wieder Unordnung in sein Haar.
Nur selten hatte ich einem anderen Vampir so viel Blut gegeben und nie aus freien Stücken. Curtis hatte hin und wieder von mir genommen oder die Gabe an ein anderes Clanmitglied befohlen, wenn jemand verwundet worden war.
Steven war mit seinen Empfindungen nicht allein. Ich fühlte mich ihm näher als zuvor und konnte meine Magie spüren, die ihm aus allen Poren strömte.
Nun waren wir wirklich wie Brüder.
***
Amber
Seit Stunden lag ich in meinem Bett und versuchte einzuschlafen. Die Playlist war schon lange zu Ende. Jetzt war es still im Haus.
Wie ein fernes Rauschen drang der Verkehr auf dem Sunset Boulevard herüber. Die Straßen waren die Lebensadern der Stadt, ihr nie verstummender Herzschlag.
Durch das offene Fenster wehte kühle Nachtluft. Obwohl meine zwei Zimmer direkt unter dem Dach lagen und im Sommer unerträglich heiß wurden, schaltete ich die Klimaanlage so selten wie möglich ein. Das monotone Brummen und der seltsame Geschmack der gekühlten Luft behagten mir nicht. Jetzt blähte Wind die Vorhänge.
Je öfter ich mich ermahnte, dass ich morgen wieder früh rausmusste, desto unmöglicher wurde es, Ruhe zu finden. Meine Gedanken jagten wild durcheinander.
Julius’ Auftauchen hatte mich völlig aus der Bahn geworfen.
Ich konnte noch immer nicht glauben, was er gesagt hatte. Frederik lebte! Oder zumindest lief er durch die Gegend und stellte Julius nach. Das war so unglaublich, dass es eigentlich nur wahr sein konnte.
Oder hatte Julius sich das alles nur ausgedacht, um einen Vorwand zu haben, mich zu sehen?
Widerwillig musste ich mir eingestehen, dass es schön gewesen war, ihn wiederzutreffen. Wie er dort im Garten gestanden hatte. Richtig verloren hatte er gewirkt, barfuß im Gras unter meinem Lieblingsbaum, mit einem Glas Limonade in der Hand, von dem er offensichtlich sogar hatte trinken müssen, um vor Ma den Schein zu wahren.
Wütend schlug ich mit der Hand auf die Matratze. So viel zu meinem Plan, meine Verliebtheit im Keim zu ersticken. Hatte ja großartig funktioniert. Er brauchte nur hier aufzutauchen, und schon stand ich wieder ganz am Anfang. Sein Lächeln verfolgte mich, schön und gefährlich. Vier strahlend weiße, spitze Zähne, zwei lang, zwei fast so kurz wie normale Schneidezähne. Wenn ich daran dachte, wurde mir gleichzeitig heiß und kalt. Wieder etwas mit ihm anzufangen konnte nicht funktionieren. Und doch … Nein! War ich eigentlich wahnsinnig geworden, überhaupt darüber nachzudenken?
Ich vergab keine zweiten Chancen an Männer, grundsätzlich nicht. Wozu auch? Wer einmal betrog, tat es wieder, und wer mein Vertrauen brach, dem würde ich nie wieder glauben können. Aber ich …
Mein Blick huschte zum Nachttisch, wo mein Handy lag. Und wenn ich ihn anrief und bat, sich mit mir zu treffen? Er würde sicher kommen.
Es war schon nach zwei, aber die Nacht war Julius’ Tag.
Ich hasste mich für meine Wankelmütigkeit. So etwas kannte ich nicht von mir, und ich war mir sicher, dass es mit diesem Siegel zu tun hatte, von dem Julius gesprochen hatte. Seit ich unfreiwillig Blut mit ihm getauscht hatte, waren wir eins, hatte er gesagt.
Und das Siegel scherte sich offenbar nicht darum, ob ich ihn hasste oder liebte. Es verband uns, ob ich es nun wollte oder nicht.
***
Julius
Im Lafayette erlebte Steven eine ähnliche, wenn auch weit niederträchtigere Show als ich, nachdem ich von Curtis getrunken hatte.
Kathryn brannte vor Eifersucht. Sie wagte es nicht, mich herauszufordern, weil ich klar über ihr stand. Und so blieben ihr nur Sticheleien und Getuschel hinter meinem Rücken, beides Dinge, die mich nicht allzu sehr berührten.
Doch bei Steven sah die Sache anders aus. Als Ältere konnte sie ihm Befehle erteilen, und sie würde sich sicherlich einige unangenehme Dinge einfallen lassen, um ihn zu schikanieren.
Der Meister sagte nichts zu unserem kleinen Wettstreit. Er kannte die Zwistigkeiten, seit er Kathryn und mich vor langer Zeit geschaffen hatte.
Curtis hörte sich meine Ausführungen zu Frederiks Auftauchen an, doch auch ihm blieb die Geschichte ein Rätsel.
Wir überlegten, was Gordon damit bezwecken konnte und was er aus Ambers Bruder gemacht haben mochte. War er vielleicht doch ein Vampir, aber so schwach, dass ich seine Energie nicht wahrgenommen hatte?
Nein, auch das ergab keinen Sinn.
Ich hatte Frederik damals gesehen. Er hatte mindestens eine halbe Stunde tot auf der Straße gelegen und wurde dann in die Pathologie gebracht. Niemand, der so lange tot war, konnte als Vampir wiederauferstehen.
In meiner langen Zeit an Curtis’ Seite hatte ich bei einigen Erweckungen zugesehen oder assistiert. Wenn dem Sterblichen nicht wenige Minuten nach dem letzten Herzschlag das Blut des Schöpfers eingeflößt wurde, dann war es zu spät. Aus und vorbei, endgültig tot.
Was also war aus Frederik geworden? Mittlerweile begann ich an meiner Erinnerung zu zweifeln. Vielleicht hatte ich ihn ja auch schlichtweg verwechselt?
Schließlich verließ ich die Zuflucht, ohne Antworten gefunden zu haben. Steven brachte mich zurück nach Hollywood und bat mich, bei mir bleiben zu dürfen. Er fürchtete sich davor, Kathryn im Lafayette schutzlos ausgeliefert zu sein.
Ich wusste, dass sie einem das Leben zur Hölle machen konnte. Nicht umsonst war sie einer der Gründe, weshalb ich alleine lebte.
Der Sarkophag, den Curtis verwendet hatte, stand noch immer neben meinem, und so ließ ich zu, dass Steven die Nacht bei mir auf dem Friedhof verbrachte.
Sobald die Sonne den Horizont berührte, war es für den jungen Vampir so weit. Er hatte sich schon eine Weile zuvor hingelegt, als sei seine Ruhestätte kein Sarg, sondern ein gemütliches Bett.
Ich saß auf der steinernen Kante und unterhielt mich mit ihm.
Wie konnte er sich in diesem engen Gefängnis nur so wohlfühlen? Aber auch für mich war ein Sarg einmal der sicherste Ort der Welt gewesen. Bis ich ein halbes Jahr darin eingesperrt worden war. Seitdem bereitete mir schon der bloße Gedanke Unbehagen. Ich verdrängte die Erinnerung, die unweigerlich daran gekettet war: Maries Tod.
Steven wurde ruhig. Es begann.
Diesmal war ich derjenige, der dem anderen beim Einschlafen zusah, das eher einem Erstarren und In-sich-Zusammensinken glich.
Die Lähmung kroch Stevens Füße aufwärts, bis auch sein Mund in halboffener Stellung erfror. Er lächelte wie eine Mumie. Mir graute vor dem Anblick.
Wenn ich mir vorstellte, dass das Gleiche mit mir geschah! Dass auch meine Haut einfiel und verhärtete wie altes Wachs!
Hastig schob ich den Deckel auf Stevens Sarg. Ich konnte seinen Anblick keine Sekunde länger ertragen.
Meine Zeit war noch immer nicht gekommen. Rastlos ging ich in dem Raum auf und ab. Nichts würde mich dazu bringen, mich verfrüht in den Sarg zu legen, wirklich gar nichts.
Schließlich zog ich mich um und las noch ein wenig, bis meine Beine endlich schwer wurden. Erst dann blies ich die Kerze aus und schob den Deckel zu.
Meine Seele wurde mit aller Gewalt in den Körper zurückgerissen.
Draußen war jemand!
Draußen war jemand, und die Sonne stand am Himmel!
Draußen war jemand, und ich konnte mich nicht bewegen!
Ich war in meinem reglosen Körper gefangen. Unter größter Kraftanstrengung öffnete ich die Augen.
Alles war schwarz. Natürlich war es das, der Sargdeckel war geschlossen. Und doch hörte ich jemanden oben am Eingang meines Mausoleums. Ich war jetzt bei vollem Bewusstsein, wach, wie Menschen das wohl genannt hätten, doch ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper.
Kurz trieb mich die Enge in meinem totenstarren Leib in die Panik, dann rief ich mich zur Vernunft und tastete mit meinen Sinnen nach dem Eindringling. Meterdicke feuchte Erde trennte mich von der Oberfläche, von Mausoleen, Gräbern, Palmen und sonnenbeschienenem Rasen.
Ich musste herausfinden, was dort oben los war. Ein Obdachloser, der im Schatten meines Mausoleums den Tag verschlafen wollte, hätte mir die geringsten Sorgen bereitet.
Ich bündelte meine Magie. Menschen waren einfach zu finden. Ihre Energie leuchtete hell wie eine Korona aus Licht. Doch so sehr ich mich anstrengte, sah und spürte ich nichts Vergleichbares. Wie Feuerfunken tanzten die Energiekerne kleiner Vögel durch die Bäume, und selbst die trägen Fische warfen einen matten Schein. Aber das Wesen, das nun deutlich hörbar an meinem Türschloss zu Werke ging, fand ich nicht.
„Julius Lawhead? Bist du da unten, du verdammter Blutsauger? Julius?“ Frederik! Natürlich Frederik! Wer sonst? Seine Stimme hörte sich seltsam an.
Plötzlich erklang ein hohes Geräusch. Metall kreischte.
Frederik bohrte das Schloss auf. Oh Gott, warum kam denn niemand?
Wo waren die ganzen Spaziergänger, Touristen und Friedhofswärter, wenn man sie brauchte? Es war doch helllichter Tag!
„Hilfe!“ Mein Blick tastete durch die absolute Schwärze des Sargs, während meine innere Stimme tobte. „Hilfe, verdammt noch mal!“
Ich konnte nicht einmal meinen kleinen Finger krümmen. Wütend schrie ich in Gedanken, rief nach Curtis, nach der grässlichen Kathryn, sogar nach Dava.
In meine Hilferufe mischte sich Stevens Stimme, ängstlicher gar als meine. Erst jetzt fiel mir wieder ein, dass der Junge ja mit mir in der Gruft lag.
Eine Erschütterung. Der obere Eingang war geöffnet. Nun trennte den untoten Vampirjäger nur noch eine Tür von uns! Das würde Frederik auf jeden Fall vor dem Sonnenuntergang schaffen.
„Julius, du musst deine Dienerin rufen“, wisperte Steven. „Wenn Frederik sich noch an sein Dasein erinnern kann, dann auch an sie. Amber könnte ihn umstimmen, ihn aufhalten!“
Er hatte recht. Wir hatten zwar erst ein Siegel geteilt, doch die Bindung musste einfach reichen.
Ich rief mit aller Macht nach Amber, während ihr Bruder mit irrem Lachen den Bohrer an das zweite Schloss setzte. Es dauerte, weil ich in den Tagen zuvor viel darangesetzt hatte, die Verbindung zu verschließen. Dann endlich hörte sie mich.
„Verschwinde aus meinem Kopf, Julius!“
Ich flehte sie an zu kommen. „Frederik will mich töten. Komm schnell, halt ihn auf, bitte!“
Die Sterblichen im Lafayette waren in Aufruhr. Curtis hatte sie alarmiert und schickte mir unentwegt Bilder. Sein Diener Robert bewaffnete sich mit einer Schrotflinte. Er würde zu meiner Rettung eilen. Die anderen Menschen verwandelten das alte Kino in eine Festung.
Vielleicht war der Angriff auf meine Gruft nur der Anfang. Vielleicht würde jemand versuchen, den gesamten Clan der Leonhardt zu vernichten. Möglich war alles.
Der Bohrer schrillte unablässig.
Curtis schickte mir weitere Bilder, die mich wohl beruhigen und ablenken sollten. Ich sah Robert, der ins Auto sprang und davonraste. Doch der Weg von Santa Monica hierher war weit. Er würde es nicht rechtzeitig schaffen.
Zu spät! Der Bohrer sang in den höchsten Tönen, dann brach er durch. Frederik ließ das Werkzeug achtlos auf den Steinboden fallen. Die dicke Holztür zitterte unter seinen Tritten, dann riss sie aus den Angeln. Jetzt war er hier, hier bei uns!
Steven kreischte in seinem steinernen Gefängnis.
Frederiks Schritte knirschten über den Boden. Er klopfte auf die Deckel der Särge und lachte. „Julius, Julius, ich dachte, du wärst alleine. Dabei hast du dir ja eine kleine Freundin gemacht.“
Seine Stimme klang schrill, fast hysterisch.
Ich versuchte, Frederiks Geist zu fassen, doch es funktionierte nicht. Ich rutschte ab wie von glattem Metall.
„Vergiss es, Julius. Du kannst gerne zuschauen, aber eingreifen lasse ich dich nicht!“
Sobald Frederik das gesagt hatte, sprang ein Teil meines Bewusstseins in seinen Kopf. Für einen Augenblick hoffte ich, die Kontrolle übernehmen zu können. Aber Frederik war kein Mensch mehr. Er hatte mir nur ein kleines Fenster geöffnet, das gerade eben ausreichte, um zu sehen, was er sah.
Hilflos musste ich durch die Augen des Untoten miterleben, wie er mein kleines Reich zerstörte.
Da Frederik die Türen aufgebrochen hatte, fiel die Treppe hinab etwas Licht in die Grabkammer. Es beleuchtete eine Orgie der Zerstörung.
Der Untote zerschmetterte meinen Spiegel mit einem Kerzenleuchter, pinkelte auf meine Bücher und meine Kleidung und schien sich dabei köstlich zu amüsieren. Mein Horror wich der Hoffnung, dass er sich damit so lange aufhalten würde, bis Robert hier war und ihm eine ordentliche Ladung Schrot in den Kopf jagen konnte.
Meine beiden Truhen waren bald das Einzige, das noch stand. Frederik hatte es sogar geschafft, das Weihwasserbecken von seinem Sockel zu reißen.
„Einen schönen Gruß von Gordon“, rief er und hob den Kerzenständer über den Kopf.
Mit lautem Krachen ging die erste meiner Truhen zu Bruch. Löwenfüße, Ranken und wunderschöne Schnitzereien, alles dahin, doch der Inhalt bedeutete mir noch mehr.
Sie enthielt kostbare Erinnerungen aus zwei Jahrhunderten, Briefe, Bücher, alles, was ich in meinem langen Dasein für aufhebenswert erachtet hatte.
Zu sehen, wie Frederik meine Schätze vernichtete, tat mir in der Seele weh. „Du verdammter Irrer!“, fluchte ich.
„Warte ab, es wird noch besser!“ Frederik trat den Deckel der anderen Truhe auf und fand meine Waffen. „Oh, was haben wir denn da?“ Sein Lachen steigerte sich zu hysterischem Glucksen. Das Schwert, die Armbrust, die Messer – all meine Waffen waren jetzt in seiner Hand.
Verdammt!
Frederik hüpfte um unsere Särge herum wie der tanzende Schnitter auf spätmittelalterlichen Gemälden.
Dann blieb er vor meinem Sarg stehen und wuchtete den Marmordeckel zur Seite. Auf einmal sah ich mich selbst durch Frederiks Augen. Ein regloses blasses Wesen, das seine schlanken, fast dürren Hände über der Brust gefaltet hatte.
Meine Haare lagen als dunkler Lockenwust auf dem Kopfkissen. Angsthelle Augen waren das einzig Bewegliche in meinem toten Gesicht.
Ich spürte einen Abglanz von Frederiks diabolischer Freude, als er mich so wehrlos vor sich liegen sah. Seine Gefühle schürten meine Angst ins Unerträgliche. Er würde mich umbringen, mit dem Vorsatz war er hergekommen, und nichts und niemand konnte ihn davon abbringen.
Ich schrie. Schrie lautlos meine Angst in die Welt, und nur Vampire konnten mich hören. Vampire und Frederik, der Untote.
„Schrei nur, Julius, schrei. Es ist Musik in meinen Ohren!“
Als er sich rittlings auf mich kniete, verstummte ich schlagartig.
„Verdammte Blutsauger, Teufelsbrut! Ihr gehört von der Erde getilgt, vernichtet!“, fauchte er mir entgegen.
Jemand hatte Frederiks Seele zurück in den Körper geholt und dort eingesperrt. Dem Gestank nach zu urteilen verfiel er, aber sein Geist war noch da, und seine Einstellung zu uns hatte sich nicht geändert. Was absurd war, da er jetzt in gewisser Weise doch selbst einer von uns war. „Frederik, du bist eine Leiche, eine wandelnde Leiche!“, sagte ich und versuchte meine Angst zu überspielen. „Du hast die Seiten gewechselt, begreifst du das denn nicht?“
Er lachte und zog mich wie ein ungezogenes Kind an den Haaren. Ich hatte mich wohl getäuscht, anscheinend hatte sein Verstand die Reise doch nicht unbeschadet überstanden. Oder war er schon immer so irr gewesen?
Seit seinem Tod sah ich ihn zum ersten Mal aus der Nähe. Er trug noch den schwarzen Anzug, in dem er bestattet worden war. Seine Haut war grau und wächsern. Doch das täuschte. Es war viel Flüssigkeit in seinem toten Körper, und sie strebte nach unten.
An seinem Hals prangten schwarze Leichenflecken, auch die nackten Füße waren aufgequollen und schwarz. Er musste irgendwo seine Schuhe verloren haben.
„Was starrst du mich so an?“
„Warum hasst du mich, Frederik? Warum bringst du nicht die um, die dir das angetan haben?“, fragte ich und versuchte dabei, meine Worte beiläufig klingen zu lassen. Auf keinen Fall wollte ich ihn noch mehr reizen.
Frederiks gelbliche Finger huschten zu einem Amulett, das ich bislang nicht bemerkt hatte. Kurz zögerten sie darüber, anscheinend konnte er es nicht anfassen. Das Amulett hing genau auf Höhe seines Herzens. Fellstückchen, Haare und Knochen baumelten neben einem kleinen Beutel an einer Schnur.
Ich nahm wieder den feinen Geruch von altem Vampirblut wahr, Gordons Blut.
Das war die Magie, die Frederik am Leben hielt! Es war eine Art Voodoo-Talisman. Gordon hatte seine Hilfe von weit her kommen lassen.
„Ich kann nicht. Ich kann den Meister nicht umbringen“, zischte Frederik. „Aber dich, Jäger, dich kann ich töten, für ihn.“
„Du musst es nicht tun!“
„Was weißt du schon, was ich muss und was nicht, Lawhead? Es ist richtig, in meinem alten Leben hätte ich lieber ihn als dich vernichtet. Ein Vampir wie du, der seinesgleichen umbringt, ist ein Segen für die Menschheit. Aber jetzt entscheidet Gordon.“
„Du musst nicht tun, was er sagt, Frederik.“
„Schweig, Blutsauger!“, schrie er plötzlich und spuckte mir ins Gesicht.
Der Speichel stank erbärmlich. Ich konnte die eklige Flüssigkeit nicht abwischen. Sie lief mir die Wange hinunter.
Steven spürte, dass etwas vor sich ging, und rief nach mir, doch ich konnte ihm nicht antworten. Nicht jetzt!
Stattdessen starrte ich unseren Peiniger wütend an. Seine Augen sahen vertrocknet aus. Ich hatte nie zuvor einen Untoten gesehen, hatte sie immer für Ammenmärchen gehalten.
Frederik lachte wieder sein irres Lachen und trommelte mit den Fäusten auf meine Brust. Doch der Rigor Mortis hatte meinen Körper fest im Griff, es war hoffnungslos.
Wann ging endlich die verdammte Sonne unter?
Frederik hielt inne, dann stand er auf, packte mich und zog meinen Oberkörper ein Stück aus dem Sarg. „So, jetzt kannst du besser sehen, was mit deinem kleinen Blutsaugerliebchen passiert.“
Er nahm Anlauf und trat gegen Stevens Sarg. Der steinerne Deckel flog hinunter und zerbrach mit einem dumpfen Knacken.
„Steven!“
„Ach, es ist gar keine Freundin. Aber ich hoffe, du magst ihn. Denn du wirst mitansehen müssen, wie er stirbt!“
Stevens Stimme hatte alles Menschliche verloren, er schrie und schrie, und doch kam kein einziger Ton über seine Lippen.
Ich bewegte meine Augen langsam zur Seite, bis ich ihn sehen konnte.
Der dünne Lichtstreifen, der durch den Treppenschacht in die Gruft fiel, meißelte Stevens jungenhaftes Profil in klare Linien.
Steven war nicht einmal in der Lage, seine Augen zu öffnen, geschweige denn, sie in meine Richtung zu wenden.
Frederik huschte wie ein Dämon durch die Gruft und sammelte die Kerzen vom Boden auf, die er zuvor durch die Gegend geworfen hatte.
Dann entzündete er eine nach der anderen und platzierte sie gefährlich nah an Stevens Kopf. Die heruntergebrannten Streichhölzer ließ er auf den jungen Vampir fallen. Steven schrie lautlos, sobald die Flammen seine Haut berührten, doch zum Glück verloschen sie schnell.
„Sei tapfer, Steven, gib ihm nicht die Genugtuung“, beschwor ich ihn. Es waren kleine Schmerzen, es gab Schlimmeres. Doch es waren nicht die Verbrennungen, die ihn so panisch werden ließen, es war die Angst vor den Flammen. Vampire fürchteten nichts mehr als Feuer und Sonnenlicht, und Frederik wusste das. Verdammt, er wusste so ziemlich alles über uns!
Der Untote lachte höhnisch und versengte Stevens goldene Locken.
„Niemand hört dich schreien. Sie laufen dort oben vorbei, und niemand kann dich hören.“
Der junge Vampir verstummte, während Frederik eine Kerzenflamme über seine Finger tanzen ließ. Eine Träne rollte aus Stevens geschlossenem Auge über seine Pergamenthaut.
Sein Peiniger ließ von ihm ab und stand auf.
War ich jetzt dran? Nein. Frederik nahm eine große Armbrust aus meiner Truhe und richtete sie auf Steven. „Mal sehen, wie gut ich noch schießen kann.“
„Nein. Bitte, Frederik, hab Erbarmen!“
Natürlich hörte er nicht auf mein Flehen, es bereitete ihm nur noch größere Freude. Diese Art zu sterben war in meiner Vorstellung immer die schlimmste gewesen. Hilflos zu sein und nichts, aber auch gar nichts tun zu können. Jeder noch so aussichtslose Kampf war mir lieber.
Als Frederik seinen Griff mit der Linken verstärkte und Anstalten machte, abzudrücken, rief ich noch einmal um Hilfe. „Er tötet Steven!“
Curtis hörte mich. Der Meister tröstete Steven und versprach, dass bald Hilfe kommen würde, doch es war zu spät, viel zu spät. Frederik zielte.
„Gleich ist er hin“, lachte er höhnisch.
Klack. Die Sehne schnellte vor. Der Bolzen rammte sich in Stevens Bauch, so tief, dass nur noch die schmalen Metallfedern hinausragten.
Sein Schrei war stumm und doch unerträglich laut in meinem Kopf.
Ich krümmte meine Finger mit größter Willensanstrengung, aber ich konnte ihm nicht helfen, und schon spannte Frederik die Armbrust erneut. Zumindest gab es einen Weg, Steven sein Leiden zu ersparen.
Der Geist des jungen Vampirs taumelte in einer Wolke aus Schmerz. Ich verschaffte mir Einlass, was mir ohne die Blutgabe an ihn nicht so leicht gelungen wäre. Beruhigte ihn, schläferte ihn ein, wie ich es sonst bei meinen menschlichen Opfern tat. Er würde nichts mehr spüren, egal, was dieser Mistkerl ihm jetzt noch antat.
Klack, wieder der Bolzen, aber diesmal hatte der Zombie auf mich gezielt. Mein Bein explodierte in Schmerz.
Aus dem Augenwinkel sah ich einen Schaft aus meinem Oberschenkel ragen und fluchte. Zähflüssiges, dunkles Blut tränkte den Hosenstoff.
„Ups, daneben. Tut das weh, Julius?“
„Nein, das ist schön, Arschloch!“
Steven wachte wieder auf. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, die Schmerzen hinderten mich. Frederik ließ die Armbrust fallen, dann bückte er sich nach einem der Trümmer des Sargdeckels und ging zu Steven. Was kam jetzt? Wollte er damit auf ihn einschlagen?
„Ende Akt eins!“
Mit theatralischer Geste zog der Untote einen grob geschnitzten Holzpflock aus der Innentasche seiner Jacke und setzte ihn auf Stevens Brust. Nein! Das durfte er nicht!
Ein Zittern durchlief Stevens steifen Körper, doch der Junge blieb stumm. Todesangst tränkte den Raum.
„Bitte“, flehte ich, „er hat noch nie getötet, er ist gut, bitte!“
Frederik drehte mir den Kopf zu, ganz langsam, und grinste mich an. Ich blickte in eine Fratze aus Boshaftigkeit. Ohne hinzusehen, hob er den Stein … und schlug zu. Als der Pflock den Brustkorb durchstieß, erklang ein Geräusch wie von morschem Holz. Ich hatte es schon viel zu oft gehört. Verzweifelt schloss ich die Augen. Die glatten, hohen Mauern warfen den widerwärtigen Klang zurück.
Ein Schlag und noch einer, dann war der Pflock ganz in Stevens Brust verschwunden.
Ohnmächtige Wut tobte durch meinen Körper. Oh, wenn ich doch nur …! Aber ich konnte nicht!
Frederik lachte und ließ den Steinbrocken fallen. Er tätschelte Stevens Leiche die Wangen. „Ein kleiner Blutsauger weniger.“
Diese Bestie!
„Und gleich werden es zwei sein!“ Der Untote legte die wenigen Schritte zwischen den Särgen mit erstaunlicher Geschwindigkeit zurück und beugte sich über mich, bis sein Kopf fast mein gesamtes Gesichtsfeld ausfüllte. „Keine Angst, Julius, für dich lasse ich mir mehr Zeit, darum hat mich Meister Gordon eindringlich gebeten. Du hast genügend seiner Kinder getötet, um die volle Aufmerksamkeit verdient zu haben.“
„Sie wurden verurteilt und sind nach Recht und Gesetz gestorben.“
„Das Messer würde sagen, dass auch du das wirst.“
„Das Mittelalter ist vorbei, Frederik.“
Frederik wandte sich von mir ab und wanderte auf der Suche nach weiteren Waffen durch den Raum. „Nicht weglaufen, Julius“, spottete er.
Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst. Wenn ich nur lang genug aushielt, bekam ich vielleicht doch noch die Chance, ihn umzubringen.
Die Sonne konnte nicht ewig am Himmel stehen.
Ich spähte zu dem Lichtstreifen, der jetzt wie Honig über die Treppe floss. Die Farbe ließ mich hoffen. Die Sonne stand tief. Nicht mehr allzu lange, und mein Körper würde erwachen.
Ich kann und ich werde es schaffen!
Frederik wühlte in der Truhe, die er noch nicht zertrümmert hatte. Metall klirrte. Anscheinend suchte er meine Messer zusammen.
Ich schielte zu Steven. Seine innere Stimme war verstummt, der Körper leblos. „Es tut mir so leid.“
Der Untote kam mit den Messern zurück und legte sie auf meinem wehrlosen Körper aus.
Ich blickte auf die Klingen, die ich mir einst hatte anfertigen lassen. Stahl mit hohem Silberanteil, Griffe aus Ebenholz, geätzte florale Muster, die wie schlanke Tiere über die Klingen krochen.
„Woran hängst du mehr? An deinen Fingern oder Zehen?“ Frederik bleckte die Zähne und lachte.
Er ließ die Klinge vor meinen Augen tanzen und zog sie über meine Wangen, ohne mich zu schneiden. Dann zerrte er meinen steifen Arm aus seiner alten Position. Er stand hoch, als gehöre er nicht zu mir, die Finger zu Klauen gekrümmt.
Frederik streifte jeden Finger mit der Klinge. Erstes Blut und scharfer Schmerz.
Ich versuchte, ruhig zu bleiben, ihm nicht die Genugtuung zu geben, sich an meiner Angst zu weiden. Verzweifelt beschwor ich die weiße Leere hinauf, die ich meinen Opfern beim Trinken bescherte. Ich verdrängte meine Gedanken und schloss die Augen.
Frederik berührte alle Finger nacheinander mit der Klinge und schnitt jedes Mal tiefer. Es ging nicht! Ich konnte mich nicht selbst betäuben.
„Curtis!“, schrie ich, als der Stahl erneut in meine Haut biss. Mein Schöpfer war weit weg, doch er hörte mich. Wie ein kühler Wind floss seine Energie in den Raum und durch meinen Körper.
Frederik hielt inne. „Was war das?“
„Mein Meister“, flüsterte ich und ergab mich Curtis’ Macht, die mich wie in Watte bettete. Plötzlich wusste ich, dass mein Schöpfer weinte.
Er lag weit weg in seinem Sarg unter dem Lafayette und vergoss um meinetwillen Tränen.
Tiefer und tiefer sank ich in die warme Dunkelheit seiner Magie, und meine Panik wich stumpfer Gleichgültigkeit. Ich schwamm schwerelos in einem See aus Taubheit.
Als Frederik mir schließlich den kleinen Finger abhackte, spürte ich nichts. Ich war zu weit weg von meinem Körper.
Ein tiefes Brummen erklang und wurde langsam lauter. Was war das?
Ich blinzelte und versuchte mich zu konzentrieren, doch die Zauberkraft meines Schöpfers hatte mich Meilen und Welten weit fortgerissen.
Curtis übertrieb. Das war ein sicheres Zeichen dafür, dass er an meiner Rettung zweifelte. Er sandte mir seine Erinnerung an goldenen Sonnenschein, eine Sonne, die vor fast sechshundert Jahren zum letzten Mal für ihn aufgegangen war. Licht und Wärme streichelten meine Haut, und ich hatte das Gefühl, dass selbst meine dunkle Gruft ein wenig heller wurde.
Das Brummen wurde lauter und riss mich mit einem Schlag aus der Illusion. Der alte Ford! Ich war gerettet!
„Amber!“
„Amber?“, fragte Frederik ungläubig. „Meine Schwester? Was hast du mit ihr zu schaffen?“
Er ließ die Messer fallen, sprang auf, durchwühlte hektisch meine Kisten und wog prüfend Holzstücke in der Hand, die aus meinen Möbeln gebrochen waren. Ich wusste genau, wonach er suchte: einem Pflock.
Er wollte es unbedingt zu Ende bringen, bevor seine Schwester ihn aufhalten konnte.
Draußen erstarb der Motor und eine Autotür schlug zu.
„Amber, Vorsicht, er ist hier unten, und er ist bewaffnet!“
„Julius!“ Sie rief meinen Namen, leise und von Ferne, aber sie war da!
Frederik zerrte an dem Pflock in Stevens Brust, doch der saß fest. Dann bekam er einen der Armbrustbolzen zu fassen, aber seine Hände zitterten, und der Bolzen glitt ihm aus der Hand. Hatte er Angst, dass Amber ihn so sah? Steckte etwa doch noch ein Rest von Gefühl in ihm?
„Julius, bist du hier drin?“
Ambers eilige Schritte erklangen auf den Stufen.
Frederik duckte sich sprungbereit hinter die eingeschlagene Tür.
Dann war sie da, meine Retterin.
„Er ist hinter dir!“, schrie ich, doch da war es schon zu spät.