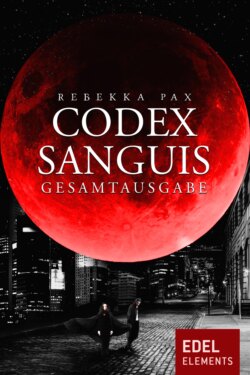Читать книгу Codex Sanguis – Gesamtausgabe - Rebekka Pax - Страница 11
KAPITEL 3
ОглавлениеAmber
Julius’ Warnung schrillte durch meine Gedanken. Ich schnellte herum. Und da war er. Mein Bruder, wie er auf der Bahre in der Leichenhalle gelegen hatte. Nur dass er auf seinen eigenen Beinen stand und noch toter aussah als zuvor. Für eine Sekunde sah er mir in die Augen, sein Kiefer klappte auf und zu. Er stöhnte gequält, dann ließ er ein Holzstück fallen, das er bis dahin in der Hand gehalten hatte, und rannte los, die Treppen hinauf ins Freie.
Ich verharrte einen Augenblick wie erstarrt. Es wollte einfach nicht in meinen Kopf. Das war wirklich Frederik!
Schon verhallten seine Schritte. „Frederik? Freddy, warte!“
„Amber, nicht! Das ist zu gefährlich.“
Ich ignorierte Julius’ Worte. An den Trümmern der Tür vorbei hetzte ich die Treppe hinauf. In dem engen Gang roch es nach Fäulnis und Frederiks Lieblingsrasierwasser, mit dem er offenbar versuchte, den Verwesungsgeruch zu übertünchen.
Draußen angekommen, sah ich ihn zwischen den Grabsteinen davonlaufen. Es hatte aufgehört zu regnen, und hier und da waren wieder kleine Trauben von Menschen unterwegs, die Fotos von den Promigräbern machen wollten.
Frederik rannte langsam zwischen ihnen hindurch, als überforderten ihn schnelle Bewegungen.
Neben der Friedhofsmauer, durch einige Hanfpalmen vor neugierigen Blicken geschützt, konnte ich ihn schließlich stellen. Ohne darüber nachzudenken, hielt ich ihn am Ärmel fest.
Er fuhr herum. „Was?“
„Frederik“, keuchte ich und wich noch im gleichen Moment entsetzt zurück. Er stank erbärmlich. Sein Zahnfleisch war schwarz. Ich musste mich überwinden, ihn überhaupt anzusehen. „Was ist mit dir … Warum bist du nicht zu mir gekommen, als du … nachdem du …“
„Nicht gestorben bist?“
„Ja, genau.“
Er spuckte mir vor die Füße. „Das fragst du? Ausgerechnet du? Schämen solltest du dich, Amber Connan.“
„Was? Ich?“
„Vampirhure!“
„Ich bin nicht …“, faselte ich und dachte an den Kuss mit Julius. Hatte Frederik uns etwa die ganze Zeit beobachtet?
Plötzlich packte er mich an den Schultern. Seine Finger fühlten sich an wie stählerne Klauen. „Wo ist das Messer, Amber?“
Ich schluckte. „Das ist weg.“
„Hab ich es doch geahnt. Und ich war so dumm zu glauben, dass du das Zeug zur Kriegerin hast. Verräterin. Stattdessen lieferst du unseren Feinden die einzige Waffe, die sie wirklich fürchten. Wo ist sie?“
Ich versuchte, mich aus seinem Griff zu winden, doch Frederik packte mich nur noch fester. In seinen milchigen Augen loderte Hass. Dass wir Geschwister waren, bedeutete ihm nichts mehr. Ich biss die Zähne aufeinander. Von mir würde er nicht erfahren, wo das Messer war.
Das schien ihm auch klar zu werden. Er ließ mich los. Ich wollte gerade erleichtert aufatmen, als er zum Schlag ausholte.
***
Julius
Es war schon eine Weile vergangen, seit Ambers Schritte auf dem Gras zuerst leiser geworden und dann ganz verstummt waren. Nun hörte ich nichts mehr außer den Abendgesängen der Vögel und dem flüsternden Plätschern eines Brunnens.
Allein mit der Leiche meines jungen Freundes. Hoffentlich tat Frederik Amber nichts an.
Schließlich bahnten sich erneut Schritte den Weg in mein zerstörtes unterirdisches Reich.
„Er ist fort, ich habe ihn verloren“, sagte Amber leise. Ihr Atem ging schnell. Die Situation schien sie völlig zu überfordern.
„Das war wirklich Frederik. Aber das kann nicht … das darf nicht …“
Sie rang nach Luft, drehte sich hilflos im Kreis und musterte dabei das Chaos um uns herum. Dabei fuhr sie sich immer wieder durchs Haar. Ihre rechte Wange war feuerrot. Hatte ihr Bruder sie geschlagen?
„Ich bin so froh, dass du hier bist.“
„Das kann nicht sein“, wiederholte sie. „Hat er das alles getan?“
„Ja. Er macht da weiter, wo er vor seinem Tod aufgehört hat. Er ist hier eingebrochen und hat Steven ermordet.“
„Was?“ Ihre Stimme überschlug sich. „Ich kann das alles nicht glauben.“
Sie ballte die Fäuste.
Ich konnte förmlich zusehen, wie sie die Panik niederkämpfte.
Schließlich trat sie mit zähen Schritten an meinen Sarg. Sie scheute meinen Anblick, so wie sie es auch vermied, sich genauer in meinem unterirdischen Zuhause umzuschauen, das sie mit spürbarem Entsetzen erfüllte.
Jetzt, da Curtis mich nicht mehr schützte, kehrten die Schmerzen in meiner Hand zurück. Sie brannte und fühlte sich nass an. Etwas fehlte, doch ich konnte mich immer noch nicht regen, um herauszufinden, was. „Bitte lass mich sehen, was er getan hat, Amber.“
„Wie meinst du das?“
„Ich möchte durch deine Augen schauen. Bitte!“
Vorsichtig verschaffte ich mir Zugang zu ihrem Geist. Der Boden, die Kissen im Sarg und meine Kleidung waren blutgetränkt. Meine Hand war zerschnitten, der kleine Finger fehlte, war einfach nicht mehr da. Aus meinem Oberschenkel stak der Pfeil. Und Steven – Steven war tot.
Erst jetzt schien Amber das volle Ausmaß der Verwüstung um sich herum bewusst zu werden, und ich fühlte, wie sich Entsetzen und Bestürzung in ihr breitmachten. Eilends verließ ich ihre Gedanken.
„Oh Gott, Julius, was hat Frederik dir nur angetan?“, fragte sie mit bebender Stimme. Sie sank neben meinem Sarg auf die Knie und legte ihre warme, lebendige Hand auf meine Stirn. Das tat so unendlich gut.
Plötzlich ging eine Veränderung mit ihr vor. Sie atmete tief durch, straffte die Schultern, und ihre Angst war wie weggeblasen. „Also, was kann ich tun?“
„Bleib einfach bei mir“, bat ich. „Bald wird Hilfe kommen. Sie sind schon unterwegs.“
Ambers Blick wanderte zu Steven, und ihre streichelnde Hand auf meiner Stirn erstarrte mitten in der Bewegung.
„Ist er wirklich tot?“
„Ja.“ Ich konnte es selbst kaum fassen. Mir schwindelte. Der Schmerz kreiste in einem roten Strudel um mein Bein, meine Hand. Die Energie floss ungebremst aus mir heraus.
„Kannst du doch etwas für mich tun?“
„Was soll ich machen?“
„Ich glaube, Frederik hat die Arterie in meinem Bein erwischt. Ich verliere zu viel Blut.“
Amber stand auf, zerriss eines der herumliegenden Hemden, das ihr Bruder nicht beschmutzt hatte, und kam zurück. Vorsichtig band sie mir das Bein ab, dann bandagierte sie meine Hand. „Er hat …“
„Ja …“ Ja, hatte er. Ich wagte nicht, den Satz zu Ende zu sprechen. Die letzten beiden Glieder meines kleinen Fingers waren fort.
„Ich kann nicht glauben, dass Frederik so etwas tut. Das ist nicht er, Julius. Ich kenne ihn schon mein ganzes Leben. Er ist immer so lieb gewesen, er hat auf mich aufgepasst, er konnte keiner Fliege etwas zuleide tun.“
„Vielleicht hat ihn das Messer so werden lassen.“
„Ganz bestimmt sogar. Anders … anders geht es nicht.“
Und dann warteten wir schweigend auf den Sonnenuntergang, der mir mein Leben zurückgeben würde.
Der Lichtstreifen auf der Treppe wurde immer blasser und ließ die Kerzen, die Frederik angezündet hatte, heller flackern.
Ich merkte, dass Amber mich musterte.
Vorsichtig legte sie eine Hand auf meine Schulter. Ihre Finger ertasteten meine verhärteten Muskeln, und eine Träne rollte ihre Wange hinab. „Wie lange bist du so?“
„Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Normalerweise verlässt meine Seele den Körper, sobald die Sonne aufgeht. Nur, wenn Gefahr droht oder ich aus anderen Gründen sehr aufgebracht bin, kehrt sie zurück.“
„Und wo bist du dann, tagsüber?“
„Ich weiß es nicht. Ich träume, und es ist hell dort. Was glaubst du, wohin die Seelen von Vampiren gehen?“
Amber zuckte mit den Schultern und zog leise die Nase hoch. „Keine Ahnung. Ich weiß ja noch nicht mal, wohin meine geht, wenn ich mal nicht mehr bin.“
Schnelle Schritte ertönten.
„Das ist Robert.“ Ich war so schwach, dass ich das Auto nicht hatte kommen hören.
Mit der Schrotflinte unter dem Arm stürmte Curtis’ Diener in die Gruft.
Amber sprang erschrocken auf.
Als Robert sah, dass keine Gefahr mehr drohte, legte er die Waffe weg. Er ging erst zu Steven, dann kam er zu mir. Ich war unglaublich erleichtert, ihn zu sehen und kurz den festen Druck seiner Linken auf meiner Schulter zu spüren.
Er blickte mir in die Augen.
„Julius, der Meister kommt, sobald es ihm möglich ist. Glaubst du, der Killer kehrt zurück?“
„Nicht, solange Amber hier ist. Sie ist seine Schwester. Er ist geflohen, als sie eintraf.“
„Dann will ich hoffen, dass du noch eine Weile bei uns bleibst, Mädchen. Ich bin Robert.“ Er reichte Amber die Hand, und sie ergriff sie zögernd.
Er hatte eine große Tasche mit allerlei medizinischem Gerät mitgebracht. „Ihr seht beide fürchterlich aus, wenn ich das so sagen darf“, meinte er lapidar und beugte sich dicht über meinen toten Freund. Vorsichtig betastete er die Haut neben dem Pflock. „Steven wird mindestens zwei Wochen brauchen, um sich halbwegs zu erholen.“
Was sagte er da? „Er lebt?“
„Ja. Wenn das ein Profi war, fresse ich einen Besen. Er hat das Herz verfehlt.“
Ich konnte mein Glück kaum fassen. Steven lebte! Auch Amber trat jetzt näher und beugte sich über den Jungen.
„Aber jetzt kümmere ich mich erst einmal um dich, Julius“, fuhr Robert fort. „Ich ziehe den Pflock nicht, bevor der Meister da ist.“
Ich konnte schon wieder blinzeln. Sah zu, wie Robert mein fehlendes Stück Finger auf dem Boden suchte und fand. Er reinigte es und wischte auch meine Hand sauber.
„Haben Sie das schon öfter gemacht?“, fragte Amber unsicher.
„Sagen wir, ich habe schon so einiges gesehen.“
Als Robert Nadel, Faden und Messer zurechtlegte, setzte sich Amber zu mir und kehrte dem Diener den Rücken zu.
Mit aller Willensanstrengung drehte ich den Kopf und sah sie an. In ihrem roten Haar glitzerte es.
„Du musst ein Engel sein. Es ist Gold in deinem Haar.“
Amber berührte ihre Strähnen, und funkelnde Sterne regneten heraus und taumelten langsam zu Boden. „Als ich hierher aufgebrochen bin, war ich bei der Arbeit. Ich bin Vergolderin. Hin und wieder bleiben Flitter an mir hängen.“
„Das hattest du mir noch gar nicht erzählt.“
Plötzlich erbebte mein ganzer Körper. Ein Seufzen entwich meiner Kehle, ohne dass ich es verhindern konnte.
Robert nähte gerade, doch als ich zu zittern begann, hielt er fluchend inne.
Amber erschrak. „Oh Gott, Julius, was hast du?“
Robert beruhigte sie. „Das ist ein ganz normaler Prozess. Das Leben kehrt in seinen Körper zurück. Der Vorgang setzt ein, sobald die Sonne untergeht. Bei Alten eher, bei Jungen später“, referierte er.
„Robert, ich bin keine exotische Spezies.“
„Doch, genau das bist du!“ Er lächelte und wandte sich dann wieder Amber zu, die mich neugierig musterte. „Wenn du Julius wirklich helfen willst, dann schenk ihm Blut, sobald er wach ist.“
Ich spürte, wie Amber innerlich schlagartig auf Abstand ging, und sagte schnell: „Das muss sie nicht, Robert.“
„Entschuldigung. Ich will mich nicht einmischen.“
Er nähte schweigend weiter, während Amber mit Grauen und Faszination zusah, wie meine wächserne Haut wieder menschlich und weich wurde.
Als mein Herz den ersten schmerzhaften Schlag tat, bäumte ich mich auf. Dann wurde es besser. Luft füllte meine Lungen.
„Amber …“, flüsterte ich. Ihr Name war das erste Wort, das ich laut sprach, und mit dem Blick in ihre meergrünen Augen begann der erste Tag meines restlichen Lebens.
Sie half mir, mich aufzusetzen, doch Robert drückte mich energisch zurück in meine blutgetränkten Kissen. „Du bleibst schön liegen, bis ich hier fertig bin.“ Und damit begann er, meine Hose um den Pfeil herum aufzuschneiden.
Amber zögerte, dann legte sie mir von hinten die Arme um die Brust und schmiegte ihren Kopf an meinen. Ich rieb mich an ihrer seidigen Wange.
Curtis’ Diener schloss seine Hand um den Pfeil, und ich biss die Zähne zusammen.
„Achtung!“ Langsam drehte er das Geschoss heraus.
Ich unterdrückte einen Schrei und schlug mit meiner gesunden Hand auf den steinernen Rand des Sargs.
Dann war es vorbei. Mit einem satten Geräusch glitt die silberne Spitze aus meinem Fleisch.
Robert riss mein Hosenbein weiter auf, wischte mir mit einem Stück Stoff das Blut von der Haut und legte einen Verband an.
Amber beobachtete ihn kritisch.
„Muss das nicht desinfiziert werden?“, fragte sie, doch Robert schüttelte nur den Kopf. Ohne aufzusehen, antwortete er: „Vampire bekommen keine Infektionen. Viren und Bakterien überleben nicht in einem Körper wie dem ihren.“ Er sah auf und fügte grinsend hinzu: „Julius ist übrigens das Mitglied der Leonhardt, das ich mit Abstand am häufigsten zusammengeflickt habe.“
„Ja, ja“, maulte ich schwach. „Aber ich bin nicht schuld daran, das liegt an meinem Job.“
„Und daran, dass du dich gerne auf Kämpfe einlässt, Julius.“
„Ich will Steven sehen“, forderte ich, ohne weiter auf seine letzten Worte einzugehen.
Gemeinsam mit Amber half er mir, den kurzen Weg zu dem anderen Sarg zurückzulegen.
Stevens Körper hatte sich nicht zurückverwandelt.
Er war noch immer wächsern und steif, als stünde die Sonne hoch am Himmel. Blut lief in dünnen Fäden aus den beiden Wunden in seinem Oberkörper, dem Pfeil in seinem Bauch und dem Pflock neben dem Herzen. Sein Gesicht war auf der linken Seite verrußt, Ohr und Haare angebrannt.
Wütend stieß ich die erloschenen Kerzen zu Boden. „Verdammt, wie konnte er nur!“
Amber zuckte unter meinem Schrei zusammen.
Ich suchte nach Stevens Geist und fand nur öde Leere. Niedergeschlagen ließ ich mich auf die Kante seines Sargs sinken. „Er müsste längst wach sein.“
„Nein, du irrst dich. Solange der Pflock in seiner Brust steckt, bleibt er in diesem Zustand“, beruhigte Robert mich. „Der Meister ist gleich da. Fragen wir ihn, aber ich denke, es ist besser, wenn wir den Jungen in die Zuflucht bringen. Er wird viel Blut brauchen, wenn ich den Pflock ziehe.“
Reifen summten über Asphalt. Ein Auto hielt nicht weit entfernt auf einem Parkplatz, und mehrere Personen stiegen aus. Als sie näher kamen, verschluckte der Rasen ihre Schritte.
„Das wird er sein“, sagte ich.
Ich fühlte meinen Schöpfer näher kommen, als sei die Luft plötzlich dichter geworden. Magie umgab ihn wie eine unsichtbare Wolke.
Curtis eilte die Treppe hinunter und stieg über die aus den Angeln getretene Tür. Selten hatte ich ihn so aufgewühlt gesehen. Einen kurzen Moment lang hielt er inne und sah sich in der verwüsteten Gruft um, dann eilte er auf mich zu und küsste mich auf die Stirn. Danach tat er das Gleiche bei der überraschten Amber.
„Ihnen gilt mein tiefer Dank, Miss Connan. Danke, dass Sie Julius gerettet haben.“
Curtis ging neben Steven in die Knie und legte ihm die Hand auf die Brust. Bestürzt untersuchte er die Wunde und strich ihm über das angesengte Haar.
„Brandon und Christina sind oben. Sie werden sich um deine Gruft kümmern und deine Sachen packen, Julius. Du kannst nicht hierbleiben. Für ein paar Tage kommst du mit zu uns. Ich weiß nicht, wieso ich dich überhaupt jemals alleine und ohne Wächter habe schlafen lassen.“
Ich nickte nur. Hier konnte und wollte ich wirklich nicht bleiben. Es stank nach Urin, Blut und Tod. Die Türen waren aufgebrochen, mein Heim zerstört und verschmutzt. Bis auf eine der beiden Truhen und meinen Sarg war alles dahin.
Ich würde ins Lafayette ziehen, keine Frage. Im Augenblick gefiel mir der Gedanke, bei den anderen zu sein, sogar recht gut.
Das alte Kino war hervorragend bewacht. Dort konnte niemand so einfach einbrechen und einen Vampir vernichten.
„Kommst du mit, Amber?“
Sie sah zweifelnd von mir zu Curtis und dachte wohl an ihre grauenhaften ersten Erlebnisse im Lafayette. „Ich gehe mal kurz Luft schnappen.“ Und damit verschwand sie die Treppe hinauf nach draußen.
Ich nahm Stevens Hand in meine und rieb mit dem Daumen über das kalte, harte Fleisch. „Sie hat uns gerettet“, sagte ich leise.
Curtis begann, saubere Kleidung und meine Waffen in die heile Truhe zu packen. Ich war zu schwach, um ihm dabei zu helfen.
Silber und Holz waren teuflisches Zeug.
Noch immer sickerte Blut aus meinem Körper. Der Verband an meinem Oberschenkel fühlte sich bereits nass an und war bis zur Hälfte dunkel verfärbt. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich schwankte, dann verlor ich den Halt.
Als ich erwachte, lag ich auf dem Boden. Alles drehte sich, und mein Bein tat höllisch weh. Anscheinend war ich darauf gefallen.
„Julius, so geht das nicht!“ Curtis war zu mir geeilt.
Mit meiner gesunden Hand umklammerte ich den Sargrand und zog mich ein Stück hoch. Doch alles, was ich berührte, begann zu fließen, wurde schwammig. Ich rutschte wieder hinab.
Dann erklangen Brandons und Christinas leise Schritte auf der Treppe. Curtis musste sie telepathisch gerufen haben.
Mein Clanbruder war nicht so blass wie andere Unsterbliche. Seine Haut hatte einen leichten Bronzeton, den ihm sein Vater, ein Navajo, vererbt hatte. Mit seinem rabenschwarzen, langen Haar und der muskulösen, großen Statur wirkte er wie das Idealbild eines Indianers.
Auch Brandon überraschte das Ausmaß der Zerstörung. Er stieg über Kleidung und Trümmer hinweg und baute sich vor mir auf. „Mann, Julius, der hat euch ja wirklich fertiggemacht!“
Neben ihm stand seine Dienerin Christina, eine Latina und eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen hatte.
Im Moment freilich sah ich beide nur verschwommen. Ihre Körper flossen ineinander wie Traumgebilde. Ich konnte Brandon nicht einmal antworten, öffnete meinen Mund, ohne einen Ton hervorzubringen. Selbst meine eigenen Gedanken bekam ich kaum zu fassen.
„Du siehst, wie schwach er ist“, sagte Curtis erklärend.
Brandons wabernder Umriss legte besitzergreifend einen Arm um die kleine Christina und zog sie an sich. Ich fühlte einen beständigen Energiestrom zwischen ihnen fließen. Sie waren eins, Vampir und Dienerin, ein Wesen mit zwei Herzen.
Brandon war wütend, und sein Zorn übertrug sich auf seine Dienerin.
„Er soll von Christina trinken? Warum? Soll es doch die da oben machen!“, antwortete er auf einen Befehl, den ich Curtis nicht hatte geben hören.
„Brandon.“ Die Stimme meines Meisters wurde leise und drohend.
„Er kann von mir trinken, wenn es unbedingt sein muss.“
„Julius ist mit Silber und Holz verwundet worden und braucht menschliches Blut, nicht deins, das weißt du genau. Der Clan muss für Steven später noch viel mehr aufbringen. Und Miss Connan hat bereits deutlich gemacht, dass sie nicht dazu bereit ist.“
„Aber …“
„Ich habe dich nicht gerufen, um zu diskutieren, Brandon Flying Crow!“
„Ja, so ist es immer mit euch Weißen, wenn ihr etwas wollt, nehmt ihr es euch! Unsere Meinung schert euch einen Dreck.“
„Keine Geschichtsstunde. Wag es nicht!“, sagte Curtis kalt.
Brandon gab ein wütendes Zischen von sich, dann neigte er den Kopf. Seine Fäuste zitterten, so sehr musste er sich beherrschen. Er konnte seinem Clanführer nicht den Gehorsam verweigern.
„Christina? Bitte.“ Curtis brauchte ihr Einverständnis.
Brandon konnte er befehlen, aber nicht ihr, wenngleich es eigentlich keine Bedeutung hatte, da sie Brandon diente.
„Ja, Meister.“ Ihre Stimme bebte.
In der Hoffnung auf Blut klärten sich meine Sinne ein wenig.
Brandon war wütend, doch er fügte sich. Ich war erleichtert. Er griff nach dem Handgelenk seiner Dienerin und zog sie zu mir.
Christina kniete sich neben mich wie ein Opferlamm. Auch ihr Zorn war deutlich zu spüren.
Es galt als ungeheurer Frevel, das Blut eines Menschen zu trinken, der die Zeichen eines anderen Vampirs trug. Es war ein Schlag ins Gesicht, eine Herausforderung. Und ich würde es ausgerechnet bei Brandons Dienerin tun müssen. Kaum ein Vampir hielt so viel auf Ehre und Regeln wie er.
Sein dunkler Blick flog von Curtis zu mir. „Wenn du sie berührst, Julius, bringe ich dich um!“
Ich fühlte seine Macht anschwellen, als er den Geist seiner Begleiterin auf die Schmerzen vorbereitete.
Christina wurde ruhig und nahm Brandons Magie an wie ein Geschenk. Dann schlitzten seine Zähne ihre Pulsader auf.
Ich riss den Mund auf. Ein warmer Strahl ergoss sich in meine Kehle.
Brandon hielt Christinas Arm hoch über meinen Kopf. Viele Tropfen trafen meine Wangen anstelle meines Mundes, doch so lief ich nicht Gefahr, beim Trinken die Haut der Dienerin zu berühren und ihren Herren damit noch mehr zu brüskieren.
Mit jedem Schluck fühlte ich mich besser, doch der Segen hatte schon bald ein Ende. Enttäuscht wischte ich mir mit dem Ärmel das Gesicht sauber.
Brandon funkelte mich noch immer wütend an, während er sich selbst eine kleine Wunde beibrachte und sein Blut in die Verletzung seiner Dienerin rieb. Die Haut schloss sich fast augenblicklich. Christina küsste Brandons Hand, dann stand sie auf und rannte hinaus, ohne sich noch einmal umzusehen.
Ich wusste, dass Brandon mir diese Sache noch lange nachtragen würde. Er war der Auffassung, dass ich hätte ablehnen müssen. Und vielleicht hätte Brandon es an meiner Stelle auch tatsächlich versucht. Doch ich war ebenso an Curtis’ Befehle gebunden wie er, und der Meister wollte mich so schnell wie möglich wieder bei Kräften sehen.
Ausgerechnet jetzt, in dieser feindseligen Atmosphäre, kam Amber zurück.
Brandon hob schweigend die mit meinen wenigen erhaltenen Habseligkeiten gefüllte Truhe auf, um sie zum Auto zu bringen.
Im Vorbeigehen spuckte er Amber vor die Füße und trat gegen den Türrahmen, der zersplitterte wie Pappmaschee.
Amber sah ihm fassungslos hinterher.
„Brandon! Treib es nicht zu weit!“, rief Curtis warnend, doch er war schon fort.
„Lass ihn, bitte.“
„Er hat zu gehorchen, Julius.“ Curtis seufzte, schluckte seinen Zorn herunter und strich Steven über die wächserne Stirn.
„Bringen wir den Jungen hier weg“, sagte er leise.
Gemeinsam mit Robert, der kurz nach Amber zurückgekehrt war, hob Curtis ihn hoch und trug ihn hinaus.
Christinas Blut hatte mir gutgetan. Ich kam auf die Beine.
Amber starrte Brandon noch immer hinterher und machte keinerlei Anstalten, mir beizustehen.
„Was sollte das denn?“, flüsterte sie entrüstet.
„Hilf mir erst einmal, bitte“, sagte ich und streckte schwankend die Hand nach ihr aus. Amber stützte mich, und während wir gemeinsam die Treppe erklommen, erklärte ich in hastigen Worten, was geschehen war.
„Aber was hat das denn mit mir zu tun?“
„Es ist Unrecht, Frevel. Brandon denkt, es sei deine Aufgabe gewesen.“
Wieder zwei Stufen, erneuter Schwindel, und Ambers Sommersprossen tanzten Ringelreihen.
„Und deshalb hat mir dieser Vampir …“
„Brandon Flying Crow.“
„Wie auch immer. Deshalb hat er mir vor die Füße gespuckt?“
„Er ist sehr wütend. Seiner Meinung nach hätte ich ablehnen müssen.“
„Und warum hast du nicht?“
„Weil ich Blut brauchte und sicher war, dass du mir keines geben würdest.“
Robert hatte den umgebauten Dodge nahe an mein Mausoleum gefahren. Ich humpelte an Ambers Seite die wenigen Schritte zum Wagen.
Brandon und Christina hielten sich ein Stück entfernt und beobachteten uns.
Ich konnte den Halbindianer zwar nicht genau erkennen, aber ich fühlte seine wütenden Blicke und Christinas Empörung. Noch war die Dienerin menschlich, doch schon bald würde sie zu einer von uns werden. Sie hatte bereits offiziell um die Verwandlung gebeten, und Curtis hatte versprochen, sie in den Clan aufzunehmen.
Curtis öffnete die Tür und half mir hinein. Ich hätte mich keinen Moment länger auf den Beinen halten können und sank erschöpft auf die lederbezogene Rückbank. Amber setzte sich zu mir.
Während der Fahrt wurde ich immer wieder ohnmächtig.
Aber Amber war da, um mich zu halten, und der Duft ihrer Haare und ihrer Haut verhinderte, dass mich die Erinnerungen an Schmerz und Folter überwältigten.
Niemand hielt es für nötig, ihr die Augen zu verbinden. Vielleicht hatten sie es auch einfach vergessen.
Als wir schließlich hinter dem alten Kino hielten, half sie mir beim Aussteigen. Im Entrée hatten sich sämtliche Bewohner der Zuflucht versammelt. Schweigend und misstrauisch beobachteten sie, wie ich mit Amber ein Sofa ansteuerte. Der Verband an meiner Hand war wieder blutgetränkt.
Curtis und Robert trugen Steven in den Versammlungsraum. Die anderen folgten ihnen in einer stillen Prozession. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, und blieb einfach sitzen.
Amber sah sich unsicher um. Ihr Blick huschte über die alten Bilderrahmen, in denen Filmplakate der Dreißigerjahre vor sich hinbleichten, doch sie war zu nervös, um sie wirklich anzusehen.
Curtis kam noch einmal zurück. Er reichte Amber frisches Verbandszeug und drückte mir ein paar Schlüssel in die Hand.
„Geht runter in meine Gemächer. Dort bist du sicher, Julius. Ich kümmere mich jetzt um Steven.“
„Und er kommt wirklich durch?“ Ich konnte es mir nicht so recht vorstellen. Steven war so jung, seine Magie noch so schwach. Doch Curtis war zuversichtlich. „Mach dir keine Sorgen. Liliana Mereley wird mir helfen. Die Kraft zweier Clanoberhäupter sollte reichen, um den Jungen zurückzuholen. Außerdem habe ich mehrere Wachleute bezahlt, damit sie mit Blut aushelfen.“
Ich nickte. Wenn Liliana kam, würde ihnen wirklich mehr als genug Magie zur Verfügung stehen. Die Vampirin leitete einen kleinen, aber mächtigen Clan, der mit unserem seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden war.
Amber half mir auf.
Curtis wartete, bis sie aufrecht stand, dann fasste er ihr Kinn und zwang sie, ihn anzusehen. „Wenn Sie mein Vertrauen brechen, Miss Connan, muss ich Sie töten. Und mir ist egal, was Julius dazu sagt!“, drohte er. Das war Curtis’ besonderer Charme.
Amber nickte mit zusammengepressten Lippen.
„Geh runter und ruh dich aus.“ Er strich mir über die Schulter, dann ging er zurück in den Versammlungsraum.
Amber sah mich an, wartete auf einen Kommentar, doch ich wies nur auf den schmalen Gang, der zu den unterirdischen Kammern führte.
Tief unter der Erde ließ ich mich auf das Sofa vor dem Kamin sinken. Amber hingegen lief rastlos hin und her und beobachtete die Fresken, als würden sie jeden Moment zum Leben erwachen. „Die sind unheimlich.“
„Es ist eine Liebesgeschichte“, erwiderte ich.
„Komm her zu mir“, forderte ich sie schließlich auf.
Sie setzte sich neben mich und starrte in die Flammen des Kamins.
Ich fragte mich, ob sie den Pflock bereits aus Stevens Körper entfernt hatten. Hoffentlich wurde der Junge wieder gesund.
„Ich bin schuld, dass Steven jetzt da oben liegt.“
Amber sah mich fragend an. Ihr Gesicht glühte von der Wärme des Feuers.
Zögernd berichtete ich von meinem Auftrag, den verwilderten Vampir zu töten, und der darauffolgenden Begegnung mit Frederik. Sein Angriff war eindeutig ein Racheakt gewesen. Und hätte Steven nicht bei mir geruht, dann wäre er gesund und ich vermutlich tot.
„Aber der Vampir, den du hingerichtet hast, wurde doch von diesem Rat der Clans rechtmäßig verurteilt?“
„Ja, und Gordon hätte Urteil und Vollstreckung akzeptieren müssen.“
„Bist du der Einzige, der …?“
„Nein, es gibt noch einen Jäger für die Außenbezirke. Adrien, den Partner einer befreundeten Clanherrin. Er wurde wie ich bereits vor Jahrzehnten auserwählt. Wir trainieren oft miteinander. Er ist ein wirklich guter Kämpfer mit genau den richtigen Instinkten. Außerdem hat er Humor, du würdest ihn mögen.“
Amber zog die Stirn kraus. „Wenn dieser Adrien für die Außenbezirke zuständig ist, dann wusste Gordon also genau, dass du kommen würdest, wenn er einen Vampir erschafft, der Menschen ermordet? Und mein … mein Bruder konnte dir danach einfach zu deinem Schlafplatz folgen?“
Verdammt. Dass ich darauf nicht selbst gekommen war! „Du meinst, Gordon hat den verwilderten Vampir womöglich nur geschaffen, um meinen Schlafplatz zu finden?“
„Wenn du noch mehr von seinen Freunden umgebracht hast, hat er doch allen Grund, dich aus dem Weg zu räumen!“
Ein tropfendes Geräusch ließ uns beide gleichzeitig zu meiner Hand schauen.
Der Verband war nass. Erste Flecken sprenkelten bereits den Boden. Amber nahm das Verbandszeug vom Tisch.
„Eigentlich habe ich immer gedacht, ich könnte kein Blut sehen.“ Ein Lächeln umspielte ihren Mund, doch als sie meinen kleinen Finger aus dem Stoff schälte, verschwand es mit einem Schlag.
Grobe Nähte hielten das abgetrennte Stück am Platz, und ständig sickerte Blut heraus. Auch die anderen Finger sahen schlimm aus. An den meisten waren eine oder mehrere Sehnen durchtrennt.
„Und das heilt wieder? Bist du dir sicher?“
War ich nicht. „Es geht langsamer als sonst. Ich sollte jagen. Nichts hilft besser als frisches Blut.“
Amber sah mich skeptisch an. „Du bist zu schwach. Du kannst doch nicht mal alleine laufen.“
Vorsichtig tupfte sie meine Hand sauber und legte einen neuen Verband an.
Ich stand auf, warf den dreckigen Stofffetzen ins Feuer, schwankte und musste mich sofort wieder setzen.
Amber schmiegte sich in meinen Arm. Ich küsste ihre Stirn und schloss die Augen. Die Schmerzen waren mir fast schon lieb, denn ohne sie wäre Amber wohl niemals zu mir zurückgekehrt. Amber, die nun vielleicht doch nicht dem Tod geweiht war. Nachdem sie mir das Leben gerettet hatte, konnte Curtis nicht einmal dann darauf bestehen, dass sie sterben musste, wenn sie sich den Siegeln verweigerte. Zumindest hoffte ich das. Andererseits …
„Würde dir mein Blut helfen?“
Ich riss die Augen auf.
„Ich werde mein Versprechen, dich niemals darum zu bitten, nicht brechen“, antwortete ich.
„Gut.“ Sie legte die Beine hoch und rückte zufrieden näher, küsste mein Kinn. Ich wollte ihre Lippen suchen, doch mir wurde wieder schwindelig. Blinzelnd versuchte ich mich zu konzentrieren.
„Und wenn ich es dir schenke?“
Ich sah sie ungläubig an. „Dann nehme ich deine Gabe mit großer Freude an. Aber du musst das nicht tun.“
Stumm sah sie mich an, dann sagte sie schließlich zögernd: „Es war mein Bruder, der dir das angetan hat. Wenn ich es ein kleines bisschen wiedergutmachen kann …“
„Tu das nicht aus Schuldgefühlen wegen deines Bruders.“
„Aber ich will es so.“
Es war ihr ernst, das konnte ich spüren. „Du überraschst mich immer wieder.“
Der Hunger, den ich fast vergessen hatte, kehrte mit Macht zurück.
Ich schluckte trocken, strich ihr über Brauen, Lippen, Haar. Streifte wie zufällig ihre Brust.
Amber zitterte und sah auf. „Mach schnell, sonst überlege ich es mir doch noch anders.“
Ich nickte, durstig, gierig. Jetzt gab es kein Zurück mehr.
„Wo?“, fragte sie mit großen Augen.
Ich schob ihr Haar zurück und ließ meine Nägel über die Haut ihrer Halsbeuge gleiten. „Hier.“
Zart und blau wie ein ferner Fluss zeichnete sich die Schlagader ab.
Ich konnte kaum noch klar denken und warf all meine Bedenken über Bord.
„Vielleicht tut es diesmal weh“, warnte ich. Ganz sicher sogar. Ich war zu schwach für irgendwelche Zaubertricks. Doch der Durst war ein rücksichtsloser Gefährte.
Amber hatte etwas, das mir gehörte, das ich brauchte. Mein Herz pochte wie wild, und Ambers Haut duftete köstlich nach ihrer Angst.
„Mach schon, Julius, ich will es!“, presste sie hervor und kniff die Augen zusammen.
Jetzt gab es kein Halten mehr! Ich bemühte mich, ihr den Schmerz zu nehmen, doch meine Kraft reichte nicht aus.
Amber stöhnte und krallte ihre Finger in meinen Rücken. Sie entspannte sich erst wieder, als ich die Zähne aus der Wunde zog. Endlich begann die Energie ihr Werk. Meine Wunden wurden heiß, begannen zu heilen.
Ich strich Amber beruhigend über die Haare. „Ich wollte dir nicht wehtun.“ Sie nickte und wischte sich grimmig eine Träne aus dem Augenwinkel. Die andere Hand presste sie auf ihren Hals. Dann streckte sie den Rücken durch und räusperte sich. „Du hast getan, was ich dir erlaubt habe.“
Dennoch fühlte ich mich schuldig. Ich sah ihr genau an, dass sie die Erfahrung verunsichert hatte. Aber ich wollte nicht, dass es so blieb. Sie sollte unsere … meine Welt nicht nur von ihrer dunkelsten Seite kennenlernen.
Ich konnte doch nicht zulassen, dass sie sterben musste, bloß weil sie sich gegen uns und mich entschied! Nicht, nachdem sie mir das Leben gerettet und jetzt auch noch freiwillig ihre Ader für mich geöffnet hatte! Es gab nur einen Weg für uns, Zeit zu gewinnen – Lebenszeit für sie und für mich eine längere Frist, um Curtis zu überzeugen, dass es unnötig war, Amber zu töten.
***
Amber
Julius musterte mich lange und intensiv. Er dachte über irgendetwas nach, zu gerne hätte ich gewusst, worüber. Es schien ihm Sorgen zu machen. Seine Augen waren dunkel, und zwischen den Brauen war eine tiefe Falte entstanden.
„Möchtest du das zweite Siegel? Ich würde es dir gerne zum Dank geben“, brach er schließlich sein Schweigen und überrumpelte mich damit völlig.
„Was würde das für mich bedeuten?“ Ich hielt die Hand fest auf die kleine Bisswunde an meinem Hals gedrückt. Sie fühlte sich heiß an und pochte ein wenig, aber tat nicht allzu weh.
„Eine engere Verbindung, Gesundheit und Heilkraft, ein längeres Leben … und Stärke“, beantwortete Julius meine Frage.
„Vielleicht“, sagte ich. Gesundheit klang nicht schlecht. Allerdings schien mir die Aussicht, viel Zeit mit Vampiren zu verbringen, nicht gerade lebensverlängernd.
Julius stand auf und hinkte quer durch den Raum.
„Du kannst wieder alleine stehen.“ Das war wirklich erstaunlich. Der Unterschied zu seinem vorherigen Zustand war gewaltig. Ich hatte befürchtet, dass mein Bruder ihn für immer gezeichnet hatte. Nun atmete ich erleichtert auf.
„Das verdanke ich dir und deinem kostbaren Blutgeschenk.“ Neben einer Vitrine, in der eine Sammlung antiker Pokale stand, blieb er stehen und wählte ein goldenes Exemplar mit gefassten Bergkristallen aus.
„Julius, was machst du da?“
Sein Blick fiel auf einen kleinen, gravierten Dolch, der anscheinend zu einem der Pokale gehörte, und er stellte das Gefäß wieder zurück. „Wir brauchen keinen Kelch. Blut schmeckt kalt und seelenlos, wenn es nicht frisch ist, wenn die Lippen nicht die Haut berühren. Freilich bin ich mir nicht sicher, ob Menschen den Unterschied überhaupt bemerken.“
Seine Worte sorgten für eine Gänsehaut auf meinen Armen. Was hatte er vor? Auch wenn ich mir mittlerweile relativ sicher war, dass Julius mir nicht nach dem Leben trachtete, erwachte leise Angst in mir.
Julius setzte sich wieder zu mir, öffnete meine Hand und legte das Messerchen wie einen Schatz hinein.
„Was soll ich damit, Julius?“ Jetzt wurde mir doch mulmig.
Er wies auf seinen Hals. „Du trinkst von mir. Schneide hier, aber nicht zu tief.“
War er verrückt geworden? „Ich kann dich nicht verletzen! Das mache ich nicht. Und außerdem habe ich doch gar nicht Ja gesagt! Diesmal läuft das nicht einfach so. Du erklärst mir jetzt erst mal, was das alles wirklich bedeutet. Diese ganze Geschichte mit den Siegeln und Dienern, meine ich.“
Julius seufzte. Die Enttäuschung war ihm anzusehen. „Wie du weißt, dreht sich unsere Welt vor allem um eins“, begann er. „Blut, Lebensenergie. Wenn wir Bindungen eingehen, bekräftigen wir unsere Schwüre damit, und unsere Magie wohnt im und spricht durchs Blut. Die Siegel sind eine magische Verbindung.“
„Zauberei?“
„Wenn du es so nennen willst. Ich trinke dein Blut, und du nimmt das Geschenk von mir. Dadurch werden wir enger aneinander gebunden. Es soll wunderschön und erfüllend sein …“
„Und dann bin ich deine Dienerin und muss dir gehorchen?“
Er legte eine Hand auf meinen Arm. „Nein, im Gegenteil. Mein Einfluss auf dich wird schwächer. Zugleich wachsen wir aber gemeinsam. So wurde es mir zumindest gesagt.“
Ich zog die Brauen hoch. Mir kam ein Verdacht. „Du hast das selbst noch nie gemacht?“
„Nein, noch nie. Aber ich wünsche es mir sehr.“
Das war doch völlig verrückt, wir kannten uns doch kaum! Wie konnte er sich da so etwas wünschen? Und doch drängte auch etwas in mir dazu, eine Kraft, die ich nicht fassen konnte. Sie wollte seine Nähe, wollte das Ritual weiterführen. Ich kämpfte dagegen an. „Warum ich?“
„Glaubst du, dass sich unsere Wege nur durch Zufall gekreuzt haben? Wir haben gemeinsam gekämpft, und du hast mir heute das Leben gerettet. Denkst du, das bedeutet nichts? Abgesehen davon gibt es auch noch einen praktischen Grund. Du wirst dadurch tabu für andere Unsterbliche. Auch wenn der Schutz des Codex vor allem für vollwertige Famuli gilt, sind auch schon zwei Siegel ein deutliches Zeichen. Wer dir etwas antut, bekommt es mit mir zu tun.“
„Das klingt ja alles schön und gut, und wahrscheinlich kann ich deinen Schutz nach der Sache mit Frederik wirklich gut gebrauchen. Aber ich kann doch jetzt nicht eine Entscheidung treffen, die für den Rest meines Lebens Gültigkeit besitzt, Julius. Wir kennen uns kaum, und bisher hast du mir nichts als Schwierigkeiten bereitet – und ich dir wahrscheinlich auch. Was erwartest du denn von mir? Dass ich mich für immer an dich binde?“
„Erst das fünfte Siegel ist endgültig, Amber. Erst dann lebst du genauso lange wie ich. Vorher kannst du dich immer noch dagegen entscheiden.“
„Und du würdest zulassen, dass ich einfach so davongehe und dich vielleicht nie wiedersehen will? Was passiert dann mit den Siegeln?“
Julius zögerte. Seine Wangen wurden kantig, als er die Kiefermuskeln anspannte. „Ich würde deinen Willen respektieren, das verspreche ich. Ich müsste die Siegel schließen. Das ist möglich, aber ich könnte bis zu deinem Tod keinen anderen Menschen an mich binden. Ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Ich teile meine Lebensenergie gerne mit dir.“
Ich schluckte, schüttelte den Kopf. „Und was hast du davon?“
„Durch dich kann ich wieder den Tag erleben. Du bist mein Tor in die Welt der Sterblichen. Ich teile meine Kraft mit dir, und du gibst mir von deiner Lebensenergie. Wir werden beide stärker, lebendiger.“
„Dann ist ‚Diener‘ das falsche Wort.“
„Vielleicht. Eigentlich nennen wir es ‚Famulus‘ beziehungsweise ‚Famula‘. Natürlich erledigt der menschliche Diener hin und wieder etwas für den Vampir, was dieser aufgrund seiner Konstitution nicht selber kann.“
Ich nickte und starrte in den Kamin. Das war doch nicht alles. Ich sah ihm an, dass ihn dunklere Gedanken umtrieben. „Was ist es wirklich?“
Er wich meinem Blick aus und umschloss den kleinen Dolch, mit dem er bis dahin gespielt hatte, mit der Faust. „Du schwebst in Lebensgefahr. Und mit nur einem Siegel kann ich dich nicht schützen.“
„Woher weißt du das?“, fragte ich mit belegter Stimme.
„Du hast doch selbst gesehen, nach welchen Regeln in unserer Welt gespielt wird. Und ein Menschenleben gilt nicht viel für einen Vampir. Wenn du das Siegel nicht annimmst, hast du möglicherweise nur noch wenige Tage.“
Ich lehnte mich zurück, dachte an all das Blut, das heute geflossen war, und an den Angriff auf Julius und mich, der genauso gut mit meinem Tod hätte enden können. Deshalb also. Meine Knie wurden weich. Mein Herz begann zu rasen, dann wurde es wieder besser, als ich versuchte, die Sache nüchtern zu betrachten. Wenn die Bedrohung damit aus der Welt geschafft wäre, was bedeutete dann schon ein kleiner, ekeliger Schluck Blut? Meine Entscheidung kippte Richtung Ja. Ohnehin zogen mich Julius und seine Welt wie magisch an. Als wäre es vorherbestimmt. Was für ein esoterischer Quatsch. Jeder hat sein Schicksal selbst in der Hand. Und doch …
„Weißt du, mit dir zusammen zu sein, ist komisch, Julius. Ich fühle mich, als würde ich dich schon mein ganzes Leben lang kennen, und dabei weiß ich fast nichts von dir.“ Ich musterte ihn, sein von Folter gezeichnetes, blasses Gesicht. Die innere Unruhe, die er vor mir zu verbergen suchte.
„Mir geht es nicht anders. Und es überrascht mich. Eigentlich halte ich mich fern von Menschen, sie bedeuten mir nichts. Bei dir ist es anders. Ich möchte nicht, dass du stirbst.“
„Und ich kann es wirklich rückgängig machen?“
„Ja, versprochen. Erst das fünfte Siegel ist endgültig.“
Er lehnte sich zurück, knöpfte den Kragen seines Hemdes auf und streckte einladend die Hand nach mir aus. „Komm.“
Also gut. Ich würde es durchziehen.
Ich atmete tief durch und rutschte näher. Mein Herz pochte heftig in meiner Brust.
„Bereit?“, flüsterte Julius in mein Haar und drückte mir einen Kuss auf die Stirn.
„Ja.“
„Nicht erschrecken, es kann sich etwas komisch anfühlen.“
Offenbar rief Julius nun seine Magie herauf. Ich ahnte, wie sie in seinem Inneren anschwoll. Es war, als hätte die Luft plötzlich eine andere Dichte bekommen und würde tastend über meinen Körper streichen. Dann öffnete sich das erste Siegel, und Julius wurde von einem fremden Wesen zu einem Teil von mir: Die Magie schien mich zu erkennen und begrüßte mich wie eine Freundin.
Unsere Herzen schlugen im Gleichtakt. „Das ist, das …“
Er brachte mich mit einem kurzen Kopfschütteln zum Schweigen. „Nicht. Nicht jetzt.“
Er hob das Messer an seinen Hals und schnitt. Liebevoll umfasste er meinen Hinterkopf und zog mich zu sich. Kurz bevor meine Lippen seine Haut berührten, hielt ich inne und starrte auf die dicken roten Tropfen, die aus der kleinen Wunde perlten. Konnte ich wirklich …?
„Trink von mir, wie ich von dir getrunken habe, Amber Connan. Meine Kraft für deine“, sagte Julius feierlich.
Ich überwand einen Anflug von Ekel und öffnete zögernd meinen Mund. Mit der Zungenspitze berührte ich den ersten Tropfen, schmeckte in einem Moment noch metallisch das Blut, und im nächsten war da nur noch berauschende Magie. Ich schloss Julius in die Arme und drückte meinen Mund fest auf die Wunde.
***
Julius
Schon die Berührung ihrer Zungenspitze ließ mich schaudern. Vorsichtig leckte sie einen Blutstropfen auf. Sofort war die Magie da und schloss die Bindung. Die nächsten Tropfen flossen und Amber wurde weniger zögerlich.
Die Energie rauschte durch uns und knüpfte ein zweites Band, öffnete ein weiteres Tor in unseren Herzen.
Ich erwiderte ihre Umarmung, zog sie noch enger an mich, wollte mit ihr verschmelzen, mit ihr und diesem wunderbaren Gefühl. Meine Zweifel, ob ich je eine Dienerin haben wollte, waren wie weggewischt. Ambers Lippen schlossen sich zum Kuss um die Wunde. Es war ein Gefühl, das süchtig machte, sinnlich und nicht von dieser Welt.
Es war die Verschmelzung von Lust und Hunger. Ich wollte Amber lieben und dabei ihre durstigen Küsse empfangen. Wegen mir hätte es ewig so weitergehen können, doch viel zu schnell musste ich Amber sanft wieder von mir schieben. Zwei tiefe Schlucke, das war genug Vampirblut für eine Sterbliche.
Amber lehnte sich zurück und berührte erstaunt ihre Lippen.
Sie musste nichts sagen. Ich wusste, was sie gerade erlebt hatte. Die Wunde an ihrem Hals schloss sich langsam, während Amber seltsam entrückt in die Ferne blickte und die Magie wie eine leiser werdende Melodie verklang.
Ich ergriff Ambers Hand und verschränkte meine Finger mit ihren.
Wir sahen eine Weile in die Flammen des Kamins, zwei Verlorene in einer fremden Welt. Ich lauschte ihrem Blut und meinem, spielte mit ihrem Haar und fühlte, wie ihr Körper dem Schlaf entgegentaumelte.
Amber lehnte sich an mich, und bald schlief sie tief und fest und so lebendig in meinen Armen.
Ich hingegen machte mir Gedanken. Über sie und mich, über Steven. Wie ging es ihm wohl?
Dank Ambers Gabe war ich nun wieder stark genug, um nachzusehen.
Im Geiste rief ich nach Curtis. Er ließ mich ein, und durch seine Augen sah ich, was im Versammlungsraum vor sich ging.
Steven lag auf dem großen ovalen Tisch aus poliertem Redwood-Holz. Wie die Tafelritter standen die anderen um ihn herum. Mein Platz war leer, ebenso der von Brandon.
Unser Versammlungsraum war im ehemaligen Kinosaal untergebracht, aus dem wir schon vor langer Zeit die Stuhlreihen entfernt hatten.
Alte Kristalllüster spendeten Licht. Schwere, geraffte Vorhänge bedeckten fast jede Wand und vermittelten das Gefühl, im Inneren eines riesigen roten Wasserfalls zu stehen.
Robert hatte seine Arbeit erledigt und wusch sich die Hände in einer Schale. Auf einem Tuch lag der riesige Holzpflock, blutig und obszön, und daneben der Pfeil aus meiner eigenen Armbrust. Er hatte also beides erfolgreich entfernen können.
Steven war schrecklich bleich und sein Oberkörper weiß wie ein Laken. Die Eintrittsstelle des Pflocks klaffte tief, die Haut darum war schwärzlich verfärbt. Nun trat Curtis an Stevens Seite, und ich spürte, wie er Magie heraufbeschwor und mit einer Leichtigkeit bündelte, die mir den Atem raubte. Von seiner Meisterschaft war ich noch Jahrhunderte entfernt.
Robert reichte seinem Herrn ein kleines, schlichtes Skalpell. Curtis schnitt sich in den Daumenballen, trat an den Tisch und ließ etwas von seinem mächtigen Blut in die Wunde tropfen.
Als öffnete sich die Schleuse eines Staudamms, stürzte die Magie in den jungen Körper. Stevens Leib zitterte wie von heftigen Schlägen. Curtis rief seine Seele zurück, und sie kam, sie kam! Stevens Körper wurde wieder weich. Tränen rannen aus seinen geschlossenen Augen.
Liliana Mereley, Herrin eines Clans aus L.A., der sich mit dem unseren verbündet hatte, hielt reglos, statuengleich den Kopf des jungen Vampirs umfasst und linderte so seine Schmerzen. Sie war eine blasse keltische Gottheit, die Haut geziert mit blauen Linien und heiligen Mustern. Das lange schwarze Haar hing ihr bis über die Hüften. Ein junger Mann, der zum Wachdienst gehörte, trat an den Tisch und wurde von Manolo kraft seines Blickes betäubt. Sie ließen ihn zur Ader, damit Steven Nahrung bekam. Ein weiterer Mensch wartete bereits. Sie würden sich ihre Gabe gut bezahlen lassen.
Ich hatte genug gesehen. Steven würde durchkommen. Vampire und Menschen halfen ihm mit vereinten Kräften. Manche freiwillig, andere, weil Curtis es verlangte, doch sie halfen.
Erleichtert kehrte ich zurück in meinen Körper.
Wohlig gewärmt von Amber und der Nähe des Kaminfeuers, schlief auch ich ein, mit dem guten Gefühl, sicher und behütet zu sein.
Es war früh am Morgen, als jemand an die Tür klopfte. Ich schrak auf.
Auch Amber war mit einem Schlag wach. Ich erhob mich steifbeinig, hinkte zur Tür und schloss auf. Es waren Robert und ein anderer Diener. Sie trugen einen wunderschönen Sarg herein, den ich nie zuvor gesehen hatte. Er war schwarz lackiert, bemalt mit Efeuranken und blassen Nachtblumen aus Perlmutt.
„Curtis hat gesagt, dass du den Tag hier verbringen darfst“, erklärte Robert.
„Das ehrt mich“, entgegnete ich.
Amber war auf dem Sofa sitzen geblieben, verschränkte fröstelnd die Arme und beobachtete die Szene. Ich ließ den Sarg neben Curtis’ steinernem abstellen.
Der andere Diener verließ die Kammer, aber Robert blieb und hob den Deckel. „Es ist eine Spezialanfertigung, aber das ahnst du sicher.“
Neugierig besah ich mein neues Quartier für den Tag. Die Innenseite war mit Seide ausgeschlagen und rot wie ein aufgerissener Rachen. Es gab auch seidene Kissen und Decken. Ich fuhr mit der Hand über den feinen Stoff.
Draußen verblasste die Nacht mit jeder Minute ein wenig mehr, ich konnte es spüren. Bald wurde es Zeit.
Ich richtete mich auf und sah in Ambers Gesicht. Sie wusste nicht, was sie denken sollte, das konnte ich ihr ansehen.
„Komm, Julius, ich zeige dir, was es damit auf sich hat.“
Robert bückte sich neben den Sarg. „Eisenverstärkt, und in die Wände sind schwere Bolzen eingelassen. Du kannst ihn von innen verriegeln.“ Er wies auf eine unauffällige Mechanik, die sich hinter den Polstern verbarg.
„Danke“, entgegnete ich knapp. Es war mir schrecklich unangenehm, vor Amber über die Vorzüge von Särgen zu sprechen wie ein sterblicher Mann über Wasserbetten oder Sportwagen.
„Du musst jetzt gehen, Mädchen“, sagte Robert dann. „Ich schließe die Tür ab, bis Curtis kommt.“
„Lass sie noch hierbleiben. Sie bringt die Schlüssel hoch, wenn sie geht.“
Robert nickte. Er wandte sich an Amber. „Wenn du oben bist, rufe im Entrée nach mir. Öffne keine Türen.“
Sie nickte und gähnte hinter vorgehaltener Hand.
Robert verließ uns, und ich setzte mich wieder neben sie auf das Sofa. Eine halbe Stunde blieb uns noch.
„Wer oder was genau ist dieser Robert eigentlich?“
Ich zog Amber in meine Arme. „Robert ist ein netter Kerl, der oberste der Diener“, begann ich. „Während des Tages hat er im Lafayette das Sagen. Er ist das menschliche Auge und Ohr des Clanherren und eine Art Vater für die anderen Sterblichen. Später, wenn wir Abschied genommen haben, wird er dir Küche und Bad zeigen.“
„Ist er schon lange Curtis’ Diener?“
„Seit über siebzig Jahren, ja.“
„Und er hat alle fünf Siegel? Hat er es je bereut?“
„Das weiß ich nicht, das musst du ihn fragen.“
„Und was bin ich jetzt für dich, Julius?“
„Wir sind Freunde, Amber. Und mit der Zeit werden wir vielleicht sogar mehr. So oder so wirst du durch die Siegel immer ein Teil von mir sein.“
Amber nickte geistesabwesend, und ihr Blick blieb fasziniert an dem lackschwarzen Sarg hängen. „Müsst ihr denn unbedingt in diesen Dingern schlafen, Julius? Das ist gruselig.“
„Nun, es gibt Regeln in dieser Welt, denen wir uns unterwerfen müssen. Ich kann mich auch in Erde eingraben oder in Sand, nur unterirdisch muss es sein. Aber es ist nicht sonderlich schön, Augen und Mund voll Dreck zu haben.
Für die Welt sind wir gestorben, deshalb die Särge. Vampire leben von geborgter Zeit und fremdem Leben. Wir sind tot und sind es doch nicht.
Sind auf eine Art sogar lebendiger als ihr Sterblichen, gesünder, stärker, und unsere Sinne sind schärfer. Aber doch sind wir auch tot und ruhen. Wirkliche Ruhe und Erholung finden wir nur im Sarg, besser noch umgeben von Toten.
Hier im Lafayette ist der Schlaf tief und friedlich. Das Kino wurde auf einem längst vergessenen heiligen Ort der Ureinwohner erbaut. Andere Vampire können uns auf einem Friedhof wie diesem nicht orten.“
Ich wies auf die Wände und zur Decke. „Über uns und um uns herum sind überall Gräber und heilige Gegenstände.“
Amber fröstelte.
„Nichts, wovor du Angst haben müsstest.“ Ich schloss sie lange in die Arme, drückte ihren Kopf an meine Brust und vergrub die Nase in ihren Locken.
Langsam wurden mir die Beine schwer. Die Sonne ging auf.
„Es tut mir leid, aber jetzt musst du wirklich gehen.“
Hand in Hand liefen wir die wenigen Schritte zur Tür.
Der lange, enge Treppenaufgang klaffte wie ein Tunnel in der Dunkelheit. Amber gab mir einen Abschiedskuss, dann trat sie hinaus und zog die Tür zu.
***
Amber
Ich schloss die schwere, gepanzerte Tür ab, lauschte, wie die Bolzen einrasteten, und rüttelte zur Sicherheit noch einmal an der Klinke. Es würde einen Grund geben, warum dieser Raum wie ein Tresor gesichert war.
„Bis bald“, klang Julius’ Stimme gedämpft hindurch.
„Schlaf gut.“ Waren das die richtigen Worte? Mit dem Schlüssel in der Hand nahm ich die Stufen in Angriff. Obwohl ich nur kurz gedöst hatte, war ich ausgeruht. Ob das dem Bluttausch zu verdanken war? Noch immer fühlte ich mich ein wenig kribbelig, nein, aufgeputscht traf es vielleicht besser. Ich konnte noch immer kaum glauben, dass ich diesem Siegel freiwillig zugestimmt hatte, auch wenn ich Julius glaubte, dass es meinem Schutz diente. Und nun fühlte es sich so … so sonderbar richtig an! Es war, als hätte ich mein gesamtes Leben nur darauf gewartet, dass sich eine Tür in diese geheime Welt öffnete. Vielleicht hatte Julius recht und es war Schicksal.
Ich lauschte in mich hinein. Ja, jetzt fühlte ich mich besser, irgendwie heil. Das Siegel konnte ich spüren wie einen kleinen, lichten Punkt. Beim ersten war mir das gar nicht aufgefallen.
Ob es mich wirklich schützen konnte? Ich dachte zurück an den dunklen Unterton in Julius’ Stimme, als er mir erzählte, dass mein Leben in Gefahr sei. Die Ahnung von dem, was mir zustoßen würde, wenn ich das Siegel ablehnte. Ob es dieser Gordon war, den Julius so fürchtete? Oder vielleicht sogar Curtis?
Fröstelnd verschränkte ich die Arme. Ich würde es herausfinden müssen, falls ich doch mit Julius brechen wollte. Doch für den Moment war es gut so, wie es war. Auf die Vorstellung abzuhauen reagierte etwas in meiner Brust mit schmerzhaftem Ziehen. Die Siegel!
Ich würde dagegen ankämpfen müssen, dass sie über mein Leben bestimmten. Ich war noch immer Herrin meiner eigenen Gedanken, und das würde auch so bleiben.
Entschlossen nahm ich die nächste Treppe in Angriff.
Über mehrere Etagen zweigten Flure ab. Überall roch es nach Erde, aus einer Richtung drang der Duft von einem verbrannten Kraut, wahrscheinlich Salbei, wenn mich meine Sinne nicht täuschten.
Es war merkwürdig, mich hier so frei bewegen zu dürfen, und ich fühlte mich erst wieder wohl in meiner Haut, als ich das Entrée erreichte. Durch zwei Fenster, die auf den Hinterhof hinausgingen, war bereits die Morgendämmerung zu sehen.
Der hohe Raum mit dem Kassenhäuschen war gespenstisch leer. An den Wänden hingen bronzeglänzende Art-déco-Lampen und warfen ihr Licht auf die kassettierte und stuckverzierte Decke. Welch ein Kontrast zu den unterirdischen Gängen und Fluren! Erst jetzt fiel mir auf, dass es auch hier beinahe unheimlich still war. Wo waren all die Menschen, die angeblich im Lafayette lebten?
„Robert?“, rief ich zögernd und dann noch einmal lauter. „Robert!“
Aus einem anderen Gang erklangen eilige Schritte. Es war Robert, direkt gefolgt von Curtis. Der Vampir überholte seinen Diener auf dem letzten Stück und blieb dicht vor mir stehen. Wie immer in seiner Nähe stellten sich mir die Nackenhaare auf. „Guten Morgen, Amber Connan“, sagte er mit seiner dunklen Stimme.
„Guten Morgen“, erwiderte ich zögernd. Wie sollte ich ihn anreden? Julius sprach immer von „Curtis“ oder seinem „Meister“. Aber darauf, dass ich ihn „Meister“ nannte, würde der Typ lange warten können.
Es gefiel mir ganz und gar nicht, wie er mich mit seinen kalten Augen musterte und sich seine Nasenflügel blähten.
Das erinnerte mich an Julius’ Worte. Vampire konnten die Siegel riechen, und genau danach schnupperte er anscheinend gerade.
„Meine Schlüssel, bitte.“ Curtis’ Blick huschte zu dem heller werdenden Lichtstreifen, der durch die Fenster fiel.
Ich gab sie ihm und versuchte, mir nicht anmerken zu lassen, wie sehr mich seine Nähe schaudern ließ.
Er lächelte dankend, doch es wirkte falsch. Seine Augen blieben kühl.
Er blickte seinen Diener an, und die beiden Männer schienen wortlos Zwiesprache zu halten. Schließlich nickte Robert, und Curtis verschwand ohne ein weiteres Wort in dem Flur, der zu seinen Gemächern führte.
Ich sah ihm nach, bis Robert mich an der Schulter berührte.
„Du musst müde sein.“
„Es geht. Ich habe ein bisschen geschlafen.“
Robert nickte lächelnd. Seine dunklen Augen blitzten freundlich und gaben mir augenblicklich das Gefühl, willkommen zu sein.
Er glich in keiner Weise seinem Meister.
„Wenn du möchtest, kannst du dich oben noch ein wenig hinlegen. Oder wäre dir vielleicht nach einem Frühstück?“
„Essen klingt gut.“ Mein Magen fühlte sich regelrecht flau an. Da fiel mein Blick auf die große Standuhr neben dem Kassenhäuschen. „Aber leider bleibt mir wohl keine Zeit mehr dafür. Ich muss zur Arbeit. Kann ich mich hier irgendwo frisch machen?“
„Sicher, komm.“
Robert führte mich zu einem großen Bad im Erdgeschoss und öffnete die Tür. „Handtücher, Duschgel und Seife findest du im Regal. Wenn etwas fehlt, schau einfach in die Schränke. Es gibt vier Badezimmer im Lafayette. Dies hier, dann eines unten für die Unsterblichen und zwei weitere oben bei uns.“
Warum erzählte er mir das? Bildete er sich ein, dass ich jetzt zu den anderen Dienern ins Obergeschoss ziehen würde? Mit Sicherheit nicht!
„Einer der Wachleute wird dich fahren. Dein Auto steht ja noch am Friedhof.“
„Danke.“ Ich wollte schon die Tür schließen, da gewann meine Neugier doch die Oberhand. „Robert, haben Sie mit Curtis gerade über mich gesprochen?“
Er drehte sich im Gehen um und lächelte. „Wir Menschen duzen uns hier, Amber. Und keine Sorge, der Meister hat mich nur gebeten, es dir an nichts fehlen zu lassen. Curtis ist dir sehr dankbar. Es ist wirklich schön, dass du hier bist“, setzte er noch hinzu, dann eilte er eine enge Wendeltreppe hinauf.
Ich sah ihm lange nach. Für Robert mochte das der Wahrheit entsprechen, aber bei Curtis hatte ich so meine Zweifel.
***
Daniel Gordon
Gordons Diener Nate ließ eilends die Jalousien hinunter, um den erwachenden Morgen auszusperren. Der Meister nahm seine unruhige Wanderung durch das Zimmer wieder auf.
„Willst du dich nicht doch lieber zurückziehen?“, fragte Nate.
„Nein!“, fauchte der Meister. „Es wird nicht lange dauern.“
Ein zögerndes Klopfen an der Tür unterbrach sie. Der Gestank, der durch den Türschlitz drang, ließ keinen Zweifel daran, wer da um Einlass bat.
„Komm rein!“
Frederik schlich in den Raum. Noch ehe er die halbe Strecke zu Gordon zurückgelegt hatte, stand dieser plötzlich mit glühenden Augen vor ihm und schlug zu. Die Faust traf den Untoten an der Schläfe und katapultierte ihn in den Winkel neben der Tür.
Während Frederik keuchend liegen blieb, wischte sich Gordon angeekelt die Hand ab. „Wie kann man nur so unfähig sein?“, donnerte er.
„Verzeih mir, Meister“, wimmerte Frederik und hob sein graues Gesicht. „Ich werde es wiedergutmachen, ich finde Lawhead, ganz bestimmt.“
„Nate, gib ihm die Schlüssel.“
Nate ließ einen Autoschlüssel und einen Stadtplan auf den Boden vor dem Untoten fallen.
„Du hast nur einen Versuch. Enttäuschst du mich wieder, filetiere ich dich eigenhändig, und wenn ich dabei das Kotzen kriege, hast du verstanden?!“
Frederik presste die Stirn auf den Boden. „Ja, Meister.“
Gordon stürmte an ihm vorbei. Es war höchste Zeit für ihn, in seinem Sarg zu verschwinden.
***
Julius
Ich war wieder da, in meiner Gruft auf dem Hollywood Forever, gefangen in den schwarzen Spinnenfäden eines Albtraums. Frederik schnitt mir einen Finger nach dem anderen ab. Alles war voller Blut, es durchtränkte meine Kleidung und die Kissen unter mir.
Ich schrie, laut und durchdringend, aber ohne meinen Mund zu öffnen.
Der Albtraum endete erst, als ich Amber ängstlich meinen Namen rufen hörte. Meine Panik hatte sich auf sie übertragen. Ihre Stimme zog mich wie auf einem Lichtpfad hinaus aus der Hölle meiner Träume.
Geborgen lag ich in meinem verriegelten Sarg in Curtis’ Gemächern. An mein Ohr drang das leise Knacken des Kaminfeuers. Mühsam schlug ich die Augen auf.
Es war pechschwarz, natürlich. Die Enge erschien mir beinahe unerträglich, gefangen in dieser Kiste und meinem eigenen Körper.
„Julius? Julius, was ist mit dir? Ist er wieder da?“, hörte ich Ambers Stimme in meinem Kopf. Seitdem wir das zweite Siegel getauscht hatten, war sie deutlicher zu vernehmen als zuvor.
„Ich hatte einen Albtraum“, beruhigte ich sie. „Darf ich durch deine Augen blicken?“
Sie stimmte zu, und ich trat ein.
Wir standen an einer kleinen Werkbank. Vor uns lag ein weißer Bilderrahmen, den Ambers Hände mit einem Stück Schleifpapier bearbeiteten.
„Wo bist du?“, fragte ich.
„In unserer Werkstatt“, antwortete sie. Auf einem gusseisernen Herd kochte Leim in einem großen Topf, der von einem jungen Mann stetig umgerührt wurde. In einem Gestell lagerten Holzrahmen. Ein älterer Mann, offensichtlich Ambers Lehrmeister, polierte einen Goldrahmen.
Nach und nach verflog Ambers Anspannung.
Sie unterhielt sich wieder ganz normal mit ihren Kollegen, und ich dämmerte in ihrem Kopf vor mich hin. Hier, bei ihr, war ich vor Albträumen sicher.
Das monotone Schleifgeräusch lullte mich ein, und der Schlaf hatte mich wieder.
Endlich war der quälend lange Tag vorüber. Die Sonne ging unter, und ich begann, mich aus meiner Totenstarre zu lösen.
Mein Herz tat einige heftige, schmerzhafte Schläge, als wollte es sich überzeugen, dass es auch heute noch funktionierte. Das Blut begann zu fließen und weckte meinen Körper. Vorsichtig beugte ich meine Finger. Der kleine machte die Bewegung noch nicht mit, aber er war wieder angewachsen. Dort, wo mich der Pfeil getroffen hatte, schmerzte mein Oberschenkel dumpf, doch insgesamt hätte es schlimmer sein können.
Stein kratzte über Stein. Ein Sarg wurde geöffnet. Curtis war neben mir erwacht. Ich hörte seine leisen, für einen Menschen kaum wahrnehmbaren Schritte.
Er räusperte sich. Mit einem elektronischen Knacken erwachte die Stereoanlage, und bald erklangen die sanften Töne einer Schubertsonate von einer der liebsten Schallplatten meines Meisters. Er legte Holz nach, und ich stellte mir vor, wie Asche und Glut aufstoben.
Es knisterte.
Curtis kam zu mir und blieb stehen. Er strich mit der Hand über meinen Sarg, und ich bildete mir ein, seine Berührung auf der Haut spüren zu können.
„Julius“, flüsterte er.
Ich tastete mit den Fingern nach dem Hebel und fand ihn unter dem dicken Polster. Die Verriegelung schnappte beinahe geräuschlos auf.
Curtis öffnete den Deckel für mich. „Guten Abend, mein Sohn.“ Er kniete sich neben mich und musterte besorgt meine Verletzungen.
„Guten Abend, Curtis.“
„Es geht dir besser?“
„Ja. Ich spüre, dass es heilt.“
„Schön.“
Ich seufzte, als mein Herz zu schlagen begann, setzte mich auf und strich über die Außenwand des Sargs. Meine Finger glitten über Perlmuttintarsien und Malereien und fanden im Lack nicht die geringste Unebenheit. Der Sarg selbst war etwas breiter als gewöhnlich und ließ mich die Enge kaum spüren.
„Ich habe ihn als Geschenk für dich anfertigen lassen“, sagte Curtis. „Er wartet schon eine ganze Weile auf dich.“
Ich war überrascht von seiner Großzügigkeit. „Danke, er ist wunderschön.“
Doch mein Meister nickte nur gedankenverloren. Ich spürte, dass ihn etwas beunruhigte.
Im Hintergrund sangen Schuberts traurige Geigen. „Weißt du noch, als wir bei dem Konzert waren, Curtis?“
Er stand auf. „Ja“, antwortete er knapp.
„Wann war das noch mal?“
„1839 im Gewandhaus in Leipzig. Wir haben Deutschland und Polen bereist. Du warst noch ganz grün hinter den Ohren.“
Ich lächelte bei dem Gedanken an die längst vergangene Zeit. Meine glücklichen Jahre. Alles war so neu und wunderbar gewesen, damals.
„Heute Morgen muss irgendetwas geschehen sein. Hast du es auch gefühlt?“, fragte er plötzlich.
Ich stand auf. „Nein, nichts.“
Curtis ging auf und ab, seine blauen Augen lagen in dunklen Schatten.
Ich wusste, dass ich ihn jetzt nicht unterbrechen durfte.
Er schloss mich bewusst aus seinen Gedanken aus. Im Geiste sprach er bereits mit anderen Clanführern.
Um ihn nicht weiter zu stören, verließ ich die unterirdischen Gemächer. Als ich das Entrée erreichte, brachen Kathryn und Dava gerade zur Jagd auf. Sie würdigten mich keines Blickes. Wäre mir mein Stolz nicht in die Quere gekommen, hätte ich mich ihnen angeschlossen.
In mir rumorte der Hunger. Mein Körper brauchte frische, menschliche Lebensenergie, um zu heilen. Vielleicht würde es mir später gelingen, alleine vor dem alten Kino Beute zu machen, wenngleich Curtis streng verboten hatte, so nahe an der Zuflucht zu jagen.
Doch erst einmal führten mich meine Schritte zu Steven. Er war aus seinem Sarg gehoben und in ein schlichtes Bett gelegt worden. Sein Schöpfer Manolo musste das getan haben, denn der Geruch des Vampirs hing noch in der Luft. Ich spürte außerdem, dass er Steven bereits von sich hatte trinken lassen.
Ich setzte mich zu dem jungenhaften Vampir und betrachtete sein regloses, wächsernes Gesicht. Um die Augen und an den Mundwinkeln gruben sich feine Falten in die Haut, die ich früher nicht bemerkt hatte.
Er schlief tief und fest. Seine Gedanken wandelten auf Pfaden, die ich nicht erreichen konnte. All das war nur geschehen, weil er bei mir geruht hatte.
Plötzlich stand Brandon in der Tür.
Ich wusste es, ohne mich umzusehen. Er war noch immer wütend und konnte seinen Zorn nur mühsam unterdrücken. „Komm mit, Curtis will, dass wir zusammen jagen.“ Er zog mich unsanft auf die Beine.
Na großartig! Der Meister hätte sich keinen Besseren einfallen lassen können. Ich humpelte neben dem Halbindianer bis nach draußen zu seinem Wagen. Brandon hielt nicht viel von Unauffälligkeit. Er fuhr einen mattschwarzen 77er Pontiac Firebird mit einer riesigen Krähe auf der Motorhaube.
Brandon startete den Motor und wartete, bis ich mich in den tiefen Sitz gequält hatte. Ich sah ihn ratlos an.
Sein dunkler, fast schwarzer Blick gab mir Rätsel auf.
„Also, wohin willst du?“, fragte er seufzend.
Ich zuckte mit den Schultern.
„Ein Klub ist wohl nichts in deinem Zustand. Wie wäre es mit Huren?“
„Nicht nach meinem Geschmack, wäre heute aber vielleicht die beste Wahl“, erwiderte ich niedergeschlagen.
Brandon trat aufs Gas. Er starrte auf die Straße und vermied es, mich anzusehen.
Ich war noch nie mit ihm gefahren. Im Leder des Beifahrersitzes nahm ich Christinas schwachen Geruch wahr. Vom Spiegel baumelten eine Adlerfeder und ein zerrissenes indianisches Türkisarmband. Ob sich Brandon nach der Zugehörigkeit zu einem Stamm sehnte? Ich wusste, dass er lange nichts von seiner Herkunft gewusst hatte und erst nach dem Tod seines alten Meisters auf die Suche nach seinen Ahnen und seiner Familiengeschichte gegangen war.
Wir hatten den Freeway schweigend hinter uns gebracht und fuhren jetzt durch Nebenstraßen.
„Mann, war das heftig gestern“, sagte Brandon plötzlich, ohne mich anzusehen. „Als ich euch schreien gehört habe, dachte ich, er bringt euch um.“
„Das dachte ich auch.“
„Man sagt, es war ein Racheakt, weil du wieder eins von Gordons Kindern kaltgemacht hast.“
„Eigentlich drei.“
„Drei?“ Brandon pfiff anerkennend durch die Zähne.
Am Straßenrand tauchten die ersten Prostituierten auf, und wir drosselten das Tempo.
Abgerissene Gestalten starrten uns an, pralle Schenkel in viel zu kurzen Röcken reckten sich uns entgegen.
Ich musterte das miserable Angebot. „Such du, ich bin noch zu schwach.“
Brandons Augen verengten sich zu Schlitzen. Seine Wahl fiel auf zwei junge Prostituierte, halbe Kinder noch. Wir hielten neben ihnen, und Brandon ließ den Charme der Unsterblichen spielen, auch wenn er sich die Magie hier eigentlich hätte sparen können.
Die Mädchen stiegen ein und nannten uns eine Absteige. Ich hatte selten in so unglückliche Augen gesehen. Brandon gab Gas. Wir wollten es beide so schnell wie möglich hinter uns bringen.
Ich wischte mir über den Mund, obwohl längst kein Blut mehr daran klebte. Brandon rieb sich die Hände an der Hose. Es war nicht zu übersehen, dass er sich ebenso ekelte wie ich. Wir verließen die Absteige, und ich wäre das letzte Stück zum Wagen am liebsten gerannt, so sehr wünschte ich mich fort von diesem abstoßenden Ort und zurück ins Lafayette, wo Amber bald eintreffen musste.
Brandon hatte sich wieder in Schweigen gehüllt. Hin und wieder sah er mich aus dem Augenwinkel an. Blicke, die ich nicht recht zu deuten wusste.
„Ich weiß genau, dass du letzte Nacht noch von ihr getrunken hast“, sagte er schließlich. „Warum ging das vorher nicht? Warum musstest du Christina entehren?“ Seine Fingerknöchel traten weiß hervor, und seine Schultern waren so angespannt, dass mir der bloße Anblick wehtat.
„Amber hat das erste Siegel nicht gewollt, sie war ohnmächtig, als sie es bekam“, gestand ich nach einem Moment der Stille.
„Was?!“, rief Brandon ungläubig. „Man gibt sein unsterbliches Blut nicht an jemanden, der es nicht will, das verbietet der Codex!“
„Es war die einzige Möglichkeit, Brandon. Wir kannten uns ja noch nicht einmal! Anders hätte ich sie am ersten Abend nie dazu bekommen.“
Der Indianer starrte mich entsetzt an, bis ich kurz davor war, ihn zu ermahnen, wieder auf die Straße zu sehen.
„Du kannst doch keine Wildfremde, die noch nicht einmal weiß, wer, geschweige denn was du bist, für die Ewigkeit an dich binden!“
„Es war Curtis’ Befehl“, rechtfertigte ich mich. „Nachdem sie es herausgefunden hatte, habe ich ihr versprechen müssen, nie wieder von ihr zu trinken.“
„Und wieso trug sie dann bitte heute Morgen das zweite Siegel? Du redest dich um Kopf und Kragen, Julius!“
„Als sie gesehen hat, wie schwach ich war, wollte sie mir helfen. Sie hat es sich eben anders überlegt.“
„So einfach ist das?“
„Ja, so einfach!“
Wir hielten vor dem Lafayette. Als wir ausgestiegen waren, rief Brandon wutentbrannt: „Weißt du was, Julius? Wenn das so einfach ist, dann will sie mich ja vielleicht auch!“ Er stürmte an mir vorbei und verschwand mit wehendem Haar im Gebäude.
Ich war einen Augenblick sprachlos, dann humpelte ich ihm so schnell ich konnte hinterher. „Wage es nicht!“, schrie ich. „Wage es nicht, oder ich bringe dich um!“
Doch Brandon war schon längst in den Tiefen des alten Kinos verschwunden.
***
Amber
Nach der Arbeit war ich nur schnell nach Hause gefahren, um nach Mama zu sehen. Kurz nach acht erreichte ich das Lafayette. Ich parkte in einer Seitenstraße und lief das letzte Stück. Vom Meer trieb ein kühler Wind heran. Einige Familien, die den Tag am Strand verbracht hatten, drängten sich an einer Bushaltestelle. Ich zwängte mich vorbei und winkte einem kleinen Mädchen zu, das versuchte, den Sand aus seinen Sandalen zu schütteln. Hier ahnte niemand von der Existenz der Unsterblichen, die nur eine Straße weiter ein altes Kino zu einer Festung ausgebaut hatten. Der Gedanke, dass ich noch vor wenigen Tagen ebenfalls zu diesen Unwissenden gezählt hatte, erschien mir absurd.
Vor dem Komplex standen Bäume, deren schütteres Laub im Wind raschelte.
Von außen wirkte das Kino wie einer der noblen Privatklubs, von denen es in L.A. und Santa Monica so einige gab.
Schon von Weitem bemerkte ich, dass heute zwei Wachleute vor der schwarzen Metalltür standen, die den Haupteingang bildete.
Zögernd blieb ich vor ihnen stehen. „Guten Abend, ich würde gerne …“
Bevor ich meine Frage beendet hatte, öffnete einer der Wachmänner die Tür, indem er einen Zahlencode eingab, während der andere in einer Sprache, die osteuropäisch klang, etwas über sein Headset durchgab. Drinnen wurde ich von einer mir unbekannten Frau empfangen, die mir erklärte, dass Julius jagen sei und bald zurückkommen würde.
Auf meine Bitte hin brachte sie mich zu Steven und ließ mich mit ihm allein.
Wieder diese Stille.
Ich stellte meine Handtasche auf dem Boden ab und atmete tief durch. Allein in der Festung der Vampire. Merkwürdigerweise fühlte ich mich hier nicht mehr so fehl am Platz, obwohl mein erster Aufenthalt im Lafayette so verstörend gewesen war.
Steven bildete einen Teil dieser schlechten Erinnerungen. Doch ich konnte ihm nicht wirklich böse sein, wie er da schlafend in seinem Bett in einem kleinen, unterirdischen Raum lag. Es gab zwar keine Fenster, aber Bilder an den Wänden, eine Kommode und Schränke. Auf dem Boden lag ein dicker, cremefarbener Teppich.
Steven sah viel besser aus als gestern, aber immer noch schwer gezeichnet. Sein Oberkörper war nackt. Ein Verband bedeckte die Stelle, wo ihn der Pfeil getroffen hatte. In Stevens Brust, direkt neben dem Herzen, klaffte ein schwarzes Loch. Es blutete weder noch hatte sich eine Kruste gebildet.
Es tat mir leid, ihn so zu sehen. Es war mein Bruder gewesen, der ihm das angetan hatte!
Ich zog mir einen Stuhl heran, setzte mich und nahm Stevens Hand in meine, wie ich es bei jedem anderen Kranken auch getan hätte. Seine Haut war kalt, zäh und lederartig, die Finger seltsam starr.
„Wie geht es dir?“, fragte ich leise, doch Steven bewegte nur kurz die Augenlider. Er schien mich nicht hören zu können – ganz anders als Julius, dessen Präsenz ich den ganzen Tag lang gespürt hatte. Oft war es mir sogar angenehm gewesen, dieses kleine Geheimnis im Herzen zu tragen. In anderen Momenten aber hatte ich es als quälend und beängstigend empfunden. Konnte er meine Gedanken lesen? Und wenn ja, ließ sich das vermeiden?
Heute, so kurz nach dem Überfall, war es okay gewesen. Aber wenn ich weiterhin ein Privatleben haben wollte, das diese Bezeichnung auch verdiente, musste ich lernen, Grenzen zu ziehen.
„Na? Wie geht es unserem Patienten?“, tönte plötzlich eine tiefe, samtweiche Stimme hinter mir.
Vor Schreck wäre ich beinahe vom Stuhl gefallen.
Ich fuhr herum und sah in die unheimlichen, kohlschwarzen Augen von Brandon Flying Crow, dem Indianer, der mir am Vorabend vor die Füße gespuckt hatte. Jetzt lag Genugtuung in seinem Blick.
Sein Auftritt hatte die erwünschte Wirkung nicht verfehlt. Mein Herz raste, ich saß in der Falle.
Flying Crow lehnte lässig am Türrahmen. Er trug eine schwarze Jeans und ein hellblaues, weites Hemd. Sein Haar schimmerte wie Ebenholz. Im Gegensatz zu den anderen Vampiren sah er unglaublich lebendig aus. Seine Schönheit war betörend.
Ich ertappte mich dabei, seine Makellosigkeit zu bewundern. Doch dann zog er plötzlich die Oberlippe hoch und entblößte rasiermesserscharfe Fänge.
Ich sprang auf, doch der Schrei blieb mir im Hals stecken.
Was hatte Julius gesagt? Dass er diesen Unsterblichen schwer beleidigt hatte. Zum ersten Mal wünschte ich mir das Messer herbei.
„Komm nicht näher, du darfst mir nichts tun“, sagte ich bemüht ruhig und streckte in einem jämmerlichen Versuch, tapfer zu wirken, das Kinn vor.
Meine Worte bewirkten das Gegenteil. Brandon genoss meine Angst und spielte mit seiner Überlegenheit: Im einen Moment strich er noch sein Hemd glatt, im nächsten stand er bereits neben mir am Krankenbett. Viel zu spät kam ich darauf, die Siegel zu benutzen, und während ich versuchte, sie zu finden und irgendwie zu öffnen, bohrte sich Brandons Blick schon in meinen.
Ehe ich wegschauen konnte, stand ich unter seinem Bann und erstarrte, zur Reglosigkeit verdammt.
Brandon ging um mich herum und musterte mich abschätzend.
„Du bist wirklich schön, auf deine Weise“, flüsterte er gegen meine Wange. Schwerer Blutgeruch lag in seinem Atem.
„Weißt du, was dein Liebster Julius gerade getan hat?“, fragte er höhnisch. Er strich mir über den Kopf, legte seine Hand auf meine Schulter und berührte mit dem Daumen den Puls an meinem Hals – eine Drohung, der ich nichts entgegenzusetzen hatte.
Das darf er nicht, dachte ich schwach, doch der Bann war zu stark. Puls und Atem wurden ruhig, fast träge. Meine Gedanken bewegten sich wie durch zähen Sirup. Die Angst war fort, und ich sah nur noch diesen unendlich schönen Mann vor mir.
Mit seinen hohen Wangenknochen, dem maskulinen Kinn und den dunklen Mandelaugen glich er den würdevollen Indianerporträts aus der Anfangszeit der Fotografie.
Mein Blick hing an seinen sinnlichen Lippen. Seine Sprache hatte eine besondere Melodie. Im Gegensatz zu Curtis und Steven wurde seine Stimme nicht tiefer, wenn er seine Kraft benutzte, sondern klar und weich.
„Julius und ich waren gerade in Hollywood und haben uns zwei hübsche Huren gesucht. Es waren noch halbe Kinder.“
In meinem Kopf tauchten plötzlich Bilder auf. Julius, wie er sich über eine junge blonde Frau beugte. Die Prostituierte lag auf einem dreckstarrenden Bett und hielt die Beine weit gespreizt.
Es sah aus, als küsse er die Fremde leidenschaftlich. Ich war mir sicher, dass er nur trank. Dennoch schmerzte mich der Anblick, und ich hasste Brandon dafür, dass er mir diese Szenen zeigte. Auch wenn ich mittlerweile akzeptiert hatte, dass Julius Blut trinken musste, um zu existieren, regte sich leise Eifersucht in mir.
„Siehst du? Julius ist dir nicht treu. Und du musst es auch nicht sein. Was hat er, das ich dir nicht geben kann? Du könntest meine Gefährtin werden. Unsterblichkeit, das ewige Leben, willst du das?“
Er kam mir so nahe, dass sein muskulöser Oberkörper meine Brust berührte, und ich hatte das Gefühl, in seinen schwarzen Augen zu ertrinken.
„Kinder der Dunkelheit, Blumen der Nacht – wenn du willst, kann ich dir gerne den ganzen Kitsch herunterbeten, auf den Julius so steht.“
Er beugte sich vor und küsste meinen Hals. Gänsehaut. Ich zitterte am ganzen Körper, ohnmächtig vor Wut. Unter seinen weichen Lippen spürte ich seine Zähne. Brandons Raubtiergebiss kratzte über meine Haut. Noch spielte er mit mir, aber gleich würde er zubeißen. Gleich. Mir brach der kalte Schweiß aus.
Warum kam Julius nicht endlich? Wofür waren diese verdammten Siegel gut, wenn sie mich im Stich ließen, sobald ich sie wirklich brauchte?
„Lass sie in Ruhe, Brandon.“ Stevens Stimme war schwach, und die Worte kamen abgehackt. „Sie gehört dir nicht.“
Brandon riss den Kopf herum. „Halt dich da raus, Steven, das ist eine Sache zwischen Julius und mir.“
Endlich erlangte ich die Kontrolle über meinen Körper zurück. Mit voller Wucht rammte ich Brandon mein Knie zwischen die Beine. Ich hatte gut gezielt.
Der Angriff traf ihn völlig unvorbereitet. Er taumelte keuchend rückwärts und stieß einen kleinen Tisch um. Verbandszeug und ein Kerzenständer fielen polternd zu Boden. Ich trat ihm noch einmal in den Bauch, dann rannte ich aus dem Zimmer, so schnell mich meine Füße trugen.
Und kaum brauchte ich sie nicht mehr, rissen die Siegel auf.
***
Julius
Als ich das Bad verließ, in das ich mich kurz zurückgezogen hatte, um mich nach meiner unliebsamen Mahlzeit frisch zu machen, zerrte Amber plötzlich an den Siegeln.
Ich hatte sie fest verschlossen, weil ich nicht wollte, dass Amber etwas von meinem Ausflug zu den Prostituierten mitbekam. Als unsere Verbindung nun aufriss, brandete mir ein wildes Durcheinander aus Furcht und Zorn entgegen, aus dem ich mir keinen Reim machen konnte. Etwas Böses war im Gange. „Amber!“
Aufgrund der Toten im Boden funktionierte mein Spürsinn nicht richtig. Ich rannte in den Flur und stieß dort fast mit Amber zusammen. Sie war völlig aufgelöst. In abgehackten Sätzen berichtete sie mir, was gerade vorgefallen war.
„Dieser verdammte Mistkerl!“, stieß ich hervor. Ich hätte ahnen müssen, dass Brandon so etwas tun würde. Doch er stand in der Clan-Hierarchie so weit unter mir, dass ich naiverweise angenommen hatte, er würde es bei seinen üblichen Sticheleien belassen.
Nicht im Traum hätte ich mir vorgestellt, dass ausgerechnet der traditionsbewusste Brandon die Regeln derart mit Füßen treten würde. Er stand Stufen unter mir!
Und nun war er zu weit gegangen, viel zu weit. Den Diener eines anderen Vampirs zu bedrohen, war ein großer Affront.
Ich wollte ihn sofort zur Rede stellen.
„Lass gut sein, Julius! Das bringt nichts“, sagte Amber ruhig. „Abgesehen davon muss er sich noch von einem saftigen Tritt in die Eier erholen.“ Sie lächelte grimmig, doch gänzlich überspielen konnte sie den Schock damit nicht.
„Er nimmt sich zu viel heraus“, presste ich hervor.
„Wenn du dir anmerken lässt, dass er dich getroffen hat, dann hat er sein Ziel erreicht“, erwiderte Amber ruhig.
„Ich werde ihm zeigen, mit wem er sich anlegt!“
„Bitte, Julius.“
Amber stellte sich mir in den Weg und legte ihre Hände auf meine Brust. Vielleicht hatte sie recht. Ich bezwang meinen Zorn.
„Er hat nicht dich bedroht, sondern mich, und ich möchte nicht, dass du deshalb Streit anfängst.“
„Du musst auf jeden Fall lernen, dich vor dem Einfluss anderer Vampire zu schützen“, erwiderte ich ernst.
Amber nickte und legte mir einen Arm um die Hüfte. „Ich habe versucht, dich über die Siegel zu erreichen, aber irgendwie bin ich nicht durchgekommen.“
„Ich habe mich abgeschirmt, das hätte ich nicht tun dürfen.“
„Aber warum hast du es dann gemacht?“
„Ich … weil …“
„Brandon hat mir gezeigt, wo ihr wart“, sagte sie nüchtern.
„Dieser Idiot!“
„Ich weiß, dass du nur Blut getrunken hast, Julius“, sagte Amber ruhig, doch ich sah ihr an, dass ihr die Wahl meiner Mahlzeit nicht zusagte.
Dennoch reichte ihre bloße Nähe aus, um meine Wut auf Brandon zu besänftigen. Irgendwie gelang es ihr, meine ewige innere Unruhe zum Schweigen zu bringen. Sie zog mich aus dem rasenden Sog der Zeit. Ihr, einer Frau, die ich kaum und doch schon mein Leben lang zu kennen glaubte, gelang das, woran selbst mein Schöpfer oft scheiterte.
„Wann bringst du mir das mit den Siegeln bei?“, fragte sie.
„Wir fangen noch heute an, versprochen.“
Eingehüllt in ihre Wärme gingen wir Arm in Arm zum Versammlungsraum.
Als wir das Entrée passierten, flog die Eingangstür des Lafayette auf und schlug mit Wucht gegen die Wand.
Ich fuhr blitzschnell herum und stieß Amber schützend hinter mich.
Wie ein Blitz schoss ein Geschöpf in den Raum. Ich spürte, dass es sich um eine Vampirin handelte, doch erst, als sie abrupt stehen blieb, erkannte ich die Meisterin Liliana Mereley, die noch am Vorabend Steven geholfen hatte. Mein rasender Puls beruhigte sich. Kein Angriff, keine Gefahr.
Doch etwas musste geschehen sein. Liliana starrte uns mit geröteten Augen an. Tränen rannen über ihre Wangen, ihre Hände waren zu Fäusten geballt.
Die Energie, die sie verströmte, war kalt und bitter, und es lag ein Schmerz darin, der mich nach Luft ringen ließ. Ohne mein Zutun flossen meine Empfindungen durch die Siegel zu Amber, und sie stöhnte entsetzt auf.
„Geh“, flüsterte ich, „geh und lass uns allein.“
Ich brauchte es ihr kein zweites Mal zu sagen. Amber war froh, diesen Gefühlen entfliehen zu können, und brachte sich in einem der Gänge in Sicherheit.
„Julius!“, schluchzte Liliana.
Ich eilte zu ihr, schloss sie in meine Arme und hielt ihren bebenden Körper. Sie klammerte sich an mich, als sei ich das einzig Feste in einer sich auflösenden Welt.
Ihre Energie floss ungebremst in meine und überwältigte mich mit ihrem Schmerz. Die Vampirin hatte jegliche Barrieren fallen gelassen.
Mit zitternden Fingern streichelte ich ihr langes Haar.
„Was ist nur geschehen?“, flüsterte ich.
„Sie haben ihn getötet!“, schluchzte sie. „Diese Bestien haben ihn umgebracht!“
Ihre Worte schnürten mir die Kehle zu. Allmählich ahnte ich, was passiert war. „Komm, komm mit und setz dich.“
Liliana ließ sich von mir in den Versammlungsraum führen.
„Wer hat wen getötet?“, fragte ich, sobald wir alleine waren.
„Adrien … mein Blut, mein Erstgeborener, mein Geliebter!“
Meine Ahnung stimmte. Adrien. Der zweite Jäger. Wir hatten vieles geteilt: die Leidenschaft für die Jagd und natürlich die Verachtung, die uns die anderen Vampire deshalb entgegenbrachten.
„Sie haben ihn hingerichtet, Julius, sie haben ihn zerstückelt! Meinen Adrien.“
Ich wusste, wie sehr sie ihn geliebt hatte. Sie waren seit langer Zeit Gefährten gewesen. Sie, die Clanherrin der Mereleys, und ihr Jäger.
Neben Curtis gab es keinen Vampir, den ich mehr verehrte als Liliana. Sie besaß alles, was unsere Art ausmachte, in Vollkommenheit: Weisheit, Stärke, betörende Schönheit. Sie maß Jahrhunderte. Umso schrecklicher war es, sie derart verzweifelt zu sehen.
„Schau“, wimmerte sie, „schau nur, Julius!“
Ehe ich es verhindern konnte, stürzten Bilder auf mich ein, die sie mit all der Macht, die ihr gegeben war, in mein Bewusstsein presste. Adriens Dienerin Kala lag in einem schwarzen See aus Blut, ihr Gesicht war fast bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert.
Doch die Leiche der Frau war nichts gegen die übrige Szenerie in dem Keller, in dem sie lag. Überall war Blut, an den Wänden, auf dem Boden und sogar an der Decke. Als hätte jemand eimerweise Farbe verschüttet. Lackrot. Rubin. Purpur, an den Rändern braun, trocken, aufgeplatzt wie vertrocknete Flussbetten.
Adriens Gesicht starrte mich von einem Kerzenständer aus an. Der Mörder hatte seinen Kopf aufgespießt. Der Körper lag zerhackt im Sarg, blutige Fetzen auf dem Teppich davor.
Mein Magen rebellierte.
Die Bilder wechselten, und ich sah die letzten Sekunden von Adriens Leben durch seine Augen. Anscheinend hatte er seine Herrin im letzten Moment um Hilfe angefleht. Es war dunkel, dann wurde sein Sarg aufgerissen und im grellen Licht erschien ein Mann. Es war Frederik. Er hielt Adriens Schwert hoch über seinen Kopf. Er lachte ebenso irrsinnig wie bei mir, und dann schlug er zu, wieder und wieder, während Adrien tonlos schrie, bis sein Blick verschwamm und schließlich brach.
Liliana bebte in meinen Armen. Sie schlug mir mit der Faust gegen den Oberkörper und schrie. Verzweifelt versuchte ich, mich von ihrem Einfluss freizumachen, doch sie war zu stark, zu mächtig.
Neue Bilder stürzten auf mich ein. Nun waren es ihre Erinnerungen. Ich sah mit an, wie sie Adriens abgeschlagenen Kopf an sich nahm und seine verzerrten, toten Lippen küsste. Der Griff, mit dem sie mich umklammerte, war unnachgiebig. Ihr Schmerz schnürte mir die Kehle zu und stach wie Messer auf mich ein. Es wurde unerträglich.
„Liliana! Du tust mir weh!“
Plötzlich gab sie mich wieder frei und stieß mich von sich. Ich taumelte zur Seite, stürzte ins Bad und erbrach Blut und bittere Galle.
Es war Frederik gewesen! Dieser verfluchte Sadist!
Während ich mir das Gesicht mit kaltem Wasser wusch, öffnete ich instinktiv die Siegel und griff nach Ambers Lebensenergie. Ich brauchte Kraft.
Amber spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Als ich aus dem Bad trat, erwartete sie mich schon und legte mir den Arm um die Hüfte. Mir war noch immer übel.
Liliana hatte sich unterdessen auf einen Stuhl gesetzt. Ihre verzweifelten Schreie waren einem stummen Zittern gewichen. „Verzeih mir, Julius, das habe ich nicht gewollt.“
Ich schüttelte den Kopf. Es gab nichts zu verzeihen, sie hatte es nicht absichtlich getan.
„Wir werden ihn finden“, versprach ich ihr heiser, „und er wird sich wünschen, niemals gelebt zu haben!“
Der Groll kam aus meinem tiefsten Herzen, und ich meinte jedes Wort, das ich sagte. Ich würde ihn leiden lassen, wie noch nie jemand unter meinen Händen gelitten hatte!
Amber legte mir beruhigend die Hand auf den Arm, doch ich ignorierte es.
„Komm, Julius“, drängte sie und verstärkte ihren Griff.
Aber ich war noch nicht bereit zu gehen, ich war zu aufgewühlt.
„Ich bringe ihn um!“, schrie ich, als könnten meine Worte Lilianas Schmerz lindern oder Adrien wieder zurückholen. „Dieses verdammte Monster! Ich bringe ihn um!“
„Beruhige dich, Julius“, flüsterte Amber beschwörend und zog mich endgültig fort.
„Was ist passiert?“
Langsam fand ich wieder zu mir zurück und versuchte, die Ereignisse zusammenzufassen.
Amber erbleichte. „Du musst nicht mehr sagen, Julius.“ Sie wusste genau, was ich verschwieg: dass ihr Bruder das getan hatte.
Jetzt gab es keine Rettung mehr für ihn. Ich würde ihn jagen wie eine tollwütige Bestie und nicht eher ruhen, bis das zurückgezahlt war, was er uns angetan hatte. Steven, mir und vor allem Adrien.
Mein leichtfertiges Versprechen, das ich Amber noch vor wenigen Tagen in ihrem Heim gegeben hatte, galt nicht mehr. Ich konnte ihren Bruder nicht schonen, nicht einmal mehr um ihretwillen.
Als wir in den Versammlungsraum zurückkehrten, war Curtis bei Liliana und sprach leise auf sie ein. Sie saßen auf dem Sofa. Nun sahen sie auf. „Julius, komm her“, befahl Curtis knapp.
Ich ließ Amber stehen und ging neben Liliana in die Knie.
„War das Frederik, Julius?“, fragte er.
Ich nickte. „Ich habe ihn in Adriens Erinnerungen gesehen. Er war deutlich zu erkennen.“
„Und du bist dir sicher, Gordons Blut an ihm gerochen zu haben?“, fragte Liliana mit leerer Stimme.
„Ganz sicher.“
Curtis tauschte einen Blick mit ihr. „Das sind selbst für Fürst Andrassy ausreichende Beweise. Ich denke, wir sollten …“
„… den Rat einberufen“, ergänzte sie, sah mich plötzlich mit wachen Augen an und ergriff meine Hände. „Julius, du wirst vor dem Rat sprechen und bezeugen, dass dieser Mörder zu Gordon gehört.“
Ich nickte. „Das muss ein Ende haben.“
Liliana stand auf, und ich erhob mich mit ihr. „Ich fahre jetzt gleich zum Fürsten. Morgen Nacht treffen wir uns dann mit den anderen.“
Curtis begleitete Liliana hinaus.
Ich blieb zurück und sah ihnen hinterher. Nur langsam wurde mir die Bedeutung dieses Gesprächs bewusst. Frederiks Angriff hatte den schwärenden Konflikt auf eine neue Stufe gehoben. Niemand konnte länger ignorieren, was vor sich ging. In gewisser Weise hatten wir insgeheim sogar auf solch eine Situation gehofft. Denn nun würde der Rat endlich gezwungen sein zu handeln. Gordon musste aufgehalten werden, bevor er zu mächtig wurde. Es würde zum Krieg zwischen den Clans kommen.
Mit grimmiger Entschlossenheit bleckte ich die Zähne.
Schritte erklangen auf dem Holzboden. Amber kam auf mich zu. Hastig drehte ich mich weg, damit sie das Feuer in meinen Augen nicht sah.
Nachdem Liliana das Lafayette verlassen hatte, bestellte Curtis Amber und mich zu sich in sein Büro. Unsere Herzen schlugen im Gleichtakt, als wir den großen, dunklen Raum unter der Bühne betraten.
Ich schaltete mehr Licht an, um die Stimmung für meine menschliche Begleiterin angenehmer zu machen, und schloss die Tür hinter uns.
Im Schein der Wandlampen schälten sich Seile und Ketten aus dem diffusen Grau. Die alten Mechaniken, die einst Vorhänge und Leinwände bewegt hatten, waren noch immer in gepflegtem Zustand. Zwischen ihnen hingen wertvolle Gemälde, eine ständig wechselnde Sammlung, die den Grundstock von Curtis’ Tätigkeit als Kunsthändler bildete.
Ein antiker Schreibtisch, der aussah, als sei er für einen Riesen entworfen worden, beherrschte den Raum.
Curtis war noch nicht da.
Amber sah sich um und strich mit den Fingern über die Ketten und das mattpolierte Holz. Die goldenen Rahmen hatten es ihr besonders angetan. Schließlich blieb sie vor einem Pult stehen, auf dem ein uralter Foliant lag. Er wurde durch einen einzelnen Strahler mit weichem Licht in Szene gesetzt.
Amber fasste mich an der Hand und zog mich dorthin. „Was ist das? Eine Bibel?“
Ich musste lächeln. „So etwas in der Art.“
Jetzt war sie nah genug, um die goldenen Lettern auf dem Ledereinband zu lesen. „Codex Sanguinis. Ist das der Codex, von dem du immer sprichst?“
„Ja, das Regelwerk unseres Zusammenlebens. Wenngleich die meisten Jüngeren heute ‚Codex Sanguis‘ sagen, oder schlicht nur ‚Codex‘. Dies ist die erste Fassung.“ Ich schlug das Buch auf und blätterte zu den hinteren Seiten, die heller waren. „Die sind nachträglich eingefügt und betreffen die Übereinkunft, uns vom Töten abzukehren.“
„Das ist alles auf Latein“, sagte Amber enttäuscht und blätterte vorsichtig durch die Pergamentseiten. Hin und wieder verweilte sie bei jenen, die mit aufwendigen Lettern und Illustrationen verziert waren. Ich übersetzte ihr die Überschriften. Von den Kindern bezeichnete das Kapitel über die Verwandlung, Von den Sünden die endlos lange Liste der Verbote.
„Was ist das?“, fragte Amber schließlich und wies auf ein Bild. Es zeigte eine Frau, die mit ausgebreiteten Armen dastand. Vögel trugen winzige rote Tropfen zu zwei Figurengruppen. Jeweils die größte Figur fing die Tropfen mit der Hand auf und schützte unter ihrem gebauschten Mantel mehrere niederkniende Frauen und Männer.
„Du hast die schönste Illustration gefunden“, sagte ich überrascht. „Das ist ein Bild über die Camarilla. Die oberste Figur …“
„Das muss eine Clanherrin sein“, folgerte Amber richtig.
„Genau, und die beiden großen Figuren sind ihr untergeordnete Meister, die jeweils eigene Vampire schützen, dargestellt durch den Mantel. Solche Camarillas kann es in einem Clan mehrere geben. Je mehr ein Clanherr unter sich vereint, desto mächtiger und angesehener wird er.“
Amber seufzte. „Ich würde es zu gerne lesen können.“
„Irgendwann bestimmt. Es gibt Übersetzungen. Aber noch bist du dafür zu kurz ein Teil unserer Welt.“ Außerdem hielt der Codex Sanguinis so einige Passagen bereit, die ihr ganz und gar nicht gefallen würden.
Sie machte einen Schmollmund. „Dumme Regeln.“ Vorsichtig schloss sie das Buch und setzte ihre Erkundungstour fort.
Irgendwann hatte Amber ihre Neugier befriedigt und kam zurück zu mir. Ich hatte sie keinen Moment aus den Augen gelassen. Sie war wunderschön. Ich hätte sie stundenlang einfach nur beobachten können. Die leichte Sonnenbräune auf ihren nackten Armen, das Grübchen in ihrer Kehle und immer wieder ihre Augen. Wenn ich sie ansah, verlor alles andere seine Relevanz.
Für den Moment vergaß ich sogar Liliana, Steven und den untoten Schlächter, der irgendwo durch die Straßen von L.A. streifte.
Amber schien die Bewunderung in meinem Blick aufgefallen zu sein, denn sie sah mich lange an, und dann kam sie langsam auf mich zu und schmiegte ihren warmen Körper an mich. Ich hielt sie fest und lauschte ihrem Atem. Sie reckte mir ihr Gesicht entgegen und küsste mich leidenschaftlich. Auf einmal wollte ich etwas ganz anderes, als mit Curtis zu sprechen. Fordernd ließ ich meine Hände unter ihr Shirt gleiten, streichelte ihren Rücken und streifte mit der anderen ihre kleinen, festen Brüste.
Gänsehaut tanzte mein Rückgrat hinauf. „Ich will dich“, hauchte ich Amber ins Ohr und fuhr mit dem spitzen Finger von dem Grübchen an ihrem Hals über Dekolleté und Bauch bis hinab in ihren Hosenbund.
Sie legte die Hände auf meinen Hintern und drängte sich gegen mich. Hitze flutete meine Lenden – doch dann ließ ich enttäuscht von ihr ab. Amber sah überrascht auf.
Aus dem Hinterzimmer erklangen Schritte.
Immerhin war Curtis so freundlich, sein Kommen anzukündigen. Er musste etwas gespürt haben, denn üblicherweise bewegte er sich fast lautlos.
Amber hörte ihn nun ebenfalls und drehte sich vor mir weg.
Sie strich sich fröstelnd über die Arme.
Es war kalt hier unten.
Ich zog mein Sakko aus und legte es Amber um die Schultern. „Danke.“ Sie schob ihre Hand in meine.
Curtis zelebrierte seinen Auftritt diesmal weit weniger prachtvoll als bei seiner ersten Begegnung mit Amber.
Die Ereignisse dieser Nacht hatten uns alle nicht unberührt gelassen.
„Entschuldigt, dass ihr warten musstet“, sagte er, sah uns dabei aber kaum an. Er trug ein mir wohlbekanntes Holzkästchen in den Händen. Die Kiefermuskeln traten deutlich unter seiner Haut hervor, und sein Blick war unstet. Seine Anspannung wich erst, als er das Kästchen auf dem Schreibtisch abgestellt hatte. Er wies auf die Stühle vor uns. „Setzt euch, bitte.“
„Danke.“ Ich rückte Amber einen der barocken Stühle heran und nahm dann selber Platz. Meine Hände ruhten auf den Armlehnen, die in geschnitzten Fabeltieren endeten.
„Ich bin froh, dass du dich für Julius entschieden hast, Amber“, begann Curtis und ließ seinen Eisblick von ihr zu mir gleiten. Das zweite Siegel hatte seine Meinung also tatsächlich geändert. Auf einmal sprach er sie sogar mit ihrem Vornamen an, ganz wie ein Mitglied seines Clans. Amber war sicher, ihr Tod vorerst abgewendet. Mir war, als würde sich eine eiserne Fessel von meinem Herzen lösen.
Amber erwiderte auf Curtis’ Worte nichts, aber ich spürte ihre Ablehnung.
Der Meister setzte sein freundliches Gesicht auf: glatt, harmlos, ganz der nette Mann von nebenan. Seine bleiche, fast durchscheinende Haut verlieh seiner Miene dennoch etwas Verschlagenes.
„Leider lernst du uns in einer schwierigen Zeit kennen“, fuhr er fort. „Ich wünschte, es wäre anders. Wie du dir sicher denken kannst, können wir den Mord an Adrien Mory und den Mordversuch an Julius und Steven nicht ungesühnt lassen.“
Ambers Blick huschte zu mir. Was hat das alles mit mir, mit uns zu tun?, schien sie zu fragen. Doch in Wirklichkeit kannte sie die Antwort bereits genau.
Curtis seufzte, lehnte sich in seinem ledernen Ohrensessel zurück und verschränkte die sehnigen Arme vor der Brust.
„Es wird zum Krieg der Clans kommen“, sagte er müde. „Jahrzehntelang hat sich der Rat bemüht, Meister Gordon zur Vernunft zu bringen, doch er schlägt alle Kompromissangebote aus, bricht den Codex, und jetzt greift er uns sogar offen an. Dazu bedient er sich eines Untoten, dessen Erschaffungsart uns bislang unklar ist. Bedauernswerterweise verfüge ich über keinerlei Kenntnisse in Hexenmagie oder Voodoo. Niemand im Clan der Leonhardt beschäftigt sich mit den geheimen Künsten.“
Curtis setzte eine kunstvolle Pause und fixierte Amber. „Der Mensch, den sie für ihr Vorhaben erwählt haben, ist uns hingegen wohlbekannt. Es ist der ehemalige Jäger Frederik Connan, dein Bruder.“
Amber schluckte laut und zog ihre Hand aus meiner. Die Wahrheit tat weh, auch wenn sie sie längst kannte.
Die Stille im Raum war beinahe körperlich spürbar. Curtis sprach die entscheidenden Worte. „Also frage ich dich, Amber Connan: Wie stehst du zu uns?“
Sie starrte ihn an, dann zuckte ihr Blick verunsichert zu mir. „Julius?“
Ich schüttelte den Kopf, sah auf meine Hände und zupfte an dem Verband. Ich konnte ihr bei dieser Entscheidung nicht helfen. Jedes meiner Worte würde falsch sein, also schwieg ich.
„Frederik ist wirklich tot?“, fragte sie unsicher.
Ich nickte.
„Aber das sind Vampire doch auch, oder nicht?“
Endlich hatte Curtis Erbarmen mit ihr. Mit einem Mal hellte sich seine Miene auf, als habe jemand eine Kerze angezündet. „Anders, meine Liebe, anders“, sagte er lächelnd und verlieh seiner Stimme einen weichen Ton.
Als er sich vorbeugte und Amber ansah, hatte sein Gesicht jegliche Härte verloren. „Ich bin alt, dreimal so alt wie der Mann an deiner Seite. Und wenn ich Glück habe, so kann ich noch viele weitere Menschenleben lang existieren. Das Herz in meiner Brust schlägt vielleicht nicht immer, mein Kind, aber dafür habe ich andere Talente.
Ich kann Gedanken lesen und mit meinem Blut einem Sterbenden das Leben retten. Vampire haben eine Art der Existenz gegen eine andere getauscht, doch wir lieben und hassen, trauern und freuen uns geradeso wie ihr Menschen. Sieh Julius an, sieh ihn wirklich an. Und dann sag mir, ob du ihn für tot hältst.“
Amber wendete den Kopf und versenkte ihren Blick in meinem.
„Nein, Julius ist nicht tot.“
Etwas Schöneres hätte sie nicht sagen können.
Curtis nickte zufrieden. Eine Stufe war genommen, doch der Weg war noch weit.
Ich griff wieder nach Ambers Hand und ließ meinen Daumen in ihrer Handfläche kreisen.
Schon setzte Curtis zum nächsten Schlag an. „Im Gegensatz zu uns ist dein Bruder wirklich tot. Ich weiß nicht, welcher unheilige Zauber ihn aus dem Grab befreit hat, aber es gibt Hinweise, dass sein Körper weiter verfällt.“
„Ich … ich weiß“, flüsterte Amber.
„Ich denke, er ist das geworden, was man hinlänglich einen Untoten nennt, Amber. Irgendetwas muss Macht über seinen Körper haben, und anders als bei einem Zombie auch über seine Seele.“
„Und das hat dieser Vampir Gordon getan?“, fragte Amber und sah mich an.
„Ja. Und dein Bruder hat Vampire gehasst“, erinnerte ich sie. „Glaubst du, er hätte nach seinem Tod Unsterblichen dienen wollen? Die meisten, die er umgebracht hat, waren aus Gordons Clan. Frederik hat sich aus dem Fenster gestürzt, um das Messer zu retten und ihnen nicht in die Hände zu fallen.“
Amber starrte mich an und nickte dann langsam. Sie verstand, worauf ich hinauswollte.
„Wie also stehst du zu uns, Amber?“, wiederholte Curtis seine Frage und schob das Kästchen mit dem Messer über den Schreibtisch in ihre Richtung.
Sie ließ den Kopf hängen. Eine Flut roter Haare schob sich über ihr Gesicht.
„Wir haben sie“, übermittelte mir Curtis tonlos.
Amber rieb sich die Wangen, holte einmal tief Luft und setzte sich auf. Ihr erster Blick galt mir. „Mein Bruder wäre lieber tot, als diesem Gordon zu dienen“, sagte sie schließlich mit fester Stimme.
Damit war es beschlossene Sache. Sie würde zu uns stehen, gegen Gordon und damit gegen ihren Bruder.
Curtis zog eine Kette aus der Tasche, an der der kleine Schlüssel für das Kästchen hing, und warf sie mir zu. Ich hängte sie mir um den Hals und schob sie unter meinen Kragen. Das Metall ruhte kalt auf meiner Haut.
Curtis stand auf, ging um den Schreibtisch herum und reichte Amber die Hand. „Willkommen.“
Sie sah ihn irritiert an und erhob sich ebenfalls. Curtis wiederholte seine Worte. „Willkommen, Amber Connan. Ich gewähre dir Schutz und Schirm.“
Sie sah mich fragend an, doch Curtis erläuterte seine Worte selbst. „Du trägst jetzt zwei Siegel, Amber, das bedeutet, dass du bis zu einem gewissen Maß Teil des Clans geworden bist. Diese Position sichert dir bestimmte Rechte. Als Julius’ Meister gewähre ich dir meinen Schutz und den der meinen. Das Haus Lafayette steht dir fortan jederzeit offen. Die Vampire des Clans der Leonhardt sind verpflichtet, für dich einzustehen, und niemand wird dir ein Leid antun.“
Curtis sah mich an. „Du gibst ihr das dritte Siegel. Noch heute“, bestimmte er.
„Und wenn sie nicht will?“, fragte ich. Mir ging das alles ein wenig schnell.
„Dann sorgst du eben dafür, dass sie ihre Meinung ändert.“
„Es wurde bereits ein Zimmer für euch hergerichtet“, fuhr er dann laut fort. „Solange Gordon sein Unwesen treibt, bleibt ihr hier.“
Mit diesen Worten ließ er uns zurück. Da er keinen Widerspruch duldete, brauchte er auch nicht zu warten, ob wir seiner Entscheidung etwas entgegenzusetzen hatten.
Amber starrte auf die Tür, hinter der er verschwunden war.
Sie stand unschlüssig vor mir, ihr Blick wanderte zum Schreibtisch. „Ist in der Kiste das Messer, Julius?“
„Das weißt du doch genau.“
„Ich habe nicht gesagt, dass ich es benutzen werde.“
„Du hast dich für eine Seite entschieden. Für unsere. Ich glaube, dein Bruder würde deine Entscheidung gutheißen. Wenn wir Gordon besiegen, kannst du ihn vielleicht befreien, Amber. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie werden wir die Seele deines Bruders von diesem Leid erlösen.“
Amber nickte. Der Gedanke schien sie zu beruhigen.
Dass ich freilich ganz anderes mit Frederik vorhatte, sollte er mir vorher in die Hände fallen, musste sie im Augenblick nicht wissen. Und am Ende würde seine Seele trotzdem frei sein, wenn ich erst einmal mit ihm fertig war.
Ich hoffte, dass sie stark genug war. Die nächsten Tage würden dreckig werden. Wenn es wirklich zum Krieg kam, hieß das, Gordon und seinen gesamten Clan zu vernichten, jeden einzelnen Vampir, jeden Diener. Es würde ein Blutbad werden wie damals in Frankreich.
Das meiste hatte ich verdrängt, jetzt kam nach und nach alles wieder hoch und krallte sich wie eine eiserne Klaue in meine Eingeweide. Wir hatten niemanden, dessen wir habhaft geworden waren, am Leben gelassen. Niemanden. Welch ein Rausch, welch ein Morden, und wie schrecklich war die Reue danach gewesen. Damals hatte ich eine Axt benutzt. Doch das Schwert, das ich jetzt führte, war nicht weniger effektiv.
„Julius, was ist?“
Ich zuckte zusammen. „Nichts, gar nichts“, erwiderte ich mit belegter Stimme und wandte mich ab. Ein Teil von mir hatte es damals genossen und würde es wieder tun.
„Gehen wir.“
Ich griff nach dem Kästchen. Sobald ich das Holz berührte, brannten meine Muskeln wie Feuer. Eilig drückte ich es Amber in die Hand und schüttelte meinen schmerzenden Arm. „Nimm du es.“
Wir verließen den Raum unter der Bühne. Ich löschte das Licht und schloss die Tür hinter mir.
Robert stand draußen und erwartete uns bereits. Er führte uns zu dem Zimmer, das für die nächsten Tage unser gemeinsames Heim sein sollte.
Es lag fast dreißig Fuß unter der Erde und war wie Curtis’ Gemächer sogar mit doppelten Stahltüren gesichert. Mein neuer Sarg stand bereits auf einem kleinen, mit einem dunkelblauen Teppich bedeckten Podest.
An der Wand dahinter rankten Efeu und Lilien. Die Malereien passten genau zu dem Muster des Sargs. Dieser Bereich konnte mit einem schweren Vorhang vom Rest des Zimmers abgetrennt werden. Direkt neben der Tür befand sich ein antikes Eisenbett mit altmodischer weißer Spitzenbettwäsche. Neben dem Sarg stand eine Vase mit duftenden weißen Lilien, und selbst an Obst, Wasser und Gebäck für Amber hatte Robert gedacht.
„Ein anderes Zimmer gibt es leider nicht“, sagte er amüsiert und händigte Amber und mir je ein Paar Schlüssel aus.
„Amber, wende dich an mich, wenn du noch Fragen hast. Die Küche und die Zimmer der Diener sind im ersten Stock. Meistens essen wir gemeinsam gegen sechs. Wenn du Probleme damit hast …“, sein Blick glitt zu meinem Sarg, „dann stellen wir dir das Bett nach oben. Übergangsweise findet sich sicher jemand, der seinen Raum mit dir teilen würde.“
„Nein, das ist schon okay. Danke, Robert.“
„Gut.“ Er zog die Tür zu. „Eine schöne Nacht wünsche ich euch beiden“, hörte ich ihn noch rufen, dann eilte er die Stufen hinauf.
Plötzlich war es ganz still.
Der Blick aus Ambers Ozeanaugen ließ Schauer über meinen Rücken jagen. Ich brauchte ihre Gedanken nicht zu lesen, um zu wissen, was sie wollte. Was wir beide seit dem Moment wollten, als wir uns dort unten bei Curtis geküsst hatten.
Sie trat einen Schritt näher. Ihre Hände glitten über meine Brust, und mein Puls raste schon jetzt. Langsam öffnete sie meine Hemdknöpfe.
Ich stand einfach nur da und sah ihr zu.
Wir ließen uns Zeit. Zelebrierten unser erstes Mal wie ein heiliges Ritual.
Ich streifte ihr das Shirt über den Kopf, und unsere Lippen fanden sich, während ich Ambers kleine weiße Brüste berührte.
Ich hob Amber hoch und trug sie durch den Raum, bis wir, in einen hungrigen Kuss vertieft, auf das Bett sanken.
Ich stand noch einmal auf, schloss die Tür ab, entzündete ein paar Kerzen und löschte das Licht. Ambers Begehren legte sich wie ein dichter Schleier über uns. Doch plötzlich flackerte Unsicherheit in ihrem Blick und sie starrte wie hypnotisiert an mir vorbei.
Ich sah mich irritiert um. Kerzenlicht zuckte über den Sarg und funkelte auf dem Lack und den Intarsienarbeiten aus Perlmutt. Dieses verdammte Ding!
Energisch zog ich den Vorhang zu, doch das Unheil war angerichtet.
Das Begehren, das gerade eben noch den ganzen Raum erfüllt hatte, wich dem bitteren Geruch von Furcht. Doch es war nicht nur das. Das Messer antwortete fein und brennend auf die Stimmung seiner Trägerin und reckte seine dünnen, schmerzhaften Finger nach meinem Herzen.
Ich keuchte, griff mir an die Brust und ging vor dem Bett in die Knie.
„Julius, ich glaube, ich kann das nicht.“ Ambers Stimme zitterte.
Nur ein Wort kam über meine Lippen. „Bitte.“
Sie streckte ihre Hand aus, berührte meine Wange und zuckte zurück wie nach einem Stromschlag.
„Du bist kalt!“, sagte sie entsetzt und rieb sich die Finger.
Das Messer hatte mich abgelenkt. Ich hatte die Kontrolle verloren. Es fehlte nicht viel, und Amber wäre schreiend davongelaufen. Vor mir, einem wandelnden Leichnam!
Ich nahm ihre Hand und schmiegte mein Gesicht hinein. Diesmal war meine Haut warm und lebendig.
Doch ihr erschrockener Blick hatte etwas in mir zerrissen. Trauer legte sich über mich wie ein schwerer Vorhang – Trauer über das, was ich war, über all die Dinge, die ich verloren hatte.
„Julius, nicht.“ Amber strich mir über den Kopf und grub ihre schlanken Finger in mein Haar. „Ich ertrage es nicht, dich so unglücklich zu sehen.“ Sie lehnte sich vor, und ihre Lippen glitten wie ein Treueversprechen über meine Haut.
„Komm zu mir“, wisperte sie und hob die Decke an. Ich verlieh meinem Herzen einen gleichmäßigen Rhythmus, atmete und versuchte, mit allen Fasern meines Körpers lebendig zu sein. Dann kam ich zu ihr ins Bett.
Wir schauten uns lange an, und ich überließ es Amber zu entscheiden, wann sie genug gesehen hatte. Doch ich hatte Angst. Angst, dass sie nicht fand, was sie suchte. Angst, dass sie mehr fand, als sie ertragen konnte.
Ihre Augen hielten mich im Bann.
Auch hier, im Dämmerlicht der Kerzen, konnte ich die feinen goldenen Sprenkel ausmachen, die die grüne Iris tupften.
Die Zeit kam mir endlos vor und ich wagte nicht, mich zu bewegen. Meine Hand lag wie festgefroren in ihrer. Was ging jetzt wohl in ihrem Kopf vor? Wog sie ab, ob es richtig war, mit einem Vampir das Bett zu teilen? Dachte sie darüber nach, ob ich wirklich tot war oder vielleicht nur auf eine andere Art lebendig?
War nicht auch das menschliche Leben nur eine Reihe mechanischer Prozesse, die erst durch Magie oder eine Seele zu dem wurden, was sie tatsächlich waren, nämlich ein Wunder? Und war nicht auch meine Existenz etwas Wundersames? All die Jahre, ohne dass der Körper alterte …
Meine Seele allerdings trug schwerer und schwerer an all den Erinnerungen, guten wie schlechten. Machte mich die lange Zeit nicht sogar menschlicher und lebendiger, als es Sterbliche mit ihren wenigen Jahren je werden konnten?
Oder betrog ich mich selbst und war in Wirklichkeit ein verdammenswertes Wesen, das zum Wohle aller von der Erde getilgt gehörte?
Amber lächelte. Es war nicht mehr als eine winzige Bewegung ihrer Mundwinkel. Dann drückte sie meine Hand. Ganz fest.
Sie legte den Kopf auf meine Brust und lauschte meinem Herzschlag.
Vor Aufregung vergaß ich beinahe zu atmen.
Sie seufzte, als ich sie zögernd in meine Arme nahm und mein Gesicht in ihren Haaren barg. Die seidigen Strähnen auf meiner Haut zu spüren war wie eine Befreiung. Ich konnte die Sonne darin riechen. Wie sehr ich das Gestirn hasste und mich gleichzeitig danach sehnte!
Jetzt war Amber meine Sonne. „Danke“, wisperte ich in ihren Nacken und presste mich an sie.
Amber rieb ihre Wange über meine Brust. Nach einer Weile ließ ich meine Hände vorsichtig ihr Rückgrat entlanggleiten.
Als meine Fingerspitzen über Ambers Hüfte strichen, seufzte sie genießerisch und drehte sich auf den Rücken. Das war eine Einladung, der ich ohne Zögern Folge leistete. Hungrig bedeckte ich ihre Kehle mit Küssen und erkundete aufs Neue ihren wunderbaren Körper.
Ich zog die Decke zurück, um sie zu betrachten. Amber schloss die Augen und ließ mir meinen Willen.
Ihre Haut hatte einen rosigen Schimmer.
Das Kerzenlicht schmeichelte den Konturen und spielte mit ihren Rundungen. Die feinen Härchen auf ihrem Bauch flossen golden zum Nabel. Mit großem Entzücken fand ich überall, sogar auf den Knien, Sommersprossen, die ich mit Küssen bedeckte.
Amber seufzte leise, während ich mich mit sanften Bissen ihre Schenkel hinaufarbeitete, berauscht von ihrem Duft, ihrem Geschmack und den dünnen, pulsierenden Äderchen unter der Haut.
Die gestärkte Spitzenbettwäsche raschelte unter unseren Bewegungen. Schließlich grub sie ihre Hände in mein Haar und zog mich mit sanfter Gewalt nach oben. Ihre Augen sprühten vor Lust. Mein feines Gehör lauschte ihrem wild klopfenden Herzen.
„Amber, Amber“, flüsterte ich lächelnd, „als ob mich das abhalten könnte.“ Ich packte ein feines Silberkreuz, das zwischen ihren Brüsten ruhte, mit den Zähnen und ließ es an der Kette hinter ihren Rücken fallen.
Amber küsste mich verlangend und unvorsichtig. Sie zuckte kurz, dann füllte warmer Kupfergeschmack unsere Münder. Sie hatte sich an meinen Reißzähnen geschnitten.
„Entschuldige“, flüsterte ich.
„Nicht schlimm.“
Es war ein Missgeschick gewesen, doch das Blut weckte Wünsche in mir. Die Verbindung von Durst und Leidenschaft ist das Höchste für jeden Unsterblichen, ein doppelter Rausch. Doch ich kämpfte den Hunger hinunter.
Ich durfte nicht. Nein!
Amber küsste mich ebenso leidenschaftlich wie ahnungslos, während ich mit meinen Dämonen rang und sich unsere Hüften immer schneller und gieriger aneinanderrieben.
Sie umklammerte mich mit den Schenkeln – und hielt dann plötzlich inne.
Ich atmete meinen Hunger in ihren Nacken, bis ihre Hände meinen Kopf aus seinem Versteck lenkten und ich Amber ansehen musste. Diesmal wich sie nicht entsetzt zurück, als sie das goldene Leuchten in meinen Augen sah.
Ambers Wangen waren gerötet wie von Fieber. „Brauchen wir Kondome, Julius? Ich habe keine dabei.“
Ich lächelte überrascht und küsste sie auf die Nasenspitze. Daran hatte ich nicht gedacht. „Nein“, antwortete ich. „Weder für das eine noch das andere.“
„Gut.“ Amber schloss die Augen und presste ihr Becken gegen meines.
In einer einzigen, heftigen Bewegung vereinte ich mich mit ihr.
Amber bäumte sich auf und unterdrückte einen Schrei. Dann krallte sie ihre Nägel in meinen Rücken und begann, den Rhythmus zu diktieren.
Ich ließ mich führen und sah sie an, sah immer nur in ihre blaugrünen Augen. Blut rötete ihren Mund, ich küsste es weg. Vielleicht konnte ich meinen Durst mit diesen kleinen Gaben besänftigen, vielleicht …
Die Lust öffnete die Siegel, die uns verbanden.
Wir verschmolzen miteinander, wurden eins. Als wäre ein großes Fenster zwischen uns geöffnet worden, erlebte ich Ambers Empfindungen, fühlte zugleich meinen Körper und ihren, mich in ihr und sie um mich herum. Ich unterdrückte einen Schrei, als sich die Magie ankündigte. Der Durst hatte sie gerufen, der Duft von Blut und Schweiß und Lust. Wie ein feines elektrisches Prickeln erwachte sie in mir, die Kraft, die meinen toten Leib am Leben hielt. Pure, uralte Magie, und ich konnte und wollte sie nicht aufhalten.
Amber stöhnte und flüsterte meinen Namen, als die Macht die offenen Siegel nutzte und auf sie übersprang.
„Oh Gott, was ist das?“, hauchte sie zwischen zwei schnellen Atemzügen.
„Unsterblichkeit“, flüsterte ich.
Dann ließ ich mich von meinem Rausch fortreißen wie von einer Droge.
Amber umklammerte das Metallgestell des Bettes, presste sich gegen mich und erreichte in einem letzten Aufbäumen den Höhepunkt.
Ihre Lust tränkte die Luft, und meine Hüften bewegten sich immer schneller. Amber hielt die Augen geschlossen. Ihre Haut glänzte feucht, Blut pochte in ihren Adern und rauschte in meinem Kopf.
Ich roch es durch ihre Haut, hörte ihren wilden Herzschlag und wusste plötzlich nicht mehr, was ich tat. Meine Lippen fanden von ganz alleine zu ihrem Hals. In einer schnellen Folge von Küssen ertastete ich ihre Schlagader, dann ertränkte ich Ambers Geist in Lust und biss zu.
Ich hatte gegen meinen Dämon verloren, und ich genoss meine Niederlage.
Nun trug mich zweierlei Rausch davon. Magie tobte durch meinen Körper und zerrte an Kehle und Lenden gleichermaßen. Ich schluckte Ambers sattes rotes Leben, während sich unsere Körper im Gleichtakt der Ekstase näherten. Ohne meine Lippen von ihrem Hals zu lösen, schnitt ich mir die Zunge auf und presste sie in ihr Fleisch. Mein Blut heilte den Biss sekundenschnell.
Ambers Finger wühlten in meinem Haar. Unsere verschwitzten Körper rieben aneinander, und ich stieß tiefer und schneller in sie hinein.
Magie umfloss uns noch immer wie ein Kokon aus Licht.
In diesem Augenblick gehörte die Kraft, die mich am Leben hielt, uns beiden, und ich wusste, dass ich sie teilen wollte, ja, musste.
Amber hatte ihr Gesicht in meiner Halsbeuge vergraben. Zwischen leisen Seufzern biss und küsste sie meine Schulter. Ich stützte mich auf die Ellenbogen und betrachtete sie. Ambers Augen glänzten, sie atmete durch halb geöffnete Lippen. Wieder blickte sie mir bis in die Seele.
„Nimm mich an“, flüsterte ich, „nimm mein Geschenk an.“
„Ja“, stöhnte Amber ahnungslos und schloss die Augen.
Ich barg ihren Kopf in meinen Händen und bedeckte ihre Wangen mit Küssen. Dann presste ich meine Lippen auf ihre.
Die wilde Magie zwischen uns unterwarf sich meinem Willen und floss mit meinem Blut in ihren Mund. Amber bäumte sich auf und versuchte, sich wegzudrehen, doch meine Hände hielten ihren Kopf mit sanfter Gewalt.
„Nimm mich an“, flüsterte ich diesmal wortlos. Sie gab ihre Gegenwehr auf und trank. Wenige Tropfen, jeder ein Rausch.
Ich keuchte, stieß zu, presste sie an mich und kam gleichzeitig mit ihr. Mein Kopf war ein Feuerwerk und die abklingende Lust in den Lenden fast schmerzhaft. Amber flüsterte mit blutigen Lippen meinen Namen.
Ich küsste sie sauber, dann ließ ich mich neben sie fallen.
Wir hielten einander an der Hand und starrten zur Decke. Das karge Zimmer glomm im Kerzenschein.
Die Magie floss jetzt ruhiger und verband unsere Körper durch ein drittes, ungleich stärkeres Band.
Ambers Atem ging schwer und ich passte mich an, in der Hoffnung, dass es mich menschlicher erscheinen ließ. Sie hielt ihre Augen geschlossen, ihre Pupillen zuckten unter den dünnen Lidern. Ambers Linke ruhte auf ihrem schweißnassen Bauch, die Finger zitterten noch in Erinnerung an die erlebte Wonne.
Ich genoss die Nähe ihres heißen Körpers. Ambers Zungenspitze leckte über ihre purpurnen Lippen. Sie sah mich an, und ihre Augen spiegelten den Raum wie Glas.
„Wieder Blut?“, fragte sie, doch es lag kein Vorwurf darin.
Ich zog sie an mich und hielt sie ganz fest.
Das dritte Siegel ohne ihre Zustimmung! Ich hatte mich in eine schwierige Situation manövriert. Doch das waren Dinge, über die ich jetzt nicht nachdenken wollte. Stattdessen vergrub ich meine Nase in ihrem Haar und genoss den Duft.
„Das war wunderschön“, sagte sie.
„Ja, das war es.“
Ich war erschöpft und angenehm müde. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass all meine Sinne geklärt waren, wie die Luft von L.A. nach einem Sommerregen.
Ich sah mich im Zimmer um, während Amber in meinen Armen ruhiger wurde. Nach und nach wurden ihre Augen schwer.
„Schlaf, Liebes“, sagte ich, zog sie in meine Arme und legte mich ganz dicht hinter sie. Morpheus entführte ihren Geist, während meine Hand auf ihrem Körper ruhte.
Es war zwei Uhr nachts. Sie war müde, sie war sterblich.
Ich dagegen war wach und der Morgen noch viele Stunden entfernt.
Statt zu den anderen hinaufzugehen, blieb ich liegen, lauschte ihrem Atem und beobachtete die Schatten, die angetrieben vom Kerzenschein über die Wände huschten. Unsere Körper waren sich so nahe, dass ihr Puls in meiner Brust wie ein lebendiger Trommelschlag widerhallte. Ob es mir in den kommenden Tagen gelingen würde, Amber und diese wunderbare Lebendigkeit zu beschützen?
Mein Blick fiel auf die Kiste mit dem Messer. Amber musste sich vorbereiten. Ich hätte sie trainieren sollen, ihr zeigen, wie man ein Messer am effektivsten einsetzte und wie sie sich vor dem Einfluss anderer Vampire schützen konnte.
Schon morgen würde der Rat zusammentreffen. Doch die Entscheidung stand eigentlich bereits fest: Gordon und seine unheilige Brut sollten vernichtet werden. An einem Krieg kamen wir kaum noch vorbei. Niemand wusste, wie viele Vampire er geschaffen hatte. Dutzende, vielleicht sogar Hunderte Unsterbliche.
Und wir waren so wenige Kämpfer. Die Jüngsten würden zu Hause bleiben. Das machte siebzehn von Curtis’ Clan, elf davon aus dem Lafayette, der Rest Einzelgänger, fünf von Liliana Mereley, sowie Amber und einige weitere Diener. Ich wollte sie nicht gefährden. Ich wünschte, jemand anderes hätte das Messer führen können. Doch Amber war dazu bestimmt, und sie hatte ihr Schicksal angenommen. Es gab kein Zurück mehr.
Ich würde meinen Teil tun. Wenige töteten so effizient wie ich. Wenige hatten so viel Übung.
Ich lächelte bitter.
Ich war der Scharfrichter, und ich würde Gordon ins Jenseits befördern, wenn es für Vampire denn überhaupt eines gab. Wenn unser Ende auf Erden nicht in die Hölle oder das Nichts führte.
***
Amber
Im ersten Augenblick nach dem Wachwerden war ich vollkommen orientierungslos. Es war stockfinster. In der Luft hing der kalte Qualm von Kerzen. Dann erinnerte ich mich. Ich befand mich noch immer in dem unterirdischen Raum im Lafayette. „Julius?“
Er antwortete nicht.
Vorsichtig tastete ich mit der Hand in Richtung Tisch. Wenn ich mich richtig erinnerte, stand eine kleine Lampe direkt neben dem Bett. Ja, da war der Schalter.
Die Leuchte warf einen scharfen Lichtkegel. Es war so still, nichts bewegte sich. Der Platz neben mir im Bett war kalt und leer. Julius musste schon vor einer ganzen Weile verschwunden sein.
Blinzelnd sah ich auf mein Handy. Ein Uhr mittags.
So spät? Als ich mich ruckartig aufsetzte, erinnerte mich ein schmerzhaftes Ziehen in meinem Körper an die vergangene Nacht. Als ich daran zurückdachte, schlug mein Herz sofort ein Quäntchen schneller.
Plötzlich wurde mir klar, wo Julius war: in seinem Sarg!
Wie ein Magnet zog der dunkelblaue Vorhang meinen Blick an. Ich musste es sehen, um wirklich begreifen zu können.
Ich stand auf und zog den schweren Stoff zur Seite. Und da stand er, der Sarg: ein schwarzes Monstrum aus Holz, Lack und Metall.
Ich kniete mich hin und hob den Sargdeckel ein Stückchen an.
Julius hatte die Verriegelung nicht benutzt.
Durch den Spalt war blasse Haut zu erahnen. Entschlossen öffnete ich den Deckel zur Gänze. Kalt und reglos lag Julius vor mir. Er hatte seine Augen geschlossen, die Wangen wirkten eingefallen. Seine Hände ruhten gefaltet auf dem nackten Oberkörper, unter dessen milchweißer Haut sich sehnige Muskeln abzeichneten.
Obwohl Julius nicht atmete, war sein Anblick nicht erschreckend, sondern auf eine seltsame Weise schön. Er erinnerte mich an zugefrorene Seen. Starr, kalt und malerisch in einem.
Wie sich sein Körper jetzt wohl anfühlte? Konnte ich es wagen, ihn zu berühren? Durfte ich es?
Vorsichtig streckte ich eine Hand aus und hielt inne. Julius’ Körper strahlte keinerlei Wärme ab. Entschlossen legte ich zwei Finger auf die Stelle über seinem Herzen. Er war tatsächlich kalt wie Stein, die Haut fühlte sich an wie Leder, und es war kein Klopfen zu spüren.
Es war unwirklich und irritierend.
Wie aus dem Nichts rief plötzlich das Messer nach mir. Als ahne es, dass vor mir ein wehrloser Vampir lag. Als wolle es mich daran erinnern, dass Frederik viele seiner Opfer getötet hatte, während sie schliefen. Meine Unsicherheit schien das Messer anzuspornen.
An einer dünnen Kette um Julius’ Hals hing der Schlüssel für das Holzkästchen, in dem die Waffe aufbewahrt wurde.
Plötzlich breitete sich ein Brennen in meinem Arm aus. So hatte es sich angefühlt, als ich vor zwei Wochen den jungen Mann erstochen hatte, ganz genau so! Vor meinem inneren Auge sah ich auf einmal Julius an dessen Stelle. Starrte in sein gemartertes Gesicht, während sich sein Körper auflöste.
„Nein!“ Plötzlich explodierte ein Gedanke wie ein Schrei in meinem Kopf, und ich wurde weggestoßen. Überrascht taumelte ich zurück, fiel hin und setzte mich sofort wieder auf. Was war das? Alles verschwamm und drehte sich um mich.
Ich presste die Augenlider zusammen, um den Eindruck zu vertreiben, doch in meinem Kopf hämmerte es wie bei einer heftigen Migräneattacke.
Es musste Julius sein! Jetzt hörte ich seine Schreie ganz deutlich. „Keine Angst, das Messer ist nicht hier“, rief ich und rutschte weiter vom Sarg fort. Sobald ich Abstand nahm, beruhigte Julius sich.
Eilige Schritte erklangen auf der Treppe.
„Amber, was ist da los?“
Es war Robert. Er schlug mit der Faust gegen die Tür. Aber ich konnte mich nicht bewegen, der Schwindel war zu stark, meine Knie waren zu weich!
Ein Schlüssel drehte sich im Schloss, dann stürzte Robert mit einer Pistole in der Hand herein. Christina stand an seiner Seite, in ihrer Hand blitzte ein Messer.
„Was ist passiert, Amber?!“, schrie Robert und sah sich mit wildem Blick um.
Christina beugte sich über den Sarg und berührte den schlafenden Vampir. „Alles in Ordnung. Er ist nicht verletzt.“
Die Schreie waren verstummt.
„Julius, wir sind hier. Dir geschieht nichts. Alles wird gut.“ Die Latina strich Julius über den Kopf.
Ich saß noch immer auf dem Boden und starrte in den Lauf der Pistole. „Ich … ich habe nichts getan.“ Meine Stimme bebte. „Ich wollte ihn nur ansehen.“
Robert steckte die Waffe in seinen Hosenbund und schloss den Sargdeckel, dann hielt er mir die Hand hin. „Komm, steh auf.“
Nachdem er mich gerade mit einer Pistole bedroht hatte, konnte ich auf seine Hilfe im Augenblick gut verzichten. Energisch stieß ich mich am Boden ab und kam auf die Beine. „Ich wollte ihn wirklich nur ansehen, mehr nicht, verdammt!“
Christina schnitt mir das Wort ab. „Julius hatte Angst um sein Leben. Und bestimmt nicht nur, weil du ihn angesehen hast!“ So recht sie damit auch hatte – ich würde ihr garantiert nicht verraten, dass das Messer versucht hatte, meine Gedanken zu manipulieren. Sie behandelte mich ja jetzt schon, als hätte ich ein Verbrechen begangen!
Noch immer auf der Suche nach einer Bedrohung tasteten Christinas dunkle Augen den Raum ab. Es war mir unangenehm, dass sie das zerwühlte Bett und die verstreut auf dem Boden liegende Kleidung sah, die deutlich erzählten, was sich hier noch vor wenigen Stunden abgespielt hatte.
„Vielleicht hatte Julius nur einen Albtraum? Vampire träumen doch, oder?“, fragte ich zur Ablenkung, weil ich spürte, wie meine Wangen rot anliefen. Doch die Blicke der beiden verrieten mir, dass keiner von ihnen an einen Albtraum glaubte.
Erst jetzt wurde mir klar, dass ich nur eine Unterhose und ein dünnes Hemdchen trug, und ich spürte mein Gesicht noch eine Nuance dunkler werden.
„Ja, sie träumen“, sagte Christina. Sie entspannte sich sichtlich, um ihre Mundwinkel zuckte ein amüsiertes Lächeln und sie legte mir in einer fast schon versöhnlichen Geste die Hand auf die Schulter. „Du musst nicht hier unten warten, bis Julius wieder aufwacht. Zieh dir rasch etwas an und dann komm hoch in die Küche. Hier im Lafayette ticken die Uhren etwas anders. Robert und ich waren gerade beim Frühstück. Du musst auch die anderen Diener kennenlernen.“ Christina steckte ihr Messer in den Gürtel. „Keine Angst, es wird dich so schnell keiner massakrieren.“
Robert nickte. Seine Züge glätteten sich und wurden freundlicher. „Seit dem Überfall sind wir alle etwas übersensibel, Menschen wie Unsterbliche.“
„Kein Problem“, sagte ich schnell und langte nach meiner Hose. „Wirklich nicht.“
Nach einem letzten Blick auf den perlmuttverzierten Sarg verließ Robert den Raum. Christina zögerte. „Du hast es gerade sicherlich nicht leicht. Scheue dich nicht, uns zu fragen, dazu sind wir hier.“
„Okay, danke. Ich komme gleich nach.“
„Du nimmst die Treppe im Entrée. Die Küche ist oben links.“
Brandons Dienerin wandte sich zum Gehen.
„Christina, warte.“ Ich suchte nach den richtigen Worten. „Wegen der Sache auf dem Friedhof … Curtis hätte dich nicht dazu zwingen sollen, Julius Blut zu geben.“
Christinas Züge verhärteten sich. Sie musterte mich, und ich glaubte, Herablassung aus ihrem Blick zu lesen.
„Ich weiß, dass ihr alle denkt, es sei meine Aufgabe gewesen“, fuhr ich fort. „Aber Julius und ich hatten uns gestritten. Ich hatte gesagt, ich würde ihm nie wieder etwas geben.“
„Ist schon gut, Amber.“
„Es tut mir wirklich leid. War es sehr schlimm für dich?“
„Was passiert ist, ist passiert. Ich weiß selbst, wie das ist, am Anfang.“ Christina lächelte mir schwach zu und legte die Hand auf die Klinke. „Bis gleich.“
Als ich alleine war, ließ ich mich aufs Bett sinken.
Plötzlich war mir elend zumute. Ich zog die Knie an den Körper und starrte auf den Sarg. Was war da eben nur geschehen? Irgendwie hatte das Messer meine eigenen Gefühle gegen mich ausgespielt. Die Vorstellung, Julius die Holzklinge in die Brust zu rammen, war mir plötzlich ganz selbstverständlich vorgekommen, als sei es der einzig mögliche Weg.
Hätte ich es wirklich getan? Ihm den Schlüssel abgenommen, das Kästchen aufgeschlossen und das Messer auf Julius’ Brust gesetzt, über sein Herz, genau dorthin, wo vorhin meine Finger gelegen hatten? Ich war mir nicht sicher, und diese Unsicherheit entsetzte mich mehr als irgendetwas sonst.
Ich rieb mir die Augen. Antworten, ich brauchte dringend Antworten! Ich schlüpfte in meine Hose und zog Julius’ Hemd über, in dessen Kragen noch der Duft seines Parfums hing.
Eilig brachte ich das Bett in Ordnung, sammelte die Kleidung auf und zog den Vorhang vor den Sarg. Jetzt sah das Zimmer wirklich aus wie eine kleine, freundliche Wohnung.
Vor dem kleinen Waschbecken mit Spiegel band ich mir die Haare zum Zopf und wusch mir das Gesicht mit kaltem Wasser.
Wenig später schloss ich die Stahltür sorgfältig hinter mir ab und machte mich auf den Weg nach oben.
Das Lafayette roch nach Staub und Erinnerungen.
Abgetretene Dielen quietschten unter meinen Füßen. Wie viele Menschen mussten hier langgelaufen sein, um sich in Zelluloidwelten entführen zu lassen?
Von den Plakaten an den Wänden strahlten längst vergessene Stars und Sternchen. Fast meinte ich den Geruch von Popcorn und das leise Summen unzähliger Stimmen wahrzunehmen.
Im Eingangsbereich blieb ich einen Augenblick unschlüssig stehen, dann nahm ich die Treppe in die obere Etage. Die Stufen knarrten bei jedem Schritt.
Staub tanzte vor einem großen Fenster über der Treppe. Die Stufen mündeten in einen kleinen Ruhebereich mit hohen Bücherregalen und altmodischen Sofas. Auf beiden Seiten zweigten Flure ab.
Klapperndes Geschirr, leise Stimmen und der Duft von Kaffee wiesen mir die Richtung. Auch hier waren die Wände mit Bildern bedeckt.
Durch eine offene Tür fiel Sonnenlicht.
„Bist du wirklich bereit, das alles aufzugeben?“, hörte ich Robert fragen. „Du hast noch so viel Zeit. Brandons Kraft schützt dich, Christina. Du musst nicht sterben, um bei ihm sein zu können.“
„Vielleicht hast du recht.“
Ich blieb stehen, lauschte.
„Natürlich habe ich das“, erwiderte Robert. „Du trägst alle fünf Siegel. Als Brandons Famula kannst du in beiden Welten zu Hause sein. Warum solltest du freiwillig auf eine verzichten? Die Zeit kann dir auch jetzt schon nichts anhaben. Überlege es dir gut, Chris.“
Ich wartete auf Christinas Antwort, doch die blieb aus.
„Komm ruhig rein, Amber!“
Ertappt zuckte ich zusammen. Sie hatten mich also bemerkt. Unsicher betrat ich die Küche. „Tut mir leid, ich wollte nicht lauschen.“
Die beiden sahen mich gut gelaunt an. „Es ist schwierig, hier jemanden zu überraschen. Unsere Herren teilen ihre besonderen Talente mit uns“, sagte Robert freundlich.
„Wir sehen und hören alles!“, ergänzte Christina.
Die beiden saßen an einem schlichten, blankpolierten Holztisch und tranken Kaffee. An der Spüle stand eine dunkelblonde Frau und wusch ab.
„Setz dich doch.“ Christina wies auf einen Stuhl.
Auf dem Tisch war bereits ein frisches Gedeck ausgelegt. Jeder schien sich Mühe zu geben, damit es mir hier gefiel. Christinas dunkle Augen strahlten wie Edelsteine, während sie mir Kaffee und Orangensaft einschenkte.
„Trotzdem, ich hätte euch nicht belauschen dürfen“, sagte ich, während ich Platz nahm.
„Wir haben hier keine Geheimnisse voreinander.“ Robert reichte mir den Brotkorb. „Im Lafayette sind wir wie eine große Familie. Anders geht es nicht, wir müssen immerhin Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte miteinander auskommen.“
Die Blonde lachte leise, aber schrill, ohne sich umzudrehen.
„Das ist Janette, sie gehört zu Kathryn“, erklärte Christina und verzog das Gesicht.
Ganz so harmonisch schien das Zusammenleben also doch nicht zu sein. „Christopher hast du leider verpasst, er ist Manolos Diener.“
Ich nickte, obwohl mir die Namen nichts sagten. Ich schmierte Frischkäse auf einen Bagel, biss ein Stück ab und kaute lustlos darauf herum, obwohl ich eigentlich Hunger hatte.
Robert musterte mich besorgt. Ohne ein Wort streckte er die Hand aus und schob meinen Zopf zurück, um meinen Hals begutachten zu können. Ich zuckte zusammen. „Was soll das?“
„Wenn das so weitergeht …“ Robert schüttelte den Kopf.
„Wenn was wie weitergeht?“, fragte ich unwirsch.
„Julius darf nicht jede Nacht von dir trinken, Amber, das bringt dich über kurz oder lang um.“
„Er hat was?“, fragte ich erschrocken und starrte von einem zum anderen.
„Na großartig“, sagte Christina, „das dritte Siegel ohne deine Zustimmung. Julius hat wirklich ein seltenes Talent, sich in ein Unglück nach dem anderen zu manövrieren.“
Mir wurde flau. Deshalb fühlte ich mich also so matt. Ich ließ den Bagel auf den Teller fallen und tastete nach der Bissstelle. „Ich habe im Spiegel gar nichts bemerkt.“
„Unsichtbar für ein menschliches Auge. Für einen Mann im Dienste eines Meistervampirs hingegen leicht zu erkennen“, brummte Robert.
„Nun mach ihr doch keine Angst“, wies Christina ihn zurecht, stand auf und strich mir über den Rücken. „Keine Sorge, der alte Griesgram übertreibt. Noch ist ja nichts passiert.“ Christina ging zu einem Hängeschrank. Als sie zurückkam, legte sie mir einige Pillen neben den Teller.
„Vitamine und Mineralien. Die helfen deinem Körper, das Defizit wieder auszugleichen. Und wenn Julius das nächste Mal der Magen knurrt, haust du ihm auf die Finger, ja? Entweder er nimmt nur ein paar Tropfen, oder du machst mindestens vier Wochen Pause.“ Sie lachte warm und setzte sich wieder an den Tisch.
Ich sah sie schockiert an. Das alles schien für Christina das Normalste der Welt zu sein. Mir hingegen war der Appetit gründlich vergangen.
Julius hatte es wieder getan, ohne mich zu fragen! Sicher, wenn ich jetzt darüber nachdachte, setzten sich die bruchstückhaften Bilder der vergangenen Nacht langsam zu einem Ganzen zusammen. Deutlich kehrte die Erinnerung an Julius’ berauschenden Kuss und das Blut in meinem Mund zurück. Ich hatte mich nur einen winzigen Moment lang geekelt, bis ich die Magie zwischen uns hatte fließen spüren. Als wären wir miteinander verschmolzen. Das Gefühl war völlig neu für mich gewesen, und schon jetzt sehnte ich mich nach einer Wiederholung.
Ein Glück, dass die anderen keine Gedanken lesen konnten. Christina beobachtete mich dennoch und schien etwas zu ahnen. Ja, sie wusste wohl genau, was ich mit Julius geteilt hatte.
Robert hingegen schien von unserem stummen Zwiegespräch nichts zu ahnen. Er trank den letzten Schluck Kaffee und stellte sein Geschirr zusammen.
„Amber, du weichst Christina erst einmal nicht von der Seite“, sagte er dann nüchtern. „Geh nicht alleine raus, es ist gefährlich.“
„Am helllichten Tag?“, fragte ich irritiert.
„Es gibt weit Schlimmeres da draußen als Vampire.“ Robert verließ die Küche, und Janette folgte ihm schweigend nach. Christina sah verträumt aus dem Fenster. Die großen, dunklen Augen und der volle, energische Mund verliehen der kleinen Frau etwas Verwegenes. Die lockigen schwarzbraunen Haare hatte sie stramm zurückgebunden, sodass sie glänzten wie Lack.
Christina war eine ebenso exotische Schönheit wie Brandon. Ich wandte den Blick ab. Doch Christina schien meine Neugier regelrecht wittern zu können. „Was ist?“
„Nichts.“ Aber dann zögerte ich. Hatte sie mir nicht gerade erst angeboten, alle meine Fragen zu beantworten? „Liebst du Brandon?“
Christina sah mich über den Rand ihrer Kaffeetasse hinweg an. „Warum willst du das wissen?“
Ich war mir selbst nicht ganz sicher und schob mir den letzten Bissen des Bagels in den Mund.
„Ja, ich liebe ihn.“ Christinas Blick bekam etwas Träumerisches. „Wir haben uns an der California State University kennengelernt. Er hat Abendkurse über die First Nation People besucht, ich hatte Geschichte im Nebenfach.“
„Und dann?“, hakte ich nach und griff noch einmal in den Brotkorb.
„Ich wusste, dass er mich beobachtete, und dennoch wich er mir aus. Er war der totale Einzelgänger. Schließlich habe ich ihn angesprochen.“ Christina grinste breit. „Das ist jetzt zehn Jahre her. Nach vieren habe ich Curtis und den Clan kennengelernt. Dann hat Brandon mir von den Siegeln erzählt. Wir haben die Rituale in nur wenigen Tagen vollzogen. Als er mir angeboten hat, die Ewigkeit mit ihm zu teilen, habe ich keinen Augenblick gezögert.“
Robert klopfte an den Türrahmen, um sich bemerkbar zu machen. Wir zuckten zusammen und lachten dann über unsere Reaktion.
„Störe ich?“
Christina schüttelte den Kopf.
„Gut, denn Curtis hat eine Aufgabe für euch. Ihr fahrt zusammen nach San Fernando Valley. Amber braucht eine Pistole. Chris, du warst ja schon mal bei Tom.“
Ich glaubte, meinen Ohren nicht zu trauen.
„Es ist mit Julius abgesprochen“, setzte er nach, als würde es das besser machen.
Stur verschränkte ich die Arme und lehnte mich im Stuhl zurück. „Das ist mir egal. Ich will keine Pistole!“
„Du darfst dich nicht nur auf das Messer verlassen. In diesem Punkt duldet der Clanherr keinen Widerspruch. Und außerdem brauchst du für heute Abend etwas anderes zum Anziehen, Amber. Der Rat ist konservativ.“
Robert griff in seine Hosentasche und förderte eine Kreditkarte zutage, die er vor mich auf den Tisch legte. Es stand Julius’ Name darauf.
„Zu dir nach Hause kannst du leider nicht. Aber ihr dürft einkaufen gehen. Das machen Frauen doch so gerne“, fügte er grinsend hinzu.
Christina und ich sahen ihn zornig an, und seine Miene wurde sofort wieder nüchtern.
Als wir kurz darauf die Hintertür des Lafayette öffneten, schlug uns die Hitze wie eine Wand entgegen. Sofort bildete sich ein feiner Schweißfilm auf meiner Haut.
Die Sonne stand gleißend an einem gräulich-blauen Smoghimmel, und auf dem kleinen Parkplatz flirrte die Luft.
„Und? Hast du deine Mutter erreicht?“, fragte Christina.
„Ja. Ich habe ihr gesagt, dass ich mit ein paar Freunden übers Wochenende nach San Diego gefahren bin, um den Kopf freizubekommen. Ich bin so eine schlechte Lügnerin.“
„Fürs Telefon hat es bestimmt gereicht.“
Ich zuckte mit den Schultern und folgte Christina die wenigen Stufen hinunter zu Brandons mattschwarzem Sportwagen. Aus den Türen schlug uns Backofenglut entgegen.
„Ich hasse den Sommer“, fluchte Christina und schob ihre große Sonnenbrille höher. Aus ihrem Hosenbund ragte eine 9-Millimeter. Sie ließ sich in den Sitz gleiten und drehte den Zündschlüssel. Sofort begann die Klimaanlage ihren schier aussichtslosen Kampf.
„Komm, steig ein, sonst verkoche ich noch.“
Ich ließ mich in den glühenden Sitz fallen und schlug die Tür zu. Christina stieß rückwärts in die kleine Seitenstraße und raste dann mit röhrendem Motor los.
Genervt drückte ich den Hinterkopf ins Leder und schloss die Augen. Wenn Christina uns unbedingt zu Tode fahren wollte, dann musste ich dabei nicht auch noch zusehen.
„Erst Klamotten?“, fragte sie und steuerte bereits auf den Parkplatz von Macy’s zu.
Mir war nicht nach Shoppen zumute, doch Robert hatte recht. Ich konnte nicht nach Hause, um mir frische Kleidung zu holen. Falls mir jemand folgte, würde ich Mama gefährden. Das wollte ich auf keinen Fall.
Unschlüssig folgte ich Christina in das Kaufhaus und streifte mit den Händen über die Kleidung auf den Tischen.
Irritiert bemerkte ich einen Mann, der mir bereits auf dem Parkplatz aufgefallen war, als er hastig die Straße überquerte. Jetzt lief er hinter uns durch die Frauenabteilung. Immer wenn ich mich umdrehte, sah er wie zufällig in eine andere Richtung. In meinem Nacken begann es unangenehm zu kribbeln. Etwas an diesem Kerl war seltsam.
Als er bei den Dessous stehen blieb und die Auslagen musterte, atmete ich erleichtert auf und schimpfte mich paranoid. Nicht jeder Mann, der für seine Frau nach schöner Wäsche Ausschau hielt, war gefährlich.
Christina hatte von meinem kurzen Anflug von Verfolgungswahn nichts bemerkt und zerrte mich durch die verschiedenen Abteilungen. Entschlossen, die Angelegenheit so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, entschied ich mich für eine schwarze Stoffhose mit schmalem Schnitt, aber viel Bewegungsfreiheit, einen Gürtel mit großer Silberschnalle und ein Shirt mit V-Ausschnitt und dezenter Spitze, alles in Schwarz. Außerdem nahm ich noch frische Unterwäsche und ein paar einfache T-Shirts mit, um die nächsten Tage zu überbrücken.
Auf dem Weg zur Kasse fiel mein Blick auf einen schlichten, halblangen Mantel aus der neuen Winterkollektion.
„Gefällt er dir?“ Christina nahm mir die Kleidungsstücke ab, damit ich ihn anprobieren konnte. Er war aus leichtem künstlichem Wildleder und saß perfekt.
Meine Laune hob sich, als ich mich vor dem Spiegel drehte.
„Draußen hat es dreißig Grad, und außerdem ist er schwarz!“, sagte Christina regelrecht vorwurfsvoll.
„Meinst du, er gefällt Julius nicht?“
„Doch, sicher. Sein Farbgeschmack ist ja auch eher …“
„Düster?“
„Monochrom. Ihr habt euch wirklich gesucht und gefunden!“ Sie schob mich weiter zur Kasse, und wir alberten ein wenig herum, fast so wie Freundinnen. Der Gedankengang überraschte mich selbst, war sie doch Brandons Partnerin. Schon der Gedanke an ihn ließ meine Stimmung sinken. Er schien auch gute Seiten zu besitzen, von denen ich allerdings noch keine kennengelernt hatte.
Ich weigerte mich, Julius’ Kreditkarte zu benutzen, und zahlte selbst.
Auf dem Weg zum Ausgang kamen wir erneut an dem Mann vorbei, der mir schon zu Anfang aufgefallen war. Er begegnete meinem Blick und ging dann eilig davon. Ich sah mich kurz nach ihm um, doch er schien völlig harmlos zu sein.
„Warum hast du selbst gezahlt?“, fragte Christina, während ich die Plastiktüten auf den Rücksitz des Pontiacs warf.
„Ich verdiene mein eigenes Geld.“
Christina steuerte den Wagen vom Parkplatz. Ein Dodge folgte uns, aber ich beschloss, das als Zufall abzutun.
„Weißt du überhaupt, wie reich dein unsterblicher Freund ist?“, schrie Christina gegen den Lärm der Lüftung an, die auf der höchsten Stufe lief.
„Das ist mir egal! Wenn Julius dabei gewesen wäre, hätte ich vielleicht mit mir reden lassen, aber so …“
„Du hättest ihn doch rufen können. Mit dem dritten Siegel kannst du das auch bei Tag.“ Schon wieder etwas, das ich nicht gewusst hatte.
Eigentlich hätte er mir das in der Nacht erklären sollen, aber stattdessen hatten wir ja unbedingt durchs Bett turnen müssen. Doch das konnte ich Chris wohl kaum sagen. Geschäftig sah ich aus dem Fenster und ertappte mich im Spiegelbild bei einem seltsam verklärten Blick. „Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie es geht. Bislang war es immer Julius, der die Siegel benutzt hat.“
Christina drehte die Lüftung herunter und schnaubte ungehalten. „Wenn du mich fragst, ist dein Kerl ein Idiot.“
„Er hat mir nichts erklärt, gar nichts“, gab ich zu.
Der Wagen kroch im Schritttempo über den Santa Monica Boulevard.
„Sobald wir zurück im Lafayette sind, zeige ich dir alles, was du wissen musst. Und dazu den ein oder anderen Trick.“ Christina grinste.
Nach San Fernando Valley brauchten wir fast eine Stunde. Die Sonne senkte sich bereits über die Berge und ließ die Smogschicht über der Stadt sichtbar werden. Heiße Santa-Ana-Winde schlossen die Feuchtigkeit des nahen Ozeans im Tal ein wie in einem Treibhaus.
Schließlich parkte Christina in einer der Seitenstraßen des Topanga Canyon Boulevard.
„Muss das wirklich sein?“, fragte ich, während ich Christina über den rissigen Beton folgte. „Ich brauche keine Pistole.“
Doch anstatt mir zu antworten, blieb sie wie angewurzelt stehen und hielt mich am Arm fest.
Ein Mann war aus dem Schatten eines Alleebaumes getreten und versperrte uns den Weg. Seine Hand hing lässig an seiner Seite. Mir war sofort klar, dass er bewaffnet war.
„Scheiße!“, fluchte Christina und hielt mit einem Mal ihre Pistole in der Hand. „Ein Diener.“
Wir wichen langsam zurück, bis wir eine Mauer hinter uns hatten. Mein Herz raste. Aber diesmal würde ich mich nicht von der Panik übermannen lassen. Ich zwang mich, ruhig zu atmen. Ich kann kämpfen, sagte ich mir. So einfach würde ich mein Leben nicht aufgeben.
„Lass die Waffe fallen, Mädchen!“
Die Stimme war von der anderen Seite gekommen. Christina schnellte herum. Dort stand der Mann aus dem Kaufhaus, und auch in seiner Hand blitzte der Lauf einer Pistole. Beide Männer kamen näher.
„Ich übernehme den Diener, du den Blonden“, wisperte Christina und visierte ihren Gegner an. Trotz aller guten Vorsätze war ich wie gelähmt vor Angst. Wie sollten wir das schaffen? Die Männer hatten Pistolen, ich hingegen hatte nichts außer meinen Händen.
„Wenn sie uns erwischen, ist es ohnehin aus“, sagte Christina leise. Na, wenn das mal nicht beruhigend war!
Der Blonde war jetzt nicht mehr weit entfernt. Drei Schritte, vielleicht vier. Unerträglich nah und doch viel zu weit für gezielte Tritte.
Hoffentlich wusste Christina, was sie tat.
Ich sah mich zu ihr um. Ausgerechnet jetzt schloss sie die Augen, ihre Lider flatterten.
„Nein!“ Der Mann schien genau zu wissen, dass sie Kontakt zu ihrem Freund aufnahm, und schnellte vor. Er schlug Christina die Pistole aus der Hand und presste ihr den Lauf seiner eigenen an die Schläfe, bevor sie Brandons Energie nutzen konnte. Entwaffnet, einfach so.
Ich hob die Hände.
Der Mann aus dem Kaufhaus überragte mich um anderthalb Kopf. Sein Gesicht war wettergegerbt, die Augen klein und hinterhältig, das kurze Haar schmutzigblond. Er stieß mir den Lauf seiner Waffe mit Wucht in die Rippen.
„Umdrehen, Hände an die Wand“, knurrte er.
Der andere Kerl hielt Christina noch immer die Pistole an den Kopf und tastete sie ab. Er war weniger muskulös als sein Partner, doch seine Bewegungen waren geschmeidig, katzenhaft, beinahe wie die eines Vampirs. Alles an ihm sprach von Gewalt.
Als der blonde Mann von hinten seine Hände über meine Brüste gleiten ließ, presste ich die Lippen aufeinander, hielt trotz meines Ekels aber still, um ihn nicht zu provozieren. Er tastete über meinen Hintern, die Beine hinab. Sein Atem ging immer schwerer.
„Wo ist das Messer, Schätzchen?“
„Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen“, stieß ich wütend hervor. Ich wusste nicht, wie ich sein Getatsche noch eine Sekunde länger ertragen sollte. „Wenn Sie nicht sofort Ihre dreckigen Finger da wegnehmen, dann …“
„Dann was? Ich kann noch ganz anders.“ Er stieß seine Hand unter mein Shirt und krallte die Finger in meine Brust.
„Na, das gefällt dir, was?“
Ich unterdrückte einen Schrei. Was nun? Mein Blick flackerte zu Christina. In ihren Augen brannte ein fremdes Feuer, das mich unwillkürlich an Brandon denken ließ. Hatte sie nun erfolgreich Kontakt zu ihrem Partner aufgenommen? Wie sollte er ihr beistehen? Es war helllichter Tag und das Lafayette zig Meilen von San Fernando Valley entfernt.
Um Christinas Beine abzutasten, musste der Mann die Pistole von ihrer Schläfe nehmen.
Ich war mir nicht sicher: Hatte Christina gerade genickt, um mir ein Zeichen zu geben, dass ich mich wehren sollte?
In diesem Moment drängte der Blonde seinen schwitzenden Körper gegen meinen Rücken und presste mir die Pistole so hart in die Rippen, dass ich sicherlich einen blauen Fleck davontragen würde. An meinem Oberschenkel konnte ich seine Erektion spüren.
Aus. Mehr ertrug ich nicht. Es war, als wäre ein Schalter in mir umgelegt worden.
Ich schrie auf, packte die Pistole mit beiden Händen und schlug sie gegen die Wand. Blitzschnell ging ich in die Knie und rammte dem überraschten Blonden mit aller Wucht den Ellenbogen zwischen die Beine.
Ein Schuss löste sich und schlug in die Mauer. Ziegelstückchen und Staub flogen durch die Luft. Ein scharfer Schmerz an der Wange, dann war er auch schon vergessen. Geschafft, die Pistole fiel zu Boden.
Christina kämpfte ebenfalls. Ihre Bewegungen waren schnell, viel zu schnell, um noch natürlich zu sein. Ihr Gegner ließ nicht locker, doch er musste viel einstecken.
Als sich mein Widersacher nach seiner Waffe bückte, zögerte ich nicht. Angestachelt von Wut und Ekel trat ich ihm mehrfach in den Unterleib und stieß ihn dann mit dem Kopf gegen die Mauer. Der Mann ging endgültig zu Boden.
Seine Hände lagen gefährlich nahe bei der Pistole. Unsicher, ob seine Reglosigkeit nicht doch ein Trick war, trat ich ihm in die Kehle und hob die Waffe auf.
Das ferne Geheul von Polizeisirenen drang an mein Ohr.
Christina und ihr Widersacher rangen miteinander um die Pistole des fremden Dieners. Christinas Glutblick bohrte sich in die zu Schlitzen verengten Augen des Mannes. Doch er versuchte, ihrem Blick auszuweichen und sie kraft seiner Muskeln zu bezwingen.
„Pistole fallen lassen“, sagte Christina mit einer Stimme, die ich noch nie von ihr gehört hatte.
Der Mann begann zu zittern, doch noch war er nicht bereit aufzugeben.
Aber was auch immer Christina da gegen ihn einsetzte: Es war stärker als sein Wille. Seine Knie gaben nach und er taumelte gegen Christina.
Das Sirenengeheul nahm zu. Wir mussten weg hier. Entschlossen umklammerte ich die Pistole und presste sie dem Mann gegen die Schläfe. „Gib ihr die Waffe!“
Er zögerte kurz, dann folgte er dem Befehl. Christina reagierte blitzschnell, trat ihm in den Unterleib und schlug ihm dann mit voller Wucht den Knauf auf den Hinterkopf. Er brach zusammen.
Christina ergriff die Pistole mit beiden Händen und zielte auf seinen Kopf.
„Tu es nicht, Christina, er ist k. o.“
Ihr Atem ging schwer, sie blinzelte, und als ich sie an der Schulter berührte, zuckte sie zusammen, als sei sie nicht mehr Herrin ihrer selbst.
„Komm, Christina, lass uns verschwinden.“
Endlich reagierte sie, sicherte die Waffe ihres Gegners und hob ihre eigene auf.
Mit plötzlicher Abscheu betrachtete ich die Pistole in meiner Hand. Hastig rieb ich meine Fingerabdrücke mit einem Zipfel meines T-Shirts ab, ließ die Waffe fallen und folgte Christina eilig die Straße hinunter.
Wir waren gerade auf den Boulevard getreten, als zwei Polizeiwagen mit quietschenden Reifen in die Gasse einbogen.
„Glück gehabt“, sagte Christina und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Mein Atem ging noch immer wie nach einem Sprint, und meine Lunge schmerzte.
Es kam mir vor, als würden mich die Passanten anstarren.
Christina blieb im Schatten einer Palme stehen, zog ein Taschentuch hervor und reichte es mir.
„Was soll ich damit?“
Christina deutete auf mein Gesicht. Erst jetzt bemerkte ich, dass mir etwas die Wange hinunterlief. Blut! Bestimmt von den Steinsplittern, die sich bei dem Schuss gelöst hatten. Hastig wischte ich das dünne Rinnsal fort und presste das Taschentuch auf die Wunde.
„Komm, es ist nicht mehr weit bis zu Tom.“ Christina zupfte mir eine Strähne in die Stirn, um die Verletzung zu verdecken.
„In dir steckt mehr, als ich dachte“, sagte sie dann anerkennend.
„Mein Bruder wollte immer, dass ich Selbstverteidigung lerne. Er hat nicht aufgegeben, bis ich mich für einen Kurs eingeschrieben habe. Seitdem mache ich zweimal die Woche Krav Maga, das gefällt mir besser, als mich stumpf im Fitnessstudio abzurackern. Und offenbar ist es sogar zu etwas gut.“
Ich blieb stehen. Es gab da etwas, das mir nicht mehr aus dem Sinn ging. „Was war gerade mit dir los, Christina? Du hättest den Kerl fast erschossen.“
„Das wäre vielleicht auch besser gewesen. Den haben wir sicher nicht zum letzten Mal gesehen. Die beiden gehörten zu Gordon.“
„Aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Der Mann war bewusstlos!“
Christina blickte sich nervös um.
Einige Leute schauten neugierig in unsere Richtung, als erwarteten sie einen Streit. „Komm.“ Sie fasste mich am Arm und versuchte, mich weiterzuziehen. Ich wand mich aus ihrem Griff und folgte ihr unwillig. Auf eine Antwort würde ich wohl vergebens warten.
Kurze Zeit später blieb Christina vor einer Stahltür stehen und drückte auf die unbeschriftete Klingel.
Schritte näherten sich.
„Ich bin es, Christina Reyes.“
„Hey, Chris“, tönte eine raue Männerstimme.
Schlüssel klirrten. Mehrere Schlösser sprangen auf, dann wurde die Tür aufgestoßen. Der schmale Flur dahinter war dunkel und gerade breit genug für die Schultern des kleinen, glatzköpfigen Mannes, der uns begrüßte.
Er reichte mir die Hand. Unwillkürlich kam mir das Wort „Gangmitglied“ in den Sinn. Unzählige Tätowierungen tanzten auf seinem Arm, und sein schmutziges Unterhemd ließ erkennen, dass auch auf der Brust kaum noch ein Stückchen Haut blank war.
„Tom, das ist Amber“, sagte Christina. „Sie gehört Julius.“
„Ah, die Freundin des Killers, ist mir ein Vergnügen.“
Er musterte mich unverhohlen.
„Ich gehöre niemandem, Chris!“ Wütend funkelte ich meine Begleiterin an. Dass ihr solche Worte überhaupt über die Lippen kamen!
„Wie auch immer.“ Tom schloss sorgfältig die Tür ab und ging voraus. Zweifelnd folgte ich Christina durch den Flur und stieß prompt mit dem Kopf gegen eine defekte Glühbirne, die an einem langen Kabel von der Decke baumelte. Worauf hatte ich mich hier nur eingelassen?
„Habt ihr Ärger, Mädels?“
„Nein“, antwortete Christina und warf mir einen Blick zu, der mich meine Antwort herunterschlucken ließ.
„Na, dann mal rein in die gute Stube. Chris, du kennst ja den Weg.“
Stockflecken prangten an der Wand, der Putz schlug Wellen. Schließlich mündete der Gang in eine fensterlose Halle mit unverputzten Betonwänden, die nur hier und da mit verblichenen Postern nackter Schönheiten dekoriert waren.
Am fernen Ende der Halle hingen Zielscheiben, manche in menschlicher Form. Ein Witzbold hatte den Figuren Vampirzähne aufgemalt.
Aber das war nichts gegen die Tischdekoration. Auf einer Plastikdecke mit Karomuster waren Schusswaffen verschiedenster Art aufgereiht, von kleinen Revolvern bis hin zu Maschinengewehren.
„Hab heute Morgen noch mit eurem Boss gesprochen. Er sagt, die Kacke ist so richtig am Dampfen.“ Tom stemmte seine muskelbepackten Arme in die Seiten. Abwartend sah er Christina an, doch sie schwieg.
„Du willst mich also nicht in euer kleines Geheimnis einweihen?“
„Nichts gegen dich, Tom, aber wenn Mr. Lawhead dir nichts gesagt hat, hatte er seine Gründe.“
„Ich kann schweigen wie ein Grab!“
„Aber deine Gedanken nicht, Tom. Du kannst dich nicht vor einem Meistervampir schützen, der liest dich wie ein Buch.“
„Hast recht. Verdammte Blutsauger.“ Die letzten Worte sagte er mit einem breiten Grinsen und wandte sich wie ein routinierter Verkäufer seiner Ware zu. „Julius’ Mäuschen braucht also eine Kanone.“
Für das Mäuschen wäre ich ihm am liebsten an die Kehle gesprungen, doch da hielt er mir bereits zwei Pistolen hin. Ich zögerte. „Ich habe noch nie geschossen, und eigentlich …“
„Die Diskussion hatten wir doch schon“, seufzte Christina. „Denk daran, was mit deinem Bruder passiert ist. Hier geht es nicht um Fairplay!“
Da hatte sie leider recht. Ich griff nach der Waffe, die mir optisch mehr zusagte, und Tom lächelte. „Smith & Wesson Kaliber 45. Automatik, leicht zu bedienen. Ist doch einfacher als Schuhe kaufen, was?“
Ich schloss die Tür auf und schaltete das Licht an.
Es war erst halb fünf, doch hier, tief unter der Erde, schien Zeit keine Bedeutung zu haben. Sicherheitshalber machte ich einen Bogen um den dunklen Samtvorhang, hinter dem Julius’ Sarg stand.
„Keine Panik, ich bin’s nur“, sagte ich leise und kam mir dabei töricht vor.
Die Tüten mit meinen neuen Kleidern und die Pistole samt Munition fanden ihren Platz in einer Ecke neben dem Waschbecken.
Ich hatte es eilig. Christina wollte mir zeigen, wie ich mich gegen unerwünschte Vampirbesuche in meinem Kopf schützen konnte, und die Chance würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen.
Ich zog mich um, band mir die Haare zusammen und eilte hinauf zu den Räumlichkeiten der Menschen.
„Ich bin hier, Amber“, schallte es aus der Gemeinschaftsküche, wo Christina bereits ein Tablett mit Tassen, Teekanne, Zucker und Keksen beladen hatte. Soeben drückte sie die tropfenden Beutel über der Kanne aus. „Gleich geht es los.“
Ich folgte ihr in ein großes Wohnzimmer. An seinem Ende führte eine schmale Wendeltreppe weiter hinauf. „Da oben wohne ich. Es ist schön, du wirst sehen.“ Wir stiegen die schmalen Stufen hinauf, die unversehens vor einer Tür endeten. Dahinter lag ein lichtdurchfluteter Raum, der durch einen großen Durchbruch in einen zweiten mündete. Es gab nur wenige Möbel, alles war offen und hell.
„Meine Zimmer werde ich wohl am meisten vermissen, wenn ich verwandelt bin“, sagte Christina leichthin, stellte das Tablett auf einem Glastisch ab und goss Tee in zwei Gläser.
„Wo wirst du dann wohnen?“
„Unten bei Brandon und den anderen natürlich. Vampire haben hier oben nichts zu suchen.“
„Sie dürfen nicht hierherkommen?“, fragte ich erstaunt.
„Hier oben ist das Reich der Sterblichen. Natürlich besucht Brandon mich, aber dann hole ich ihn an der Treppe ab.“
Ich bewunderte Christinas kleines Paradies. Auf einer Kommode standen Fotografien, die sie und Brandon zeigten, mal zu zweit, mal mit einem Paar mittleren Alters, bei dem es sich offensichtlich um Christinas Eltern handelte. Die Vorstellung, wie sie ihrer Familie ihren Vampirfreund präsentierte, erschien mir vollkommen absurd.
„Nach meiner Verwandlung könntest du die Zimmer haben, Kathryns Dienerin gönne ich sie nicht. Es ist fast wie eine eigene Wohnung.“
„Nein danke, Christina, das ist lieb, aber ich habe nicht vor, hier einzuziehen.“
Sie sah mich zweifelnd an. Aber das war ein Thema, mit dem ich mich gerade wirklich nicht befassen wollte. Schweigend trat ich an eines der großen Fenster und sah hinaus. Das Kino war höher als die umliegenden Häuser, und über die flachen Dächer hinweg ließ sich ein Streifen Blau erahnen: das Meer.
„Kommen wir zu dem Grund deines Besuchs“, sagte Christina.
Sie holte zwei dünne Matten aus einer Ecke und breitete sie auf dem Parkett aus. „Wichtig ist, dass du dich halbwegs lösen kannst. Sobald du die Technik beherrschst, geht der Rest mit ein paar Tricks wie von allein.“
Sie setzte sich, als sei sie meine neue Yogalehrerin, und klopfte auf die Matte neben sich. „Fangen wir an, die Herren werden schließlich bald wach.“
Gespannt auf die Lehrstunde setzte ich mich im Lotussitz hin. „Kann losgehen.“
Die Sonne schien durch die großen Fenster, wärmte und tauchte mich in wohltuendes Licht. Nach und nach fielen die Anspannung und das Grauen der vergangenen Tage von mir ab, und unter Christinas Führung spürte ich meiner Lebensenergie nach und fühlte sie als warme Kraft durch meinen Körper rinnen. Es war ein einziges Summen und Fließen, das stärker wurde, je mehr ich mich darauf konzentrierte. Schließlich rief ich sie als warmen Kern in meiner Mitte zusammen. Als Christina mich dann anregte, der Energie aus dem Körper hinauszufolgen, hatte ich auf einmal das Gefühl, ich könne meine Aura wie eine dünne, feine Hülle erahnen.
„Bleib einfach so, wie du bist. Ich zapfe jetzt Brandons Magie an. Erschrick dich nicht“, sagte Christina ruhig. Also hielt ich weiterhin die Augen geschlossen und konzentrierte mich auf meinen Körper. Plötzlich spürte ich etwas.
Totenmagie.
Wie ein kalter Wind streifte sie durch das Zimmer und ließ mich frösteln.
Das war die Kraft, die ich auch in Julius gespürt hatte, die Kraft, aus der sich die Energie der Vampire speiste.
„Ich werde dir zeigen, wie du deine Aura sehen kannst. Es ist völlig ungefährlich. Vorsicht, Amber, ich berühre dich jetzt.“
Mir war noch immer nicht klar, was Christina vorhatte, doch plötzlich schien es mir, als würde die Luft dichter werden. Vor meinem inneren Auge geschah etwas Sonderbares. Wie ein elektrisches Funkeln antwortete eine dünne Hülle, offensichtlich meine Aura, auf Christinas Berührung. Leben und Tod rieben sich aneinander.
„Siehst du sie?“
„Ja“, flüsterte ich ehrfürchtig.
Brandons Energie berührte nun nicht mehr nur eine Stelle der Aura, sondern breitete sich wie ein Flächenbrand aus, und auf einmal saß ich in einem funkelnden Kokon aus Licht, der sich schwach gegen die fremde Kraft stemmte.
„Du musst versuchen, eine starke Wand zu errichten, die dich von dem Einfluss der Magie abschirmt.“
Doch das Bild der Wand passte nicht zu mir. Eine Wand war aus Stein. Ich musste das Element verwenden, mit dem ich jeden Tag arbeitete. Also stellte ich mir vor, wie von überall her Goldflitter auf mich zuflogen, als würden sie statisch angezogen. Einer nach dem anderen legte sich an meine Aura, bis ich in einem goldenen Kokon saß, der so fein war, dass die Sonne das dünne Metall immer noch durchdringen konnte. Ich fühlte mich wohl und geborgen wie lange nicht mehr, als plötzlich ein Riss erschien und eine kalte Kraft einließ. Mit ihr kam Dunkelheit. „Nein!“
„Amber, was ist passiert? Ich habe nur ein wenig stärker gedrückt!“
Und so begannen wir von Neuem.
Es dauerte eine Weile, bis ich den richtigen Ansatz fand, doch dann gelang es mir besser und besser, Christinas fingierten Angriffen zu widerstehen.
Erschöpft saßen wir schließlich auf dem Sofa und tranken den inzwischen kalt gewordenen Tee. Die Sonne stand bereits tief und ließ die Flachdächer in warmen Tönen glänzen. Hupen und schwacher Verkehrslärm drangen bis in das Zimmer hinauf.
„Ich glaube, es wird dir nicht schwerfallen“, sagte Christina. „Bald musst du gar nicht mehr darüber nachdenken, wie du dich schützen und eine Mauer um deine Gedanken aufbauen kannst.“
Ich nippte an meinem Tee und lehnte mich in die weichen Kissen zurück. „Ich habe meine Aura und diese Siegel zum ersten Mal gespürt.“
„Julius muss dir zeigen, wie man sie benutzt. Das ist seine Pflicht. Die Verbindung zwischen mir und Brandon steht immer ein wenig offen, ich kann jederzeit auf seine Kraft zurückgreifen und er auf meine. So sollte es auch sein. Es soll beide stärken.“
Ich nickte. Ja, Julius schuldete mir mehr als nur eine Antwort. Mit seiner Hilfe hätte ich mich besser gegen die Angreifer wehren können.
Und mit der Erinnerung an die Angst, die ich ausgestanden hatte, kehrte mit einem Mal auch die Wut auf ihn zurück.
***
Daniel Gordon
Der Morgen zog herauf. Daniel Gordon stand mit seinem Diener Nate vor einem Grundriss und studierte den Plan. Noch konnte er die schwächende Macht des verstrichenen Tages in seinen Beinen spüren. Alle anderen Vampire aus seinem Clan schliefen noch, und er genoss die Stille. Der Sturm würde noch früh genug kommen.
„Und du meinst, es wird wirklich funktionieren? Wenn nicht, müssen wir wieder ganz von vorne anfangen“, sagte Nate mit gerunzelter Stirn.
„Ja, die Falle ist perfekt.“ Der Plan vor ihnen bildete ein Labyrinth aus Hallen, Schächten und Fluren ab. Ihre Gegner würden ahnungslos hineinlaufen und nie wieder hinauskommen.
„Wir werden hohe Verluste haben, das wird dich schwächen.“
„Aber nicht lange.“ Gordon bleckte die Zähne. „Wir vernichten sie alle!“