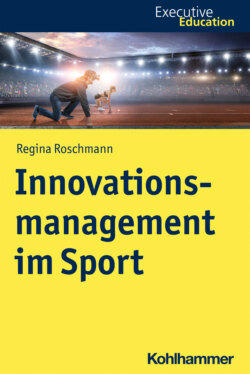Читать книгу Innovationsmanagement im Sport - Regina Roschmann - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Einleitung und Aufbau des Buches
ОглавлениеBedeutungsanstieg des Sports
Der Sport hat über die letzten Jahrzehnte einen enormen Bedeutungsanstieg erlebt. Der Dachverband der Sportvereine in Deutschland, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), berichtet von 27,57 Millionen Mitgliedschaften im Jahr 2019 und damit einem Anstieg um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (vgl. DOSB (2020), S. 1). Hinzu kommen Sporttreibende, die in kommerziellen Organisationen ihrem Bewegungsdrang nachgehen. Allein in deutschen Fitnessstudios waren 2019 11,66 Millionen Mitgliedschaften registriert, 2015 waren es noch 9,46 (vgl. DSSV (2020b)). Weltweit sind es sogar 183 Millionen Mitgliedschaften (vgl. IHRSA (2019), zit. nach DSSV (2020a)). Und auch die informellen, also selbstorganisierten Aktivitäten, tragen dazu bei, dass insgesamt ca. 80 Prozent der Deutschen angeben, Sport zu betreiben, 61 Prozent sogar regelmäßig (vgl. Repenning/Meyrahn/an der Heiden et al. (2019), S. 6).
Die Bedeutung des Sports ergibt sich auch aus vielfältigen Funktionen und Aufgaben, die ihm zugeschrieben werden. Demnach ist er in der Lage u. a. Menschen unterschiedlicher Herkunft oder unterschiedlichen Alters zusammenzubringen, kann als geselliges Erlebnis und als Plattform für Werte wie Fair Play und Respekt dienen, Toleranz und Weltoffenheit fördern und eine wichtige Rolle für die Gesundheit spielen (vgl. Deutscher Bundestag (2014), S. 13). Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hat mit ihren globalen Empfehlungen für körperliche Aktivität – zu welcher auch der Sport explizit gehört – die Bedeutung von Bewegung für die Gesundheit hervorgehoben (vgl. WHO (2010)). An der Entwicklung der Nationalen Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung in Deutschland waren Sportwissenschaftlicher und Sportmediziner entscheidend beteiligt und an ihrem Transfer in die Praxis wirkten innerhalb der Arbeitsgruppe »Bewegungsförderung im Alltag« etliche sportbezogene Verbände und Institutionen in zentraler Rolle mit (vgl. Rütten/Pfeiffer (2016)). Entsprechende Untersuchungen zeigen auch, dass Sport beim Erreichen der Bewegungsempfehlungen für viele Menschen eine wichtige Rolle spielt. So erreichen 34 Prozent der Bevölkerung (ab 16 Jahren) in Deutschland die Empfehlungen der WHO schon alleine durch ihre sportlichen Aktivitäten (vgl. Repenning/Meyrahn/an der Heiden/Ahlert/Preuß (2020), S. 11).
Auch die Europäische Union hat mit der Herausgabe des sogenannten Weißbuchs Sport im Jahr 2007 den Sport endgültig auf die Agenda der europäischen Politik gehoben. Eine Vielzahl an Maßnahmen mit Fokus auf den Sport wurde dadurch auf den Weg gebracht. Betont wird von der EU dabei sowohl die wirtschaftliche als auch die gesellschaftliche Bedeutung des Sports (vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2007)).
Betrachtet man den Sport aus einer ökonomischen Perspektive, so zeigt sich, dass dieser zu einem beträchtlichen Wirtschaftsfaktor geworden ist. Der sportbezogene Anteil am Bruttoinlandsprodukt Deutschlands lag im Jahr 2016 bei 71,6 Milliarden Euro. Das entspricht 2,3 % des BIP (vgl. Ahlert/Repenning/an der Heiden (2019), S. 8; Tab. 1). Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Sport in den 88.348 Sportvereinen innerhalb des DOSB (DOSB (2020), S. 3; Stand 2019) in hohem Maße ehrenamtlich und gemeinnützig geprägt ist und die Sportvereine auch deshalb ihre Angebote besonders preiswert unterbreiten können. Das BIP spiegelt diese ehrenamtliche Arbeit also nur bedingt wider. Unterstellt man einen Stundensatz von 15 Euro, so ergäbe sich im Jahr 2013 eine Wertschöpfung von 4,3 Mrd. Euro durch ehrenamtliche Arbeit – freiwillige Helfer, die unregelmäßig in Sportvereinen aktiv sind, noch nicht mitgerechnet (vgl. Breuer/Feiler (2014), S. 14).
Zwar ist die Sportwirtschaft in den Jahren 2010 bis 2016 nicht so stark gewachsen wie die gesamte Volkswirtschaft, was unter anderem damit erklärt wird, dass die EU-Schuldenkrise die dienstleistungsorientierte Sportwirtschaft deutlich stärker beeinträchtigt hat als die exportorientierte Industriewirtschaft in Deutschland. Vor allem das Wachstum der Konsumausgaben privater Haushalte und des Staates kann jedoch im Sportsektor mit der gesamten Volkswirtschaft mithalten. Die angesichts dessen geringe Wachstumsrate des BIP erklärt sich vor allem durch die Globalisierung der Gütermärkte, die in Deutschland zu einem Überschuss an Importen im Wert von 24,4 Mrd. Euro im Vergleich zu Exporten im Wert von 3,8 Mrd. Euro geführt hat. Die enormen Konsumausgaben für Sport führen in Deutschland also nur teilweise zu einer Steigerung des BIP (vgl. Ahlert/Repenning/an der Heiden (2019), S. 6 ff.).
Tab. 1: Entwicklung ausgewählter Kennzahlen der Verwendungsseite des Sportsatellitenkontos in Deutschland für die Berichtsjahre 2010 und 2016 (Quelle: Ahlert/ Repenning/an der Heiden (2019), S. 8)
20102016*Veränderung in % 2016 gegenüber 2010
*Ergebnis einer Fortschreibung
Bedeutungsanstieg des Innovationsbegriffs
Als eine Antwort auf die Globalisierung und andere Herausforderungen wie den verschärften Wettbewerbsdruck oder kürzere Produktlebenszyklen, denen Unternehmen sich zunehmend gegenübersehen und die ihren langfristigen Erfolg erschweren, ist seit geraumer Zeit der Innovationsbegriff in aller Munde und wird in allen Bereichen der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft umfassend diskutiert (vgl. Vahs/Brem (2015), S. 1, S. 4, S. 8). Auch ein Abfließen von Technologie-Know-how und ein damit verbundener Anstieg von Imitationen, der die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Ländern oder Unternehmen bedroht, führt dazu, dass Innovationen eine hohe Relevanz zugeschrieben wird (vgl. Meffert et al. (2019), S. 405 f.). Innovationen gelten – neben der Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer und verschiedenen Rationalisierungsmaßnahmen – als die dritte und mit Blick auf einen Wettbewerbsvorsprung vielversprechendste Möglichkeit, auf zunehmenden Konkurrenzdruck zu reagieren (vgl. Boutellier (1997), S. 15, zit. nach Hochmeier (2012), S. 11). Daraus entsteht in vielen Bereichen eine gewisse Innovationsnotwendigkeit zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen (vgl. Meffert et al. (2019), S. 405 f.). Selbst im gemeinnützigen Sport lässt sich ein höherer Wettbewerbsdruck um Zuschüsse, Spenden, Freiwillige und Teilnehmer feststellen (Svensson/Cohen (2020), S. 139). Cropley und Cropley ((2018), S. 1) formulieren gar: »Moderne Organisationen müssen innovieren oder sterben.«
Dem Sport werden nicht selten Eigenschaften zugeschrieben, die wenig innovationsorientiert sind. Sportvereine reagieren z. B. vergleichsweise langsam auf qualitative und quantitative Nachfrageänderungen – und müssen dies unter Umständen auch gar nicht (vgl. Heinemann (1995); Breuer (2003)). Aktuelle Vorwürfe aus Politik, Medien und Wirtschaft unterstellen dem organisierten Sport derzeit beispielsweise, verkrustet, altmodisch oder traditionalistisch zu sein, weil er sich im Umgang mit Trends wie dem E-Sport schwertut (vgl. Borggrefe (2019), S. 90)? Und doch hat der Innovationsbegriff ebenso wie innovatives Verhalten mittlerweile, ja vielleicht schon immer, einen festen Platz auch im Sport eingenommen. So gilt gerade der Sport an anderer Stelle als besonders innovativ, da er in der Lage ist, sich sozialen, politischen und technologischen Veränderungen anzupassen (vgl. Ratten/Ferreira, 2016). Vor allem im Spitzensport stellt das Streben nach Siegen und Rekorden sogar einen natürlichen Treiber der Innovation dar (vgl. Balmer/Pleasence/Nevill (2012), zit. nach Tjønndal (2017), S. 291).
Innovationen in Sportorganisationen
Die Bedeutung von Innovationen im Sport lassen sich sowohl bei großen Verbänden wie auch kleinen Vereinen erkennen. Sie finden sich im Non-Profit-Bereich ebenso wie im kommerziellen Sport. So setzt der Deutschen Fußballbund (DFB) – mit seinen über 7,1 Millionen Mitgliedern und ca. 24.500 Vereinen einer der größten Sportverbände der Welt (vgl. DFB (2019a)) – das Thema beispielsweise durch die Verankerung eines Think-Tank an der DFB Akademie um.
Als dessen Ziele formuliert der DFB [sic!]:
• »Agieren als Innovationsmotor der DFB-Akademie, um Weltklasse-Niveau zu sichern,
• »Melting Pot« für Fußballpraxis, Wissenschaft, Technologieunternehmen und Start-ups,
• Etablierung als Innovationspartner für Spitzen- und Amateurvereine« (DFB (2019b)).
Und auch bei der Besetzung von Trainerstellen verfolgt der DFB ein klares Konzept, das in den U-Nationalmannschaften – d. h. den Nachwuchsteams – stets auf Dreierteams setzt. Neben den Trainertypen »Erfahrung« und »Altersspezialist« hat auch der »Typ Innovation« einen festen Platz (vgl. DFB (o. D.)).
Innovationen können jedoch nicht nur ein Merkmal großer, professioneller Verbände sein. So richtet sich der seit 2007 vergebene dsj-Zukunftspreis der Deutschen Sportjugend (dsj), an »engagierte Sportvereine, deren Erfahrungen und Konzepte anderen als Inspiration und Vorbild dienen. Praktische und bereits erprobte Lösungen im Kinder- und Jugendsport werden so als Good-Practice-Beispiele bundesweit öffentlich gemacht.« (dsj (o. D.)). Wie die Liste an Preisträgern der letzten Jahre zeigt (vgl. dsj (o. D.)), werden dabei typischerweise viele breitensportorientierte Vereine prämiert, die sich fundamental von Organisationen wie dem DFB unterscheiden und trotzdem offenbar ein großes Innovationspotenzial aufweisen können.
Dass auch kommerzielle Organisationen aus dem Bereich des Sports auf Innovationen setzen, scheint in diesem Sinne kaum mehr überraschend. Anfang 2019 hat Adidas die Beteiligung am weltweit größten Start-up-Campus »Station F« in Paris bekannt gegeben. Im eigens entwickelten Programm »Platform A« wolle man mit 13 ausgewählten Start-ups an neuen Geschäftsideen für die Sportindustrie arbeiten und die Innovationskraft der Start-up Szene nutzen, um neue, strategisch wichtige Projekte zu identifizieren (vgl. Adidas (2019)).
Wozu ein spezifisches Innovationsmanagement für den Sport
Innovationen spielen also gerade im Sport eine wichtige Rolle. »Der« Sport stellt allerdings in Wahrheit ein sehr heterogenes Anwendungsfeld dar und das Management von bzw. im Sport unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von allgemeinen betriebswirtschaftlichen Anwendungsfeldern (vgl. Horch/ Schubert/Walzel (2014), S. S. 2 ff.; Hoye/Smith/Westerbeek/Stewart/Nicholson (2006), S. 8 ff.). Die unreflektierte Übernahme betriebswirtschaftlicher Konzepte in den Sport ist jedoch selten sinnvoll oder kann sich sogar als gefährlich erweisen (Riedl & Langhof 2014; Thiel & Mayer 2009). Organisationen sollten sich sicher sein, dass sie ein Management im betriebswirtschaftlichen Sinne durchführen wollen und vor allem wann und in welchem Kontext sie dieses anwenden möchten (vgl. Baecker (2003), S. 15).
Für ein Innovationsmanagement im Sport lässt sich daraus ableiten, dass dieses möglicherweise für verschiedene Akteure unterschiedlich relevant ist, mit Sicherheit aber je nach Anwendung spezifisch angepasst werden muss. Natürlich ist dies keine Besonderheit des Sports, auch für herkömmliche betriebswirtschaftliche Anwendungsfelder gilt, dass ein Innovationsmanagement in einem spezifischen Unternehmen oder einer Branche im Detail anders aussehen wird als in einem anderen Unternehmen oder einer anderen Branche. Dennoch ist es möglich, diese Anpassung auf den konkreten Anwendungsfall zu erleichtern, indem das (allgemeine) Innovationsmanagement mit Bezug zum Sport spezifiziert wird.
Notwendigkeit zum Transfer auf konkrete Beispiele
Genau dies soll in dem vorliegenden Buch geschehen. Es erhebt nicht den Anspruch, für alle erdenklichen Ausprägungen des Sports – für jede Art der Sportorganisation, für jeden Produkttyp, der sich im Sport finden lässt oder für jede Sportart usw. – ein spezifisches Innovationsmanagement bereitzustellen. Der Sportbegriff und die Sportbranche sind zu heterogen und auch das Forschungsfeld zu neu, als dass dies in einem solchen Buch möglich wäre. Möglich ist jedoch, durch wechselweise Bezugnahme auf diese verschiedenen Ausprägungen des Sports den Lesern ein umfassendes Verständnis für die Besonderheiten zu vermitteln, die mit einem Innovationsmanagement im Sport einhergehen und sie dadurch in die Lage zu versetzen, die ebenfalls vermittelten Überlegungen, Prozesse, Methoden und Instrumente des Innovationsmanagements zielgerichtet auf das eigene Anwendungsbeispiel aus dem Bereich des Sports anzupassen.
Hintergründe verstehen
Das erste Kapitel zielt schwerpunktmäßig auf das Verstehen der Hintergründe und Zusammenhänge von Innovationsmanagement und Sport, denn das kommerzielle (und ggf. auch nicht-kommerzielle) »…Überleben erfordert ein differenziertes Verständnis von der Natur innovativer Produkte, der Denkprozesse, durch die solche Produkte zustande kommen, der psychologischen Ressourcen der Menschen, die solche Prozesse durchführen, sowie der externen und internen Umfelder, in denen innovative Menschen agieren« (Cropley/Cropley 2018, S. 1). Zu diesem Zweck werden im ersten Kapitel zunächst die Begriffe Innovation und Sport intensiv beleuchtet und Innovationsarten, Aspekte und Typen von Innovationen im Bereich Sport thematisiert.
In den folgenden Kapiteln gewinnt auch die Anwendung stärker an Gewicht. Kapitel 2 widmet sich den Voraussetzungen für Innovationen im Sport, indem das strategische Management im Sport, Organisationsstrukturen und die Organisationskultur näher betrachtet werden. Abschließend geht das Kapitel auf Entrepreneure und Entrepreneurship im Sport ein.
Kapitel 3 widmet sich schließlich schrittweise dem konkreten Entwicklungsprozess von Innovationen, also insbesondere der Ideengenerierung, der Ideenakzeptierung/-bewertung und der Ideenrealisierung.