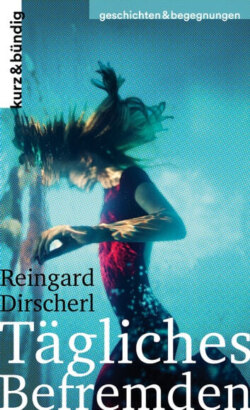Читать книгу Tägliches Befremden - Reingard Dirscherl - Страница 5
ОглавлениеMein Opium
Le sang blanc coule épais du pavot de sa tête. Il le recueille à pleines mains. Et le sang rouge en bas lui trace les chemins au bout desquelles la mort à l’épouser s’apprête.1
Er sieht mitgenommen aus, der Katalog zu Opium. Die Texte sind mit Fragezeichen oder Pfeilen und Anmerkungen versehen. So wirken sie auf mich verlässlich. Für wichtige Zahlen baue ich Eselsbrücken und verankere sie so im Gedächtnis. Manchmal dient mir ein Spickzettel. Wie oft war ich im Museum und habe mir die Opiumpfeifen angesehen, da ich die Exponate im Ausstellungsführer nicht erkennen konnte. Fokussierende Schärfe auf ein Detail ist das Markenzeichen des Hausfotografen. Der Rest verschwimmt im Nebel. Die Aufnahme gestattet der Betrachterin nur einen Blick. Der zweite bleibt verwehrt und lockt so zu den Dingen. Um diese zu erkennen, genügt es nicht, sie abzubilden. Das Auge will schweifen. Der Geist will sich mit ihnen auseinandersetzen.
Neben dem Ausstellungskatalog liegt ein Roman über die Vorgeschichte der Opiumkriege in China. In Das mohnrote Meer beschreibt Amitav Gosh die Monopolisierung des indischen Mohnanbaus durch die East India Company. Ich notiere mir den Namen Jardine & Matheson. Die britische Firma ist durch Opiumhandel und Zwangsarbeit reich geworden. Die Website des heute noch existierenden Unternehmens mit Sitz auf den Bermudas zeigt, dass es sich um einen weltweit tätigen Konzern handelt. Er verschiebt Autos, Schiffe, sogar Immobilien, nur kein Opium mehr. Zur Imagepflege fließen Gelder in wohltätige Zwecke. Ein Paradebeispiel, wie während des Kolonialismus erwirtschaftete Erträge postkolonial geschönt weiterwirken und Milliarden umsetzen.
Etwas später verwies mich die Geschichte über den Anbau von Opium in andere geografische Regionen. In Afghanistan fanden die Machenschaften um Einfluss und Gewinn im 20. Jahrhundert ihre Fortsetzung. Die Opiumproduktion vor Ort soll während des Kalten Krieges durch die CIA initiiert worden sein.2
Als ich mehr über die Pflanze wissen wollte, fand ich heraus, dass nährstoffreiche Lehmböden sich günstig auf ihr Wachstum auswirkten und weiße Samen den besten Ertrag lieferten. Im Botanischen Garten der Stadt sah ich dem Schlafmohn beim Wachsen zu.
Mohnöl bekam einen festen Platz in meiner Küche, und ich versuchte mich, dank eines Rezepts meiner Großmutter, an Mohnpotizen, einem Gebäck aus zerstoßenen Mohnsamen und Germteig. Beim Aufräumen auf dem Estrich stieß ich auf ein verstaubtes Gemälde. Meine Katze Poppy liegt auf einem vergessenen Grab. Ich drehte das Bild um und entzifferte meine eigene Schrift: Nur wer mit Toten vom Mohn aß, von dem ihren, wird nicht den leisesten Ton wieder verlieren.3 Rilke-Fan mit einem Hang zum Frühgrufti, schmunzelte ich über meine einstigen Vorlieben und stellte das düstere Bild neben das Buch von Gosh.
Schließlich fragte ich einen Ex-Opiomanen über seine Abhängigkeit aus und verliebte mich. Ich folgte jeder Spur, die Opium gelegt hatte oder nach sich zog, und ließ mich sogar von einer Parfumverkäuferin im Globus mit der neuesten Version Black Opium von Yves St. Laurent besprühen. Zu Hause rieb ich mir den süßlichen Duft von Jasmin, Kaffee und Patschuli von der Haut.
Falls ich vergessen haben sollte, mich vorzustellen: Ich vermittle Kultur.
«Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Museums der Kulturen», lauteten meine Standardworte vor Führungen. Ein Zitat von Jean Cocteau half mir dabei, den Spielraum der Ausstellung Opium auszuloten: Ich verteidige nichts, ich richte nicht. Ich trage belastende und entlastende Urkunden zum Prozess des Opiums bei. Mit den Besuchern werfe ich einen Blick hinter Fassaden. Gemeinsam kratzen wir am Verputz.
Raum und Zeit bestimmen den Umgang der Menschen mit Opium. Was gestern und anderswo erlaubt war, ist heute und hier verboten. Das muss gesagt sein und betrifft jene, die Prinzipien brauchen. Zudem arbeite ich in einer offiziellen Institution und bin mir meiner Rolle bewusst. Ich achte auf meine Worte. Das Zitat von Cocteau dient als roter Faden, den ich durch die Räume ziehe und um die Dinge wickle. Da ich geradezu versessen aufs Prozessuale bin, finde ich es gut, dass es Zitate gibt, mit denen man den Rahmen abstecken kann. Ich spinne Netze dazwischen. Manchmal passiert es, dass so etwas eingefangen und ausgesponnen wird, was seine eigenen Wege geht. Es ist meine letzte Führung durch Opium. Das
Publikum ist mir zugewandt. Ich spüre seine Zuneigung. «Ich begrüße Sie herzlich im Namen von – bewusste Pause – Opium», sage ich dieses Mal.
Hinter mir, auf den Dias an der Wand, schieben sich Mohnblüten übereinander, bis sie sich, noch während ich spreche, von den Kapseln lösen und – weiß, lila und purpurfarben –
zu Boden schweben. Eine junge Frau mit kupferroten Locken bückt sich nach einer. Ein Teppich aus Blütenblättern bedeckt den Boden, vor dem die Besucher einen Halbkreis bilden.
Das nächste Bild: Unter den Fingernägeln eines Opiumbauern aus Pakistan, dem Land der Reinen, klebt schwarzer Dreck. Er ritzt die Frucht an und zeigt, wie Opium gewonnen wird. Von oben nach unten. Die erste Milch ist weiß, wenn sie in Tröpfchen aus der jadegrünen Kapsel quillt. Der Bauer auf dem folgenden Dia sammelt die rotbraun glänzende Paste in Schalen. Die Wahl des Erntezeitpunkts ist heikel, ich
weiß.
Die Besucher sollen sich von Anfang an beteiligen. «Was assoziieren Sie mit Opium?», frage ich und ritze. Von oben nach unten. Was geht wohl in ihren Köpfen vor? Ich lausche. Einzelne Laute entsteigen den Mündern und formieren sich zu Begriffen wie Afghanistan, Opiumhöhle, Sucht, Schmerzmittel oder Rausch. Ich lasse den Klang nachzittern und merke mir die Wörter, bevor sie sich verflüchtigen und nach einem Ort in der Ausstellung suchen, auf dem sie sich niederlassen werden. Der Ausblutungsprozess ist im Gange. Le sang blanc coule épais du pavot de sa tête. Wir folgen seiner Spur. Geritzt wird üblicherweise drei Mal.
«Die erste Ritzung gibt den besten Saft», höre ich mich sagen. Dann beugen wir uns über fast zwei Kilo Rohopium unter einem Glaskubus im Eingangsraum. Diese Verbeugung verdient das letzte Opiumbrot, das 1973 zu medizinischen Zwecken und ganz legal von der Türkei nach Basel gelangen konnte: Das Corpus Delicti oder der Stoff, aus dem sowohl Träume als auch Albträume sind. Wie Sie wollen.
«Hunderte Arten von Mohn gibt es, aber nur eine mit dem ganz besonderen Saft, den die Griechen Opos nannten: Papaver somniferum», erkläre ich. Das Licht im großen Raum ist anders als sonst. Wir haben die Schwelle überschritten. Es geht los. PAPA VER SOMNIFERUM: Jetzt habe ich die Pflanze zerschnitten. Ich behalte den Kopf samt dem roten Faden von Cocteau in meinen Händen. Die Kapsel ist der Teil, der das meiste Opium enthält. Papa, ver somniferum4 ist das Stichwort, auf das sich vor der Vitrine mit den Opiumtinkturen und den Porzellangefäßen mit der Aufschrift Theriak eine Gestalt eingefunden hat. Sie erscheint in einem weißen Labormantel, wie Mikroanalytiker ihn zu tragen pflegen, und wartet. Sie ist ein Er. Er wartet auf mich. Ich erkenne meinen Vater. Sein Geist erscheint, wenn ich ihn rufe. Selbst wenn es sich dabei um ein Missverständnis handelt. Er reagiert eben auf Laute. Und da ich nach Papa eine kurze Pause eingeschaltet habe, bevor ich das Wort mit -ver somniferum zu Ende bringen konnte, ist er im ersten Stock des Museums gelandet. Genau an dem Platz, der ihm entspricht, während ich das ausgeflogene Wort Schmerzmittel von der Vitrine nehme und es mit der Kapsel und dem roten Faden deponiere. Theriaca steht auf dem Apothekergefäß aus Porzellan. Das opiumhaltige Universalheilmittel fand im 18. Jahrhundert reißenden Absatz.
Papaver Somniferum hat eine mehrere tausend Jahre alte Entwicklung als Schmerzmittel durchgemacht. Hul Gil, Pflanze der Freude, sollen es die Sumerer genannt haben. Theriak wird es heute noch im Iran genannt. «Theriak heilt alles, aber gegen Theriak5 gibt es kein Theriak», zitiere ich ein persisches Wortspiel, das sich mit der Auswirkung von Opium beschäftigt.
Die Anfangssilbe von Theriak führt mich weiter zu Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Den Namen lasse ich mit Bedacht über meine Lippen gehen. Er schmeckt üppig, und er steigert die Spannung bei den Besuchern. Noch, so vermute ich, kann niemand etwas mit dem Namen anfangen. Erst als ich ihn dem Arzt Paracelsus zuordne, der aus Basel flüchten musste, sehe ich das Leuchten in den Augen. Ihm folgt ein mehrköpfiges Nicken. Von Paracelsus stammt das Zitat: Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift. «Allein die Dosis macht’s», beendet es ein Mann mit buschigen Augenbrauen, die seinen Blick verstärken. Das Kopfnicken setzt sich fort, bis ich den Faden wieder aufnehme. Leider wusste auch Paracelsus über sein Laudanum, wie er die gelobte Opiumtinktur aus Alkohol nannte, nicht, mit welcher Menge aus der heilenden Dosis eine tödliche wurde. Viele sind an Atemstillstand, verursacht durch eine Überdosis, gestorben.
Mein Vater gibt ein Zeichen und verzieht seine Lippen zu einem Namen. «Sertürner», flüstert er mir zu. Er kann es nicht erwarten, von der mittelalterlichen Alchemie endlich zur Chemie vorzustoßen, die durch Analyse der Alkaloide Opium zu Beginn des 19. Jahrhunderts berechenbar und die in ihm enthaltenen Substanzen dosierbar gemacht hat. Seine Augen funkeln verschmitzt, als er mir ins Wort fällt, um mit der Geschichte des Apothekergehilfen aus Paderborn, ebendiesem Sertürner, zu beginnen, dem es furchtbar übel wurde, bevor ihm die Isolierung des Morphins aus dem Mohnsaft gelang. Die Besucher scharen sich um den Chemiker und wollen mehr dazu wissen. Während er mit einem Marker C17H19NO3, die chemische Formel für Morphin, dann die für Kodein und Heroin auf einem der Ausstellungsschränke notiert, stehe ich regungslos daneben und stelle mir vor, wie er das ganze Museum mit Formeln vollschmiert. Mein Mund ist trocken. Ich habe vergessen, ihn zu schließen. Ich brauche H2O – Wasser. Erst als ich unsere Aufsicht mit einem Putztuch auf die Scheibe zueilen sehe, rühre ich mich von der Stelle. Da hat sich der Chemiker im weißen Kittel schon aus dem Staub gemacht. Zurück bleiben nur Buchstaben und Zahlen auf dem Glas und ein Dunst, der sich vor dem Fenster im Gegenlicht abzeichnet. Wie kann ein Geist wissen, wie man sich in einem Museum benimmt? sage ich zu mir, um meinen Vater in Schutz zu nehmen. Manche Besucher wissen es auch nicht, und die sind keine Geister.
Wir wissen es jetzt: Opium wird getrunken. Opium wird gegessen. Opium wird als Morphin gespritzt, und Opium wird geraucht. Wir ziehen weiter, bis wir vor den Rauchutensilien haltmachen. Neben den seltenen chinesischen Pfeifen nehme ich historische Daten auf und lasse Fakten sprechen. Ein Blick auf meine Notizen zeigt: 1842, nach dem ersten Opiumkrieg, wurde China gezwungen, Hongkong für immer an England abzutreten. Die kleine Insel sollte sich als idealer Hafen herausstellen, um ungestört einen gigantischen Markt zu erschließen. «Ein Markt, der den einen Millionen sicherte, aber Millionen andere siecher machte6», erlaube ich mir das Wortspiel um ökonomisch profitable Abhängigkeiten. 1906 zählte China 13,5 Millionen Opiumsüchtige, was einen jährlichen Absatz von 39 000 Tonnen Opium bedeutete. Die chinesische Regierung führte einen erbitterten, aber aussichtslosen Kampf gegen den schwarzen Dreck, in dem die Behörden alles, was mit Opium zu tun hatte, zerstören und verbrennen ließen.
Die wertvollen Objekte, um die wir uns gruppieren, zählen zu den wenigen, die weltweit erhalten geblieben sind. Opium lässt erinnern, und wir erinnern uns. Ich erwähne den Sammler der schönsten Opiumpfeifen, Steven Martin, der seine Leidenschaft für das Rauchen und dessen Wirkung mit folgenden Worten beschrieben hat: Hinter entzückenden kunsthandwerklichen Erzeugnissen verbergen sich tatsächlich höchst effiziente Werkzeuge der Selbstzerstörung.7
«Wieso so negativ?», fällt mir der Althippie mit Mandschurenzopf ins Wort. «Opium ist ein Geschenk des Himmels, ein Segen, eine Gnade», während er sich Schritt für Schritt nach links um seine Achse zu drehen beginnt. «Opium ist Gottes eigene Medizin, es hilft uns Schmerzen zu ertragen und …» Zwei seiner Begleiter aus Bayern breiten die Arme aus und tun es ihm gleich. Das Kreisen erfasst einen nach der anderen. Wie die tanzenden Derwische haben sie die rechte Handfläche zum Himmel geöffnet, die andere weist zur Erde. Der mächtige goldene Buddha aus Japan, der in der Ausstellung Platz gefunden hat, thront davor und lächelt ihnen gütig zu. Er scheint von innen her zu leuchten und sich über das ausgelassene Drehen zu freuen. «Amida Buddha, hilf», flehe ich halb zu ihm, halb zu mir gewandt, «und bringe sie vom Kosmos zurück auf den Boden!» Buddha lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, er bleibt stumm. Die rechte Handfläche in der Geste des Lehrens nach oben, die linke nach unten, auch er. Ich peile den nächsten Saal an, doch die Tanzenden haben keine Eile. Nachdem sie sich wieder geortet haben, interessiert nur noch, wie man Opium raucht und wie es wirkt.
Opium verführt. Im Gegensatz zu Bizets Carmen, die ihr mais si je t’aime prends garde à toi hinausposaunt, um schließlich Don Josés Dolchstoß zu erliegen, schleicht es sich an und zeichnet die Wege vor, an deren Ende der Tod uns umfängt.
«Solange du Opium rauchst, ist es ein Segen, aber wehe, wenn es dich zu rauchen beginnt», sagte mir einer, der es wissen musste. Es schält dich aus der Verantwortung für Gegenwärtiges und Zukünftiges. Die Besucher hören nicht mehr zu. Sie entgleiten mir. Sie wollen es selbst erfahren und fordern die Seele der Pflanze heraus. Möge sie sich offenbaren. Ein Drängen zur Opiumhöhle beginnt. Niemanden stört es, dass das transparente Kunststoffiglu im Zentrum nicht im Entferntesten einer solchen gleicht. Der Tanz hat auch die Vorstellungskraft befreit. Jeder bekommt eine Pfeife, bevor wir uns in und neben der Opiumhöhle aus Plexiglas niederlassen. Ich wähle die Bambuspfeife mit dem Jademundstück und wickle den roten Faden um das dunkle Rohr. Geduld, meine Damen und Herren, geschätztes Publikum, es gibt genug Opium für alle in den Ausstellungsschränken. Der Mann von den Front Services hat mittlerweile die Waffen gestreckt und Klappstühle herangeschafft, um das Beisammensein gemütlicher zu gestalten. Er hilft mir beim Anzünden der Opiumlampe und bringt uns das persische Opium samt Glas aus der Vitrine. Es ist in Rollen vorbereitet. Eine Rolle entspricht etwas über neunzehn Gramm. Noch ist es viel zu hart. Rauchen werden wir es auf die chinesische Art. Mit ausgesuchten Luxuspfeifen soll der Prozess der kulturellen Aneignung8 erfahrbar werden. Opium wird verdampft und nicht angezündet. Ich muss es ihnen noch zeigen. Bühne frei für Opium.
«Nehmen Sie die Nadel und erwärmen Sie ein Opiumkügelchen über der Lampe, und zwar so, dass es nicht mit der Flamme in Berührung gerät», erläutere ich, während meine Hand zittert. Ziemlich umständlich, aber der Althippie hat Erfahrung, und nach einigen Versuchen blubbern die ersten Kügelchen schon auf den Pfeifenköpfen. Auch die Aufsicht kann sich zurücklehnen. Die Besucher werden gesprächig. Eine ältere Dame erzählt von ihrer ersten Begegnung mit Opium in Indien. «Damals habe ich keine Wirkung verspürt. Jetzt fühle ich mich so leicht und friedlich», sagt sie. «Vielleicht hat die Ruhe Buddhas auf dich abgefärbt», meint ihre Freundin. Die Gäste aus Bayern unterhalten sich mit der Indienreisenden. Ein Pharmamanager ergreift das Wort und spricht sich nach mehreren tiefen Zügen für den Opiumanbau an Walliser Berghängen aus. Leider seien die Winter dort zu kalt, meint jemand, der sich auskennt. Die Gespräche plätschern sonor dahin. Während die Zungen träger werden, wird der Gehörsinn geschärft. Selbst das Echo im Innern ist lauter geworden. Nein, Opium erzeugt keine Visionen, es ist kein Halluzinogen. Der Rausch verstärkt nur, was bereits in einem schlummert. Gib
einem Ochsentreiber Opium, und er wird wahrscheinlich von Ochsen träumen, meinte Thomas de Quincy. Wie spät ist es eigentlich? Die Uhr zeigt mir, dass fast drei Stunden vergangen sind. Doch weiß ich nicht mehr, was drei Stunden bedeuten. Wir haben das Zeitgefühl verloren. Der Applaus, bevor wir uns verabschieden, gehört allen, nicht zuletzt – aber das wissen Sie ja schon!
Meine letzte Führung ist vorbei. Opium ist zu Ende. Die Ausstellung wird abgebaut. Wo Opium war und mich zur Entdeckerin seiner vielseitigen Aspekte werden ließ, ist tohu wa bohu, wüst und leer. Entzogen ist mir die Quelle meiner Inspiration. Ich suche sie überall, doch wohin ich mich auch wende, sie ist versiegt. Ich finde nur ein Loch, so rund und leer wie O für Opium. Sein schonungsloser Sog zieht mich hinein. Hier muss ich durch. Es gibt keinen Ausweg. Die magnetische Höhle beginnt sich nach hinten zu verlängern. Der Tunnel wird auch mich verschlingen. Verkehrslärm pulsiert durch die Röhre. Ein transversales Dröhnen schraubt sich durch mein Gehirn. Ich schlafe nicht mehr. Ich brauche diese Substanz, die mich zum Fließen brachte.
Das Mondlicht schiebt sich durch die Luken meines Dachfensters. Schicht um Schicht. Opium treibt mich um. Ich muss es zu Papier bringen. Ich schreibe. Meine Feder kratzt trocken über das Papier. Dann fließt aus ihr der Saft. Er dunkelt nach. Mein Geist wird klar. Die Erzählung kann beginnen. Ich werde sie Mein Opium nennen.