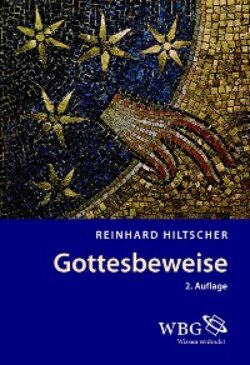Читать книгу Gottesbeweise - Reinhard Hiltscher - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1.3 Spinoza
ОглавлениеAn den Anfang der Ethik stellt Spinoza47 eine Definition. Spinoza ist Cartesianer durch und durch. Schon der erste Satz der Ethik schließt sich an diese Tradition durch die Verwendung des cartesischen „Aseitätsbegriff“ an:
„Unter Ursache seiner selbst verstehe ich das, dessen Wesen das Daseyn in sich schliesst, oder das, dessen Natur nicht anders als daseyend begriffen werden kann.“
Spinoza macht (im Sinne Henrichs) von der zweiten Variante des cartesischen Beweises Gebrauch. Er wählt nämlich als Ausgangspunkt den Begriff eines Wesens von höchster Allmacht.48 Die erste Definition artikuliert dementsprechend die unerlässliche Fundamentalbedingung der Allmacht, die Aseität. Ein Wesen, dem Aseität eignet, ist eine „causa sui“. Um ein Missverständnis der „causa sui“ auszuschließen, sei gesagt, dass „causa sui“ im Verständnis Spinozas eine Entität sein soll, in deren Wesen das Dasein eingeschlossen sei. Die „causa sui“ wird also nicht absurderweise so gedacht, als erzeuge sich die zum Zeitpunkt t1 (noch) nicht seiende „causa sui“ als seiend zum Zeitpunkt t2 selbst. Bei einem solchen Modell gehörte ja gerade das Dasein nicht zum Wesen der nur vermeintlichen „causa sui“ – zumindest nicht zur „zeugenden causa sui“ bei t1. Der „Daseinseinschluss“ in das Wesen einer Entität von Aseität hat die Folge, dass das „ens a se“ nicht anders als real instanziiert gedacht werden könne. Die „causa sui“ in diesem Sinne kann nicht vergehen, ebenso wenig aber auch allererst entstehen, wie das eben skizzierte Fehlverständnis von ihr nahelegen könnte. Gut cartesisch gilt: Wenn eine solche Wesenheit, in die das Dasein inkludiert ist, idealiter existiert, dann muss sie auch wegen des „Daseinseinschlusses“ in ihren Wesensbestimmungen realexistieren. Denn nach Descartes gilt das Prinzip, dass eine Wesenheit idealiter unabhängig von ihrem Gedachtwerden existiert, wenn die Verknüpfung ihrer Bestimmungen notwendig ist. Wir haben dies im vorhergehenden Descarteskapitel hinlänglich dargestellt. Sofern also die Bestimmung höchster Allmacht nicht ohne die Bestimmung „Sein“ zu denken ist, ist ein allmächtiges Wesen nicht nur idealiter existent, sondern auch realiter. Doch diesen cartesischen Schnell-Schluss zieht Spinozas Ethik nicht, sondern quält sich für den heutigen Leser ein wenig befremdlich über weitere Definitionen, Axiome und Lehrsätze allererst zu diesem Ergebnis.
Die zweite Definition exponiert den Sinn von „endlich“. Endlich sei etwas genau dann, wenn es durch „Seinesgleichen“ restringiert werde. Ein Körper werde immer durch einen anderen größeren begrenzt – Denken werde durch anderes Denken begrenzt. Endlichkeit wird also im Kontext einer durchgängigen funktionalen Limitation von Extensions- und Denkbestimmungen verstanden. In der dritten Definition geht es um die adäquate Fassung des Substanzbegriffes. Alles was eine bestimmte „Stelle“ im System des Seins einnimmt, ist zwar hierdurch einerseits genau bestimmt, aber aufgrund dieser Bestimmtheit durch die anderen Momente des Seins als endlich limitiert. Es sei nun Charakteristikum der Substanz, dass diese nur aus sich selbst heraus begriffen werden könne, ohne dass zur Bestimmung ihres Begriffes die Begriffe anderer Dinge nötig seien. Dies setzt aber klarerweise voraus, dass die ontologische Verfasstheit der Substanz „per definitionem“ nicht anderer Entitäten bzw. der Relation zu diesen bedürftig sei. Für den „betrachtenden Verstand“ heißt dies, dass man nicht des Begriffes irgendeines anderen Dinges bedürfe(n dürfe), um den Begriff (zunächst) irgendeiner Substanz zu bilden. Damit ist eigentlich bereits per definitionem ausgeschlossen, dass man irgendeine endliche Entität als Substanz verstehen könne. Denn nach der Definition von „Endlichkeit“ hätte der Umstand, dass ein Begreifen der Substanz nur unter Bezug auf etwas der Substanz Jenseitiges möglich wäre, die Folge, dass die Substanz von diesem Jenseitigen zur Endlichkeit begrenzt würde. Da nun aber die Substanz definitionsgemäß „im Prinzip“ allein aus sich heraus bestimmt ist und damit nur durch sich selbst erkannt werden kann, folgt nach den Gesetzen einer vollständigen Disjunktion, dass die Substanz unendlich, unbegrenzt sein müsse, da sie nicht endlich sein kann. Unbegrenztheit geht aber in etwa mit der „omnitudo realitatis“ zusammen, die offenkundig ja nur als eine Singularität möglich ist. Im Grunde liegt also in dieser Definition schon beschlossen, dass man die „Substanz“ nach Spinoza nur als ens necessarium qua omnitudo realitatis auffassen kann. In unausweichlicher Konsequenz kann man unter Anerkennung der spinozistischen Definitionen von Substanz nur als von einer Singularität sprechen. „Attribut“ wird in der vierten Definition als Bestimmung des Wesens der Substanz gefasst. Attribute sind damit innerliche Wesenbestimmungen der Substanz derart, dass sie zur Ausübung ihrer Bestimmungs- und Konstitutionsfunktion nicht auf Substanzexternes angewiesen sind. Das „Attribut“ sei also – so lehrt Spinoza – als wesensimmanentes Konstitutivum der Substanz aufzufassen, so dass der Verstand mit dem Attribut eine immanente, nichtrelative Bestimmung der Substanz erfasse. Der Modus der Substanz hingegen betreffe Relativbestimmungen zu anderem, aus denen heraus man die Substanz auch begreifen könne. Diese modale Erfassung der Substanz sei aber keinesfalls als deren Wesenserkenntnis zu werten. Modi sind qua Relativbestimmungen gerade keine Konstitutiva des Wesens, mithin wird in ihnen die Substanz auch nicht in sich selbst erfasst. Die sechste Definition bezieht sich nun expressis verbis auf Gott. Gott müsse als eine unendliche Substanz in der Weise verstanden werden, dass jedes seiner Attribute Unendlichkeit ausdrücke. Denn einem Etwas, das nur in seiner Art unendlich sei, könne man widerspruchsfrei unendliche Prädikate absprechen. Gottes (substanziales) Wesen beinhalte unendliche Attribute. In einem unendlichen Wesen drücke alles nur in einem positiven, nicht limitierten Sinne Wesen aus. Denn der Momentcharakter der endlichen Entität, der diese als endliche Entität konstituiere, beinhalte uno actu eine limitative Negation allen anderen „Komplementärseins“, mithin eine Negation anderer Partialrealitäten. Genau diese, dem endlichen Sein inhärente Negativität ist für Spinoza Grund für ebendiese Endlichkeit. Dem Unendlichen hingegen kommt diese limitative Negativität nicht zu. Genau deshalb ist es ja unendlich. Auf die Definitionen folgen nun Axiome. Axiom 1 artikuliert den ontologischen Prinzipiensachverhalt des „Gegründetseins“. Alles was sei, sei entweder in sich oder in einem anderen – lesen wir. Da die Disjunktion in den Augen Spinozas notwendig vollständig ist, kann man schließen, dass dann, wenn das eine nicht gilt, das andere gelten müsse. Das heißt erstens: Wenn etwas nicht in sich und durch sich im Sein kontinuiere, dann muss es ein anderes ins Sein bringen und dort bewahren. Zweitens heißt dies: Wenn etwas kraft seines eigenen Wesens im Sein kontinuiert, dann kann kein anderes Sein es ins „Dasein“ setzen und sein Wesen ist ontologisch „unbezüglich“ konstituiert. Nicht in Frage zu stellen scheint Spinoza damit den „metaphysischen Sachverhalt“, dass jede Entität bezogen auf ihr Sein und bezogen auf ihr Wesen eines Grundes bedürftig sei. Insofern ist Axiom2 konsequent, wenn in ihm gesagt wird, dass dasjenige, das nicht durch ein anderes begriffen werden könne, nur durch sich begriffen werden könne. Nun folgen zwei spezifische „Kausalaxiome“. Aus einer gegebenen Ursache erfolge notwendig die ihr korrelierte Wirkung – und gebe es keine Ursache, so könne auch keine Wirkung erfolgen. Darin liege auch, dass die Erkenntnis einer Wirkung von der Erkenntnis der Ursache abhänge. Wichtig sind für unsere Belange noch die Axiome5 und 7. Axiom 5 behauptet, dass Dinge ohne jede Gemeinsamkeit und wechselseitige Relation nicht auseinander begriffen werden können. Dies hat die Folge, dass bezogen auf zwei Entitäten A und B weder im Begriff von A ein Merkmal der Entität B vorkommen kann, noch im Begriff von B ein Merkmal der Entität A. Axiom7 statuiert, dass Wesenheiten, von denen man prinzipiell denken könne, dass sie (auch) nicht realexistent seien, in ihrem Wesen nicht das Dasein einschlössen. An die Axiome schließen sich nun die Lehrsätze an. Ein erster Lehrsatz kennzeichnet die Substanz als das prinzipienlogisch Frühere und Ursprünglichere gegenüber ihren Affekten. Denn die Substanz (siehe Definition 3) muss und kann nur aus sich selbst heraus begriffen werden. Da sich Affektionen der äußeren Reflexion verdanken, sind sie „per definitionem“ keine solchen inneren Bestimmungen, aus denen heraus die Substanz begriffen werden kann. Innere Bestimmungen des Wesens der Substanz sind ja die Attribute. Aus Spinozas Problemexposition folgt nun ganz zwingend, dass verschiedene Substanzen keine Attribute gemeinsam haben können, denn sonst würden diese Substanzen jeweils nicht aus sich heraus bestimmt sein – und könnten (teilweise) nur relational zueinander bestimmt werden. Bezogen auf Dinge gilt, dass sie nicht als in wechselseitiger Kausalrelation stehend betrachtet werden können, wenn sie nichts gemeinsam haben und ihre Begriffe nicht im Verhältnis der Interdependenz stehen. Nun schreibt sich die Problematik natürlich zu der Frage fort, wodurch Dinge je unterschiedlich sind bzw. vom Verstand je unterschieden werden können. Verschiedene Dinge unterscheiden sich aufgrund der Attribute ihrer Substanzen oder aufgrund ihrer Affektionen. Wenn sich Dinge „attributiv“ unterschieden, beträfe die Unterscheidung Attribute derselben Substanz. Ebenso wenig wäre der „affektive Unterschied“ ein Unterschied der Substanzen, da die Substanz ihren Affektionen vorausginge. Dies heißt: Die Substanz ermöglicht als Grund allererst differente Affektionen. Der Grund nun (= die Substanz) kann damit nicht selbst jenen Gesetzlichkeiten der Ausdifferenzierungen unterliegen, die er allererst ursprünglich ermöglicht und stiftet (differente Affektionen). Denn wenn die Substanz letzter Differenzierungsgrund ihrer Affektionen ist, dann müsste sie, wenn sie ihrerseits in ihren substantialen Bestimmungen selbst wesenhaft different wäre, das Andere ihrer selbst sein. Das Andere eines Differenzierungsgrundes könnte aber nur ein Grund der Nicht-Differenzierung sein. Der Begriff der Substanz wäre mithin innerlich widersprüchlich, denn die Substanz wäre dann in einer identischen Hinsicht zugleich Differenzierungsprinzip und Nichtdifferenzierungsprinzip ihrer selbst. Ein dialektisches, negationstheoretisches Repertoire hatte Spinoza noch nicht zur Verfügung, um den Gedanken eines inneren Unterschiedes konsistent durchführen zu können. Als Folgerung aus diesen Zusammenhängen ergebe sich, dass Substanzen, die keine gemeinsamen Attribute aufwiesen, nichts miteinander gemein hätten. Somit sei es einerseits auszuschließen, dass eine Substanz eine andere Substanz erzeugte, andererseits könne eine Substanz auch nicht durch eine andere begrifflich erkannt oder „kausal“ rekonstruiert werden. Spinoza knüpft (wie gesehen) die Möglichkeit, etwas als aus sich selbst heraus bestimmt erkennen zu können einerseits und etwas als fremdbestimmt erkennen zu können andererseits an die Frage, ob dieses Etwas im ontologischen Sinne Selbststand (= erster Fall) ist – oder ob es ontologisch fremdkonstituiert ist (= zweiter Fall). Da die Substanz nur durch sich selbst erkannt werden könne, sei sie ausschließlich als ontologischer Grund ihrer selbst zu fassen. Dies bedeutet nun aber auch, dass die Substanz in ihrem Wesen das Dasein einschließe, dass sie der „Ort“ der Aseität sei. Weiterhin könne diese Substanz nur als unendliche verstanden werden, da eine endliche Entität durch Gleichartiges begrenzt werden müsste. Da es nicht mehrere, einander limitierende Substanzen geben könne, müsse die eine unlimitierte Substanz unendlich sein. Definition 6 fasst Gott konsequenterweise als eine Substanz von unendlichen Attributen. Da Gott als Wesen von vollständiger Aseität nur als unendliches Seiendes schlechthin zu begreifen sei, könne es nach den definitorischen „Einlassungen“ Spinozas bezogen auf die Substanz nur eine unendliche Substanz mit unendlichen Attributen geben. Dass die Argumentation auf die Bestimmung des ens a se als omnitudo realitatis hinausläuft, wird umso deutlicher, als Spinoza an dieser Stelle die Unterscheidung zwischen „schlechthin unendlich“ und „in seiner Art unendlich“ anführt. Nur dasjenige sei schlechthin unendlich, was ausschließlich Wesen (= positive Vollkommenheit) ausdrücke, jedoch keine einschränkenden Negationen artikuliere.