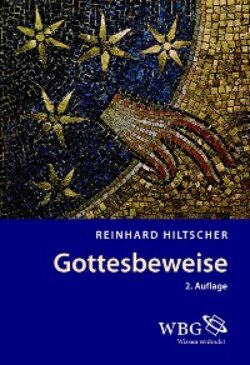Читать книгу Gottesbeweise - Reinhard Hiltscher - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
0 Einführung
ОглавлениеWas ist ein Gottesbeweis? Die Antwort könnte trivialerweise lauten: Ein Gottesbeweis ist der Versuch zu beweisen, dass ein Gott existiert. Wenn wir aber etwas als existent behaupten, dann müssen wir zumindest ein Grundwissen davon haben, welche Verfasstheit diejenige „Sache“ aufweist, die da existieren soll. Vielleicht betreiben wir drittmittelgefördert etwas Zoologie. Wir könnten z. B. im Dschungel Südamerikas die Existenz einer neuen Tierart feststellen. Zu diesem Zwecke müssten wir Eigenschaften, die mit diesem „neuen Tier“ grundsätzlich immer „unauflöslich“ verbunden sind, beobachten. Denn nur ein fest geschnürtes Bouquet bestimmter signifikanter Eigenschaften kann Indiz für eine neu entdeckte Spezies sein. Außerdem sollten wir bei einem ausführlichen schriftlichen Bericht in der Lage sein, sicher und ohne jeden Zweifel gegenüber der DFG nachzuweisen, dass dieser spezifische Eigenschaftsverbund weltweit bisher bei keiner anderen Tiergattung festgestellt werden konnte. Oder wir gehen umgekehrt von einem Begriff bzw. einer Fiktion aus. Wir könnten etwa den Begriff eines grünen Marsmenschen bilden. Die minimalen Bestandteile dieses Begriffs sind grüne Hautfarbe (evtl. Fellfarbe?), der ursprüngliche Lebensraum auf dem Planeten Mars und das Menschsein. Wenn wir Menschsein als eine bestimmte Verfasstheit der rational-kognitiven Ausstattung verstehen, dann müssten wir sagen: Der Marsmensch, den wir meinen, ist grün eingefärbt, lebt auf dem Mars, ist strukturell ähnlich intelligent wie wir und hat eine mit der unsrigen vergleichbare kognitive Ausstattung. Bisher konnte man die Existenz eines so gearteten Mitbewohners unseres Kosmos leider nicht nachweisen. Aber die Forscher der NASA bleiben bei derlei Fragen bestimmt hartnäckig „am Ball“. Entweder entdecken wir somit einen Teil unserer Welt neu und bilden dann erst begrifflich das Was seiner Eigenschaften – oder aber, wir haben eine Vorstellung oder einen Begriff zur Verfügung und fragen dann, ob dieser Vorstellung (bzw. diesem Begriff) etwas in der Welt entspricht. In jedem Falle ist die Existenzfrage stets mit dem Was der Eigenschaften derjenigen Entität verbunden, die da existieren soll. Die Frage nach der Existenz Gottes ist nun wohl eher der zweiten der beiden alternativen Möglichkeiten zuzuordnen. Wir müssen einen Begriff (eine Art Vorstellung) von Gott besitzen – und können dann erst fragen, ob ein „wirkliches Seiendes“1 diesem Begriff korrespondiert. In einer Weise, die eine eindeutige empirische „Existenzidentifikation“ erlaubte, begegnet uns Gott in der Welt sicherlich nicht. Ein Wesen welcher Art versuchen wir nun aber zu beweisen, wenn wir Gott beweisen wollen? Welchen Begriff, welche Vorstellung haben wir von diesem Wesen? Als Kinder des christlichen Abendlandes und Personen, die kulturell von dessen monotheistischen Traditionen geprägt sind, könnten wir sagen: Wir fragen nach der Existenz eines Wesens, das wenigstens diese fünf Eigenschaften aufweist: Gott ist eine Person (1), die allmächtig (2), allweise (3), allgütig (4) und höchst gerecht (5) ist. Wir müssen gar nicht unseren Kulturkreis verlassen, um zu bemerken, dass dieses Gottesbild alles andere denn alternativlos ist. Die alten griechischen Götter waren sicherlich nicht allgütig – und keineswegs moralisch integer bzw. moralisch skrupulös. Die meisten griechischen Göttinnen hätten wohl nur einen sehr kurzen Aufenthalt in einem Mädchenpensionat genießen können und wären dort keineswegs zu „ignorieren“ gewesen – sehr im Gegensatz zu jenem relativ harmlosen „Mann im Mädchenpensionat“, von dem Georg Kreisler einmal gesungen hat.2 Von einer Allmacht der griechischen Götter zu sprechen, wäre ebenfalls eher als Kategorienfehler zu bewerten, denn die griechischen Götter waren dem Schicksal – der Moira – genauso unterworfen wie die Menschen. Ähnliche Inkompatibilitäten mit der monotheistischen Gottesvorstellung gibt es bei den germanischen Göttern. Diese waren offenkundig rechte Raufbolde und gegen moralische Fehler nicht wirklich gefeit. Wie die griechischen Götter hatten sie eine Vorliebe für sexuelle Exzesse sowie Saufgelage – und waren unseren germanischen Ahnen keineswegs immer liebenswürdige Zeitgenossen. Mit welchem Recht geht also unsere Gottes-Existenzfrage scheinbar vom monotheistischen Gottesverständnis aus, wie es sich im Judentum, dem Christentum und dem Islam findet? Ist dies nur deshalb der Fall, weil das Gottesbild in diesen Religionen intellektuell ausgefeilter ist als in anderen Religionen? Ein Blick auf die fernöstlichen Religionen kann diese Annahme sofort widerlegen. Viele Spielarten der fernöstlichen Religionen haben überhaupt keinen expliziten Gottesbegriff (zum Beispiel der Buddhismus). Der Hinduismus andererseits hält unverbrüchlich an seiner Vielgötterei fest. Von beiden Religionen kann aber keineswegs gesagt werden, sie seien intellektuell rückständig. Man denke etwa an die parallel zu diesen Religionen praktizierte hoch entwickelte Philosophie und „Seelentechnik“ (um einen Ausdruck Max Schelers zu verwenden). Sollten uns die Pilgerfahrten der europäischen Jugend nach Indien insbesondere in den sechziger und siebziger Jahren nicht endgültig Bedenken gegenüber der monotheistischen Gottesvorstellung einflößen – waren denn John Lennon und George Harrison keine echten, ernst zu nehmenden Intellektuellen? Und schließlich hat doch auch Spinoza in seiner Glasschleiferwerkstatt ein pantheistisches Gottesverständnis zumindest mit relativer immanenter Konsistenz darlegen können.
Vor diesem Hintergrund scheint die Frage nach einem Existenzbeweis Gottes, die von dem skizzierten jüdisch-christlichen Gottesbild ihren Ausgang nimmt, extrem eurozentrisch zu sein. Dieser Befund wäre zutreffend, wenn nicht ein zweiter Aspekt hinzukäme. Dieser Aspekt ist primär innerphilosophisch situiert. Wir meinen damit den Gedanken einer letzten Begründung, der sich von Anfang an in der griechischen Philosophie gebildet hatte und der bis in unsere Tage im philosophischen Kopfwerk weitertradiert wird, wenn er sich auch innerhalb der Philosophenzunft nicht immer einer gleichbleibenden Beliebtheit erfreut. Der Letztbegründungsgedanke ist unabdingbare Voraussetzung für die philosophische Berechtigung und Entstehung der Frage nach der Existenz eines monotheistischen Gottes. Nun ist die philosophische Frage nach Letztbegründung keineswegs eine univoke Frage, sondern es gibt verschiedene (wenn auch zusammenhängende) Begründungsprobleme, die einer letzten Begründung harren. Die Frage nach einem letzten Grund kann ontologisch gestellt werden. Wir fragen dann nach einem letzten Grund alles Seins. Sie kann aber auch erkenntnistheoretisch (gnoseologisch) gestellt werden. Wir fragen dann nach dem letzten Grund der Möglichkeit dafür, dass wir gültige Erkenntnis von der Welt haben. Eine weitere Letztbegründungsfrage könnte in der Frage nach dem letzten Grund unserer Moral bestehen usw. Es zeigt sich sehr schnell, dass ein allmächtiger, allweiser, allgütiger und allgerechter personaler Gott am besten als ein letzter Grund aufgefasst zu werden vermag. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang scheint auch die Tatsache zu sein, dass dieser monotheistische Gott als optimaler Kandidat dafür, letzter Grund zu sein, gleichermaßen für all diese Letztbegründungsprobleme infrage kommt. Die skizzierten Letztbegründungsfragen können wir nun sehr leicht den verschiedenen Formen der Gottesbeweise zuordnen. Der kosmologische und der teleologische Gottesbeweis suchen nach einem letzten Grund alles Seins bzw. der Welt. Der moralische Gottesbeweis statuiert Gott als den letzten Grund der Möglichkeit der Geltung der Moral. Der ontologische Gottesbeweis fragt nach der letzten Basis der Möglichkeit der Erkenntnis, indem er ein ganz bestimmtes Verhältnis von Denken und Sein letztfundiert. In jedem dieser Fälle ist ersichtlich, dass philosophische Gottesbeweise keine Selbstzwecke sind, sondern eine Begründungsfunktion zu übernehmen haben. Diese rein rationale Begründungsfrage unterscheidet die philosophische Frage nach Gott fundamental von der theologischen. Im theologischen Rahmen sind die Gottesbeweise natürlich ebenfalls von erheblicher systematischer Signifikanz.3 Mit ihnen soll ja mit dem Anspruch auf theoretische Geltung bewiesen werden, dass der „geglaubte Gott“ ist. Aber selbst dann, wenn es rein rational gelingen sollte, in irgendeinem theoretischen Beweis aufzuzeigen, dass ein „aliquid“ ist, welches wir mit dem Namen „Gott“ bedenken, so könnte dies nur der Ausweis eines letzten Absoluten der Begründung sein, dessen Identität mit dem im Medium des Religiösen intendierten totalen Sinnuniversum noch nachgewiesen werden müsste. Ohne einen solchen „Identitätsnachweis“ läge z. B. aus christlicher Sicht nur ein „höflicher Atheismus“ vor, wie dereinst ein nicht völlig unbekannter Philosoph (allerdings) mit Blick auf den Pantheismus bemerkte. Geben wir zunächst einen „Durchblick“ durch die verschiedenen Formen der Gottesbeweise. Worum geht es beim kosmologischen bzw. beim teleologischen Gottesbeweis? Beide Beweisformen – wir sagten dies bereits – streben an, einen letzten Grund alles Seins auszumachen. Nun kennen wir in der Welt nur Dinge, die zu existieren beginnen und ebenso wieder zu existieren aufhören. Hieraus resultieren nun zwei unterschiedliche, jedoch eng zusammenhängende Probleme. 1.) Stellen die Zustände der Welt und der Dinge in ihr eine unendliche Zeitfolge bis zum jetzigen Zeitpunkt dar – oder gibt es einen Anfang in der Zeit? 2.) Gibt es einen ersten Grund von allem, was ist? Die zweite Problemstellung ergibt sich aus der Tatsache, dass bei allen Dingen, die wir kennen, letztlich immer eine diesen Dingen externe Ursache (oder Bedingung) den Eintritt dieser Dinge in ihre Existenz sowie aus dieser hinaus gründet. Entweder man nimmt an, dieser Gründungsprozess sei ewig, womit wir bei Problem 1.) angekommen wären, oder aber dieser Prozess wird als endlich und abgeschlossen betrachtet. Wird er als abgeschlossen betrachtet, so ist für ihn eine erste Ursache anzunehmen. Diese könnte nun entweder unbegründet und zufällig stattfinden, oder aber – wie auch immer dies gedacht werden können soll – Grund ihrer selbst sein. Nur im letzteren Falle hätten wir einen echten Abschluss der Begründung, mithin eine echte Letzt-Begründung. Im ersten Falle läge sozusagen nur ein unbegründeter und zufälliger erster Grund vor. Wir brauchen nicht viel Rhetorik aufzuwenden, wenn wir klarmachen wollen, dass eine erste Ursache, die Grund ihrer selbst sein soll, nicht anders denn als allmächtig verstanden werden kann, sofern wir diese selbstgründende Ursache mit dem monotheistischen Attribut der Personalität in Verbindung bringen. Wir sind hier bei einem ersten theistischen Attribut angelangt, nämlich dem der Allmacht. Wie steht es mit der Zweckordnung der Welt? Tun wir einmal so, als habe Darwin nie gelebt. Dem ersten Augenschein nach gibt es viel Seiendes der Welt, das zweckhaft strukturiert ist. Eine zweckhafte Strukturierung verlangt aber nach einem Erzeuger, der vernunftbegabt ist. Denn planende Zweckrationalität kennen wir nur von Wesen, die Vernunft besitzen. Nun könnte man sich betreffs einzelner naturaler Zwecke der Welt durchaus Kobolde, Dämonen, Zwerge, Riesen und andere Phantasiegestalten ausdenken, die diese jeweils erzeugt hätten. In ätiologischen Mythen, Märchen und Sagen finden wir dergleichen Erklärungen ja oftmals. Eines können diese ganzen Phantasiegestalten wohl aber nicht überzeugend erklären: nämlich die gesamte und durchgängige Zweckordnung der Welt – oder plakativer gesprochen, den Sinn der Welt. Um eine durchgängige Zweckordnung der Welt im Ganzen bis hinein in ihre kleinsten Details entwerfen zu können, benötigt man Allweisheit. Dies gilt umso mehr, als diese durchgängige Zweckordnung nicht nur den aktuellen Zustand unseres Universums betreffen kann, sondern die Gesamtzukunft des Universums „umgreifen“ muss. Damit sind wir bei einem weiteren Attribut des theistischen Gottesbegriffes angelangt. Soll das allweise Wesen in der Lage sein, seinen Gesamtplan der Schöpfung selbst durchsetzen zu können, muss es zugleich das allmächtige Wesen des kosmologischen Beweises sein. Wieder dient Gott als letzter Grund, diesmal als letzter Begründungsbaustein in der Erklärung der Zweckordnung der Welt. Was ist nun mit unserer Moral? Egal, wie diese in ihren einzelnen Statuten aussehen mag, sie erhielte einen unbedingten Charakter insbesondere dann, wenn ein allgütiger Gott, der zugleich höchstgerecht ist, deren Gesetze garantieren würde. Aber selbst dann, wenn man etwa wie Kant eine Selbstfundierung der Moral in Abwehr ihrer Theonomie propagiert, bleibt die Frage offen. Kann sich Moral durchsetzen? Diese Frage hat ihren Ort zunächst in einer „allgemeinen“ Lebenserfahrung, nämlich der, dass offenkundige Schurken zumeist besser leben und sich auch oftmals als „lebenstüchtiger“ erweisen als sensible Moralisten. In tiefen süddeutschen Gefilden bringt man deshalb oftmals dem gerissenen „Sauhund“ (insbesondere auch dann, wenn er ein bekannter Politiker ist) eine Art Bewunderung entgegen. Vertritt man einen Atheismus, so scheint deshalb die Frage berechtigt zu sein, warum man denn moralisch handeln solle, wenn einem dieses moralische Handeln in der Welt erkennbar überdurchschnittlich viele Nachteile einbringt. Dieses Argument als solches ließe sich eventuell noch atheistisch umschiffen. So könnte man etwa dem Tugendbold ein moralisches Wohlbehagen, eine innere Selbstzufriedenheit attestieren, das/die der Gauner so nie erfahren könnte. Das Bewusstsein der eigenen Tugendhaftigkeit könnte für den passionierten Stoiker zur nicht absetzbaren Droge werden, die ihn für viele Weltnachteile entschädigen könnte etc. Gesteht man allerdings zu, dass Moral autonom (und eben nicht theonom) zu begründen sei, so ist damit zunächst bestenfalls sichergestellt, dass Moralität eine Wesensverfasstheit der Gattung Mensch ist. Moral scheint eine exklusive Gesetzlichkeit von uns Menschen zu sein. Was sollte sie auch sonst sein? Steine, Pflanzen und wohl auch Tiere können doch nicht als moralisch verpflichtet gedacht werden. Kann Moral dann aber – gemessen an der Struktur des Kosmos – eine mehr als partikuläre Relevanz aufweisen? Prima facie ist die Frage nach einer kosmischen Relevanz unserer Moral verfehlt. Doch so leicht kommen wir hier nicht davon.
Geben wir zwei Beispiele, um uns verständlich zu machen. Wir empfinden es normalerweise als gerechtfertigt, Tiere unter gewissen Bedingungen zu töten – etwa um uns mit deren Fleisch zu ernähren. Könnte man nun etwa ein psychisch nicht labiles, nicht suizidales Hausschwein fragen, ob ihm dieses Verfahren sonderlich zusage, wäre die Antwort sicher ein klares Nein. Womit begründen wir es, dass wir in das Leben höher entwickelter Tiere eingreifen? Offenkundig wohl mit der Behauptung, dass wir uns sonst nicht zureichend ernähren könnten und in dem Falle, dass wir das nicht täten, keine Überlebenschance hätten. Warum soll aber die Gattung Mensch überleben? Etwa bloß darum, weil sie im Vergleich zu Schweinen höher entwickelte kognitive Fähigkeiten hat? Konstruieren wir ein zweites Beispiel. Nehmen wir an, eine Fliegende Untertasse landet auf der Erde. Ihre Insassen haben uns weit überlegene kognitive Fähigkeiten. Die Fremdlinge müssen nun Erdlinge verzehren, um sich ernähren zu können. Vielleicht tun sie dies, weil erstens ihre Bordnahrung bereits verbraucht ist und sie sich zweitens nicht von irdischen Pflanzen ernähren können. Zudem vertragen sie nicht das Fleisch von Tieren unserer Erde, sondern nur das der humanoiden Erdlinge. Vielleicht schmeckt ihnen aber auch ganz einfach nur Menschenfleisch besonders gut, das sie ohne großes Nachdenken und Moralisieren einfach genießen. Sind wir gegen diesen außerirdischen Speiseplan nur deshalb, weil wir als Gattung und als Individuen überleben wollen – oder sind die Fremdlinge unmoralisch in einem absoluten, universalen Sinn? Sind sie aber unmoralisch in diesem postulierten universalen Sinne – mit welchem Recht töten wir dann Nutztiere? Nun wird man an dieser Stelle argumentieren, dass nur Menschen und die fiktiven Außerirdischen im strengen Sinne Personen seien, nicht jedoch vernunftlose Tiere. Man würde dann weiter argumentieren, dass sich moralische Verpflichtungen nur zwischen Personen ergeben können. So in etwa lautet ja auch das klassische moralphilosophische Argument für die skizzierten Zusammenhänge. Auch wenn wir diese Argumente als grundsätzlich zutreffend akzeptieren, müssten wir dennoch aus einer kosmologischen Perspektive heraus die Frage abschließend beantworten können, warum denn Personen eher überleben sollen als nichtpersonales Leben. Etwa nur deshalb, weil Personen dies so wollen? Da offenkundig nur Personen über einen rationabilen Willen verfügen, könnte man letztlich nur diese Art des Willens als Grund anführen. Außer dem puren (rationabilen) Wollen und der faktisch gegebenen Fähigkeit, dieses Wollen durchsetzen zu können, gibt es eigentlich keine weitere Begründung für die Geltung unserer Moral bezogen auf das Ganze des Kosmos. Der Vorwurf des sogenannten „naturalistischen Fehlschlusses“, den viele Moralphilosophen in diesem Zusammenhang vielleicht erheben würden, ist nur teilweise ein Argument gegenüber den „beiden Beispielen“. Denn wir fragen jetzt nach dem Sinn und der Funktion der Moral im gesamten Kosmos. Wirft man dieser Frage jedoch vor, sie stelle eine „Kategorienverwechslung“ dar, so muss man Moral unausweichlich als eine partikuläre Gesetzlichkeit für partikuläre Wesen denken. Aus einer fiktiven Außenperspektive auf die Gesamtwirklichkeit heraus wäre sie ein schlichtes Teilsystem des Ganzen – aber eben nicht mehr. Wenn wir aber annehmen, ein allmächtiger, allweiser, allgütiger und höchstgerechter Gott habe die gesamte Weltordnung auf endliche personale Vernunftwesen4 hin eingerichtet, so sind wir vor solchen Begründungsengpässen sicher. In diesem Falle wäre die moralische Ordnung endlicher, personaler Vernunftwesen zugleich eines der Hauptordnungsprinzipien der Gesamtwirklichkeit. Der allgütige und allgerechte Gott müsste dann aber zwingend auch ein solcher sein, der zugleich allweise ist, damit er die Fähigkeit besitzen kann, den gesamten Kosmos auf das moralische Bedürfnis der Menschen hin einzurichten. Um dies bewerkstelligen zu können, muss er zudem allmächtig sein. Werfen wir nun noch einen Blick auf den „ontologischen Gottesbeweis“. Diesem kommt im Unterschied zu den anderen angeführten Gottesbeweisen eine Art Exklusivität zu. Im Gegensatz zum Sprachgebrauch, der sich eingebürgert hat, sind der kosmologische, der teleologische und der moralische5 Gottesbeweis eigentlich viel eher ontologische Gottesbeweise als der sogenannte „ontologische Gottesbeweis“. Denn sowohl der kosmologische, der teleologische und der moralische Gottesbeweis gehen von einer angenommenen Struktur (bzw. von einer geforderten Struktur) der Welt aus – und schließen von diesem Fundament aus auf Gott als deren letzten Grund zurück. Der sogenannte ontologische Gottesbeweis hingegen ist im Grunde gerade nicht ontologisch fundiert. Bei ihm geht es vielmehr um den letzten Grund der Möglichkeit, dass wir Menschen uns gültig erkennend auf die Welt beziehen können. Dabei spielt nun der Prinzipienbegriff der traditionellen Philosophie eine überaus große Rolle. Unsere erkennende Intentionalität ist eine eigenbestimmte Intentionalität, die sich von sich aus auf die Wirklichkeit, das Sein, die Welt bezieht. In einem theoretischen, gnoseologischen Sinne kann uns niemand zwingen, irgendein Weltstück mit unseren Gedanken erkennend zu intendieren. In unserer gnoseologischen Intentionalität sind wir in gewisser Hinsicht autark. Die Prinzipienform des Erkennens, die dies ermöglicht, ist jene angesprochene Eigenbestimmtheit6 unseres Erkennens selbst. Innerhalb der Geschichte des sogenannten ontologischen Gottesbeweises, der in Wahrheit ein gnoseologischer Gottesbeweis ist, gibt es zwei Haupttypen des Verständnisses dieser Intentionalität. Anselm denkt sie als eine Form, der jeder einzelne, faktische Intentionalitätsvollzug genügen muss, will er dann noch kontingent wahr oder falsch sein. Gott wird hier als letzter (die „Invarianz“ der intentionalen Form stiftender) Grund erschlossen. Die andere Auffassung liegt in der neuzeitlichen Variante des ontologischen Gottesbeweises bei Descartes vor. Für Descartes besteht die gelungene Intentionalität nur in völlig gesichertem, wahrem Wissen. Dementsprechend obliegt dem Gottesbeweis die Aufgabe, Gott als den letzten Grund der Gewissheit unseres unbezweifelbaren und wahren Wissens darzutun. Mit dem ontologischen Gottesbeweis hat der sogenannte „noologische Gottesbeweis“ eine gewisse Ähnlichkeit. In der platonisch-augustinischen Urform dient er zur letzten Erklärung der Präsenz von unveränderlichen Wahrheiten in unserem Geist. Die Unveränderlichkeit und Unbezweifelbarkeit gewisser „Wahrheiten“ in uns, die im Gegensatz zur Veränderlichkeit und Kontingenz aller unserer sonstigen Vollzüge steht, wird als ein Argument für die Existenz Gottes benutzt.7
Gehen wir die Sache von einer historischen Perspektive aus an. Innerhalb der griechischen Philosophie findet sich beginnend bei den sogenannten Vorsokratikern ein Traditionsstrang (unter anderen Traditionssträngen!), der den letzten Grund des Seins nicht als ein bestimmtes Weltstück denken will. Nur dann, so klingt der Grundtenor dieser Tradition, wenn der letzte Grund nicht schon selbst ein bestimmtes Stück (in) der Welt ist, kann er sich gleichermaßen gründend zu allen je bestimmten Weltstücken verhalten. Um diesen Grund, der gerade kein bestimmtes Weltstück sein soll, denken zu können, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder wird der gesamte Kosmos bzw. das ihm inhärente Prinzip als letzter Grund gedacht – in diesem Falle liegt eine Vorstufe des Pantheismus vor. Oder aber alternativ hierzu wird der postulierte Grund als außerhalb der konkreten Weltstücke stehend gedacht. Dann haben wir eine Vorstufe des Theismus vorliegen. Den Vorsokratikern wird man natürlich keine ausdrückliche Intention unterstellen wollen, einen monotheistischen Gottesbeweis vollzogen zu haben. Doch hat bereits die Ausgangsfrage der griechischen Naturphilosophen nach den Urelementen des Seins eine gewisse Ähnlichkeit mit der Kosmoteleologie der Nachfahren. Wir können hier nur exemplarisch einige Positionen anreißen.
Thales von Milet sah den Urgrund des Kosmos im Wasser. Hier wird das Gründende durchaus noch einem bestimmten Seienden zugeordnet. Anders ist dies bereits bei Anaximander. Anaximander führte in die vorsokratische Debatte das „Apeiron“ ein. Das Apeiron ist das Unbestimmte, der nicht schon bestimmte Stoff. Doch wird dieses Apeiron von Anaximander als seiender Urgrund gedacht, aus dem heraus sich alles bestimmte Seiende entwickelt. Damit gewinnt Anaximander schon eine rudimentäre Form des angedeuteten Prinzipienbegriffs, gemäß dem das gründende Prinzip nicht eines jener bestimmten Elemente sein darf, die es gründet. Pythagoras erreichte endgültig die gründende Prinzipienebene, indem er die Zahl zum Urprinzip erklärte. Zahlen und Zahlenverhältnisse sind als solche gewiss keine bestimmten Dinge innerhalb der materiellen Welt. Besondere Erwähnung verdienen auch Heraklit und Parmenides. Heraklit hat das Werden zum Prinzip des Seins erklärt. Das Feuer, das nach Maßen aufflammt und verlöscht (Bruno Snell), wird dabei zur Metapher für eine logoide Metrik dieses Werdens, die sich als solche nicht „dinglich“ manifestiert und auch nicht in Dingen aufgehen kann. Demgegenüber insistiert Parmenides auf dem abstrakt-allgemeinen Sein als Grund. Dieses trage keinerlei Differenzen und „Werdemöglichkeiten“ in sich. Damit ist es ein Grund jenseits jeder ontischen Spezifikation. Mit der Blüte der griechischen Philosophie bei Platon und Aristoteles8 wird der Gedanke einer letzten Begründung in einem absoluten Grund endgültig manifest. Eine Form des Gottesbeweises bei Platon lehnt sich an dessen Unsterblichkeitsbeweis der Seele an. Wie später bei Aristoteles oder Thomas ist das Fundament dieses Beweises im Phänomen der Bewegung9 zu sehen. Nimmt man eine Distinktion des „Phänomens“ der Bewegung vor und unterscheidet einerseits einen Typus von Bewegtem, das durch anderes bewegt wird, und andererseits einen Typus von Bewegtem, das durch sich selbst bewegt wird, dann wird schnell klar, dass Selbstbewegung den ursprünglicheren Typus darstellt. Das Selbstbewegende ist, wie Platon im Phaidros ausführt, die Seele. Nun legt Platon die Eigenschaften von „gut“ oder alternativ „böse“ nicht nur schlicht der Seele bei, sondern er gründet hierauf auch eine Korrelation des Begriffs „Ordnung“ mit dem Prädikat „gut“ sowie eine Korrelation des Begriffs „Unordnung“ mit dem Prädikat „böse“. Gemäß dem platonischen Rationalismus ist „gut“ substituierbar durch den Terminus „geordnet“ – und „böse“ ist dementsprechend substituierbar durch den Terminus „ungeordnet“. Diese Substitutionsmöglichkeiten erlauben es Platon „gut“ und „böse“ auch auf (in unseren Augen) reine Naturvorgänge zu beziehen. Betreffs der Bewegung ergibt sich hieraus die Lehre, eine gute Seele sei Urheberin geordneter Bewegungen, eine böse Seele hingegen initiiere ungeordnete Bewegungen. Da nun die Naturabläufe eine strikte Ordnung artikulieren – man denke insbesondere an die Bewegung der Himmelskörper –, so sei anzunehmen, dass die zugrundeliegenden Initialselbstbewegungen sich den guten Seelen verdankten. Die „oberste Seele“, der sich das „kosmische Leben“ verdanke, müsste somit als beste, edelste und vollkommenste verstanden werden. In der Politeia findet sich eine weitere Wurzel der Gottesbeweise. Gemeint ist die Lehre vom Anhypotheton. Dieses hat seine wichtigste Funktion innerhalb der Ideenlehre. In dieser platonischen Konstruktion ist der systematische Gedanke der Aseität eines absoluten Grundes in nuce vorhanden. In der Politeia10 (509a) ist zu lesen:
„Ebenso nun sage auch, dass dem Erkennbaren nicht nur das Erkanntwerden von dem Guten komme, sondern auch das Sein und Wesen habe es von ihm, da doch das Gute selbst nicht das Sein ist, sondern noch über das Sein an Würde und Kraft hinausragt.“
Was Platon sagen will, ist nichts anderes, als dass die Idee des Guten Grund aller anderen Ideen ist. Darüber hinaus aber – und das ist entscheidend – ist sie auch Grund ihrer selbst. Die Ideendialektik Platons artikuliert damit einen eminent wichtigen begründungstechnischen Ansatz: Sie entfaltet den Sinn von Selbstgründung. Platon stößt damit auf einen Typus von Grund, den man Jahrhunderte später als das „Absolute“ charakterisieren wird. Bei Aristoteles findet sich in der „Metaphysik“ und der „Physik“ eine Vorform des Gottesbeweises. Auch hier geht es wieder um die Abgeschlossenheit der „Bewegungsreihe“. Die Argumentation zielt auch hier wieder auf den Schluss, dass es ein erstes Bewegendes geben müsse, das seinerseits nicht wiederum von einem anderen Seienden bewegt wird. Aristoteles verbindet diese Konzeption des ersten unbewegten Bewegers mit dem Gedanken der Selbstgründung. In der Systematik des Aristoteles gibt es bekanntlich jene Unterscheidung, die der „Aquinate“ später als Differenz von Möglichkeit (= Potenz) und Wirklichkeit (= Akt) bezeichnen wird. Jedes von anderen Seienden bewegte Ding – sei es, dass diese Bewegung akzidentielle oder aber ausschließlich substantielle Strukturen betrifft – ist zunächst „nur“ der Möglichkeit (Potenz) nach in Bewegung, bevor es in Wirklichkeit (Akt) von seinem Beweger bewegt wird. Nun kann nach dieser Konzeption der letzte absolute Beweger (= der unbewegte Beweger) nicht aus dem Zustand der Potenz in den des Aktes übergehen, denn dann wäre er ja selbst bewegt und sei es auch nur aus akzidentiellem Anlass. Also muss er beständig im Akt „subsistieren“. Damit ist er ein Grund, dessen Nichtsein nicht möglich ist, da er nicht von der Seinsalternative des „bloßen Möglichseins“ betroffen ist. Hier haben wir genau jenes „esse“, das später beim ontologischen und kosmologischen Gottesbeweis eine gewichtige Rolle spielen wird: Es ist ein Seinsgrund, dessen Nichtsein nicht möglich ist, dessen Nichtsein ergo nicht mit Gründen denkbar ist. Obgleich hier eine gewisse Ähnlichkeit mit Descartes’ ontologischer Gottesbeweisvariante, die auf dem Begriff des allmächtigen Wesens fußt, vorliegt, so sind dennoch die antiken (Vor-) Formen der Gottesbeweise letztlich dem ontologischen Gottesbeweis am unähnlichsten. Mit Anselm von Canterbury tritt nämlich zum ersten Male in der Philosophiegeschichte eine Überlegung hervor, gemäß der die Prinzipien unseres Erkennens bestimmte Bedingungen an das Sein stellen, die dieses erfüllen muss, soll es überhaupt gewusst werden können. Ein solcher Gedanke wäre für einen antiken Philosophen schlicht unmöglich gewesen. Die notwendigen philosophischen Schlussfolgerungen aus seiner neuen Einsicht konnte Anselm jedoch noch nicht ziehen. Der Gedanke, das endliche Denken könne selbst in der Lage sein, diese postulierten Bedingungen auch durchzusetzen, war Anselm als Kind seiner Zeit ein unmöglicher Gedanke. Für Anselm sind die Prinzipien der Erkenntnis dann und nur dann in der Lage, ihre „Forderungen“ gegenüber dem Sein durchzusetzen, wenn der menschliche Geist ein Abbild des trinitarischen Gottes ist. Der Ausweis dieses Abbildungsverhältnisses mit rationalen philosophischen Gründen ist in den Augen Anselms zugleich der Beweis dafür, dass Gott ist. Während für Anselm der Abbildcharakter des menschlichen Geistes nur garantiert, dass unser wohlgeformtes Erkennen seinen Gegenstand notwendig wahr oder aber falsch intendieren kann, garantiert für Descartes der im ontologischen Gottesbeweis bewiesene Gott, dass all unser Wissen, das seinen eigenen Prinzipien genügt, im positiven Sinne inhaltlich wahr ist. Meines Erachtens stellt der ontologische Gottesbeweis mit seiner fundamentalen gnoseologischen Attitüde den wichtigsten und interessantesten aller Gottesbeweise dar. Denn dieser Gottesbeweis geht nicht etwa von der letztlich beliebigen Annahme irgendeiner subjektstranszendenten Weltstruktur aus, sondern operiert mit der Prinzipienstruktur unserer Intentionalität. Dieser Gottesbeweis impliziert damit in seinen diskutablen Spielarten immer einen Rückgang der erkennenden Subjektivität in sich selbst. Er nimmt seinen Ausgang von Notwendigkeiten unseres Erkennens und Denkens, denen gegenüber wir uns gar nicht mehr zustimmend oder ablehnend verhalten können. Denn wenn unsere erkennenden intentionalen Akte diesen nicht genügten, läge überhaupt keine Intentionalität mehr vor.