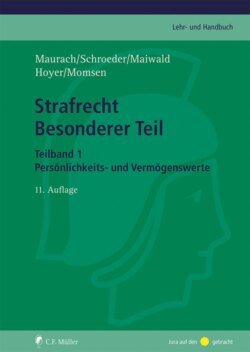Читать книгу Strafrecht Besonderer Teil. Teilband 1 - Reinhart Maurach - Страница 255
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Der objektive Tatbestand
Оглавление8
a) Der Tatbestand verlangt zunächst, dass jemand einen Menschen[12] zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt. Über diese Formulierung ist viel gestritten worden[13]. Einschneidend war die Behauptung, alle abgenötigten Verhaltensweisen setzten ein gewolltes Verhalten des Opfers voraus[14]. Dies hätte bedeutet, dass nur Einwirkungen auf die Willensbildungsfreiheit, nicht solche auf die Willensbildungsfähigkeit und die Willensbetätigungsfreiheit (s.o. Rn. 6) unter den Tatbestand fallen. Diese Auffassung missachtet jedoch den Wortlaut des § 240 StGB und ist überdies sachwidrig. Es ist einerlei, ob ich jemand zum gewollten Verlassen eines Raumes zwinge oder ihn hinauswerfe (RG 2, 288). Aber auch die Auffassung, die Alternative der „Duldung“ sei überflüssig, da jede Duldung die Unterlassung eines Widerstandes sei, ist eine Begradigung des Gesetzeswortlauts, die den sachlichen Unterschied der Fälle verschwinden lässt. Unter die Nötigung fallen:
| a) | der Zwang des Opfers zu bestimmten Handlungen (Erzwingungsnötigung) |
| b) | die Verhinderung vom Opfer beabsichtigter Handlungen (Verhinderungsnötigung) |
| c) | der Zwang zur Hinnahme weiterer Handlungen des Täters (Duldungserzwingungsnötigung). |
9
Die Alternative a) erfolgt durch Einwirkung auf die Willensbildungsfreiheit, die Alternative b) durch Einwirkung auf die Willensbildungsfreiheit (Abhaltung von einer beabsichtigen Handlung durch Drohung oder willensbeeinflussende Gewalt), die Willensbetätigungsfreiheit (Abhaltung von einer beabsichtigten Handlung durch physische Gegenwehr) oder die Willensbildungsfähigkeit (Betäubung). Für die Alternative c) ist die verbreitete Unterordnung unter den Angriff auf die Willensbetätigungsfreiheit eine Folge der erwähnten Umdeutung in den Zwang zur Unterlassung des Widerstands. Sie erfolgt ebenfalls durch Einwirkung auf die Willensbildungsfähigkeit (Betäubung), die Willensbildungsfreiheit und die Willensbetätigungsfreiheit. Die bloße Gewaltanwendung ist keine Nötigung und darf nicht in eine Nötigung zur Duldung der Gewalt umgedeutet werden (Schroeder FS Gössel 421). Keine Nötigung ist auch die kurzfristige Überraschungsgewalt[15].
10
b) Nötigungsmittel sind Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel.
11
aa) Die Gewalt ist einer der umstrittensten Begriffe des Strafrechts, zumal er auch in vielen anderen Tatbeständen vorkommt (§§ 81, 105, 106, 113, 177, 249, 253, 255 u.a.; s.o. § 12 Rn. 10–13).
12
(1) Das RG bestimmte die Gewalt als körperliche Kraftentfaltung zur Beseitigung eines tatsächlich geleisteten oder erwarteten Widerstandes, die vom Opfer körperlich empfunden werde („vis corpore corpori afflicta“[16]), konnte mit diesen Kriterien allerdings keine überzeugende Abgrenzung gewinnen. So wurden das Aushängen von Türen und Fenstern zur Vertreibung der Mieter[17], die überraschende Einsperrung, ja deren bloße Vortäuschung[18] und das Versperren von Wegen[19] als Gewalt beurteilt. Dagegen wurde das Vernageln aller Wohnungsfenster und mehrerer Zimmertüren zur Vertreibung der Mieter nicht als Gewalt angesehen (RG GA 35, 63). Bei der Aussperrung aus gemieteten Räumen wurde Gewalt verneint (RG 20, 354), jedoch bejaht, wenn sie in Gegenwart des Mieters erfolgte (RG 61, 156) oder ihn von seiner Kleidung aussperrte[20]. Als Gewalt galt ferner die Aussperrung hilfsbereiter Personen (RG 69, 330). Mithilfe der Ausweitung auf die „Empfindung als körperlicher Zwang“ wurde auch die Abgabe von Schreckschüssen als Gewalt angesehen (RG 60, 159; 66, 356). Dagegen wurde die Betäubung des Opfers mangels Kraftentfaltung nicht als Gewalt angesehen (RG 58, 98) und nur aufgrund der seit 1935 zulässigen Analogie bestraft (RG 72, 351).
13
(2) Der BGH verzichtete zunächst auf das Erfordernis der körperlichen Kraftentfaltung und sah damit die Betäubung durch List als Gewalt an (BGH 1, 145[21]); anschließend verzichtete er auch noch auf die Einwirkung auf den Körper und stellte nur noch auf die Zwangswirkung ab (BGH 8, 103 zum Massen- oder Generalstreik). Später wurde diese radikale Erweiterung zurückgenommen; in die Gewalt wurden aber doch folgende Fälle einbezogen: Verhinderung des Überholens (BGH 18, 389), Erzwingung der Fahrbahnfreigabe durch dichtes Auffahren (BGH 19, 263: „körperlicher Zwang“ durch Herbeiführung von Nervosität als Einwirkung auf das Nervensystem; eingehend auch OLG Köln NZV 92, 371), Verhinderung des Straßenbahnbetriebes durch Sitzen auf der Fahrbahn (BGH 23, 54: unwiderstehlicher Zwang zwar nicht gegenüber den Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe, wohl aber gegenüber den Straßenbahnführern auf psychischem Wege), zu einem tödlichen Schock führendes Richten einer Pistole auf einen anderen (BGH 23, 126: Empfindung als körperlicher Zwang durch Herbeiführung starker Erregung und damit Beeinflussung der körperlichen Voraussetzungen der Freiheit der Willensentschließung; noch weitergehend BayObLG NJW 93, 211), Niederbrüllen eines Universitätsdozenten (NJW 81, 189: Empfindung als körperlicher Zwang, da das Opfer der Einwirkung entweder überhaupt nicht oder nur mit erheblicher Kraftentfaltung begegnen könnte[22]), die Verhinderung des Geschäftsbetriebs durch Verstecken der Ware (BGH JR 88, 75).
14
Weitere Ausweitungen durch andere Gerichte: Unterbrechung der Wasser- oder Stromzufuhr zur Erzwingung der Räumung oder Mietzahlung (OLG Karlsruhe MDR 59, 233: „unmittelbare körperliche Einwirkung“, „Empfindung als körperlich“[23]); Nichtherauslassen eines verbotswidrig geparkten Pkw durch den Grundstückseigentümer (BayObLG NJW 63, 1261: „Empfindung als physischer Zwang“); Gegendemonstration mit Sprechchören (LG Frankfurt NStZ 83, 25: „Einsatz von Mitteln, der darauf gerichtet und geeignet ist, die Willensentschließung oder -betätigung des Opfers zwangsweise zu beeinflussen und auszuschließen“). Zu den besonderen Formen der Gewalt bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung s.u. § 18 Rn. 10 ff.
15
(3) Mit dieser Ausweitung blieb die Rechtsprechung allerdings hinter noch weitergehenden Forderungen in der Literatur zurück. In Weiterführung von Ausführungen bei Schönke/Schröder und unter Hinweis auf die Inkonsequenz der Rechtsprechung entwickelte vor allem Knodel eine radikale Erweiterung des Gewaltbegriffs als „jedes Vorgehen, das bestimmt und geeignet ist, einen tatsächlich geleisteten oder als bevorstehend erwarteten Widerstand dadurch zu überwinden, daß dem Opfer ohne sein Einverständnis die Willensbildung oder -betätigung unmöglich gemacht oder die Freiheit der Willensentschließung durch gegenwärtige Zufügung empfindlicher Übel genommen wird“ (aaO 59). Knodel wollte damit – über die bisherige Rechtsprechung hinaus – folgende Fälle in die Nötigung miteinbeziehen: die Aussperrung, den Entzug körperlicher Hilfsmittel, ja den Entzug von zur Verwirklichung von Absichten des Opfers erforderlichen Mitteln und Werkzeugen überhaupt, die gegenwärtige Übelszufügung[24], den Zwang gegenüber, ja auch die Täuschung von Drittpersonen. Im Anschluss hieran verzichtete ein großer Teil der Lehre nunmehr explizit auf das Merkmal der körperlichen Einwirkung beim Opfer oder definierte die Gewalt im Wesentlichen als jeden Einsatz von Mitteln, der darauf gerichtet und geeignet ist, die Willensbildungs-, Willensentschließungs- oder Willensbetätigungsfreiheit des Opfers auszuschließen[25].
16
(4) Gegen diese Modernisierung des Gewaltbegriffs bildete sich seit Mitte der sechziger Jahre eine zunehmende Restaurationsbewegung. Teils wurde versucht, den modernen Gewaltbegriff mit weiteren Ausweitungen ad absurdum zu führen (Koffka JR 64, 397), teils eine Rückkehr zum „klassischen“ Gewaltbegriff (was ist das?), teils ein „mittlerer Kurs“ gefordert, dessen Kriterien jedoch offen blieben (Geilen aaO 465). Krey/Neidhardt plädierten für eine körperliche Zwangswirkung mit „normativer Relativierung“[26]. Wenig einleuchtend war auch das Argument, bei dem Zwang zu einem Verhalten durch eine abgeschlossene Veränderung der Umwelt handle das Opfer wie bei der Täuschung seinem Willen gemäß[27]; denn das tut derjenige, der nicht sinnlos an seinen Fesseln rüttelt, auch (Jakobs FS Peters 77). Kaum befriedigen konnten auch die vielfältigen Versuche, die Gewalt auf Körperverletzungen oder Körpergefährdungen zu beschränken[28]. Ebenso erscheint es wenig sinnvoll, den Gewaltbegriff durch eine Hereinnahme der Rechtswidrigkeit einzuschränken[29]. Vollends irritierend waren Rundumschläge gegen den engen Gewaltbegriff als Unterdrückung der körperlich arbeitenden unteren Klassen und Schichten und zugleich gegen den weiten Gewaltbegriff als sonstige politische Unterdrückung[30]. Die Ablehnung der Gewalt bei Verkehrsblockaden ist nicht über die Untergerichte hinausgelangt[31].
17
BVerfGE 92, 1 (1995) hat Sitzblockaden von Verkehrswegen als Zwangswirkungen angesehen, die nicht auf dem Einsatz körperlicher Kraft, sondern auf geistig-seelischem Einfluss beruhen, und die Bejahung von Gewalt als verbotene Analogie bezeichnet[32].
Dieses unklare und gegen die Gleichbehandlung verstoßende Urteil hat erhebliche Unsicherheit in der Rechtsprechung hervorgerufen. BGH 41, 182 hat die Blockade mittels der durch eine Sitzblockade angehaltenen Fahrzeuge als Gewalt angesehen (sog. „2. Reihe-Urteil“)[33]. Gewalt wurde ferner bejaht bei: länger dauerndem dichtem Auffahren (OLG Karlsruhe NStZ-RR 98, 58), dem längeren Verhindern des Überholens durch Linksfahren (OLG Düsseldorf StV 01, 350)[34], dem Zwang des nachfolgenden Autofahrers zur Reduzierung der Geschwindigkeit auf 42 km/h durch Langsamerfahren (BayObLG NJW 02, 628), Befestigen von Stahlkörpern auf Eisenbahngleisen[35], Straßenblockade mit Fahrzeugen (BGH NJW 95, 2862; OLG Karlsruhe NJW 96, 1551) oder durch Hunderte von Menschen (BGH NStZ 95, 593[36]), dem Sichlegen auf die Motorhaube eines Pkw (BGH StV 02, 360).
Das BVerfG hat das Sichanketten in einer Einfahrt und die Blockade einer Autobahn mittels Fahrzeugen als „Errichtung einer physischen Barriere mittels körperlicher Kraftentfaltung“[37] und das dichte Auffahren auf den Vordermann (NStZ 07, 397) als Gewalt angesehen.
Dagegen wurde Gewalt verneint bei dem verkehrswidrigen Gehen auf der Fahrbahn zur Behinderung von Autofahrern (BGH 41, 420), dem Verhindern des Passierens mit einem Einkaufswagen[38], dem andauernden Anhupen eines verkehrsbedingt haltenden Verkehrsteilnehmers (OLG Düsseldorf NJW 96, 2245), der Blockade einer Internetseite (OLG Frankfurt a.M. StV 07, 244).
18
Gewalt ist danach die körperliche oder mit Hilfsmitteln erzielte Kraftentfaltung, die sich als physisch vermittelter Zwang zur Überwindung eines tatsächlichen oder erwarteten Widerstands auswirkt[39]. Wichtiger als eine Definition erscheint es, die Strukturen des Zwanges aufzudecken und in diesem Raster eine sinnvolle Abgrenzung der Gewalt zu suchen. Nicht alle Nötigungsmittel sind bei allen drei Nötigungsarten (s.o. Rn. 8) möglich (Schroeder FS Gössel 416 ff.). Nach der Einwirkungsart steht neben der technischen Unmöglichmachung (vis absoluta) die Veranlassung, von selbst das erstrebte Verhalten vorzunehmen (vis compulsiva). Die vis absoluta kann nur zu einer Duldung, die vis compulsiva auch zu einer Handlung oder zu einer Unterlassung zwingen (s.o. Rn. 8). Die Einwirkungsart bestimmt zugleich die Art des Ausschlusses der Handlungsfreiheit: die vis absoluta richtet sich gegen die Willensbildungsfähigkeit und die Willensbetätigungsfreiheit, die vis compulsiva gegen die Willensbildungsfreiheit (s.o. Rn. 6).
19
Innerhalb des absoluten Zwangs können Einwirkungen auf die Person und auf die Umwelt unterschieden werden. Einwirkungen auf die Umwelt mit Zwangswirkung sind möglich als Bereitung von Hindernissen oder Zerstörung verhaltensnotwendiger Gegenstände. Der absoluten Unmöglichmachung steht die Offenhaltung eines unzumutbaren Auswegs (Einsperren im oberen Stockwerk eines Gebäudes; Überfahren des Blockierers, BGH 23, 54) gleich. Kompulsiver Zwang ist möglich durch Zufügung von Übeln wie Schmerzen, seelischen Übeln (Einwirkung auf nahestehende Personen, Lieblingstiere oder Gegenstände mit Affektionsinteresse) mit konkludenter Fortsetzungsdrohung, die Schaffung fortwirkender derartiger Zustände, die Schaffung schadensdrohender oder wartungsbedürftiger Zustände und schließlich auch durch sonstige zum Ausweichen zwingende Umweltveränderungen (z.B. Lahmlegung der öffentlichen Verkehrsmittel durch Taxiunternehmer). Eine Freiheitsberaubung kann als Gewalt nur die Unterlassung des Weggehens und dieses voraussetzender Handlungen, nicht aber Handlungen und die Duldung von Handlungen am Körper erzwingen (Schroeder FS Gössel 422).
20
Ordnet man die bisherige Rechtsprechung in diese Abstufungen des Zwanges ein, so liegen die bedenklichen Grenzen innerhalb der Einwirkung auf den Körper bei den Fällen der Einwirkung über die Sinne (Schreckschüsse, Richten einer Pistole, Auffahren) und der bloßen Zufügung von Kälte und Witterungsunbilden. Soweit die Rechtsprechung die Gewalt auf die Einwirkung auf die Umwelt erstreckt hat, fällt auf, daß sie sich hierbei auf den Schutz hochrangiger Verhaltensmöglichkeiten beschränkt hat: der Fortbewegungs-, der Verkehrs- und der Lehrfreiheit sowie der Unverletzlichkeit der Wohnung. Letzteres entspricht dem Sonderschutz der Wohnung im Rechtssystem (Art. 13 GG; § 123 StGB, s.u. § 30; § 306a Abs. 1 Nr. 1 StGB, s. Tlbd. 2, § 51 II)[40].
Unergiebig ist die Unterscheidung von Gewalt gegen die Person und Gewalt gegen Sachen[41], da § 240 – anders als §§ 249; 255 – beides erfasst.
Die Vorschriften über Sachbeschädigung, Wegnahme, Verkehrsunfallflucht sowie § 251 E 1962 (Sachentziehung) u.a. zeigen, dass nicht jede Veränderung der Umwelt mit Zwangswirkung als Nötigung gelten soll[42].
21
Gewalt ist auch durch Unterlassen möglich, nämlich der Beseitigung einer Zwangslage[43].
22
Da der BGH bei der Versperrung einer Fahrbahn zwecks Einflussnahme auf die Verkehrsbetreiber die Nötigung auf die Verhinderung des Weiterfahrens der Fahrzeugführer verlagert hat (BGH 23, 46), muss bei diesen Willensmittlern der Wille zur Weiterfahrt tatsächlich vorgelegen haben[44]. Die Rechtsprechung verlangt, dass das Verhalten des Opfers eine spezifische Folge der Gewaltanwendung ist, lässt dafür aber auch polizeiliche Sperrmaßnahmen in unmittelbarem örtlich-zeitlichem Zusammenhang mit der Blockade ausreichen[45].
23
Manche Fälle, in denen eine „Gewalt“ zweifelhaft ist, stellen im Übrigen eine Drohung mit einem empfindlichen Übel nach Rn. 24 ff. dar (so für Hausbesetzungen OLG Hamm NJW 82, 2678[46]; für das Abbestellen des Heizöls durch den Hauseigentümer OLG Hamm NJW 1983, 1505; für Lärmterror OLG Koblenz NJW 93, 1809; abl. für die bedrängende Fahrweise OLG Köln NZV 92, 371). Dies gilt allerdings nicht für die bloße Verhinderung mit Fortsetzungsankündigung wie bei Sitzblockaden[47].
24
bb) Zweites Nötigungsmittel ist die Drohung, d.h. die bedingte[48] Inaussichtstellung eines Übels, auf dessen Eintritt der Drohende Einfluss zu haben behauptet (RG 24, 151; BayObLG JZ 51, 25). Die Vortäuschung eines vom Täter unbeeinflussbaren Übels bleibt dagegen – unbeschadet der Bewertung als Täuschung – bloße Warnung[49]; doch kann sich hinter einer angeblichen Warnung eine Drohung verstecken (RG 54, 236). Die Drohung kann sich sowohl gegen den Erklärungsempfänger als auch gegen einen Dritten wenden; eine „nahestehende Person“ wie bei § 241 (s.u. § 16 Rn. 5) ist nicht verlangt (BGH NStZ 87, 222). Doch muss auch im letzteren Falle der Erklärungsadressat das Übel als eigene Einbuße empfinden und durch dessen Ankündigung zu seinem unfreien Verhalten veranlasst worden sein[50]. Die Zufügung eines Übels kann die Drohung ihrer Fortsetzung oder Wiederholung enthalten (OLG Hamm NJW 83, 1505; OLG Koblenz NJW 93, 1808; s.o. Rn. 23).
25
Hinsichtlich des Drohungsinhalts steht die Nötigung der Erpressung gleich: hier wie dort ist darauf verzichtet, im Gegensatz zu § 241 (Bedrohung mit einem Verbrechen) und im Gegensatz zu § 240 a.F. (Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergehen), das Maß der Drohung zu formalisieren; es genügt die Drohung mit einem „empfindlichen Übel“.
Wann mit einem empfindlichen Übel gedroht wird, ist Frage des Einzelfalles. Im Schrifttum bahnt sich ein ähnlicher Individualisierungsweg an, wie bezüglich der Schadensberechnung beim Betruge seit Längerem anerkannt. Der objektive Maßstab (erhebliche Werteinbuße, deren Inrechnungstellung einen besonnenen Menschen zu dem von der Drohung erstrebten Verhalten veranlassen könnte[51]) ist für sich allein formalistisch und vernachlässigt das Wesen der Nötigung als heterogene Koppelung (Schroeder JZ 83, 287), der rein individualistische Maßstab[52] führt in der Konsequenz zu der gleichen Überspitzung wie beim Betruge: genötigt ist, wer sich genötigt fühlt. Der BGH bestimmt den Maßstab seit Längerem normativ: von dem Opfer muss unter Umständen erwartet werden, dass es in seiner Lage der Drohung in besonnener Selbstbehauptung standhält[53]. Maßgeblich ist das Verhältnis zwischen angedrohtem und gefordertem Verhalten. Das Übel darf nicht nur – wie bei der Sitzblockade – in der Durchsetzung des erstrebten Opferverhaltens bestehen (Schroeder GS Meurer 241).
26
Die Frage, ob das angedrohte Übel empfindlich ist, muss nicht nur von der Strafbarkeit des angekündigten Übels, sondern auch von seiner bloßen Rechtswidrigkeit abgeschichtet werden. Auch die Zufügung eines solchen Übels, das der Betroffene an sich zu dulden verpflichtet ist, schließt dessen „Empfindlichkeit“ nicht aus. Drohungen mit an sich erlaubten Druckmitteln wie mit Arbeitsniederlegung, Abbruch der Beziehungen, Erstattung begründeter Strafanzeigen, Veröffentlichung wahrheitsgemäßer Pressemitteilungen (OLG Hamm NJW 57, 1081) usw. können in concreto durchaus die Annahme eines empfindlichen Übels rechtfertigen[54]. Ein Verhalten, zu dem jemand rechtlich verpflichtet ist (z.B. Strafverfolgung nach § 152 StPO), kann allerdings nicht „angedroht“ werden; es handelt sich um ein verschleiertes Angebot einer Unterlassung und damit eines Vorteils (Schroeder JZ 83, 288). Die Frage, wann ein Übel „empfindlich“ ist, lässt sich im Übrigen nie ganz von dem Unrechtsgehalt der Handlung als Ganzem, nämlich der anstößigen Verkoppelung von Mittel und Zweck, lösen (vgl. u. 3).
27
Lebhaft umstritten ist es, ob die Drohung mit einem Unterlassen nur strafbar sein kann, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln besteht[55], oder auch darüber hinaus[56]. Hierbei wird jedoch häufig das Angebot von Vorteilen unzulässig in die Drohung mit einem Unterlassen der Gewährung des Vorteils umgedeutet. Ein Drohen mit einem Unterlassen liegt nur dann vor, wenn der Täter droht, die Lage des Opfers zu verschlechtern, indem er mit einem Abbruch eines bisher geübten Verhaltens droht oder überraschende Zusatzleistungen (BGH NJW 93, 1807; BGH 44, 252[57]) oder Gegenleistungen für ein rechtlich gebotenes Verhalten (z.B. Hilfe bei Unglücksfällen, vgl. § 323c StGB, Einstellung des Strafverfahrens nach §§ 153, 153a StPO, OLG Oldenburg NJW 08, 3012) verlangt; umgekehrt ist allerdings das „Angebot“, ein im Belieben stehendes Verhalten zu unterlassen (z.B. Strafanzeige), in Wahrheit die Drohung mit einem Tun[58]. Die Versuche zur Umdeutung „eindeutiger Angebote“ in Drohungen beruhen vor allem auf einer Fehlkonstruktion des § 174b (s.u. § 19 Rn. 4).
28
c) Zwischen den Nötigungsmitteln und dem Erfolg (abgenötigte Handlung, Duldung oder Unterlassung) muss ein Kausalzusammenhang bestehen. Dieser fehlt, wenn das Opfer die Handlung ohnehin vorgenommen oder unterlassen hätte. Er fehlt auch, wenn das Opfer die Handlung in der sicheren Erwartung der Irrelevanz des abgenötigten Verhaltens nur zur Bestrafung des Täters vornimmt oder unterlässt[59]. Die h.M. verlangt darüber hinaus einen unmittelbaren, spezifischen Zusammenhang, eine objektive Zurechenbarkeit dahingehend, dass sich in dem Opferverhalten das durch den Zwang geschaffene Risiko realisiert (Eser S/S 14), doch wird er vom BGH schon bei einem mittelbaren Erfolg (BGH 41, 182, „2. Reihe-Rechtsprechung“, s.o. Rn. 17), ja bei einem vorsorglichen Anhalten bejaht.
29
d) Die bloße Summierung der bisher erörterten Tatbestandsmerkmale vermag aber noch nicht jeder Handlung, die diese Tatbestandsmerkmale an sich aufweist, den Unrechtsgehalt der Nötigung zu verleihen. Es gibt im sozialen Leben kaum ein Verhalten, das sich nicht unter dem mehr oder weniger scharf determinierenden Einfluss darauf ggf. positiv oder negativ reagierenden Mitmenschen vollzieht (s.o. § 12 Rn. 14). Es muss also, um das strafwürdige Tatbild der Nötigung hervortreten zu lassen, eine Abscheidung vorgenommen werden zwischen den Handlungen, bei denen die Abnötigung eines bestimmten Verhaltens infolge ihrer sozialen Üblichkeit, ja Unentbehrlichkeit sich innerhalb der Grenzen des Erlaubten oder sogar Gebotenen bewegt, und denjenigen Handlungen, die diese Grenze überschreiten. Nur die Letzteren sind als Nötigung strafwürdig. Gesetzestechnisch ergeben sich für den Ausscheidungsprozess zwei Möglichkeiten.
30
Die erste war in der alten Fassung des § 240 verwirklicht und bestand in der strikten Innehaltung des Regel-Ausnahme-Verfahrens bei der Ausscheidung rechtmäßiger Fälle aus dem Tatbestand: es musste zuerst der („geschlossene“) Tatbestand festgestellt und hierauf durch Ermittlung etwaiger Rechtfertigungsgründe die Gegenindizierung gewonnen werden. Dieses Verfahren, sonst zuverlässig, bot gerade bei der Nötigung erhebliche Schwierigkeiten, zwang auch zur Beschreitung vermeidbarer Umwege. Der Tatbestand musste zwangsläufig weit gefasst sein, wodurch sein Wert als Indiz der Strafwürdigkeit von vornherein verringert wurde. Auf der anderen Seite war der Katalog der zur Verfügung stehenden Rechtfertigungsgründe unzureichend. Die Folge war, dass entweder eine befriedigende Ausscheidung der rechtmäßigen Zwangshandlungen nicht immer durchgeführt werden konnte, oder dass man – an sich contra legem – die die Nötigung begründenden Mittel zu begrenzen suchte (Frank IV).
31
Die zweite Möglichkeit ist von der heute geltenden Fassung des § 240 gewählt worden. Sie besteht darin, dass ein „offener“, als solcher nicht unrechtsindizierender Tatbestand gebildet wird (Abs. 1), der durch eine positive Feststellung der Verwerflichkeit „geschlossen“ werden muss. Damit ist für § 240 n.F. die schon häufig aufgestellte Forderung berücksichtigt, nur ein solches Verhalten als „tatbestandsmäßig“ zu erklären, das nicht „sozialadäquat“ ist, d.h. aus dem Rahmen sozial anerkannten oder gebotenen Handelns herausfällt. Ob die Lehre von der sozialen Adäquanz grundsätzlich berechtigt ist, ob sie praktikabler und mit größerer Rechtssicherheit ausgestattet ist als das bei den meisten Delikten angewandte Regel-Ausnahme-Verfahren, soll hier nicht untersucht werden. Dass es aber Deliktstypen gibt, bei denen sie mit Erfolg durchgeführt werden kann, ist unbestreitbar, und hierzu gehören in erster Linie Nötigung und Erpressung, bei denen der Gesetzgeber diese positive Prüfung der Sozialadäquanz angeordnet hat[60].
32
Mit einer solchen „Verlagerung“ bei der Ermittlung der Tatbestandsmäßigkeit der Tat sind allerdings die Wege noch nicht aufgezeichnet, auf denen diese Ermittlung zu erfolgen hat. Theoretisch bestehen hier drei Möglichkeiten.
Zunächst die, dass ein bestimmter Grad der Gewalt oder eine bestimmte Gefährlichkeit der Drohung – schon isoliert betrachtet – die Verwerflichkeit der Tat begründet. Dieser Weg ist indes nicht gangbar, und an ihm war die Praktikabilität des § 240 a.F. (Drohung mit Verbrechen oder Vergehen) gescheitert. Denn er würde den Tatbestand zu schematisch einengen. Es gibt Fälle, die trotz Ausübung eines geringeren Grades von Gewalt oder Drohung mit einem an sich unverbotenen Verhalten verwerflicher erscheinen als andere, in denen die Gewalt oder das angedrohte Übel gravierender sind[61].
33
Ebenso wenig ist es aber möglich, den Unrechtsgehalt der Tat allein aus der Verwerflichkeit oder Rechtswidrigkeit des Zweckes zu entnehmen. Die Erzwingung eines rechtswidrigen Verhaltens mit Gewalt oder Drohung ist zwar regelmäßig verwerflich[62]. Diese Fälle, in denen vielfach schon eine mittelbare Täterschaft hinsichtlich des abgenötigten Verhaltens, jedenfalls aber eine Anstiftung vorliegt, reichen jedoch zur Umgrenzung der verbotenen Gewaltanwendung keineswegs aus.
Hiernach verbleibt als letzte Möglichkeit, die Verwerflichkeit der Tat aus der Verkoppelung, aus der Anstößigkeit des Verhältnisses zwischen Mittel und Zweck zu entnehmen. Diesen Weg hat die geltende Fassung des § 240 beschritten.
34
Rechtswidrig ist die Tat, wenn der Einsatz der Mittel zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist; nur die „gebundene Betrachtung“ führt zum Ziel. Dieses Erfordernis einer zusätzlichen, positiven Ermittlung der Rechtswidrigkeit gilt für beide Tatmittel; angesichts der Weite des Gewaltbegriffs (s.o. Rn. 11–20) kann auch die Anwendung von Gewalt die Rechtswidrigkeit nicht mehr indizieren[63]. Freilich wird damit die Bejahung der Nötigung stark ins Konkret-Normative verlagert. Indessen lassen sich auch für die gebundene Betrachtung bestimmte allgemeine Grundsätze aufstellen.
35
Zunächst stellt sich die Frage, ob unter den angestrebten Zwecken neben der erstrebten Handlung, Duldung oder Unterlassung (s.o. Rn. 8) auch Fernziele, insbesondere eine Einflussnahme auf die öffentliche Meinung, berücksichtigt werden können[64]. Dies widerspricht der Tradition des Strafrechts: der Heilige Crispinus konnte von der Anklage des Diebstahls nicht freigesprochen werden, weil er das gestohlene Leder zu Schuhen für die Armen verwerten wollte. Die Berücksichtigung von Fernzielen wird daher überwiegend abgelehnt[65]. Neuerdings gewinnt jedoch die Auffassung an Boden, dass sich Nah- und Fernziele nicht klar voneinander trennen lassen[66]. Nachdem BVerfGE 73, 206 nur noch eine Blockierungsgleichzahl dafür gefunden hatte, dass die Nichtberücksichtigung von Fernzielen jedenfalls nicht verfassungswidrig ist (krit. Starck JZ 87, 148), hat BVerfG 104, 92, 109 wegen Art. 8 und 2 Abs. 1 GG (Gebot schuldangemessenen Strafens) eine Berücksichtigung des „Kommunikationszwecks“ verlangt.
36
Im Übrigen wird der Unrechtscharakter der Tat umso klarer sein, je deutlicher das Missverhältnis zwischen Mittel und Zweck in qualitativer Hinsicht ist. Wie auch sonst im Strafrecht heiligt bei der Nötigung der Zweck noch nicht das Mittel[67]. Bei erlaubtem Zweck sind entsprechend strengere Anforderungen an das Nötigungsmittel zu stellen[68]. Zweitens wird die Rechtswidrigkeit durch die Heterogenität von Mittel und Zweck indiziert; die willkürliche Verknüpfung zweier nicht zusammengehörender Lebensvorgänge durch den Täter wird in der Regel auch dann zur Bejahung der Nötigung führen, wenn eine isolierte Betrachtung weder Mittel noch Zweck anstößig erscheinen lässt, insbesondere bei der Verquickung öffentlicher Belange mit rein persönlichen Zwecken.
37
So die Drohung mit einer polizeilichen Anzeige zur Erreichung persönlicher Vorteile (OLG Hamburg HESt 2, 293) oder die Drohung, Vorgänge der Privatsphäre zu veröffentlichen (OLG München NJW 50, 714). Ferner: ein „Star“ verweigert kurz vor Aufgehen des Vorhanges den Auftritt, sofern nicht seiner höchst unbegabten Freundin eine wichtige Rolle zugewiesen wird: Nötigung; keine Nötigung dagegen, wenn die Auftrittsverweigerung erfolgt, um die Beseitigung einer Gefahrenstelle auf der Bühne zu erzwingen. Ein Kaufhausinhaber kündigt seiner Ladenangestellten Entlassung an, die nur durch Gewährung eines Geschlechtsverkehrs abgewendet werden könne: Nötigung; keine Nötigung dagegen, wenn der Verlobte seine Braut unter der Ankündigung, sonst das Verlöbnis aufzulösen, zum vorehelichen Geschlechtsverkehr veranlasst. Die Drohung mit unbegründeter Strafanzeige wird in der Regel Nötigung darstellen. Das gleiche gilt für die Androhung einer unbegründeten Privatklage (OLG Düsseldorf AnwBl 73, 317). Problematischer die Drohung mit begründeter Anzeige: hier wird durchweg die Willkürlichkeit der Verkoppelung des Nichtzusammengehörenden und die Verfolgung egoistischer Motive unter dem Vorwand der „Staatsbürgerpflicht“ zur Bejahung der Nötigung führen. Daher Nötigung bei Androhung des Hinwirkens auf eine Abschiebung zur Beitreibung einer Forderung (OLG Düsseldorf NStZ-RR 96, 5), ferner, wenn der Kaufhausinhaber einer ertappten Ladendiebin mit Strafanzeige droht, wenn sie sich ihm nicht „zum Ausgleich“ sexuell preisgibt; dagegen keine Nötigung, wenn der Diebin mit Anzeige gedroht wird, wenn sie nicht als private Sühne einen Betrag zugunsten eines Wohltätigkeitsfonds einzahlt oder wenn zwecks Erzwingung der Erstattung von Zivilklagekosten mit der Anzeige einer Straftat gedroht wird, die mit der Zivilklage zusammenhängt (BayObLG MDR 57, 309). Die Drohung mit Strafanzeige, um den anderen Teil zum Verzicht auf ein ihm zustehendes prozessuales Recht, z.B. Einlegung eines Rechtsmittels, zu veranlassen, ist grundsätzlich keine Nötigung (a.M. BGH NJW 57, 596). Verwerflich ist die Drohung mit begründeter Strafanzeige aber dann, wenn der vom Anzeigenden erstrebte, ihm an sich zustehende Vorteil in keinem Verhältnis zu dem dem Angezeigten durch die Anzeige drohenden Schaden steht (BGH 5, 254[69]). Grundsätzlich verwerflich ist auch die Androhung öffentlicher Bekanntmachung früherer Verfehlungen des anderen Teils, um diesen zur Erfüllung einer zivilrechtlichen Verbindlichkeit zu veranlassen (BGH 5, 261). Regelmäßig nicht verwerflich ist die Drohung mit Klage, um einen wirklichen oder vermeintlichen Anspruch zu realisieren[70]. Ausnahmsweise kann auch die gewaltsame Verhinderung einer fremden Straftat oder Ordnungswidrigkeit verwerflich sein (OLG Saarbrücken VRS 17, 25). Die eigenmächtige Vertreibung einen Angriff vorbereitender Rechtsradikaler ohne Einschaltung der Polizei wird von BGH 39, 137 als verwerflich angesehen[71].
38
Besondere Bedeutung hat die Prüfung der Verwerflichkeit bei Nötigung im Straßenverkehr[72]. Eine Verhinderung des Überholens durch wiederholtes Ausscheren nach links kann bei „erschwerenden Umständen“ verwerflich im Sinne von § 240 Abs. 2 sein (BGH 18, 389). Solche Umstände sind die Gefährdung von Verkehrsteilnehmern (BGH 18, 389; OLG Stuttgart VRS 17, 25), die keine konkrete zu sein braucht[73], das mehrfache Handeln (BGH 18, 393; BayObLG JZ 86, 407) oder ein über die Behinderung hinausgehender verwerflicher Zweck (OLG Celle NJW 59, 1597; OLG Hamm VRS 57, 347: Schikane). Eine Gewaltanwendung zur Erzwingung eines Überholvorgangs ist verwerflich, wenn der Vorausfahrende lediglich zum Zwecke des eigenen schnelleren Vorwärtskommens gefährdet wird[74], nachhaltiger Druck ausgeübt wird und Ausweichmöglichkeiten nicht bestehen oder der Genötigte sich korrekt verhält[75]. Verwerflich sein kann auch der Missbrauch eines Kfz zu mutwilligen Behinderungen[76] oder zum Zwecke der Selbstjustiz[77]. Dies gilt auch für das Blockieren eines falsch geparkten Pkw (OLG Koblenz VRS 20, 436), während die Androhung, bei hartnäckigem falschen Parken die Luft aus den Reifen abzulassen, nicht verwerflich sein soll[78]. Rechtsprechungsübersicht bei Voß-Broemme NZV 88, 2; Maatz NZV 06, 337. Das Beiseitedrängen eines den Parkplatz besetzt haltenden oder sonst im Wege stehenden Fußgängers ist in der Regel nicht verwerflich, wenn ein Anrecht am Parkplatz besteht und zwar durch früheres Eintreffen mit dem Kfz[79] oder durch Einweisung (OLG Hamburg NJW 68, 662). Dies ist keine Frage der Notwehr[80]. Die Verwerflichkeit kann aber dennoch zu bejahen sein, wenn der Fußgänger erheblich gefährdet wird, ihm keine ausreichende Ausweichmöglichkeit bleibt[81], nicht jedoch, wenn er nur weggeschoben wird[82] oder eine besondere unvernünftige Hartnäckigkeit an den Tag legt (OLG Stuttgart VRS 30, 106).
39
Problematisch ist die Verwerflichkeit der Gewaltanwendung auch bei Demonstrationen und anderen kollektiven Meinungsäußerungen. Die umfangreiche Diskussion ist zwar teilweise durch BVerfGE 92, 1 überholt, bleibt aber angesichts der unklaren Situation nach wie vor beachtlich. Die Grundrechte der Demonstranten aus Art. 5 und 8 GG erlauben jedenfalls keine absichtliche gewaltsame Verkehrsbehinderung[83]. Auch der „zivile Ungehorsam“ macht die dabei vorgenommenen „Regelverletzungen“ nicht rechtmäßig[84]. Nach der Rechtsprechung vor allem des BVerfG[85] sind bei der Verwerflichkeitsprüfung regelmäßig zu berücksichtigen: der zum Blockadetermin zu erwartende Dienstbetrieb, Dauer und Intensität der Aktion, deren vorherige Bekanntgabe, Ausweichmöglichkeiten über andere Zufahrten, der Sachbezug der betroffenen Personen zum Protestgegenstand, die Zahl der Demonstranten, die Dringlichkeit der blockierten Transporte und sonstigen Dienstfahrten, die Beherrschbarkeit der Aktion durch anwesende, überlegene Polizeikräfte, die Ernsthaftigkeit des Handlungsmotivs. Besonders wichtig ist dabei die Dauer; bei geringfügigen Blockaden fehlt die Verwerflichkeit[86]. Bedenklich LG Frankfurt NStZ 83, 26: keine Verwerflichkeit von Gewalt gegen den Informationsstand einer rechtsradikalen Vereinigung (allerdings war hier die Gewalt zweifelhaft)[87].
40
Die von Roxin aaO dem hier zugrunde gelegten Missverhältnis nach Maß und Heterogenität zur Seite gestellten „Prinzipien“ der Verwerflichkeit enthalten z.T. Rechtfertigungsgründe (s.u. Rn. 43), z.T. sind sie in dem hier zugrunde gelegten Maßstab enthalten, z.T. bleiben sie dahinter zurück (z.B. Ausschluss der Verwerflichkeit bei Geringfügigkeit schon der Gewaltanwendung). Fragwürdig insbesondere die generelle Nichtverwerflichkeit der Drohung mit der Unterlassung nichtobligatorischer Handlungen (s.o. Rn. 28). Beachtliche Modifikationen bei Horn/Wolters SK 39 ff. Wenig ergiebig die im Wesentlichen auf das Maß des Nötigungsmittels und der genommenen Freiheit hinauslaufenden Kriterien bei Hansen S. 157 ff.
Den für die Drohung mit Unterlassungen hier zugrunde gelegten Gesichtspunkt der angedrohten Verschlechterung der Lage des Bedrohten (s.o. Rn. 28) verlagert Herdegen auf die Rechtswidrigkeit (LK11 § 253 Rn. 4). Unklar BGH 44, 79: Keine Verwerflichkeit bei Androhung einer Unterlassung bei Nichterfüllung von anderen gestellter Bedingung[88].